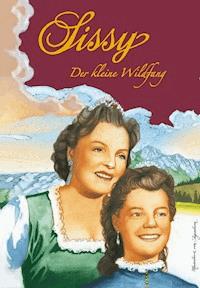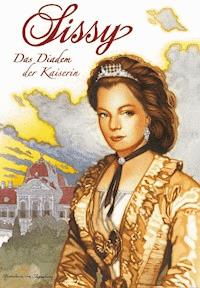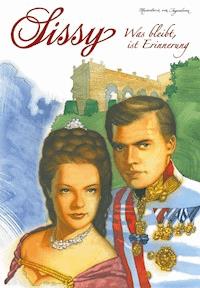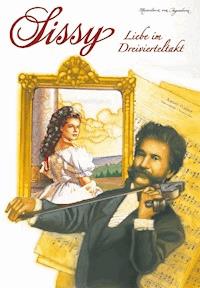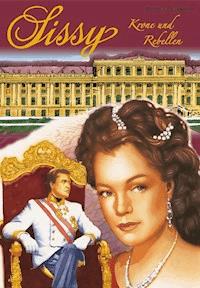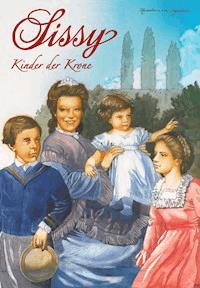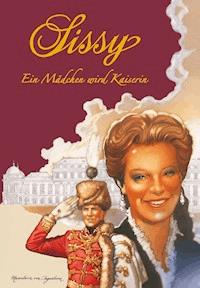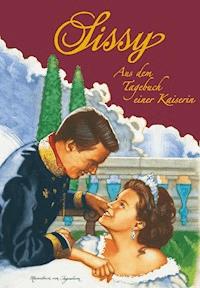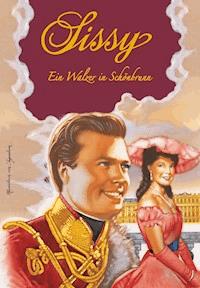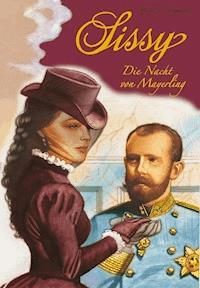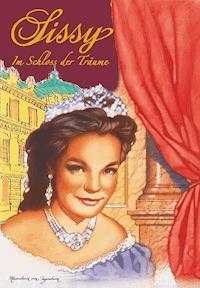Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Breitschopf Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sissy
- Sprache: Deutsch
Budapest und Wien – zwei Perlen an der Donau, Brennpunkte des Reiches, zwingen Sissy in einen gefährlichen Konflikt, denn ihr Herz schlägt für die Ungarn. Sie ist fest entschlossen, die Spannungen zwischen den beiden Metropolen abzubauen. Mit all ihrer Kraft kämpft sie daher gegen die Vielzahl an Vorurteilen und politischen Interessen an …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIELUISE VON INGENHEIM
Sissy
Schwarzer Diamant der Krone
Autorin: Marieluise von Ingenheim
Illustration Überzug: M. Pleesz
Copyright der E-Book-Ausgabe von hiStory Publications:© Copyright 2016 by Verlagsbuchhandlung Julius Breitschopf GmbH,A-3420 Klosterneuburg bei WienAlle Rechte vorbehalten.Das Werk ist weltweit urheberrechtlich geschützt.All rights reserved throughout the world.
ISBN: 978-3-7004-4438-1EAN: 9783700444381
Inhalt
Prolog
01 - Ein schwieriger Patient
02 - Sissy auf der Mendel
03 - Ein lieber Gast
04 - Geheimnis um Sophie
05 - Auf Befehl des Kaisers
06 - Villa „Hermes" und ihre Gäste
07 - Frau von Mikes in geheimer Mission
08 - Sissy wird ungeduldig
09 - Seine Eminenz blitzt ab
10 - Sophies Glück
11 - Der Vogel breitet die Schwingen
12 - Spiele an Bord
13 - Meuterei?!
14 - Die Kasha
15 - Farlini rehabilitiert sich
16 - Das Inselparadies
17 - Die Bahn wird modernisiert
18 - Stille Betrachtungen
19 - Das Fest des Thrones kommt in Sicht
20 - Überraschungen in Wien
21 - Venedig in Wien
22 - Einsame Weihnacht
23 - Der Hofzug
24 - Überraschung in Cap Martin
25 - Ein dickköpfiger Engel
26 - Rudolf findet keine Ruhe
27 - In der Lagunenstadt
28 - Bewegte Tage
29 - Ein Sommer der Kaiserin
30 - Kaiserlicher Herbst
31 - Geschichten und Geschichte
32 - Der Königsthron
Prolog
Budapest und Wien - zwei Perlen an der Donau, Brennpunkte des Reiches, zwingen Sissy in einen gefährlichen Konflikt, denn ihr Herz schlägt für die Ungarn. Sie ist fest entschlossen, die Spannungen zwischen den beiden Metropolen abzubauen. Mit all ihrer Kraft kämpft sie daher gegen die Vielzahl an Vorurteilen und politischen Interessen an...
Ein schwieriger Patient
Man schrieb das Jahr 1894. Es war Frühsommer in den Schweizer Bergen. Spät, aber doch war in diesem Jahr die Macht des Winters gebrochen worden. Hoch oben auf den Almen grünte es. Und wer seinen Blick von der Terrasse des Sanatoriums auf der Mendel über die Umgebung schweifen ließ, mochte allein schon durch den friedvoll-idyllischen Anblick Kraft und innere Ruhe gewinnen.
Das Sanatorium war eine Heilstätte für Lungenleidende, die aus aller Welt hierherkamen. Zurzeit aber beherbergte es - obwohl die „Saison” im Gange war - nur einen einzigen Patienten. Der hatte noch dazu seinen eigenen Chefarzt mitgebracht, ein etwas ungewöhnlicher Fall, den das Personal erst einmal verkraften musste.
Denn dieser Patient war auch in anderen Dingen ein recht eigenwilliger Mensch. Die einen hielten ihn für überheblich, die anderen für einen bedauernswerten, armen Teufel. Und so widersprüchlich er vielen erschien - er selbst duldete keinerlei Widerspruch.
Die Art und Weise, in der er mit anderen Menschen umging, wirkte vielfach herausfordernd. Das Personal schrieb dies allerdings weniger dem Umstand zu, dass es sich bei dem sonderbaren Patienten um einen Neffen des österreichischen Kaisers handelte, als vielmehr der Krankheit selbst. Immerhin meinten die meisten, dass ein „volles Haus” auch nicht strapaziöser sein könne als dieser kranke Mann.
Erzherzog Franz Ferdinand, ein noch junger Mann von einunddreißig Jahren, war vor kurzem von einer Weltreise zurückgekommen, die ihn nach Ägypten, Indien, Japan und in die Prärien der Vereinigten Staaten geführt hatte. Dabei hatte er zwar seine Sammelleidenschaft mit Jagdtrophäen und Souvenirs befriedigt, doch sein Gesundheitszustand hatte sich unterwegs nicht gebessert. Sein Leibarzt - der berühmte Professor Eisenmenger aus Wien - musste im Gegenteil auch noch gegen Depressionen ankämpfen, die einen negativen Verlauf von Franz Ferdinands Krankheit eher begünstigten. Medikamente waren hier machtlos. Und der Erzherzog zeigte sich verschlossen wie eine Auster, wenn man die Ursache seiner bedrückten Stimmung herausfinden wollte.
Nach dem geheimnisvollen Tod des Kronprinzen Rudolf in Mayerling war Franz Ferdinand der rechtmäßige künftige Thronerbe. Doch im Hinblick auf seine Krankheit rechnete jeder damit, dass nicht er, sondern sein Cousin, Erzherzog Otto, eines Tages den Thron besteigen werde.
Viele hätten das gern gesehen. Otto war ein lebenslustiger „Feschak” nach dem Herzen der Wiener und stets zu Streichen und Späßen aufgelegt. Dadurch wäre er zweifellos ein leicht lenkbarer Herrscher gewesen, bei dem ein Köpferollen innerhalb der Hofkamarilla und der mächtigen Beamtenschaft nicht zu befürchten war. Der Drill der Balletteusen im Übungssaal der Hofoper interessierte ihn weit mehr als der Exerzierplatz der Infanterie auf der Schmelz. Und mit tiefgreifenden politischen Reformen musste man auch nicht rechnen; ihm genügte zur Lösung von Problemen sein Charme.
Ganz anders Franz Ferdinand. Charme besaß er keinen, dafür Ordnungssinn und einen eisernen Willen. Seine Schreibtischlade war voll von Reformplänen, vor allem von solchen, die das Heerwesen betrafen. Und dazu bewegten ihn noch die Ideen von Kronprinz Rudolf, der geahnt hatte, dass er sterben müsse, bevor er an die Macht käme. Franz Ferdinand und Rudolf stimmten im Wesentlichen in ihren politischen Vorstellungen von der künftigen Entwicklung der Monarchie in der Art eines modernen Bundesstaates als Kern eines vereinten Europas überein - etwa nach dem Vorbild der USA. Dabei waren sie sich bewusst, bei der Durchsetzung solcher Pläne ein gewagtes, ja lebenslängliches Spiel zu treiben. Sie mussten Feinde im Inneren wie von außen fürchten. Doch nur so - davon waren sie überzeugt - glaubten sie die Zukunft des Habsburgerreiches sichern zu können.
Und deshalb kämpfte nach Rudolfs Tod Franz Ferdinand verzweifelt gegen sein ererbtes Leiden an. Sein Onkel, Franz Joseph, wunderte sich. Und mit ihm wunderten sich viele. Im Erzhaus gab es Aussteiger, die auf Rang und Namen verzichteten, „unstandesgemäße” Ehen eingingen, die Monarchie verließen, um ein Leben nach ihrer Fasson führen zu können. Niemand in der Familie riss sich um die Last der Krone - auch Otto nicht. Franz Ferdinand hingegen schlug die Chance aus, um die andere kämpfen mussten: die Chance, ein normales, bürgerliches Leben führen zu können, frei von Pflichten, ja sogar frei von materiellen Sorgen.
Seine innig geliebte Mutter, die zarte, wunderschöne Prinzessin Maria Annunziata von Sizilien, war an Tuberkulose gestorben. Franz Ferdinand litt von Kindheit an gleichfalls unter dem heimtückischen Leiden, einer Geißel der Menschheit jener Tage, die niemanden verschonte, weder arm noch reich.
Dennoch war er ein Mann der Pflicht. Er versagte sich die persönliche Chance eines bequemen Daseins als Privatmann um der Chance des Reiches willen, dem er sich verpflichtet fühlte. Und da man an ihm zweifelte, wurde er starrköpfig und unangenehm. Er fühlte sich nicht ernst genommen und zurückgesetzt. Er wurde zum Kämpfer für sein Recht auf den Thron, für sein Recht auf Pflichterfüllung.
Der Kaiser, selbst ein Pflichtmensch durch und durch, begann ihn zu achten. Kaum bemerkte Franz Ferdinand dies, als er auch schon mit Reformplänen und Denkschriften vorpreschte, die Franz Joseph radikal und der Kamarilla gefährlich erschienen. In manch einem dieser Pläne erkannte Franz Joseph die Ideen seines Sohnes wieder; und er warnte Franz Ferdinand vor gefährlichem Übereifer.
Dieser aber dachte an das frühe Ende seiner Mutter und den gewaltsamen Tod seines Freundes Rudolf. Er wähnte sich in Zeitdruck, geriet in den Zustand eines Kessels unter Überdruck. Alle Augenblicke entlud sich sein Zorn, seine Nervosität an seiner Umgebung. Franz Ferdinand, der das Beste wollte, wurde unbeliebt.
Franz Joseph, um eine Politik sorgsam ausgewogener Interessen bemüht, sah bald den unbequemen jungen Mahner auch nicht mehr gern. Der einzige Mensch am Hof, der Ferdinand zu verstehen und zu lieben schien, war die Kaiserin, Tante Sissy - und gerade bei ihr hatte er dies am wenigsten erwartet; war doch auch sie so etwas wie eine „Aussteigerin”, die vom Hof flüchtete, sooft sie nur konnte. Und der man Meinungen nachsagte, die eher eine republikanische, ja vielleicht sogar anarchistische Einstellung vermuten ließen, was doch mit der Stellung einer Kaiserin völlig unvereinbar war...
Nun, für Franz Ferdinand war Tante Sissy jedenfalls eine höchst sonderbare Frau. Eine, die rätselhaft wirkte in ihrer berückenden Schönheit; eine, die unbegreiflich war in ihrem Verhalten, ihren Entschlüssen, ihren Taten. In ihr hatte der kranke Thronfolger eine aufrichtige Verbündete; von ihr konnte er Hilfe und Unterstützung erhoffen. Nur über sie führte der Weg zum Wohlwollen des Kaisers.
Denn Franz Joseph und Sissy hatten einst aus Liebe geheiratet; damals in Ischl, als sie einander zum ersten Mal begegnet waren, da wurde es Liebe auf den ersten Blick. Franz Joseph war auf Brautschau nach Ischl gekommen. Seine Mutter Sophie und Tante Ludovika, die Frau des Erzherzogs Max in Bayern, hatten ihm dessen Tochter Helene zur Braut bestimmt.
Doch Tante Ludovika hatte Helenes jüngere Schwester Sissy nach Ischl mitgebracht. Sissy, ein junges, übermütiges und gar nicht für die Rolle einer Kaiserin vorbereitetes Mädchen, hatte mit seinem natürlichen Liebreiz Franzls Herz entflammt - und er, der junge Kaiser in seiner prächtigen Uniform, das ihre. Wohl oder übel hatten die Eltern zur Kenntnis nehmen müssen, dass nicht Nené, wie sie die sanfte, damenhafte Helene nannten, die Krone tragen würde, sondern der Wildfang Sissy. „Wildfang”, so hatte Franzls Mutter Sophie sie genannt. Und das blieb Sissy noch lange.
Nichts hatte Elisabeth bändigen können, nicht der Wille der Schwiegermama, nicht das strenge spanische Zeremoniell. Lieber ging sie von Wien fort, ritt halsbrecherische Parforcejagden in England oder fuhr auf der weißen Jacht „Miramar” über fremde Meere. Sie schrieb Gedichte, die davon zeugten, wie sehr sich ihr Geist nach Freiheit sehnte, nach einer Freiheit, die in den alten Mauern der Wiener Hofburg nicht zu erleben war. So gewann sie die Herzen der Ungarn im Sturm, weil diese Nation nach Freiheit dürstete wie sie.
Und da gab es eine Parallele: Franz Ferdinand verbrachte einen Großteil seiner Militärdienstzeit in Böhmen. Und dort begann er die Völker Böhmens zu achten und zu lieben; sie fühlten sich wie er zurückgesetzt und benachteiligt innerhalb der Familie der Monarchie. Franz Joseph war nicht zum König von Böhmen gekrönt. Er hätte den Eid auf die Krone Böhmens nicht leisten können, ohne die beschworene Reichsverfassung der Ungarn zu verletzen. Franz Ferdinand aber, der oftmals in der Uniform eines Obersten der Dragoner durch die Straßen Prags geritten war, wollte den Böhmen ein „echter” König werden - eine Notwendigkeit mehr, die Monarchie zu reformieren.
Die noch immer schöne Elisabeth, die sich durch Sport geschmeidig und durch grausame Hungerkuren die jugendliche Figur erhielt, zog noch immer die Männerblicke auf sich: Blicke, die, wie sie sehr wohl wusste, der Frau galten und nicht der Kaiserin. Und so wenig Franz Joseph seiner schönen Gattin auch oft gedanklich zu folgen vermochte, so sehr stand auch er immer noch in ihrem Bann. Ja, vielleicht war es sogar ihr exzentrisches Wesen, das für ihn einen Teil dieser Faszination ausmachte.
Auch Franz Ferdinand war von ihr beeindruckt. Dabei war die am Weihnachtsabend des Jahres 1837 geborene Tante Sissy um ganze sechsundzwanzig Jahre älter als er. Während seiner Kur auf der Mendel, von Professor Eisenmenger sorgsam betreut, dachte Franz Ferdinand öfter an Tante Sissy. Und nicht nur an sie. Er dachte noch an eine andere Frau, von der nur Tante Sissy und der Kaiser wussten, und die die Ursache seiner Depressionen war: an die Komtesse Sophie von Chotek-Chotkova. Und Sissy war sein einziger Hoffnungsschimmer, dass die Affäre doch noch zu einem guten Ende kommen könne. Denn der Kaiser war unerbittlich; er beharrte auf dem uralten Hausgesetz der Habsburger, das gerade ein Thronfolger nicht verletzen durfte. Die Rechte der regierenden Familien, ihr Anspruch auf den Thron, basierten auf der Übereinkunft, dass sie nur untereinander Ehen eingehen durften. Eine Handvoll Familien in Europa, durch viele Ehen mehrfacht verwandt und verschwägert, beherrschten den Kontinent. Dadurch waren sie auch degeneriert. In der Familie Tante Sissys, den Wittelsbachern, gab es zwanzig Fälle von geistiger Umnachtung - zuletzt König Ludwig II. von Bayern und dessen Bruder, den nunmehrigen König Otto, der entmündigt von seinem Vormund Prinz Luitpold vertreten wurde. Und Sissy selbst lebte in ständiger Angst, dass sich auch ihr Geist verwirren könne...
Das Haus Habsburg hatte frisches Blut nötig. Die Komtesse Chotek gehörte zwar ältestem und vornehmstem böhmischen Adel an, war aber trotzdem keine „standesgemäße Partie”, weil die Choteks nicht zu den regierenden Familien gehörten. Und dabei hatte sie längst die Herrschaft über das Herz des schwierigen Patienten angetreten.
Sissy auf der Mendel
Franz Ferdinand fühlte sich an diesem Morgen etwas besser. Die herbe, saubere Luft tat ihm sichtlich gut. Und auch die von Professor Eisenmenger verordnete Mastkur verfehlte nicht ihre Wirkung; er hatte wieder etwas zugenommen und Farbe gewonnen. Nach seiner großen Reise, die ihn über weite Meere geführt hatte, war er abgekämpft und müde heimgekehrt.
Ein Jahr lang war er fortgewesen. Ein Jahr, das nicht enden zu wollen schien. Und es hatte das Bild, das er heimlich in seinem Herzen mit sich trug, nicht zum Verlöschen gebracht: das Bild von Sophie - jenem Mädchen, das er liebte.
Wo immer er auch seine postlagernde Adresse angegeben hatte, nie war von ihr ein Brief, eine Karte gekommen. Nicht eine einzige Zeile von ihr hatte ihn erreicht. Die Ungewissheit über ihr Schicksal nagte an ihm, sie zehrte an seiner geschwächten Gesundheit wie eine zweite Krankheit, gegen die er anzukämpfen hatte. Und er verwünschte oft die vermeintliche Grausamkeit seines Onkels, des Kaisers. Und dies, obwohl er doch wusste, dass dieser gar keine andere Wahl hatte, als auf der Einhaltung des Familienstatuts zu bestehen. Das gehörte zu seinen Aufgaben als Kaiser und Oberhaupt des Hauses Habsburg.
Der Prinz lag, sorgfältig in wärmende Decken gehüllt, auf einem Liegestuhl im sonnenbeschienenen Garten des Sanatoriums und erwartete Professor Eisenmenger und seinen Assistenten, der zum Stammpersonal des Sanatoriums zählte und zu normalen Zeiten hier Chefarzt war. Beide waren Kapazitäten; der Erzherzog war als Patient in den besten Händen, soweit es zumindest seine Tuberkulose betraf.
Er hörte Schritte. Die beiden Ärzte, begleitet von zwei Krankenschwestern, kamen herbei.
„Wir wünschen einen guten Morgen, Kaiserliche Hoheit”, grüßte Eisenmenger.
„Guten Morgen”, brummte Franz Ferdinand missgestimmt trotz des strahlenden Sonnenscheins.
„Nun, Kaiserliche Hoheit - wie fühlen wir uns heute?” forschte Eisenmenger besorgt.
„Wie soll sich ein Mensch fühlen, der von seiner Umgebung ausgesperrt ist?” lautete die barsche Gegenfrage. „Jawohl, abgeschnitten! Ich komme mir hier vor wie ein Gefangener. Vielleicht bin ich das auch, oder...?”
Misstrauen lagen in Worten und Blicken des Patienten. Ganz offenkundig hatte er sich eben in Gedanken mit seiner Isoliertheit beschäftigt. Ja, er glaubte allmählich tatsächlich, dass Besuche auf Befehl des Kaisers von ihm ferngehalten und seine Briefe zensuriert würden.
Eisenmenger seufzte und schüttelte den Kopf.
„Kaiserliche Hoheit erregen sich völlig unnötig”, versicherte er. „Kaiserliche Hoheit sind selbstverständlich kein Gefangener. Kaiserliche Hoheit sind vielmehr Patient und als solcher gewissen auf die Behandlung zurückzuführende Beschränkungen unterworfen. Ein Lungenleiden ist eine langwierige Angelegenheit; Kaiserliche Hoheit müssen Geduld haben!”
„Geduld, Geduld und immer wieder Geduld! Dieses Wort kenne ich bis zum Überdruss!” rief Franz Ferdinand wütend, um sich gleich darauf zu beherrschen, als er die betroffenen Mienen der beiden Ärzte sah. „Entschuldigen Sie. Ist wenigstens Post für mich da?”
Eine vage Hoffnung klang aus dieser Frage und war auch in den Blicken des Prinzen aufgeflackert. Eisenmenger, der diese tägliche Frage erwartet hatte, musste auch heute wieder verneinen und kannte die darauf folgende Reaktion: Tiefe Mutlosigkeit sprach aus dem Gesicht des Patienten.
Mit ehrlichem Bedauern zuckte Eisenmenger mit den Achseln, denn als Arzt wusste er, dass der Kranke Optimismus und gute Laune brauchte, um dessen Widerstandskraft zu stärken.
„Vielleicht morgen”, versuchte er abzuschwächen.
Franz Ferdinand machte eine fahrige Handbewegung, und seine Miene wurde zu Stein.
„Also wieder nichts”, stellte er fest. Und während ihm die Zornesadern schwollen, richtete er sich mit einem Ruck halb empor: „Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ich frage Sie auf Ehre und Gewissen, Professor: Werden an mich gerichtete Briefe abgefangen?!”
Eisenmenger war ehrlich entsetzt, und auch sein Schweizer Kollege, der bedenklich den Kopf schüttelte, ließ ein empörtes Brummen hören.
„Kaiserliche Hoheit - wer sollte denn so etwas tun? Und zu welchem Zweck?” rief Eisenmenger.
„Zu welchem Zweck? Die Herren, die das veranlassen, werden schon wissen, weshalb! Und wer das machen soll?
Die Zensur, die Geheimpolizei, irgendwelche Aufpasser, die man hinter mir her hetzt - was weiß ich!”
Der Chefarzt des Sanatoriums wechselte einen vielsagenden Blick mit seinem berühmten Wiener Kollegen; er hielt den Erzherzog nicht bloß für lungenkrank. Seiner Meinung nach war dieser auch ein Fall für einen Psychiater - etwa einen Arzt wie diesen Doktor Freud, der jetzt so von sich reden machte. Offenbar litt der Erzherzog an Verfolgungswahn.
Doch Eisenmenger hielt nichts von den neuartigen Ideen des Doktors aus der Berggasse in Wien.
„Es gibt nichts dergleichen, Kaiserliche Hoheit, das versichere ich Ihnen!” erklärte er kategorisch. „Kaiserliche Hoheit befinden sich in der Schweiz!”
„In einem freien Land!” setzte der Chefarzt mit Überzeugung hinzu. Franz Ferdinand winkte mit müdem Lächeln ab. Er kannte den langen Arm seines Onkels.
„Freiheit - was ist das?” fragte er gequält. „Darunter versteht doch wohl jeder etwas anderes. Wirklich frei ist man erst, wenn man hinüber ist.”
Todesgedanken - das fehlte gerade noch, sagte sich Eisenmenger entsetzt. Die durfte man erst gar nicht aufkommen lassen!
„Kaiserliche Hoheit sind zur Erholung und Heilung hier und benötigen Ruhe”, erklärte er. „Kaiserliche Hoheit haben sich eine Aufgabe gestellt; dazu benötigen Sie Kraft und Gesundheit. Ich bitte Sie, denken Sie daran!”
„Wie kann ich Ruhe finden, wenn…”begann Franz Ferdinand mit müdem Lächeln.
Er sprach den Satz nicht zu Ende, sondern starrte finster vor sich hin und ließ es wort- und widerstandslos geschehen, dass der Arzt ihm besorgt den Puls fühlte und eine Schwester ihm das Fieberthermometer unter die Achsel schob.
Seine Gedanken wanderten offenbar in weite Fernen. Sein Blick wurde ausdruckslos. Eisenmenger fragte sich, was wohl hinter der Stirn seines Patienten vorgehen mochte, während er auf das Ergebnis der Messung wartete.
„Noch immer erhöhte Temperatur”, stellte er schließlich nicht ohne Besorgnis fest und vollzog eigenhändig die Eintragung in Franz Ferdinands Fiebertabelle.
Der Prinz zeigte unverhohlene Schadenfreude.
„Es steht nicht zum Besten, wie?” grinste er verbittert.
„Das Befinden ist schwankend”, erklärte Eisenmenger wahrheitsgemäß. Heute bin ich nicht zufrieden. Weshalb erregen sich Kaiserliche Hoheit so? Wollen Sie mich nicht ins Vertrauen ziehen? Ich bin Ihr Arzt; vielleicht kann ich helfen!”
Stirnrunzelnd betrachtete er den Prinzen, aus dem er nicht ganz klug wurde. Franz Ferdinand besaß einen eisernen Willen; er kämpfte gegen das ererbte Lungenleiden an, doch in letzter Zeit mehrten sich bei ihm Anzeichen einer gefährlichen Apathie, die zu dieser heilsamen Haltung in Widerspruch stand. Etwas bedrückte den Patienten, raubte ihm Frohsinn, Lebensmut und Zuversicht. Stattdessen häuften sich Zornausbrüche, die sich gegen alles und jeden, ja oft sogar gegen ihn selbst richteten. Und das erfüllte den Arzt mit berechtigter Sorge für den erhofften Heilerfolg.
Plötzlich hörte er, wie der Erzherzog mit gepresster Stimme sagte: „Schicken Sie mir eine Pistole, Professor.” Und als dieser nicht sofort reagierte, sondern in bestürztem Schweigen verharrte, wiederholte er verärgert und ungeduldig: „Ich möchte meine Pistole haben!”
Eisenmenger war erschrocken. Unwillkürlich drängte sich ihm der Gedanke an Selbstmordabsicht auf.
„Wozu, Kaiserliche Hoheit, benötigen Sie denn jetzt diese Waffe?” fragte er vorsichtig.
Er las gottlob nicht Depression, sondern Zorn in den Blicken des Erzherzogs, der jetzt mit einer heftigen, fordernden Kopfbewegung herrisch zu ihm aufblickte.
„Dumme Frage - zum Schießen natürlich!” rief er barsch. „Ich komme hier ja um vor Langeweile!”
Kopfschüttelnd entfernte sich Eisenmenger mit dem Assistenzarzt, und Franz Ferdinand sank mit einem ergebenen Seufzer in seinen Liegestuhl zurück.
„Was sagen Sie dazu Professor?” fragte der Schweizer Chefarzt den Kollegen aus Wien. „Ein Glück bloß, dass wir nur einen von dieser Sorte hier zu behandeln haben. Ein zweiter wäre imstande, mich selbst reif für ein Sanatorium zu machen!”
„Er ist ein armer Teufel”, bemerkte jedoch Eisenmenger. „Sie kennen ihn und das Milieu, aus dem er kommt, nicht so gut wie ich. Es ist eine Welt, in der andere Gesetze gelten. Strenge Gesetze! Es ist eine Denkart, über die Ihre Landsleute den Kopf schütteln würden; ich tue es nicht, denn ich weiß, wie viel sie auch für sich hat. - Wenn ich bloß wüsste, was den Prinzen bedrückt; ich glaube, dass wir dann einen großen Schritt weiterkämen...”
Franz Ferdinand erhielt seine Pistole samt einer Schachtel Munition. Eine Krankenschwester brachte sie schon nach wenigen Minuten und überreichte sie ihm mit furchtsamem Blick.
Franz Ferdinand sah ihr lächelnd und kopfschüttelnd nach, als sie gleich darauf über den Rasen davonlief, als wären böse Geister hinter ihr her. Hinter den hohen, verglasten Bogenfenstern des Parterres des Sanatoriumgebäudes bemerkte er schemenhafte Gesichter, die zu ihm herüberstarrten. Das Gefühl, wie ein Gefangener unter Beobachtung zu stehen, verstärkte sich wieder in ihm.
Verächtlich wandte er sich ab, lud sorgfältig seine Pistole und zielte dann im Liegen auf eine halte, hohe Tanne, von deren dichtbenadelten Zweigen Tannenzapfen von besonderer Größe hingen.
Er suchte sich einen der Zapfen als Zielpunkt aus und drückte ab. Was für ein hervorragender Schütze er war, hatte er erst vor wenigen Monaten bei einer gefährlichen Tigerjagd in Indien bewiesen, die er als Gast eines Maharadschas mitgemacht hatte. Und auch jetzt wieder traf er haarscharf; prasselnd polterte der Tannenzapfen durch das Geäst des Baumes auf den Wiesengrund.
Vom Sanatorium her wurden bewundernde Ausrufe, ja sogar Beifallsklatschen laut; doch Franz Ferdinand kümmerte sich nicht darum. Er ballerte mit steigendem Vergnügen weiter und schoss Zapfen um Zapfen von den höchsten Ästen der Tanne.
Es war für ihn mehr als bloß Zeitvertreib. Er konnte nicht anders; er musste auf diese Weise seinen Zorn abreagieren. Den Zorn über die Ohnmacht, zu der er verurteilt war.
Währenddessen kam ein leichtes Gefährt den Serpentinenweg vom Tal zu der Anhöhe hinaufgefahren, auf welcher das Sanatorium stand. Kutscher und Pferd schnauften erleichtert, als drei Damen, die sie bergwärts gebracht hatten, ausstiegen.
Ein lieber Gast
Eine der Frauen entlohnte den Kutscher für seine Mühe; eine andere hatte bereits ihren Sonnenschirm aufgespannt und schritt leichtfüßig auf das Tor des Sanatoriums zu, wo sie läutete.
Professor Eisenmenger hörte das Schellen mit aufrichtiger Erleichterung. Er hatte den Besuch, von dem er dem Patienten nichts verraten durfte, bereits mit Ungeduld erwartet. Als er nun das Glöckchen hörte und den Wagen vor dem Tor aus Schmiedeeisen stehen sah, stürzte er aus dem Portal und ließ öffnen; gleich darauf empfing er die Ankömmlinge mit tiefen Bücklingen.
„Majestät, ich bin entzückt”, rief er und dienerte vor der Schirmträgerin, die ihn gleichfalls freundlich begrüßte.
„Guten Tag, Professor, wie geht es Ihnen? Ich habe meine beiden Hofdamen mitgebracht: Gräfin Sztaray und Gräfin Mikes.”
„Entzückt, entzückt”, verbeugte sich Eisenmenger auch vor den beiden Damen, um sich sofort wieder der Kaiserin zuzuwenden. „Majestät kommen heute wie gerufen...”
Sissy betrachtete flüchtig das Gebäude und fragte dann den Arzt: „Wie gerufen? Was wollen Sie damit sagen, Professor? Wie geht es denn dem Erzherzog?”
„Es geht ihm den Umständen entsprechend, Majestät. Doch sein seelischer Zustand bereitet mir ernsthaft Sorgen. Bei dieser Krankheit ist die seelische Verfassung eines Patienten nicht ohne Bedeutung. Depressionen fördern einen negativen Krankheitsverlauf.”
„Er hat Depressionen?” erkundigte sich Sissy lebhaft.
„So ist es”, seufzte Eisenmenger bekümmert.
„Weiß er, dass wir kommen?”
„Natürlich nicht, Majestät haben ja ausdrücklich befohlen, und ich habe es auch versprochen...”
„Es sollte eine Überraschung für ihn sein”, meinte Sissy und schritt eifrig aus, voll Ungeduld, Franz Ferdinand zu sehen.
„Ja”, nickte Eisenmenger, „und ich hoffe auch, dass Ihr Besuch auf der Mendel eine so angenehme Überraschung für ihn ist, dass sich die Laune Seiner Kaiserlichen Hoheit endlich bessert!”
Sissy nickte eifrig.
„Ja, wir wollen doch hoffen, dass sich der Zustand des Erzherzogs bessert und er wieder gesund wird”, meinte sie ernst. „Wir alle zählen auf Ihre Hilfe und Ihre ärztliche Kunst.”
„Was in meinen Kräften steht, wird geschehen”, erwiderte der Professor ernst. „Doch ich bin nur ein Mensch. Ich kann nicht Wunder wirken. Und letzten Endes liegt unser Schicksal in Gottes Hand.”
Sissy horchte auf.
„Steht es denn so schlecht?” fragte sie mit jäh erwachender Besorgnis und runzelte die Stirn.
Der Professor wehrte ab: „Das kann man nicht direkt sagen, Majestät. Doch stünde es zweifellos besser um seine Gesundheit, wenn…”
„Wenn? Sprechen Sie es aus! Was ist mit ihm?” drängte sie.
„Wenn ich nur wüsste, was los ist. Dann wäre ihm schon geholfen”, meinte er. „Er ist bedrückt, Majestät. Unterwegs dachte ich, es wäre das Heimweh. Nun aber hätte er dazu doch kaum mehr Grund. Sollte etwa ein Zerwürfnis mit Seiner Majestät schuld daran sein, ein Vorfall, von dem ich nichts weiß und über den er nicht sprechen will?”
Der Professor kam der Wahrheit näher, als er dachte. Ja, es gibt dieses Zerwürfnis, musste sich Sissy eingestehen. Doch der Grund liegt noch tiefer. Es ist das spurlose Verschwinden von Sophie Chotek, das Franz Ferdinand solche Sorgen bereitet, dass er keine Ruhe finden kann...
Laut aber sagte sie zu Eisenmenger, der versuchte, in Sissys Miene eine Antwort auf die quälende Frage zu finden: „Der Erzherzog hat offenbar Sorgen privater Natur; ich will mit ihm sprechen. Vielleicht kann ich ihn aufheitern.”
„Davon bin ich überzeugt, Majestät”, erklärte Eisenmenger hoffnungsvoll.
„Nun, wir werden sehen”, lächelte Sissy. „Und was tut unser Patient im Moment?”
„Er schießt”, antwortete Eisenmenger verlegen.
„Was bitte - was tut er?” staunte Sissy, denn sie glaubte, sich verhört zu haben.
Der Professor hob die Hände mit einer Gebärde, die deutlich genug ausdrückte, dass er an der gegenwärtigen Tätigkeit Franz Ferdinands völlig schuldlos sei.
„Er schießt”, wiederholte er mit Nachdruck. „Und das schon eine ganze Weile... Majestät können es ja hören. Da, nun knallt es eben wieder - diesmal scheint er sein Ziel nicht getroffen zu haben.”
„Das ist Franz Ferdinand?” wunderte sich Sissy.
„Jawohl, Majestät, das ist er”, brummte Eisenmenger. „Unsere Schwestern haben bereits eine Höllenangst. Da - schon wieder!”
„Und ich dachte, es sei eine Jagd im Walde”, meinte Sissy kopfschüttelnd.
„Seine Kaiserliche Hoheit hält Jagd im Liegestuhl, Majestät. Er schießt höchst erfolgreich auf Tannenzapfen. Und wenn das so weitergeht, wird hier bald keine einzige Tanne mehr einen Tannenzapfen tragen! - Könnten Majestät nicht versuchen, ihm diese Knallerei auszureden?!”
„Ich werd's probieren, lieber Professor”, versicherte Sissy schmunzelnd. „Wenn Sie mich fragen - ich bin auch kein großer Freund vom Schießen. Wenn wir Frauen das Sagen hätten, dann gäbe es gewiss eines Tages überhaupt keine Waffen mehr. Denken Sie nur an unsere liebe Frau von Suttner. Nun also, wir wollen sehen, was mein lieber Franz Ferdinandmacht, und ob wir ihm nicht für eine Weile wenigstens das Schießen abgewöhnen können.”
Der Professor erbat sich den Vortritt, um Sissy den Weg zu zeigen; doch sie hätte ihren Neffen auch ganz allein gefunden. Der Lärm von Franz Ferdinands Pistole wies ihr ganz unfehlbar den Weg. Nach einer kleinen Pause - offenbar zum Nachladen seiner Waffe - krachte es nämlich schon wieder los.
„Furchtbar”, meinte Sissy kopfschüttelnd.
Auch der Professor schüttelte missbilligend den Kopf. Und dann sahen sie bereits den schießwütigen Patienten.
Eisenmenger war ein Naturfreund; was sein Patient anstellte, ging ihm gegen den Strich. Die Kaiserin schien seine Gedanken zu erraten und meinte: „Ich hoffe, er wird bald genug Gelegenheit haben, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, Professor. Aber vielleicht ist es aus diesem Grunde besser, wenn ich jetzt mit ihm allein spreche!”
Der Arzt blieb stehen.
„Aber selbstverständlich, Majestät! Ich ziehe mich gern zurück. Sie können ihn ja nicht mehr verfehlen.”
„Bitten Sie bloß noch meine beiden Begleiterinnen, in der Halle auf mich zu warten.”
„Oh, ich kann den beiden Damen ja auch auf der Terrasse einen Imbiss servieren lassen. Vielleicht ist ihnen eine kleine Stärkung willkommen.”
„Natürlich, wenn die Gräfinnen wünschen”, nickte Sissy und wartete, bis sich Eisenmenger in Richtung auf die zurückgebliebenen Hofdamen entfernt hatte. Die beiden waren erst gar nicht mitgekommen, weil sie von der Absicht Sissys, mit Franz Ferdinand unter vier Augen zu sprechen, wussten.
Der Erzherzog hatte von dem, was hinter seinem Rücken vorging, nichts bemerkt. Vielmehr bedeckten zahlreiche abgeschossene Tannenzapfen rings um die schlanken Stämme der hohen Nadelbäume den grünen Wiesengrund.
Sissy schritt rasch aus. Doch sie ging leichtfüßig und leise, um Franz Ferdinand nicht zu früh auf sich aufmerksam zu machen. Sie freute sich schon auf das verdutzte Gesicht, das er nun wohl bald machen würde.
Als er ihren leichten Schritt hinter sich vernahm, wandte er sich gar nicht um. Franz Ferdinand dachte, es handle sich, wie so oft, um eine der Schwestern. Es kümmerte ihn nicht; er wollte jetzt nicht an seine Krankheit erinnert werden!
Und schon zielte er wieder in die Höhe und nahm einen baumelnden Tannenzapfen aufs Korn. Zum Unterschied von Eisenmenger meinte er, es lägen noch lange nicht genug solcher Dinger auf der Wiese. Oder vielleicht waren es gar nicht die Tannenzapfen, die ihn reizten. Es schien vielmehr so, als gelänge es ihm - für kurze Augenblicke wenigstens — durch den Schall des Schusses etwas in seinem Inneren zum Schweigen zu bringen.
Er zielte also. Die großen Zapfen waren schon alle seiner Schießwut zum Opfer gefallen; nur noch ein paar kleinere konnte er erspähen, und die waren nicht so leicht zu treffen. Diesmal zielte er besonders sorgfältig, denn der Zapfen war halb hinter Gezweig versteckt.
Doch er kam nicht dazu abzudrücken. Zwei behandschuhte Frauenhände legten sich überraschend um seinen Kopf und verdeckten ihm die Sicht. Und dann sprach eine ihm wohlbekannte Stimme, und es klang seltsam weich, beruhigend und vertrauenerweckend:
„Nein, ich bin nicht Sophie... ich bin jemand anderer - auch jemand, der dich mag. Rate, wer gekommen ist!”
Er ließ die Pistole sinken. Es wallte heiß in ihm auf. Das hatte er wirklich nicht erwartet! Seine Finger, die eben noch so hart den Knauf der Pistole umkrampft hatten, lösten sich aus ihrer Starre. Er warf die Waffe ins Gras und fuhr herum. Nein, Franz Ferdinand hatte sich nicht getäuscht: Sissy stand vor ihm! Die Kaiserin, seine heimliche Verbündete!
„Tante Sissy!” rief er aus und warf die Decken, die ihn wärmen sollten, von sich, um hastig aus dem Liegestuhl zu springen. „Du, hier auf der Mendel!”
„Jawohl, und darauf kannst du dir eine ganze Menge einbilden, du schrecklicher Neffe. Ich bin nämlich nur deinetwegen hier.”
„Nein, so etwas! Ich kann es noch gar nicht fassen!” rief er aus; man sah es ihm an, es drängte ihn, sie zu umarmen - doch dann besann er sich. Der Respekt vor der Kaiserin hätte ihn um ein Haar davon abgehalten, wenn nicht Sissy selbst es gewesen wäre, die ihn jetzt an sich zog und auf seine beiden Wangen einen herzhaften Kuss drückte.
„Schämst du dich denn gar nicht”, sagte sie dabei mit ironischem Lächeln, „die armen, schönen Tannen deinen Unmut entgelten zu lassen? Sie können doch wahrhaft nichts für deinen Kummer!”
„Aber Tante Sissy –”
„Nichts da, Franz Ferdinand! Du solltest diesen Tannen dankbar sein. Sie spenden den Sauerstoff, den deine kranken Lungen brauchen, um wieder gesund zu werden!”
„Schön, Tante Sissy”, lachte er, „ich verspreche hiermit feierlich, zum Dank und als Entschädigung eigenhändig in diesem Garten eine Jungtanne zu pflanzen.”
„Das ist ja wohl auch das mindeste, was du tun kannst”, erklärte Sissy. „Und nun wollen wir von etwas anderem reden. Schließlich bin ich nicht hier heraufgekommen, um mich mit dir über Botanik zu unterhalten.”
„Wollen wir ins Haus gehen?” fragte er.
Er sah, dass ihre Miene plötzlich ernst geworden war, und spürte ein leichtes, erwartungsvolles Herzklopfen. Sicherlich hatte sie ihm etwas Wichtiges zu sagen.
„Nein”, wehrte sie ab, „hier sind wir ganz unter uns und ungestört. In einem Haus aber weiß man nie, ob nicht die Wände Ohren haben.”
„Du machst mich wirklich neugierig, Tante”, versicherte er.
„Nun”, sagte sie nach kurzem Überlegen, „du kannst dir ja wohl denken, worum es geht.”
„Um Sophie?” fragte er erwartungsvoll.
„Ja, natürlich, um Sophie, wie du sie zu nennen pflegst. Um die Komtesse von Chotek-Chotkova, deine nicht standesgemäße Braut, die dir offenbar niemand ausreden kann.”
„Nein, das kann wirklich niemand”, versicherte er gepresst, und seine Lippen wurden schmal und hart. „Du bist doch nicht etwa gekommen, um es auch zu versuchen?”
Sie sah das Misstrauen in seinen Blicken, das plötzlich in ihm erwacht war. Ein Zug von schwerer Enttäuschung zeichnete sich um seine Mundwinkel ab, die sich schmerzlich verzogen.
„Nein, nein”, beruhigte ihn Sissy sofort. „Ich denke, das müsstest du eigentlich wissen!”
„Oh, Tante Sissy”, murmelte er mit einer müden Handbewegung, „ich habe schon so viele Enttäuschungen erlebt...”
„Du kränkst mich, Neffe”, stellte sie beleidigt fest.
Er erkannte schnell, dass er ihr Unrecht getan hatte. Es tat ihm leid.
„Verzeih”, sagte er einfach.
„Ist schon vergessen”, meinte Sissy. „Ich kenne ja meinen misstrauischen Franz Ferdinand!”
Sie war tatsächlich leicht verärgert über ihn. Da kam sie nun in der besten Absicht herauf auf die Mendel, und er war imstande, dies völlig zu verkennen.
„Nein wirklich, Tante”, bekannte er mit sichtlicher Reue. „Ich bin wirklich ein – ein –“
„Ein ganz schrecklicher Mann bist du, jawohl”, schimpfte sie. „Und ich kann es überhaupt nicht begreifen, wie dieses Mädchen dich, ausgerechnet dich, heiraten will!”
Nun hellte sich seine Miene auf, und seine Augen gewannen einen frohen Blick. Und er strahlte plötzlich über sein ganzes, kantiges Gesicht.
„Ja, nicht wahr?” lachte er. „Das frage ich mich auch. Irgendjemand muss einen ja schließlich lieben! Irgendjemand muss doch wohl. Und diesen einen, einzigen, will man mir nehmen...”
Seine Stimme senkte sich wieder zu schmerzvoller Traurigkeit. Sissy legte ihm begütigend die Hand auf die Schulter.
„Nein, nein”, sagte sie, „hab Vertrauen. Seid ihr wirklich füreinander bestimmt, dann werdet ihr auch zusammenkommen!”
„Das sage ich auch, Tante Sissy”, fasste er wieder Hoffnung. „Was ist - hast du eine Nachricht von ihr für mich? Doch nein, das darf ich wohl nicht hoffen. Aber weißt du wenigstens, wo sie ist, kannst du mir das wenigstens sagen, und ob sie meine Briefe erhalten hat? Ich bin ohne jede Nachricht von Sophie, und sicher fängt man ab, was sie mir schreibt. Sei mir nicht böse, Tante Sissy, ich weiß, du liebst deinen Mann, und er ist mein Onkel - aber manchmal glaube ich, dass ich ihn hasse...”
„O nein”, erschrak sie, „tu das nicht, Franz Ferdinand. Glaub mir, dass er auch für dich nur das Beste will. Wie für uns alle!”
Geheimnis um Sophie
„Aber”, entgegnete Franz Ferdinand kopfschüttelnd, „wie kann er dann mein Lebensglück durch seine Starrköpfigkeit zerstören? Ich liebe Sophie; sie liebt mich. Das ist die einfachste Sache der Welt, Tante! Wir sind zwei, die zusammengehören, meine Sophie und ich, und nichts wird uns trennen können. Ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich einst das Reich regieren muss. Gerade weil es eine so schwere Aufgabe ist, brauche ich eine Stütze, eine Frau an meiner Seite, für die das alles auf mich zu nehmen sich lohnt.”
„Lohnt es sich nicht in erster Linie für das Reich und seine Menschen?” fragte Sissy, und ein leiser Vorwurf lag in ihrer Stimme. „Die Habsburger haben es sechshundert Jahre lange gemehrt und regiert; sie haben Kriege geführt und Ehen geschlossen, und letzteres viel lieber und erfolgreicher als ersteres. ,Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich - heirate', heißt es.”
„Aber ich will ja heiraten!” rief Franz Ferdinand erbost.
Sie wanderten längst durch den Park des Sanatoriums. Der Erzherzog unterstrich seine Worte mit so impulsiven Gesten, dass es - falls man sie beobachtete - wie ein Streit aussehen konnte. Und diesen Eindruck wollte Sissy unbedingt vermeiden. Tatsächlich sah die Mikes die beiden auch bald zwischen den Tannen verschwinden.
„Du möchtest heiraten - ja, aber nicht dem Konnubium gemäß”, erklärte Sissy. „Du machst meinem Franz damit schwere Sorgen. Ist dir der Unterschied zwischen der ungarischen und der österreichischen Verfassung überhaupt klar, mein Herr Thronfolger? Hast du bedacht, dass du zwar das Konnubium nach der österreichischen Verfassung durch eine morganatische Ehe umgehen könntest, was dir offenbar vorschwebt, nach der ungarischen aber nicht, weil man in Budapest diesen Begriff nicht akzeptiert? Danach wäre deine Sophie in Ungarn womöglich Königin und ihre Kinder Thronerben; in Wien jedoch würde sie dem Rang nach erst nach der jüngsten Hofdame kommen. Das wäre doch ein ganz unmöglicher Zustand! Mein Mann, dein Onkel, ist daran ganz unschuldig; er hat diese Ehegesetze nicht gemacht, ist aber als Oberhaupt des Hauses verpflichtet, über ihrer Einhaltung zu wachen. Und solltest du einmal Kaiser und König sein, wirst du dieselbe Pflicht übernehmen müssen. Wie aber würdest du das können, wenn du selbst das Hausgesetz dermaßen brichst?”
Dem verliebten Erzherzog begann zu dämmern, in welchem Dilemma sich sein Onkel befand und in welche Situation er ihn durch seinen Starrsinn brachte. An seinem Entschluss änderte das aber nichts.
„Tante Sissy, wie du selbst sagst, sind diese Gesetze alt. Man muss sie reformieren, wie so manches andere.”
„Und das möchtest du tun?”
„Das werde ich tun”, verkündete er.
„Im Grunde denke ich wie du”, musste sie seufzend zugeben. „Wir Kaiser und Könige sind Gefangene unserer Macht. Als wir die arme Eugenie in Cap Martin besuchten, hatten Franzl und ich fast den Eindruck, dass Eugenie sich im Exil wohler fühlt als in ihren einstigen Prunkgemächern in Versailles. Doch zu deiner Reformidee, zu welcher dich deine Liebe zu Sophie inspiriert, möchte ich dir zu bedenken geben, dass der Rechtsanspruch der regierenden Familien gegenüber ihren Völkern und Machtstreben: aller Art eben auf diesem Konnubium beruht, das du umstoßen willst. Es gibt in der Botanik einen verwandten Begriff; er heißt ,Cönobium'. Darunter versteht man eine zu einer Gemeinschaft vereinigte Zellfamilie gleicher Abstammung.”
„Oh, ich verstehe sehr wohl, was du meinst, Tante”, entgegnete er heftig. „Und wenn du schon mit wissenschaftlichen Vergleichen kommst, dann komme ich dir mit dem Begriff der ,Inzucht'. Eines Tages besteht unsere wunderbare ,Zellfamilie', welche Europa unter sich aufgeteilt hat, nur noch aus degenerierten Idioten.”
Er hatte Sissy an einem ihrer wundesten Punkte berührt; insgeheim wurde sie stets von der Furcht geplagt, dass es ihr eines Tages ergehen könne wie so manchem anderen Wittelsbacherkind. Nachts wachte sie manchmal auf, in Schweiß gebadet, und sah das Gespenst des drohenden Irrsinns vor Augen. Doch diesmal wehrte sie entschieden ab.
„Die Macht hat ihren Preis, Franz Ferdinand, einen sehr hohen Preis. Wir müssen auf vieles verzichten. Es könnten durch eine Heirat mit Sophie Chotek in der ungarischen Reichshälfte Probleme entstehen, die noch dadurch verschärft würden, dass Sophie aus Böhmen stammt und dem böhmischen Adel angehört. Dabei würde eine Situation entstehen, in welcher Habsburgs Thronanspruch in Frage gestellt ist, wie er, basierend auf dem Konnubium, in den Deutschen Bundesakten von 1814 festgelegt wurde.”