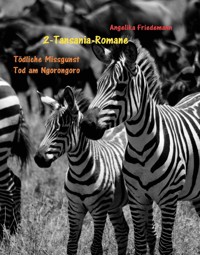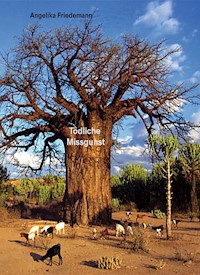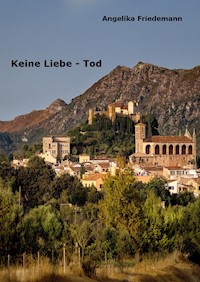3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. Die Geschichte einer Frau, die einen lang ersehnten Traum von einem Leben in Afrika verwirklichen möchte. Die geheimnisvolle, exotische, farbenprächtige Kulisse von Kenia dient als Hintergrund zu diesem Roman. Nach ihrer Scheidung beschließt die Chirurgin Katrin Labert einen Neuanfang in einem Hospital in Nairobi. Ihr 16-jähriger Sohn ist begeistert von der Lebensform in der neuen Wahlheimat. Aller Anfang ist schwer. Sie fühlt sich einsam und zu wenig beachtet. Sie missgönnt anderen Menschen ihr Glück, ihre Zufriedenheit und ihre Erfolge. Sie will genau das. Aber sie legt sich kräftig ins Zeug, will allen zeigen, wie gut gerade deutsche Ärzte ausgebildet sind. Sie spinnt ein Netz aus Intrigen und Lügen nicht nur, um ihr eigenes Image aufzubessern, auch um mehr Macht und Ansehen zu erlangen. Eines Tages wird Katrin von Männern der radikalen al-Shabaab-Terrororganisation entführt. Nun lernt sie die grausame und brutale Welt des Terrors kennen. Sie wagt nach Wochen des Bangens, der Angst die Flucht aus einem fast menschenleeren Gebiet in Somalia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sterne über Kenia
Ideale sind wie Sterne,man kann sie nicht erreichen,aber man kann sich nach ihnen orientieren. C. Schurz23456789101112131415ImpressumIdeale sind wie Sterne,man kann sie nicht erreichen,aber man kann sich nach ihnen orientieren. C. Schurz
1
Sie schleuderte die Pumps von den Füßen, stellte die Handtasche ab, durchquerte das Wohnzimmer, um weit die Balkontür aufzureißen. Sofort strömte ihr eine warme Brise entgegen. Einen Moment schaute sie auf die Spitzen der Berge in der Ferne, da heute sehr klare Luft vorherrschte. Am Wochenende könnte man eventuell in die Alpen fahren, wandern gehen, irgendwo eine Brotzeit einnehmen, bevor man den Rückmarsch antrat. Gleichzeitig wusste sie jedoch, dass sie das nicht wirklich wollte. Das hatten sie früher oft mit …
Sie wendete sich ab: Nein, das war vorbei.
Sie zog Rock und Bluse aus, wählte ein blaues, älteres, verwaschenes Sommerkleid, das sie gern trug, band die dunkelblonden Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen, wusch die Hände. Lenard würde bald kommen. Bis dahin sollte das Abendessen parat stehen. Sie schaltete das Fernsehgerät an, da sie die Nachrichtensendung sehen wollte. Während der Arbeitszeit war sie nicht dazugekommen, die neusten Meldungen zu hören oder etwas zu essen. Einmal mehr hatte Hochbetrieb geherrscht.
Sie begann die Salatsoße zuzubereiten, holte vom Balkon Petersilie, Kresse, Schnittlauch, die sie in Töpfen züchtete. Gießen muss ich nachher noch, sonst verwelkt das alles, dachte sie, ließ ihren Blick zu den Berggipfeln gleiten. Sie liebte diese Aussicht. München liegt mir zu Füßen, hatte sie damals gelacht und Stefan hatte sie in den Arm genommen, genauso wie ich, gesagt.
Vergiss ihn, drehte sie sich um, schaute zum Fernseher, da man den Wetterbericht sendete.
Der Salat war gerade fertig, als die Wohnungstür aufschnappte.
„High, Mama“, rief er und sie hörte seinen Rucksack herunterfallen.
„Hallo, Len, räum ihn gleich in dein Zimmer. Zehn Minuten.“
„Cool! Ich habe Hunger. Es gab so blöde Nudeln mit irgendwelchem Fleisch und Soße. Sah, wie schon mal gegessen aus.“
Sie schmunzelte. „Also Hamburger.“
„Keine Zeit, da wir keine Freistunde hatten. Hab ´ne Banane gegessen.“
Er kam in die Küche, gab ihr einen Kuss, stibitzte aus der Schüssel ein Salatblatt. Er war jetzt schon so groß wie sie. Eine Tatsache, die sie nicht besonders erfreute. Viel zu schnell wurde aus ihrem kleinen Buben ein Teenager.
„Hände waschen. Wollen wir draußen essen?“
„Ist okay“, verschwand er und sie blickte ihm nach. Er war seit der Scheidung erwachsener geworden. Für ein 16-jähriges Kind war er erstaunlich vernünftig und extrem selbstständig. Sie seufzte, wollte den Gedanken verdrängen, dass er in wenigen Jahren eigene Wege gehen würde, eine Freundin für ihn wichtiger war, als sie, seine Mutter. Obwohl sie es nie zugeben würde, sie hatte Angst vor diesem Moment. Danach war sie ganz allein.
Sie schaute einen Film über die Serengeti an, der von der Wanderung der Gnus berichtete, als ihr Sohn sich zu ihr setzte.
„Hausaufgaben erledigt?“
„War nicht viel. Morgen schreiben wir die Geo-Arbeit. Vor den Ferien jeden zweiten Tag ´ne Arbeit. Ist echt ätzend.“
„Das ist so, wenn es Zeugnisse gibt. Weißt du das Thema?“
„Nö, aber egal. Das möchte ich mal live und in Farbe sehen“, deutete er auf den Film.
„Ich auch. Eventuell sollten wir im Urlaub nach Afrika reisen.“
„Wäre echt cool. Da wolltest du schon immer hin. Philip war in Tansania und fand es klasse. Da kann man mit einem Ballon fliegen, so über die Viecher hinweg, hat er erzählt.“
„Das muss faszinierend sein“, äußerte sie schwärmerisch.
„Mama, hast du nie überlegt, für ein paar Jahre dort zu arbeiten?“
„Das sind Träume, die ich als junge Ärztin hatte. So wie Albert Schweitzer, den armen Menschen helfen, sie heilen, den Schwarzen alles bei bringen und sie lehren, damit sie irgendwann so wie wir leben können“, amüsierte sie sich.
„Jetzt könntest du das doch machen. Das Heilen, meine ich. Den Rest können sie mittlerweile. Sie leben doch dort nicht mehr nackt in der Wildnis.“
Sie lachte laut. „Sicher. Du wirst mein Assistent und Hilfe benötigen die Neger reichlich. Sie sind in ihrer Entwicklung noch hundert Jahre zurück, kennen weder Schulen noch sonstige moderne Errungenschaften. Deswegen müssen wir denen doch andauernd Gelder geben, sonst würden die verhungern. Sie können nicht denken, können nicht produktiv arbeiten, sind träge. Du hast doch neulich gehört, was unsere Kanzlerin sagte: Man muss ihnen alles beibringen, selbst wie man Mais oder so anbaut. Schulen müssen wir aufbauen. Nicht einmal Straßen haben sie vernünftige. Sie kriegen nichts in die Reihe. Aber egal. Nein, mein Sohn, du wirst brav die Schule beenden.“
„Nö, so meinte ich das nicht. Sondern ich gehe zur Schule und du arbeitest. Ist anders. Eben in Afrika.“
„Ach komm, hör auf. Dazu bin ich mittlerweile zu alt. Mich können sie generell nicht bezahlen und ein bisschen Geld verdienen müsste ich schon.“
„Mama, du bist 39. Ärzte haben sie gewiss nicht so reichlich, außerdem bist du Chirurgin und ´ne Gute, sagst´e doch immer. So etwas benötigen sie bestimmt. Muss ja nicht unbedingt im tiefsten Urwald sein. Ich meine, so ein richtiges Krankenhaus. Die gibt’s dort auch.“
„Guck dir die Krokos an, wie sie sich die Gnus schnappen. Die Zeit der Schweitzer Nachfolger ist vorbei.“
„Logo, da die Menschen lange in der Zivilisation angekommen sind. Stell dir vor, Kigali, Dar-es-Salaam oder eine andere Stadt würden dir ´nen Job anbieten, würdest du da zusagen?“
„Sofort. Nur sie bieten mir keinen Job an, weil sie nicht einmal wissen, dass es mich gibt. Du bist albern.“
„Ich fände das cool.“ Er stand auf, gab ihr einen Kuss. „Ich höre noch ein bisschen Musik und träume, wir beide machen Afrika unsicher.“
„Pass auf, dass dich kein Löwe frisst“, lachte sie. „Gute Nacht.“
Sie schaute ihm schmunzelnd nach, bevor sie von einem Leben mit Len auf dem schwarzen Kontinent träumte. Das war immer ihr Plan gewesen, derweil kam alles anders. Erst Stefan, dann die Schwangerschaft, die Hochzeit und Len, ihr Abschluss als Chirurgin. Es folgte die ständige Gratwanderung zwischen Arbeit und Familie. Stefan hatte ihr später vorgeworfen, er wäre dabei auf der Strecke geblieben. Eine damische Ausrede, weil er sie jahrelang betrogen hatte. Die Vorwürfe trafen sie trotzdem hart, zumal die völlig unvorbereitet auf sie eingeprasselt waren. Es gab nie die leiseste Andeutung, dass er, seit über einem Jahr neu liiert war. Sie hatte seinen Ausflüchten von Überstunden, Kollegentreffs geglaubt, bis zu dem Samstag, als sie Freunde zu ihrem 36. Geburtstag eingeladen hatten und er nicht nach Hause kam. Am Sonntag erschien er, fiel sofort mit der Tür ins Haus: Ich werde mich endlich scheiden lassen, da ich seit längerem eine feste Freundin habe, waren seine Worte gewesen. Das alles widert mich nur noch an. Ich habe keine Lust mehr, weiter all den Leuten diese blöde Schmierenkomödie vorzuspielen. Von wegen - glückliche Familie. Du bist ein stupides Weib, das unbedingt Karriere machen möchte. Nur dazu wird es nie kommen, weil du Mittelklasse, für keine Kritik empfänglich bist, obwohl du angeblich sooo toll sein willst. Daheim mutierst du zu einem schlampigen, damischen Hausmütterchen, das alt geworden ist. Guck dich doch an, wie du herumläufst: In alten abgetragenen Fetzen latschst du durch die Wohnung, hatte er sie verhöhnt.
Innerhalb von zwei Minuten hatte er auf brutale Art, nicht nur 13 Jahre Beziehung weggeworfen, sondern eine 11-jährige Ehe mit eimerweisem Dreck übergossen. Selbst der eigene Sohn blieb nicht verschont. Ihn hatte er als vernachlässigten Bub betitelt, um den er sich jahrelang allein kümmern musste.
Sie hatte Lenard angeschaut, der von seinem Vater zu ihr und zurückgeblickte, nicht begreifend, warum sein Vater so tobte. Plötzlich war er aufgesprungen, hatte zu Stefan gesagt, du bist das Letzte und war in sein Zimmer gerannt. Seitdem hatte er seinen Vater nie mehr gesehen, da er sich weigerte, den zu besuchen. Das hatte er so dem Jugendamt gesagt. Der Mann wäre für ihn gestorben. Alles Zureden half nichts, er blieb bei seinem nein. Selbst mit Stefans Eltern hatte er sich überworfen, besuchte sie nicht mehr, obwohl er das einzige Enkelkind von ihnen war. Was dort vorgefallen war, wusste sie nicht, da er nie darüber sprechen wollte. Er hatte damals sogar den Namen der Mutter annehmen wollen, da sie Stefans Namen nach der Scheidung abgelegt hatte. Das wäre ihr wie ein Hohn vorgekommen, noch seinen Nachnamen zu führen.
Katrin, vergiss ihn und diese verlogene Ehe. Jeder Gedanken an diesen Mann ist vergeudet, sagte sie sich. Nur sie wusste, so simpel war das nicht. Es gab keinen Tag, an den sie nicht an ihn dachte. Jedes Teil in ihrer Wohnung erinnerte sie an Stefan. Sie beschwor Kritiken an ihrer eigenen Person herauf, um so, die ihr zugewiesene Schuld zu ergründen. Das versuchte sie seit der abrupten Trennung. Sie fand nur keine, weil sie alles für ihn, für ihre Familie getan hatte. Was war daran falsch, wenn man als Frau Erfolg im Beruf haben wollte? Es existierte heute eine Ellenbogengesellschaft und sie wusste inzwischen genau, wo sie den Ellenbogen einsetzen musste, damit man sie nicht unterbutterte. Stefan und Lenard waren deswegen nie zu kurz gekommen. Sie meisterte Haushalt und Kindererziehung perfekt, war stets eine tolle Mutter, Köchin, Ehefrau und Geliebte gewesen. Vermutlich zu perfekt. Manche Männer kamen damit nicht klar, dass die Ehefrau Karriere, Kind, Haushalt und Ehe unter einen Hut brachte, während sie nur den Berufsalltag bewältigten. Stefan gehörte dazu.
***
Vier Wochen waren vergangen und heute gab es Zeugnisse. Das war immer der Tag, an dem sie mit Len essen ging. Er war bereits zu Hause, als sie aufschloss.
„Hei Len“, rief sie.
Er kam aus seinem Zimmer gestürmt. „Hei Mama.“
„Na nu, du hast ja so gute Laune? Ist dein Zeugnis doch besser ausgefallen, als du dachtest?“ Sie gab ihm einen Kuss. „Zeig her.“
Sie wartet im Flur, bis er mit der Mappe erschien, legte den Arm um ihn. „Schon überlegt, wo wir heute essen gehen?“
„Habe ich.“
„Gut, lese ich schnell, dann geht es los.“
Sie nickte anerkennend, aber es war nicht anders ausgefallen, als sie es anhand der Noten in den Klassenarbeiten ausgerechnet hatte. Er war ganz ihr Sohn, daher seine Intelligenz.
„Sehr gut. Ich bin stolz auf dich“, lobte sie. „Besonders die Eins in Mathe und Englisch sind super.“
„Oma und Opa haben schon angerufen und gefragt. Opa hat gesagt, wenn wir am Wochenende kommen, hat er eine Überraschung für mich. Weißt du, was es ist?“
Sie lachte. „Nein und selbst wenn, würde ich es dir nicht sagen. Ist es ja keine Überraschung mehr. Gehen wir, da ich Hunger habe. Heute kamen drei OPs dazu, da es einen schweren Unfall auf der Autobahn gab.“
„Mir sagst´e immer, ich soll mittags etwas essen.“
„Du wächst noch und ich schrumpfe bereits. Fahren wir.“
„Wir gehen zum Chinesen, dachte ich. Müssen wir nicht fahren und ich habe Lust auf Ente.“
„Noch besser. Ich habe nämlich gerade einen Parkplatz direkt vor der Tür ergattert.“
Sie hatten bestellt und Leonard schob ihr einen Umschlag zu. „Da, Post für dich.“
„Aha! Wieso gibst du mir den hier?“ Sie musterte die Briefmarke, den Umschlag.
„Wirst´e gleich lesen. Mach schon auf.“
„Wieso schreibt mir ein Hospital aus Nairobi?“ Sie riss das Kuvert auf.
„Na ja", druckste er herum. „Du hast dich da um den Job einer Chefchirurgin beworben.“
Sie blickte hoch. „Ich habe waaass?“
„Nicht so laut“, raunte er ihr zu und sie bemerkte die Blicke von den Gästen am Nebentisch.
Sie faltete den Bogen auseinander und las.
„Was schreiben sie denn, Mama?“
„Das, mein Sohn, nennt man Briefgeheimnis.“
„Mama, sag!“
„Len, wie kommst du auf so eine Schnapsidee?“, guckte sie ihn etwas verwirrt an.
„Weil du immer nach Afrika wolltest und sie suchen eine Ärztin.“
„Das sind Träume und …“
„Mama, Träume soll man verwirklichen. Was spricht dagegen, wenn sie dich nehmen?“
„Eine Menge. Meine Freunde, die ich hier habe, meine Familie, einen gesicherten Arbeitsplatz, meine Wohnung, die ich gerade erst abbezahlt habe, meine gehobene Position im Krankenhaus, deine Schulausbildung, deine Freunde. Nur ein paar Dinge.“
Sie wartete, bis die Bedienung die Getränke abgestellt hatte.
„Len, von etwas zu träumen, ist eine Sache. Eine gesicherte Existenz aufzugeben eine andere. Afrika ist generell nicht unbedingt der frauenfreundlichste Kontinent, dazu kommen die vielen anderen Nachteile. Wassermangel, Stromversorgung, die bisweilen unzureichend ist. Das Klima, die Arbeitsbedingungen, Korruption, hohe Kriminalitätsraten, deine Schulausbildung. Wir kennen dort niemand, haben keine Freunde. Wie das mit Wohnungen ist – keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich nur einige Dinge, von denen ich weiß. Das ist ein völlig anderes Leben, ohne all die Annehmlichkeiten, die wir hier kennen und lieben.“
„Nairobi ist eine moderne Stadt und kein Dorf in der Walachei. Es gibt da eine deutsche Schule, Universitäten und neue Freunde findet man. Die laufen doch heute nicht mehr halbnackt herum“, empörte er sich.
„Trotzdem leben sie völlig anders als wir.“
„Na und? Man kann sich umstellen. Fernsehen, Internet und Handys gibt es dort auch. Sie haben Strom aus der Steckdose, Wasser kommt aus der Leitung, wie bei uns. Was schreiben sie denn?“
„Dass ich zu einem Vorstellungsgespräch kommen soll. Was hast du ihnen geschrieben?“
„Dass du eine sehr gute Chirurgin bist, viel Erfahrung hast, auch bei Transplantationen, dass du die Chefin der Chirurgie bist und so weiter. Wie man sich bewirbt, habe ich im Internet herausgesucht. Habe sogar alles in Englisch geschrieben. Nur deine Zeugnisse habe ich nicht gefunden.“
Sie schüttelte den Kopf, unterdrückte ein Schmunzeln.
„Wann sollst du denn kommen?“
„Len, vergiss es. Das war eine Schnapsidee.“
„Du traust dich nicht. Sage es einfach. Mensch Mama, das wäre die Chance für dich. Einige Jahre Auslandserfahrung sind immer gut, sagst du ständig. Überleg mal, wir können in die Maasai Mara fahren, uns die Tiere alle angucken, sehen, wie die Maasai wirklich leben und so.“
„Das wäre kein Urlaub, sondern harter Alltag, vermute ich. Nichts da in einem tollen Hotel wohnen, sich bedienen lassen, schwimmen gehen oder Safaris erleben. Kein Hamburger zwischendurch essen gehen, keine Freunde, kein Wochenende bei deinen Großeltern, kein Ski fahren im Winter, nichts dergleichen. Dort gibt es Armut, Slums, Malaria, andere Krankheiten.“
„Gibt es bei uns inzwischen auch. Du traust dich nicht, das ist es doch, obwohl du immer dorthin wolltest. Mama, sei ehrlich, hätte dir das Stefan vorgeschlagen, hättest du ja gesagt, oder?“
Sie überlegte einen Moment, nickte.
„Weil der so eine junge Tussi hat, magst du darauf verzichten? Mensch, er hat uns nur belogen, sagst´e ständig, wenn ich Papa besuchen wollte.“
Sie schluckte eine harsche Erwiderung herunter. „Mit einem Mann ist es etwas anders, als wenn dort eine Frau mit einem Buben auftaucht.“
„Ich bin doch kein Kind mehr“, empörte er sich. „Dass es mich gibt, habe ich denen geschrieben. Denk doch wenigstens darüber nach. Wir fliegen hin und du guckst dir das an. Ist eben unser Urlaub. Du hast mir versprochen, dass wir verreisen.“
„Wir verreisen ja auch. Mindestens zwei Wochen und eine gemeinsame Woche machen wir München und die Berge unsicher. Wie vereinbart.“
Zurück schaltete Lenard schnurstracks seinen Laptop an, den er zum Geburtstag von den Großeltern bekommen hatte, zeigte ihr eine Internetseite über Kenia, anschließend welche über Nairobi.
„Da sieht es echt cool aus.“
„Lenard, das ist nur die eine Seite, die sie da veröffentlichen, damit sie die Touristen nicht abschrecken. Meinst du, auf Informationsseiten über München steht, in welchen Bezirken Arme leben, wie manche Mietshäuser vergammeln, dass es hier selbstverständlich Kriminalität gibt?“
„Na siehst´e, gibt es auch bei uns.“
„Ich schaue es mir ja an“, lenkte sie ein.
„Eben. Gucken wir uns jetzt Kenia an und danach kannst du ja nachdenken, ob wir hinfliegen“, jubelte er.
***
Mittags sprach sie in der Kantine mit Maria, einer Kollegin und guten Bekannten. Als sie ihr die Geschichte erzählte, lachte sie laut. Max, ein Kollege setzte sich zu ihnen. „Heute habt ihr ja beste Laune“, stellte er fest.
Nun folgte nochmals die Geschichte von Lenard.
„Der junge Mann ist clever, habe ich immer gesagt. Und nun?“
„Auf der einen Seite bin ich natürlich neugierig, auf der anderen Seite ist das eine völlig verrückte Geschichte.“
„Du hast in wenigen Tagen Urlaub und wusstest eh noch nicht, wohin du fahren willst. Warum nicht nach Kenia?“, erkundigte sich Maria. „Würde man mir eine Stelle auf den Malediven anbieten, würde ich sofort ja sagen.“
„Du bist genauso verträumt wie Len“, lachte Katrin. „Nix da, schwimmen, schnorcheln, tauchen, an der Bar Cocktails trinken oder was man sonst so macht.“
„Spielverderberin“, scherzte Maria. „Wenigstens in der Freizeit hätte ich das und kein Schmuddelwetter, Föhn, Autoabgase und was weiß ich noch alles. Vorgestern haben sie mir in der U-Bahn das Portemonnaie gestohlen, mit allen Karten und so. Ich hab´ nu die Rennerei. Wäre mir auf den Malediven nicht passiert.“
„Logisch, da gibt es keine U-Bahn“, amüsierte sich Katrin.
„Maria, du würdest noch mehr Sommersprossen und Sonnenbrand bekommen“, stellte Max fest. „Katrin, hinfliegen würde ich auf jeden Fall. Das ist generell eine Chance, wenigstens für einige Jahre etwas anderes kennenzulernen. Vielleicht kannst du danach bei uns in einem anderen Krankenhaus mehr erreichen, als nur immer in der dritten Reihe zu stehen. Wäre ich in eurem Alter, würde ich die Gelegenheit wahrnehmen. Ich wollte immer für ein paar Jahre ins Ausland, habe aber auf die Familie Rücksicht genommen. Man bereut es hinterher.“
Sie blickte den Kollegen an, den sie am meisten von allen mochten und schätzte, nicht nur als Kollege, sondern als Arzt, Berater, Freund, Vertrauter. In zwei Jahren würde er in Rente gehen und sie bedauerte heute schon den Verlust.
„Wisst ihr, irgendwie bin ich schrecklich neugierig, wie es dort wirklich ist. Ich meine, wie die Menschen leben, nicht nur die Viecher. Auf der anderen Seite stelle ich mir Bürgerkriege, Hungersnot, keinen Strom und all das vor. Da kriege ich Panik.“
Der Arzt lehnte sich zurück, verschränkte die Arme vor der Brust, streckte seitlich die Beine aus. „Vorfinden wirst du vermutlich von jedem etwas. Das ist kein Umzug, als wenn du Hamburg oder Wien wählen würdest. Ich weiß nun nicht viel über Kenia, außer mehr über die üblichen Touristenattraktionen. Dazu dieser scheußlichen Sache mit Den Haag ist da haften geblieben. Da gab es vor drei oder vier Jahren Wahlen mit den üblichen Manipulationen, aber von beiden großen Parteien. Danach herrschte Chaos im Land. Der Strafgerichtshof hat nun irgendwelche Politiker angeklagt, soviel ich weiß. Seitdem scheint es dort ruhig zu sein. Gut, darüber findet man ja heute alles im Internet. Nairobi ist eine rasch wachsende Metropole, zumal dort viele Organisationen sich angesiedelt haben. In den Städten schätze ich, wird die Infrastruktur schon passen, außerhalb wird es shocking sein. Von einer Hungersnot wirst du wohl nicht betroffen sein, da auch das mehr die ärmeren Gegenden betrifft. Den Weißen geht es in solchen Ländern in der Regel immer gut, weil sie all das kaufen und besitzen, von denen normale Schwarze nur träumen. Je nach Klinik kommst du selbst dort nicht mit der normalen Bevölkerung in Verbindung, weil die sich weder einen Arztbesuch geschweige einen Krankenhausaufenthalt leisten können. Fliege für ein paar Tage mit deinem Buben hin, schaut die Stadt und einen der Nationalparks an, danach weißt du mehr. Du hast sowieso Urlaub. Nairobi, Maasai Mara und Indischer Ozean, ist da glaube ich angesagt.“
„Max hat recht. Genau das würde ich machen. Guck kurzerhand im Internet nach, was man da über dieses Krankenhaus findet? Ist es eine Bruchbude – vergiss es. Ist es modern, mit den üblichen Kriterien, siehst du es dir an. Hakuna matata, sagen meine zwei Rangen immer. Ist Kisuaheli.“
„Auch König der Löwen geguckt“, lachte Katrin. „Den Film konnte ich seinerzeit fast auswendig mitsprechen, so oft hat sich den Len reingezogen. Alle Sorgen bleiben dir immer fern, hakuna matata“, sang sie leise.
Nun lachten sie.
Nachmittags traf sie sich mit ihrem Bruder in einem Café. Severin hörte sich die Geschichte grinsend an.
„Coole Idee, würde Len es nennen. Fahr hin, sieh den Laden an. Wo ist nun dein Problem?“
Sie teilte auch ihm ihre Bedenken mit und ähnlich wie Max, zerstreute er die zum Teil.
„Wäre ich so nach Afrika verrückt wie du, würde ich es mir wenigstens ansehen. Ist die Klinik in Ordnung, dann nimm die Chance wahr. Du musst ja dort nicht hundert Jahre leben. Ein paar Jahre und du kommst zurück, falls du es dann überhaupt noch willst. Was hast du zu verlieren? Auslandsarbeiten fördern später die berühmte Karrierestufe aufwärts. Du möchtest doch immer ganz nach oben“, lästerte er. „Katrin, hier bleibst du ewig nur eine kleine Hilfschirurgin, weil du über zu wenig Kenntnisse verfügst. So jedoch kannst du dich dort weiterbilden, lernen. Fällt da vermutlich nicht auf, dass du nicht wirklich operieren kannst.“
Sie erwiderte nichts auf seine Äußerung, weil sie wusste, hier würde sie wirklich nie Karriere machen, da man ihr das als Frau missgönnte.
Abends suchte sie mehr über das Land und das Krankenhaus heraus. Was sie über das Nairobi Hospital, wie es hieß, fand, gefiel ihr, weniger die Dinge, die sie über das Land las:
Nairobi, die südlich des Äquators auf über 1.600 Metern Höhe gelegene Hauptstadt von Kenia, ist ein wirtschaftliches, kulturelles und geistiges Zentrum dieser Region. Es lebten an die drei Millionen Menschen in der Metropole. Durch viele Zuwanderer bemerkt man an unzähligen Orten der Stadt die europäischen Einflüsse. Dennoch ist das ursprüngliche afrikanische Flair nicht zu übersehen. Südlich der Kenyatta Avenue, welche durch das Zentrum führt, befinden sich einige luxuriöse Einkaufsstraßen, Hotels der gehobenen Klasse sowie der City Square, in dessen unmittelbarer Nähe steht ein modernes Wahrzeichen der Stadt: Das Kenyatta Conference Centre mit seinem auffälligen Turm. Der bekannte Nairobi National Park liegt wenige Kilometer südlich der Stadt in der Athi-Ebene und ist mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar. Dort können viele Wildtiere beobachtet werden. Im Hintergrund erblickt man die Kulisse von Nairobi – ein wirklich interessanter Anblick mit Seltenheitswert, berichtete man.
Hörte sich toll an, wenn da nicht die andere Seite wäre, resümierte sie. Es wurde von unzähligen Slums berichtet, in den hunderttausend Menschen unter katastrophalen Bedingungen hausten. Kein Wasser, kein Strom, keine sanitären Einrichtungen – nur Wellblechhütten. Dazu gesellte sich die politische Lage, die ihr nicht vertrauenerweckend erschien, obwohl sie nicht viel darüber wusste. Das war alles das krasse Gegenteil von dem, was sie kannte, schätzte und liebte. Trotzdem besaß das Angebot eine magische Anziehungskraft für sie. Allein das Wort “Afrika“ verursachte bei ihr ein Glücksgefühl. Dazu das Wort “Karriere“ wirkte wie ein Magnet.
Am Freitag buchte sie vier Tage Aufenthalt in Nairobi. Sie hatte einen Termin für eine Art Vorstellungsgespräch erhalten. Die Idee fand sie immer noch völlig deppert, aber sie wollte es sich wenigstens ansehen. Ob man länger in der Millionenstadt bleiben würde, eventuell die Maasai Mara aufsuchte, wollte sie erst vor Ort entscheiden.
Lenard war, wie nicht anders zu erwarten, rundheraus aus dem Häuschen. Das waren die Momente, die sie liebte und benötigte. Ihr Sohn schaute zu ihr auf, lobte sie, liebte sie für ihr Verständnis und weil sie alles für ihn tat. Das würde ihn enger, auch in ferner Zukunft, an sie schmieden, weil das sonst keiner für ihn tat.
2
Kenia empfing sie mit strahlendem Sonnenschein. Während des Landesanflugs konnte man die Skyline der Metropole erkennen.
Len schaute zum Fenster hinaus. „Mama, das sieht toll aus. Guck mal, die vielen Hochhäuser. Echt cool.“
Der ältere Herr neben ihr, dessen krauses Haar schneeweiß war und ein riesiger Kontrast zu der kaffeebraunen Haut, schmunzelte: „Du warst noch nie in Kenia?“, erkundigte er sich im holprigen Deutsch.
„Nein“, antwortete sie anstelle ihres Sohnes, der begeistert hinausblickte. Sie fragte sich, woher ein Neger Deutsch konnte. Ob er einer dieser Asylanten war? Nur dafür war er eigentlich zu alt.
„Nairobi ist eine faszinierende Stadt. Auf der einen Seite verkörpert sie den Reichtum des neuen Ostafrika, auf der anderen Seite dessen ganze Armut. Hier die modernen Glasbauten und ein paar Kilometer entfernt, laufen die Löwen und Giraffen herum. Wenn Sie länger in der Stadt sind, sollten Sie das Ihrem Sohn zeigen. Er wird begeistert sein.“
„Wir bleiben nur einige Tage.“
„Ein Tipp: Gehen Sie am späten Abend nicht allein auf die Straße.“
„Danke.“
Der Jomo Kenyatta International Airport kam kurz ins Blickfeld, da der Pilot eine Schleife fliegen musste.
Lenard setzte sich ordentlich hin, schnallte sich an. „So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich finde es jetzt schon toll.“
„Das ist die Faszination von Afrika“, lächelte der Mann und sie dachte etwas verblüfft, der Neger hat ja weiße Zähne. Zahnbürste und Zahnpasta gibt es hier also.
„Wohnen Sie hier?“, erkundigte sich Lenard in Englisch.
„Ndiyo … eh ich meine ja, in Nairobi.“
„Ndiyo verstehe ich schon. Hapana heißt nein. Kennen Sie das Nairobi Hospital?“
Der Mann schaute etwas erstaunt. „Warum interessiert dich ein hospitali?“
Lenard warf seiner Mutter einen Blick zu, die ihn verärgert anguckte. „Nur so.“
„Es ist so ein hospitali wie bei euch. Ganz modern.“
„Asante“, bedankte sich Len und der Mann grinste breit.
Sie musste die Formalitäten erfüllen, danach holte sie das Gepäck.
In dem Flughafengebäude herrschte reger Verkehr. Touristen, die als solche durch das viele Gepäck und ihrer Kleidung erkennbar waren, schlenderten durch die Halle. Schwarze lungerten herum, taxierten die Ankommenden oder Abfliegende. Menschen mit unterschiedlich braunen Hautfarben, adrett in Anzug, Kostüm oder Kleid, mit und ohne Hut bekleidet, eilten schnell Richtung Gate oder dem Ausgang zu. Es herrschte er reges Stimmengewirr in vielen Sprachen. Sogar einige Brocken Deutsch vernahm sie im Vorbeigehen.
Sie wurden bereits von einem Fahrer des Norfolk Hotels erwartet.
„Jambo Miss Labert, Bwana mdogo“, begrüßte er sie, nahm ihnen die zwei Reisetaschen ab.
Sie folgten dem Mann durch eine breite Glastür. Angenehme Wärme schlug ihr entgegen. Morgens in München war es dagegen richtig kühl gewesen, zudem hatte es in Strömen geregnet.
Er dirigierte sie zu einem großen Jeep, auf dem das Emblem des Hotels prangte.
Sie hatte sich für dieses über hundert Jahre alte Hotel entschieden, weil sie viel Geschichtliches darüber gelesen hatte und es als sehr gut bewertet wurde.
Len und sie stiegen ein, da kam ein weiterer Schwarzer mit einer älteren Dame. Die beiden unterhielten sich angeregt in einer fremden Sprache. Sie begrüßte den anderen Mann freundlich, wechselte einige Worte mit ihm, nahm den eleganten Hut dabei ab, strich die langen Haare nach hinten, lachte, bedankte sich.
Warum unterhielt sich eine Weiße fast schon vertraut mit diesen Negern? Das waren doch nur einfache Arbeiter.
Sie nahm in der Reihe hinter ihnen Platz, grüßte dabei kurz.
Die Fahrt zeigte ihr gleich die Gegensätze der kenianischen Hauptstadt. Da fuhren Luxuslimousinen der neusten Baureihe neben Autos, die kaum als solche noch erkennbar waren. Sie schmunzelte. Der deutsche TÜV würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, die klapprigen Dinger alle aus dem Verkehr ziehen. Teilweise kuriose Gebilde waren durch anscheinend eigene Reparaturen entstanden. Am besten gefielen ihr eine Sorte Taxis. Die sahen wie alte Londoner Cabs aus, die sie von ihrem Wochenendtrip nach London kannte. Nobel, feudal und irgendwie erinnerten sie an die Kolonialzeit.
Lenards Nase klebte fast an der Scheibe, weil er alles sehen wollte und immer wieder kam „Mama, guck mal.“
Im Spiegel sah sie, wie der Fahrer breit grinste, dass man seine weißen Zähne in dem schwarzen Gesicht blitzen sah. Das war wahrscheinlich etwas, was er schon tausendmal gehört hatte.
„Mama, guck mal, dort sieht es aber scheußlich aus“, deutete er aus dem Fenster.
Wellblechhütten, Bretterbuden und manche sahen sogar wie aus Pappe aus, klebten aneinander, als wenn sie sich gegenseitig stützen müssten, damit sie nicht umkippten. Rauchfahnen stiegen gen Himmel, Frauen und Kinder sah man sitzen oder laufen, Hunde rannten hinter Kindern oder Hühner her. An einigen dieser merkwürdigen Wohngebilde hingen irgendwelche undefinierbare Stofffetzen.
„Solche Ansiedelungen sieht man häufig im Land“, sagte die Frau leise im stammelnden Deutsch. „In wenigen Minuten siehst du das Nairobi für die Touristen und Geschäftswelt, sauber, mondän, mit all den Dingen, die du von daheim kennst.“
Katrin fand, dass es vorwurfsvoll klang und sie drehte sich ein wenig um. „Sind Sie keine Touristin?“
„Nein! Ich bin gebürtige Kenyanerin und darauf bin ich sehr stolz“, antwortete sie nun in Englisch, entschuldigte sich, da sie nur einige Brocken Deutsch könne. Die Frau sah gut aus, besaß eine gewisse Ausstrahlung, dazu bemerkte Katrin, wie exquisit sie gekleidet war. Allein die Ohrringe mussten ein kleines Vermögen gekostet haben, wenn es wirklich Diamanten waren. Trotzdem sahen sie nicht zu auffällig aus, genauso wie die Ringe an den schlanken Fingern mit den hellroten Fingernägeln. Sehr geschmackvoll in ein beigefarbenes Leinenkostüm gekleidet, die Beine gekonnt seitlich gestellt, lächelte sie, die Musterung wohl bemerkend.
„Sie haben es gut, können immer hier wohnen“, stellte Lenard fest.
„Du stellst dir das vermutlich zu schön vor, mit all den Wildtieren. So ist es nicht. Ich wohne nördlich von Nairobi und sehe die Wildtiere höchstens zweimal jährlich. Vieles ist hier nicht so einfach wie bei dir in Deutschland. Du sprichst übrigens ausgezeichnet englisch, Bwana mdogo.“
„Asante sana sagt man hier, oder?“
Sie lachte. „Ndiyo! Das heißt ja.“
„Was heißt mdogo? Bwana heißt Herr.“
„Mdogo bedeutet klein, jung. Bwana mdogo sagen wir zu jungen Männern.“
Lenard strahlte nun förmlich. „Wenn Sie hier wohnen, wieso fahren Sie zu einem Hotel?“
„Len, bitte!“, maßregelte Katrin ihn.
„Lassen Sie. Junge Menschen haben etwas erfrischend Ehrliches an sich, lancieren nicht wie Erwachsene herum. Ich kenne das von meinen Enkeln. Ich treffe dort meinen Mann und später meinen jüngsten Sohn, der in Nairobi arbeitet. Ich sehe ihn sonst nur einmal im Monat. Erst morgen Vormittag fahren wir nach Hause. Viele Kenyaner handhaben das so. Sind sie in Nairobi, übernachten sie dort ein oder zwei Nächte. Da trifft man Freunde, die weiter entfernt wohnen, man kauft groß ein und genießt die andere Umgebung, das Flair unserer Hauptstadt, das teilweise andere Essen.“
„Ach so. Bei uns sagen sie Kurztrip dazu. Asante für die Erklärungen.“
„Gern geschehen, Bwana mdogo.“
Er schaute hinaus und auch Katrin blickte aus dem Fenster. Die Hüttenansammlung, die augenscheinliche Armut und der Schmutz hatten sie irgendwie schockiert. Ob das einer dieser berüchtigten Slums war?
Das Bild draußen veränderte sich. Es wurde grüner. Die Häuser, oftmals im Kolonialstil sahen allerdings nicht gepflegt und weniger feudal aus. Sie mussten einmal wahre Prunkstücke gewesen sein. Kleinere Läden in hässlich aussehenden Flachbauten erschienen. Ältere Frauen schlurften in langen Röcken mit einem bunten Turban auf dem Kopf und Männer in ausgeleierten Hosen oder komisch aussehenden Anzügen auf dem Bürgersteig entlang. Frauen, total in einen schwarzen Tschador gefüllt gingen rascher, wichen den Entgegenkommenden aus. Unförmige Negerinnen in bunten Wickeltüchern, die ein Baby auf dem Rücken trugen, spazierten gemächlich miteinander schwatzend einher.
Je näher sie dem Zielort kamen, umso mehr veränderte sich das Aussehen der Metropole.
Die Bauten sahen gepflegter aus, wirkten moderner. Überall davor blühten Büsche in Weiß, rosa oder lila. Ein farbenfrohes Bild, das durch die Palmen besonders exotisch wirkte. Junge Frauen in Miniröcken, Sommerkleidern oder Hotpants und hochhackige Sandalen, wiegten bei jedem Schritt gekonnt mit den Hüften. Männer in Jeans und Shirt blickten ihnen nach oder liefen telefonierend. Alle Hautfarben waren vorhanden, von fast Schwarz bis zu einem hellen Braun, das Katrin an Milchkaffee erinnerte.
Der Verkehr geriet ins Stocken. Das Bild der Stadt und damit das Aussehen der Menschen änderte sich peu á peu. Die Ladenfronten glichen denen in der Maximillianstrasse, lange und glänzende Glasfronten. Das Erscheinungsbild ähnelte dem in München, lediglich die Hautfarbe der Leute unterschied sich davon. Einige Weiße waren zu sehen, nicht anders bekleidet wie die schwarzen Männer und Frauen. Teils eilend, teils schlendernd bevölkerten sie das Straßenbild. Anzug und Krawatte, Kostüme und Sommerkleider waren zu sehen. Einige Frauen trugen dazu passende Hüte. Sehr elegant und das verblüffte sie, da sie das bei den schwarzen Einwohnern nie vermutet hätte. Sogar zwei Inderinnen, im leuchtenden Sari gewahrte sie. Es hatte irgendwie etwas Faszinierendes. Langsam rollte der Wagen vorwärts.
Drei Männer in strahlend weißen Kaftan standen an der Seite, plauderten. Seitlich parkten zwei schwarze Luxussportwagen. Eine Nobelkarosse hielt und zwei jüngere Damen stiegen aus. Der Wagen fuhr weiter. Die Frauen nickten kurz den Männern zu, schlenderten davon. Die Männer schauten ihnen nach. Sie sahen in schmalen Etuikleidern mit hochhackigen Pumps wirklich nett aus. Die eine Frau hob kurz die Hand, strich eine lange Haarsträhne aus dem Gesicht. Dabei sah man drei Ringe an ihrer Hand funkeln. Sie verschwanden in einem Modeladen. Ja, das war die passende Umgebung für sie, dachte Katrin.
Das Norfolk empfing sie so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Es sah elegant aus, verkörperte die Kolonialzeit, wie es versprochen wurde. Es war im altenglischen Tudorstil mit viel Fachwerk erbaut. Auf den ersten Blick störte sie das vorgebaute Entree. Sie hatte gegenwärtig keine Zeit, sich das alles genauer anzusehen, da der Mann direkt auf die Rezeption zusteuerte.
„Einen schönen Aufenthalt in Kenya“, sagte die ältere Dame und kurz darauf umarmte sie einen großen, schlanken, trotz seines Alters gut aussehenden Herrn, vermutlichen ihren Mann.
Lenard eilte zu dem Paar, sprach mit ihnen und der Mann antwortete schmunzelnd.
An der Rezeption schaute sie sich ein wenig um. Die hellen Fliesen glänzten, dass man sich darin spiegeln konnte. Ob das Mamor war? Die Möbel sahen urgemütlich aus. An der Wand sah man Fotos aus der alten Zeit. Die musste sie sich nachher genauer ansehen. Bevor sie dem Hotelboy nach oben folgte, bestellte sie eine Flasche kalten Orangensaft.
Das große Zimmer war wunderschön und Len rannte gleich zu der großen Fensterfront.
„Mama, wow, das sieht ja cool aus. Da ist ein Garten mit ganz vielen Bäumen und Sträuchern und so. Sieht wie ein Urwald aus. Gucken wir uns das an?“
Sie hörte der Erklärung des Mannes zu, der ihr Fernsehgerät und Klimaanlage zeigte, gab ihm 10 Kenyan Shilling, ignorierte dessen komischen Blick. Er lehnte ab und schloss lautlos die Tür von außen. Hatte der Nigger etwa gedacht, er würde mehr kriegen oder gab man hier generell kein Trinkgeld? Da es umgerechnet 10 Cent waren, die Schwarzen hier generell weniger verdienten, als in Deutschland, erschien ihr das daher angemessen.
„Alles zu seiner Zeit. Jetzt packe ich die Tasche aus, gehe mich waschen, trinke etwas und danach sehen wir weiter. Was hast du mit dem Ehepaar geredet?“
Er antwortete nicht, rannte ins Bad und abermals fand er das alles cool und sie schmunzelte: Schien ihm zu gefallen.
Da Lenard erst ein wenig von der Stadt sehen wollte, kaufte sie einen Stadtplan und suchten zuerst den Central Market auf, der in unmittelbarer Nähe des Hotels stand.
Lenard fand das hingegen weniger interessant, wie er enttäuscht feststellte.
„Was hast du denn erwartet?“, amüsierte sie sich.
„Na eben Afrika. Das sieht wie bei uns aus, außer dass die Leute dunklere Haut haben. Ist echt blöd.“
„Das ist eine Großstadt. Nur hier sieht es gewiss nicht wie bei uns aus, da es dort sauber und ordentlich hingelegt ist.“
„Guck mal, da das Obst, liegt genauso wie bei uns und es ist sehr sauber. Das sieht cool aus. Was ist das?“
Sie erklärte ihm die verschiedenen Sorten, soweit sie diese kannte. Bei unbekannten Arten flunkerte sie oder lenkte rasch ab, schlenderte weiter. An einem Stand bot man Tücher an: Kanga, wie es die ältere Frau nannte. Sie zeigte ihr geschickt, wie viele Möglichkeiten man hatte, die als Kleid, Rock oder sogar als Turban zu tragen. Katrin kaufte zwei, da sie die praktisch fand, aber besonders die kräftigen Farbtöne gefielen ihr. Sie zahlte und spazierte weiter. Len wollte unbedingt noch einen geschnitzten Elefanten aus Holz haben und danach wanderten sie zum Hotel zurück. Sie hatten Hunger und irgendwie war es zu viel Gewühl. Diese Neger schienen alle nicht zu arbeiten.
Sie saßen auf der mit Glas versehenen, bekannten, Lord Delamere Terrace und aßen Fisch. Es schmeckte ihnen vorzüglich, danach sahen sie sich die weite Gartenanlage an, die wirklich an einen Dschungel erinnerte. Eine faszinierende exotische Pflanzenvielfalt zeigte sich dem Besucher, dazu zog ein betörender Duft teilweise an ihnen vorbei. Benennen konnte sie die einzelnen Pflanzen nicht, aber sie fand Gefallen an ihnen. Allerdings müsste man da mehr Ordnung hineinbringen, das alles etwas korrekter beschneiden und nicht nur so verwildert wachsen lassen.
Langsam schlenderten sie nach oben, dabei schauten sie sich die vielen Fotografien und teilweise sehr alten Stiche an. Len staunte, wie es hier einmal ausgesehen hatte, auch über das alte Nairobi, dazu, welche Prominenten schon alle in dem Hotel übernachtet hatten.
„Siehst du Len, du kannst sagen, auch du warst schon in diesem Hotel“, nahm sie ihn in den Arm. Er befreite sich rasch. „Gehen wir schwimmen.“
Enttäuscht sah sie ihm nach, wie er in das Nebenzimmer eilte. Sie hatte gehofft, dass er sagt, dass sie die beste Mutter der Welt sei.
Seufzend zog sie die Badesachen an. Ein Sommerkleid über den Bikini – fertig. Sie wusste noch nicht, ob sie ebenfalls hineinspringen würde. Sie wollte erst sehen, welche Leute dort saßen.
„Dass die hier so Latschen und Bademäntel haben, ist cool.“
„Gehört zum Service, wenn man einige Sterne haben will. In Deutschland erwartet man da wesentlich mehr Komfort, aber das ist eben Afrika. Soweit sind sie hier noch lange nicht.“
„Oh Mama, du machst alles schlecht. Das nervt!“
„Das sind nur die vielen Mängel, die ich aufzähle. Ich bin eben nicht so verträumt wie du. Nur Kinder sehen das generell anders.“
„Ich bin kein Kind mehr, sondern bald 17.“
„Du bleibst noch sehr viele Jahre mein kleiner Junge“, strich sie ihm durch die Haare. Er ging schnell weg. „Gehen wir“, rief er ihr zu.
An dem beheizten Außenpool saßen drei Pärchen, unter anderem die Dame, mit der sie vom Flughafen hergefahren waren. Das beigefarbene Kostüm hatte sie gegen ein lindgrünes Sommerkleid getauscht. Die Pumps lagen neben dem Stuhl im Gras, auf dem Tisch in der gleichen Farbe eine Kuverttasche. Diese Frau hatte ein glückliches Händchen für ihre Garderobe. Sie nickte ihnen kurz zu, hörte ihrem Mann zu.
Lenard begrüßte das Paar und sie hörte den Mann etwas leise sagen, worauf Len lachend antwortete. Nun die Frau und von Len kam ein, „ndiyo!“
Katrin schüttelte verärgert den Kopf. Man konnte das Afrikanische auch übertreiben. Diese Leute schienen anhänglich zu sein.
Katrin setzte sich, erkundigte sich bei ihrem Sohn, was er trinken wollte, bevor er in das Wasser hüpfte. Ein etwas jüngerer Junge drehte dort seine Runden, ansonsten war er leer.
Sie bestellte für Len den Saft und für sich einen Cocktail. Sie zog die Pumps ebenfalls aus, genoss den dicken kühlen Rasenteppich unter ihren Fußsohlen. Etwas erstaunten sie die angenehm warmen Temperaturen. Sie hatte es sich wesentlich heißer vorgestellt. Ihre Gedanken schweiften zu dem morgigen Tag und sie fragte sich, was sie dort erwartete.
Sie hörte Lenard lachen und blickte zu den beiden Jungs, die von der Seite abwechselnd hinein hopsten. Anscheinend ging es darum, wer am weitesten sprang. Hoffentlich war das Wasser einigermaßen sauber.
Gelangweilt blickte sie sich um, hoffte, dass sich Len bald zu ihr setzte.
Sie schien für ihn nicht mehr existent zu sein, ärgerte sie sich eine Stunde später.
Nach einem reichhaltigen Abendessen in einem Art Steakhouse des Hotels gingen sie nach oben. Es waren heute viele neue Eindrücke auf sie eingeprasselt und Lenard schlief sofort ein, obwohl er ursprünglich noch Fernsehen schauen wollte. Sie zog einen Pulli über das Kleid, da es jetzt kühl draußen war, setzte sich auf den kleinen Balkon, lauschte den leisen Stimmen von unten, hörte Autos vorbeifahren und ihr unbekannte Tierlaute.
„Hapana! So geht das nicht weiter. Ich habe deinen Torheiten lange genug zugesehen, aber das jetzt eine Schwarze ein Kind von dir bekommt, das geht zu weit“, hörte sie unten eine ärgerliche Männerstimme.
„Dad, ich bin gewiss nicht der Erzeuger. Damned! Diese yaya ist wazimu“, antwortete eine Bassstimme. Sie erblickte nun die beiden Männer, die über den Rasen spazierten. Der ältere Herr schien der Mann diese Dame zu sein, folglich war der andere der Sohn. Sie wollte nicht lauschen, nur wenn sie sich jetzt erhob, würde man sie sehen. Irgendwie war ihr das unangenehm, aber sie war auch zu neugierig, was diese Leute für ein Problem hatten.
„Sie behauptet es zumindest. Deine Weibergeschichten seit Jahren reichen mir. Erfährt das deine Mum, wird sie die mke zu uns holen. Sie wird niemals dulden, dass ein Enkel von ihr, irgendwo in einer Hütte aufwächst. Die Kleine ist 19. Damned!“, polterte der ältere Mann weiter.
„Audrey spinnt. Es ist nicht mein Kind. Ndiyo! Wir hatten Sex, aber mit, außerdem ist die Affäre fünf Monate her. Wenn das Baby da ist, wirst du sehen, dass ein Schwarzer der Erzeuger ist, niemals ich“, ereiferte er sich. „Dad, ich bin es garantiert nicht.“
Aha dachte sie, doch nicht alles so toll, bei diesen angeblich feinen Leutchen.
„Such dir endlich eine bibi, damit das aufhört. Du bist 36 und kein Junge mehr, der sich austoben mag. Das hattest du jetzt lange genug.“
„Dad, ich möchte keine bibi, keine watoto und das wisst ihr. Nie! Es gibt viele willige Frauen und das macht wenigstens Spaß. Deswegen passe ich auch auf, dass ich nicht noch mal Baba werde. Jetzt möchte ich einen Whisky. Mum wird bereits warten. Kommt diese mke erneut bei euch an, wirf sie raus. Es gibt da nichts für sie oder eine andere zu holen. Blöde billige Weiber, die denken, sie könnten bei mir oder euch abkassieren.“
„Warum nimmst du sie dann mit?“
„Weil sie willig, teilweise gut beim Sex sind und es mir Spaß bereitet. Ich zwinge sie nicht dazu, verspreche nichts. Sie kommen auf ihre Kosten, ergo sollen sie danach verschwinden. So sage ich es ihnen vorher. Ein, zwei Nächte und kwa heri.“
„Du bist ein arroganter mzungu, mwana“, antwortete der ältere Mann, aber es schien ihn eher zu belustigen. „Gehen wir hinein.“
„Dad, ich lasse mir keine watoto unterjubeln und gewiss von keiner schwarzen muuguzi. Ich habe Alina und sie wird mein einziges Kind bleiben. Ich habe heute einen neuen Wagen bestellt. Auf zehn Millionen konnte ich herunterhandeln.“
„Guter Preis. Wann kommt er?“
„In drei bis vier Wochen“, wurde die Stimme leiser und Katrin atmete auf, dass man sie nicht entdeckt hatte.
Diese Familie musste reich sein, aber das erklärte den tollen Schmuck. Sie rechnete, das musste um die 90.000 Euro sein. Wow, diese Leute mussten reich sein. So ein Mann würde gut zu ihr passen. Mal morgen früh sehen, wie der Kerl aussah.
Sie wartete noch wenige Sekunden und schlüpfte rasch hinein, schaltet den Fernseher ein und kuschelte sich auf die Couch.
Was sollte sie morgen sagen? Ja, nein oder eventuell? Eventuell wollte man gewiss nicht hören, sondern man erwartete von einer zukünftigen Leiterin der chirurgischen Abteilung eine klare Ansage.
***
Das ältere Ehepaar saß bereits am Tisch. Sie nickte nur, während Len sofort hinlief, „Hujambo“, sagte. Beide antworteten fast gleichzeitig mit „Sijambo.“
Katrin nahm Platz, betrachtete verstohlen die Frau, die heute eine lange beige Leinenhose, mit einem grob gestrickten Pullover in der gleichen Farbe, trug. Darunter hatte sie etwas Weißes an, das wie ein Top aussah. Das Auffälligste waren jedoch die langen Ohrgehänge, die vermutlich aus Weißgold und wie ein Blatt geformt waren.
Lenard setzte sich und kurz darauf trat ein Mann zu dem Ehepaar und sie hörte, wie er sie mit Lady und ihn mit Sir ansprach, bevor er Platz nahm. Aufgeblasene Angeber, dabei hatte die einen missratenen Sohn, der anscheinend alle Weiber schwängerte. Der kam allerdings nicht und sie war enttäuscht.
Nach dem reichhaltigen Frühstück im Garten bei herrlich warmen Temperaturen fuhren sie mit dem Taxi zum Nairobi Hospital. Sie hatte ein mulmiges Gefühl dabei. Es war lange her, dass sie sich irgendwo beworben hatte und dazu kam, dass das Gespräch auch noch in englischer Sprache geführt werden musste.
Das Hospital galt als sehr gut mit hoch spezialisierten Ärzten, auch aus verschiedenen europäischen Staaten. Die Preise für ein Zimmer fand sie erschreckend hoch. Für ein Bett in einem Mehrbettzimmer verlangte sie über 6.000 Shilling, dazu mussten die Patienten 70.000 für die Behandlungen und so weiter hinterlegen. Ein Euro waren umgerechnet etwa 110 Kenyan Shilling. Das konnten sich keine Neger leisten, außer ein paar Politiker oder so.
Ein imposanter Bau erwartete sie.
„Mensch Mama, das sieht ja cool aus. Richtig modern und schöner wie das bei uns.“
„Ja, wirkt irgendwie ansehnlich, eher wie ein Bürokomplex, mit der Fensterfront. Du wartest hier und machst keine Dummheiten.“
„Guck mich ein bisschen um.“
„Len, keine Dämlichkeiten. Wir sind hier nicht in München.“
Der zog die Stirn kraus. „Du musst dich beeilen, sonst kommst du zu spät. Ich drück dir die Daumen.“
Sie betrat das Gebäude und fragte sich durch. Irritiert betrachtete sie die schwarzen Patienten, die hier hin und herliefen. Sie hatte vermutet, dass man nur Weiße behandelte. Nur Weiße sah sie keine. Auch das Personal schienen nur Schwarze zu sein, wie sie gewahrte. Das konnte doch nicht sein, oder?
Pünktlich klopfte sie an, wurde von einer schwarzen Frau in den mittleren Jahren in ein anderes Büro geführt. Eine Negerin als Tippse amüsierte sie sich.
Zwei Männer schauten sie an, wobei der Weiße sie genauer musterte.
„Miss Doktor Labert, kommen Sie herein“, erhob sich der schwarze, ältere Herr hinter seinem wuchtigen Schreibtisch. Er reichte ihr die Hand, stellte sich vor. Sie war davon völlig überrumpelt, da sie nicht mit einem Neger gerechnet hatte.
„Das ist Doktor Dermond. Mark, wir waren ja fertig. Die Aufstellung lasse mir bitte zukommen. Asante“, verabschiedete der ihn.
Der Mann, etwa in ihrem Alter nickte ihr zu und verließ den Raum.
Die nächste halbe Stunde wurde sie ausgefragt, vereinzelt stellte sie Fragen. Es war für sie mehr als anstrengend, da sie einiges nicht verstand, da der Mann nuschelte, wie sie fand.
Plötzlich stand der Mann auf. „Kommen Sie bitte mit. Ich zeige Ihnen Ihren zukünftigen Arbeitsplatz, falls wir uns für Sie entscheiden.“
Was sollte das denn heißen? Sie konnten doch froh sein, wenn man sie bekam.
Es hörte sich irgendwie stolz an, und dass er das wirklich war, bemerkte sie, als sie die OP-Räume betrat. Es sah nicht anders als in München aus, dem ungeachtet teilweise Neuer. Sie war verblüfft, da sie da so nicht erwartet hatte. Auch ein großes Büro, für die gesamte Ärzteschaft der chirurgischen Abteilung, sah modern eingerichtet aus. Nur alles wirkte schmutzig, nicht so sauber, wie sie es aus Deutschland kannte. Selbst die Schwestern wirkten schmuddelig, unsauber. Vermutlich kannten die Nigger keine Duschen.
„Sie sehen, Doktor Labert, es ist alles vorhanden. Ich werde Sie noch ein wenig durch das hospitali führen.“
Sie folgte dem Professor, schaute in Räume, sah Aufenthaltsräume und Behandlungszimmer. So schlimm, wie sie sich das vorgestellt hatte, war es nirgends, im Gegenteil, sie war angenehm überrascht und das sagte sie ihm auch, worauf er breit grinste. „Sehen Sie, viele Europäer sehen uns immer noch als Wilde im Bastrock oder mit Lendenschurz. Die Zeiten sind lange vorbei. Bei uns arbeiteten Ärzte aus Amerika, Europa. Die meisten hohen Positionen können inzwischen von Kenyanern besetzt werden. Wir sind auf dem neuesten Stand der medizinischen Geräte und dem Wissen. Leider haben wir noch nicht genug eigene Ärzte, aber das wird sich in wenigen Jahren ändern.“
Blödsinn, die Neger werden uns immer benötigen, deswegen ja weiße Ärzte.
Er führte sie einen Korridor entlang, wo er ihr wenig später in einer Art Cafeteria Platz anbot, zwei Tassen Kaffee bestellte, als sein Handy klingelte. Er entschuldigte sich, ging etwas beiseite.
Sie schaute sich neugierig um. Da waren nur Schwarze anwesend und das irritierte sie. Der gut aussehende Mann von vorhin, betrat den Raum, sah sie und steuerte auf den Tisch zu.
„Wie gefällt Ihnen unser hospitali, Doktor Labert?“, lächelte er. Seine braunen Augen musterten sie aufmerksam. Er war ein Adonis von einem Mann. Katrin, du bist dusselig, meckerte sie innerlich.
„Sehr gut! Danke“, antworte sie, da er auf Antwort wartete, wie sie ihm ansah.
„Sie werden eventuell also eine neue Kollegin, falls sich das Konsortium für Sie entscheidet?“
„Ich habe mich noch nicht entschieden, Doktor Dermond.“
„Wie Sie meinen. Zuerst entscheidet es die hiesige Klinik, besonders Ihre eventuellen Vorgesetzten“, zuckte er nur mit der Schulter, aber sie glaubte, in seinem Blick Bedauern zu erkennen. „Dachte ich mir.“
„Wieso?“, fragte sie verblüfft.
„So wie Sie sich vorstellen. Kein Mensch, der wirkliches Interesse hat, kommt so zu einem Vorstellungsgespräch. Jeans, Pulli, Latschen. Jedenfalls nicht bei uns.“
Sie lächelte. „Ich verbinde das mit einem Urlaub. Es gibt meinerseits einige andere Faktoren, die wichtig für mich sind, falls ich ins Ausland gehen sollte.“
„Die wären?“, erkundigte er sich eher gelangweilt, nickte lächelnd einer Frau zu, die den Raum betrat.
„Wohnung, Schule, Infrastruktur, Kosten, sind einige davon.“
„Schule?“
„Ja, da ich einen Sohn habe.“
„Spricht er Englisch?“
„Nicht so perfekt wie ich.“
Der Adonis zog die Augenbrauen hoch, schüttelte den Kopf, erhob sich, murmelte etwas, wie mbuzi oder so und ging.
„Es gibt eine deutsche Schule. Meine Sekretärin kann Ihnen die Adresse geben“, mischte sich der Professor ein und setzte sich. Sie blickte dem Adonis nach, der diese Schwarze gerade auf die Wange küsste, sich zu ihr setzte, etwas zu ihr sagte, worauf sie in ihre Richtung guckte.
„Wir wären Ihnen selbstverständlich bei der Suche eines Hauses oder einer Wohnung behilflich. Sie müssten angeben, was Sie in etwa wünschen. Einige Ärzte haben Häuser in der Nähe, in einem ruhigen Viertel der Stadt. Dort ist eine Security-Agentur zuständig oder in Runda. Das ist ein Viertel, dass durch eine Sperre betreten werden kann. Solche Sicherheitsvorkehrungen müssen sein. Hier gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten in großen Centern, wo man fast alles bekommt. Eines dürfen Sie hingegen nicht, in der Öffentlichkeit rauchen. Das ist verboten und wird mit einer hohen Geldstrafe geahndet. Nairobi ist eine sehr moderne Stadt, in der viele Ausländer leben und arbeiten. Wir haben jedoch zu viel Verkehr, allerdings ein gut ausgebautes Straßennetz. Die Trinkwasser und Stromversorgung ist, bis auf gewisse Gegenden, überall vorhanden. Trotzdem kann es passieren, dass gelegentlich das Stromnetz kurzfristig zusammenbricht. Nie für lange Zeit. Trotz vieler Sicherheitsmaßnahmen gibt es gewisse Gebiete, wo man als Lady nicht unbedingt allein hingehen sollte, besonders nicht nach Einbruch der Dämmerung. Es gibt sehr viele arme Menschen bei uns, das darf man nie vergessen. Wo viel Armut ist, herrscht auch Kriminalität.“ Er trank den Kaffee aus und erhob sich.
„Gehen wir zurück. Es ist schade, dass Ihr unmittelbarer Vorgesetzte, der Chief der chirurgischen Abteilung, dessen Stellvertreter heute nicht anwesend sein können. Ich werde mit den Herren sprechen und wir werden beratschlagen. In den nächsten Tagen werden wir Sie darüber informieren. Lassen Sie uns bitte schnellstens die Zeugnisse, detaillierte Aufstellungen Ihrer Arbeiten, besonders der Transplantationen, von Ihrem derzeitigen Arbeitgeber zukommen.“
Vor seinem Büro verabschiedete er sich, bat um Antwort in den nächsten Tagen. Sie war darüber erstaunt, da sie gedacht hatte, er würde sie drängen, dass sie ja sagte. Zudem forderte er ein Zeugnis. Sie wollten beratschlagen? Sie sollten doch froh sein, dass man sie, eine gut ausgebildete Deutsche bekam. Eine Unverschämtheit, ärgerte sie sich.
„Und?“, empfing sie Len. „Das hat ja ewig gedauert.“
„Ich habe mir einige Tage Bedenkzeit genehmigt, da es so einige Mängel gibt. Als Leiterin der Chirurgie muss man knallhart vorgehen. So ist alles in Ordnung, trotzdem …“
„Mama, warum sagst du dann nicht ja?“
„Weil ich nachdenken muss. Das Schulproblem besteht noch, daneben wo wir wohnen werden. Len, ich will nicht so eine schwerwiegende Entscheidung innerhalb weniger Minuten treffen. Wir fahren zurück zum Hotel, dann rufe ich die Schule an und vereinbare einen Termin. Danach sehen wir weiter.“
„Mama, es sind Ferien.“
„Eventuell ist trotzdem jemand da. Lenard, drängle nicht“, maßregelte sie ihn unwirsch, immer noch empört über diese Forderung des Zeugnisses und über diesen Kerl, der sich anmaßte, sie wegen ihrer Kleidung zurechtzuweisen.
In der Michael Grzimek School erreichte sie wirklich niemand.
„Siehst´e, habe ich dir gesagt“, triumphierte er. „Nu?“
„Nun gehen wir etwas Essen und ich überlege. Zieh nicht so ein Gesicht. Verstehe doch. Ich kann nicht holterdiepolter in München alles aufgeben. Hier ist vieles anderes, wie du es kennst. Es gibt mehr Kriminalität als bei uns. Es sind völlig andere Menschen, mit denen wir es zu tun kriegen. Sie haben eine andere Mentalität, andere Lebensgewohnheiten, dazu kommen bei ihnen das beschränkte Wissen, diese Unsauberkeit und zig weitere Mängel. Man muss viele Abstriche machen. Das ist nicht ständig Tiere ansehen, Safaris, sondern wenn man hier lebt, kehrt der Alltag ein. Woher willst du wissen, ob dir die Schule gefällt oder ob sie überhaupt Platz haben? Hier herrscht nicht gerade Frieden, seit Kenia für die AU in Somalia eingesetzt ist. Vor einigen Jahren gab es nach den Wahlen eine Art Bürgerkrieg. Trinkwasser ist knapp, die Stromversorgung funktioniert auch nicht ständig. Bei der Ernährung müssten wir uns umstellen. Wir müssten eine Wohnung oder besser ein Häuschen finden, das nicht zu weit von der Schule entfernt liegt und trotzdem in einer sicheren Gegend ist. Wir müssten uns völlig neu einrichten. Ich habe keine Ahnung, wie teuer hier eine Wohnung oder ein Haus ist, ob man das mieten oder kaufen kann. Ich weiß nicht, was Möbel kosten, was man für Versicherungen benötigt und was es sonst alles zu beachten gibt. Ich müsste ein Auto kaufen. Auch da weiß ich nicht, wie teuer die hier sind, ob mein Führerschein anerkannt wird, wie es mit einer Versicherung aussieht. Das sind eine Menge Punkte, die es zu bedenken gibt. Ich werde den Teufel tun, das innerhalb von fünf Minuten übers Knie zu brechen.“
„Du hast ja recht, nur das können wir zu Hause übers Internet herausfinden. Du machst alles ständig kompliziert. Du redest alles schlecht, derweil stimmt das nicht. Es gibt kenianische Ärzte, Professoren und hier sieht es sauberer aus, als auf dem Viktualienmarkt.“
„Das kannst du nicht beurteilen, nur weil es da ein Mann geschafft hat, zu studieren. Falls sie überhaupt studiert haben und sich nicht einfach so als Doktor bezeichnen. Nein, du machst es dir zu einfach. In München weg, hier her und dann wird es schon irgendwie werden. So geht das nicht. Nun Schluss mit dem Thema.“
Bei einem Streifzug durch die Stadt fand sie die vielen Bauten im Kolonialstil interessant. Leider sahen einige davon heruntergekommen aus, andere wurden gerade instand gesetzt.
Sie spazierten die Kenyatta Avenue, eine schöne Straße mit Bäumen und vielen blühenden Büschen entlang, bestaunten das I.C.E.A.-Building. Da man mit einem gläsernen Fahrstuhl hinauffahren konnte, genossen sie einen tollen Ausblick auf Nairobi. Es folgten weitere Hochhäuser: Anniversary Towers, Nyayo House, Teleposta Towers und das Lonrho House, welches besonders Len gut gefiel. Das NSSF Building mit über 100 Metern Höhe sah hingegen weniger schön aus. Im Central Park schauten sie sich das Nyayo Monument an.
„Das hat man 1988 zu Ehren des Präsidenten Moi errichtet, der zu diesem Zeitpunkt seit zehn Jahren Präsident war. Ein eher mieser Despot, passt da wohl besser“, flüsterte sie. „Er soll dem Staat Kenia angeblich Milliarden gestohlen haben.“
Hinter dem Denkmal war ein Hügel, von dessen Buckel sie einen beeindruckenden Blick auf die Skyline der Stadt hatten. Eine Weile spazierten sie durch den Uhuru Park. Da gab es sogar einen See, den man mit Booten befahren konnte. Aber darauf verzichteten sie, weil sie nicht mit so einem maroden Kahn absaufen wollte.
Lenard schüttelt nur den Kopf über ihre Bemerkungen.
Nun folgten sie dem Uhuru Highway, wo weitere hohe Bauwerke standen. Der Delta Corner Tower und der er KANU Tower, las sie auf dem Stadtplan.
„Was ist KANU?“
„Ein Parteigebäude. Der jetzige Präsident Kibaki ist von der KANU. Ich habe gelesen, dass man da früher in ein Restaurant hochfahren konnte. Haben sie wohl zugemacht. Hat sich nicht gelohnt, da dieses Zeug, was die Neger da kochen, kein ordentlicher Europäer isst.“
Sie näherten sich dem Kenyatta International Conference Centre.
„Das wurde bereits 1974 gebaut, da lebte der erste Präsident Kenias noch. Es ist 105 Meter hoch und ist das einzige größere Konferenzgebäude Kenias, steht hier. Es soll innen wunderschön eingerichtet sein und viele Kunstschätze ausgestellt haben.“
„Schade, Führung war am Vormittag.“
„Sieht langweilig aus“, stellte sie fest. „Das ist die Jomo-Kenyatta-Statue. Dort, wo die Männer stehen, liegt Präsident Jomo Kenyatta in einem Mausoleum begraben. Das ist seine Ehrengarde.“
„Sie haben doch jetzt wieder einen Minister, der so heißt, oder?“
„Uhuru Kenyatta, sein Sohn, glaube ich. Er ist Finanzminister. Wie sie neulich geschrieben haben, ein angeblich Guter. Ob er rechnen kann, bezweifele ich. Nur ganz wenige Nigger können etwas schreiben oder rechnen. Allerdings ist da diese Sache vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, weil er irgendwelche Leute gegen den heutigen Premierminister aufgehetzt haben soll. Dadurch kam es zum Bürgerkrieg. Diese Neger sind alle gleich - Verbrecher.“
Sie sahen das Sheria House, die City Hall, die Law Courts.
Auf der Harambee Avenue spazierten sie zurück, passierten den Times Tower, mit 140 Metern, das höchste Gebäude der Stadt und der I+M Bank Tower.
„Da hinten siehst du das Lonrho House. Der Wolkenkratzer, der so spiegelt. Jetzt müssen wir nach rechts.“
In der Moi Avenue schauten sie sich die Tom Mboya Statue an.
„War er auch Präsident?“
„Nein. Kenia hatte nur drei. Jomo Kenyatta, Daniel arap Moi und jetzt Mwai Kibaki. Tom Mboya wurde Ende der sechziger Jahre ermordet. Er war beliebt bei dem Volk, weil er modern eingestellt war. Es heißt, dass es entweder Kenyatta oder der Vater des heutigen Premiers Odinga in Auftrag gegeben habe, eben weil er so angesehen war.“
Das letzte Gebäude, bevor sie zum Hotel gingen, war das Nation Centre, das sie sich anguckten.
„Ich habe gelesen, dass die Beine an ein Zebra erinnern sollen.“
„Stimmt ein bisschen. Das Haus habe ich schon vorhin gesehen. Wo ist nun dieses UNEP-Haus?“
Sie blätterte in dem Stadtplan.
„In der Limuru Road. Keine Ahnung, wo die ist. Das ist auch kein Hochhaus, sondern eher flach.“
Zurück im Hotel gingen sie essen und anschließend wollte Len schwimmen. Sie selbst fragte an der Rezeption nach, ob man von hier aus irgendwie in die Maasai Mara käme und ob man dort noch Unterkunft in einer Lodge buchen könnte. Sie musste eine Weile warten, dann bekam sie Bescheid, dass man sie am nächsten Tag, am späten Vormittag, abholen würde.
Lenard jubelte natürlich, als sie ihn damit überraschte. Eine Woche Maasai Mara, das war die Erfüllung eines Traumes für ihn, und wenn sie ehrlich war, auch für sie. So hatte sie Zeit, das alles genauer zu überdenken. Sie umarmte ihn, hielt ihn fest an sich gepresst, ihren kleinen Buben. Seine Mutter tat eben alles für ihn.
***
Auf der langen Fahrt, es waren rund 250 Kilometer, hatte sie anhand der Karte ausgerechnet, sah sie viele Seiten von dem Land.
Die Hausfassaden waren wunderschön, obwohl teilweise abgebröckelt. Sie ließen erahnen, wie kunstvoll sie einst gewesen waren. Nun hatten sie die Sonne, die Hitze, der Regen und das Alter abgewaschen, die Farben verblassen, Mörtel und Putz bröckeln lassen. Es kam ihr zuweilen so vor, als wenn sie die Farben Afrikas widerspiegelten. Hellgelb, orange, rötlich, dazu die Blautöne des Himmels.
Je weiter sie aus der Stadt herausfuhren, umso ärmlicher wurde es.
Tristesse in den Dörfern. Wenige Meter entfernt, Luxus bei der Oberschicht, dachte sie.
Sie fuhren an Ansiedlungen vorbei. Diese standen eng gedrängt nebeneinander. Alle Lehmrundungen zierten die obligatorischen Palmendächer. Ausgemergelte Frauen in verschlissenen, zu faden Pastelltönen verblichenen Kleidern saßen vor den Hütten. Feuer brannten und darüber hingen große Töpfe. Bei den nackten Kindern konnte man die Rippen erkennen. Große runde schwarze Kulleraugen in spitzen Gesichtern schauten zu dem Auto. Knochige Zebus glotzen blöd. Die sahen nicht so aus, als wenn sie noch einen Tropfen Milch geben würden. Am liebsten hätte sie anhalten lassen, damit sie den Kindern etwas Geld geben konnte, aber sie unterließ es, wollte die Menschen nicht beleidigen oder beschämen.
Männer, nur in Hosen, barfuß, schoben einen Pflug, der von einem Ochsen gezogen wurde. Frauen, mit Tüchern bekleidet, hockten auf den Feldern und warfen etwas in die Körbe, die sie auf dem Rücken trugen. Gerade wenn man aus der feineren Gegend von Nairobi kam, war das ein immenser Kulturschock, den auch Katrin erlebte. Es sah alles so ärmlich aus, im Gegensatz zu dem mondänen Umfeld des Hotels.
Eine Weile darauf folgten Mais- und Weizenfelder, soweit das Auge reichte. Sie fragte sich, wie konnte es da Hunger im Land geben?
„So viel Mais“, staunte Len.
„Der gehört eurer Regierung“, teilte ihnen der Fahrer mit. Er hatte sich als Robert irgendwie vorgestellt, aber den Namen hatte sie bereits vergessen, da der generell unwichtig war.
„Aber wieso?“
„Eure Regierung hat uns das Land vor einigen Jahren als Bezahlung für die geleistete Entwicklungshilfe entwendet, da der Boden hier sehr fruchtbar ist. Alle Bauern mussten weg, die Dörfer wurden abgerissen, der Wasserzugang wurde Mensch und Tier verwehrt. Nennt sich Hilfsprogramm.“
„Ist doch sinnvoll“, wusste Katrin, der irgendwie der anklagende Tonfall des Fahrers missfiel. „So kriegen eure Leute wenigstens etwas zu essen.“
„Miss, das geht alles nach Deutschland. Ist für Biobenzin. Tausende Leute müssen deswegen hungern, hatten kein Dach mehr über den Kopf, keine Heimat mehr. Sinnvoll? Ja, für euch. Besitzen Sie Eigentum? Was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen das stehlen würden?“
Rasch schaute sie aus dem Fenster. Was konnte sie dafür? Wahrscheinlich hatte Deutschland viel Geld dafür gezahlt. Ständig musste man den Schwarzen Geld geben.
„Siehst´e, was ich immer gesagt habe“, triumphierte hingegen Lenard.
Katrin ersparte sich eine heftige Antwort, wollte keinen Streit.
Sie passierten weitere Dörfer und der Fahrer erklärte, da würden Maasai wohnen. Viel zu sehen bekam man von den Bewohnern hingegen nicht. Außerhalb der Umzäunung dieser Hütten sah man Jugendliche, die auf die Herden Kühe oder Zebus aufpassten. Die Jungs waren mit roten Tüchern bekleidet, trugen viel Perlenschmuck, was weibisch wirkte. Sie guckten kurz, wenn der Wagen vorbeifuhr. Die Touristen waren sie anscheinend gewohnt.
Hier schien es ein wenig kühler zu sein, bemerkte sie, als sie nach Stunden ausstiegen. Ein Schwarzer kam ihnen sofort entgegen, hieß sie willkommen, nahm ihr die Taschen ab und führte sie in die Lodge.
Rasch erledigte sie die Formalitäten. In ihrer Unterkunft, einem großen weißen Zelt, schauten sie sich erstaunt um. Selbst Lenard war erstaunlich still, als er das sah. Fast direkt vor dem Quartier sah man, entfernter und tiefer gelegen, Löwen, die unter einer Akazie dösten. Nur einige Jungtiere tobten herum. Fast direkt vor ihnen fraßen unzählige kleine Gazellen.
Das Zelt selbst war einfach umwerfend, wie sie fand. Auf dem hellen Holzfußboden lagen weiß-gelb-orange gewebte Brücken. Die Möbel rustikal, die Polster in einem hellen Beige. Sogar ein Schreibtisch war vorhanden. Die Planen der Zeltwände waren augenblicklich alle geöffnet und die Sonne schien hinein. Eine große Badewanne stand in dem Zimmer und beim Baden konnte man auf einen Fluss schauen, der sich durch die Landschaft schlängelte. Es gab dazu ein richtiges Bad mit Dusche und zwei Waschbecken. Vor dem Zelt war eine Art Terrasse und dort stand Lenard und schaute auf die Tiere. Sie bedankte sich, reichte ihm 10 Kenyan Shilling, die der Kerl grinsend ablehnte. Eben nicht! Sie ging zu ihrem Sohn, stellte sich neben ihn und schaute auf diese Bilderbuchlandschaft. Ja, so hatte sie es sich immer vorgestellt. Eine Herde Elefanten, sie zählte 17 Tiere, wanderte gemächlich Richtung Wasser. Zwei Strauße stolzierten an ihnen vorbei, wobei einer sein Federkleid spreizte, als wollte er sagen, guckt mal, ich bin groß und schön. Der andere Vogel hingegen begann zu tänzeln, um seinen Kumpel die Show zu stehlen, wie es den Anschein hatte. Angeber dachte Katrin belustigt.
Nur die vielen Autos störten das Bild ein wenig.
„Mama, ist das schön“, flüsterte Len ergriffen.
Sie legte den Arm um ihn, schob sich nah an ihn. „Ja, wunderschön, faszinierend. So habe ich es mir immer vorgestellt.“
Von Juli bis Oktober fand die große Wanderung der Gnus aus der Serengeti und zurück statt. Noch waren sie nicht eingetroffen, wie man ihnen mitteilte, aber schon jetzt war die Savanne mit unzähligen Tieren bevölkert.
Den restlichen Tag verbrachten sie auf der Terrasse, zu schön war es, die Tiere live und in Farbe zu sehen, wie es Lenard nannte. Es war eine wahre Bilderbuchlandschaft, die sich im saftigen Grün repräsentierte. Der Wind strich raschelnd über das hohe Gras, säuselte in den Blättern der Büsche. Elefanten, Löwen, Kaffernbüffel, Zebras, Giraffen und verschieden Antilopenarten spazierten vorbei, als wenn sie sich den Touristen präsentieren wollten. Am Himmel kreisten Vögel, andere staksten auf der Ebene herum.
Katrin und Lenard schauten abwechselnd durch das Fernglas, das sie noch im letzten Moment eingepackt hatte.
Auch das Essen genossen sie dort, selbst schwimmen wollte Lenard nicht. Sie bemerkte die bunten Geckos, die außerhalb des Zeltes an den Stangen zu kleben schienen. Sie sahen hübsch aus, hatten gelblich bis bräunliche Färbungen. An Menschen waren sie gewähnt, ließen sich nicht stören, nur als Len einen anfassen wollte, verschwand der rasch nach oben.
Immer wieder entdeckte er andere Tierarten, fragte, wie sie hießen. Sie wusste es teilweise nicht, nannte daher irgendwelche Tiere, von denen sie gehört hatte. In den Schirmakazien sah man durch das Fernglas Affen toben, während kurz unter oder neben ihnen Giraffen gemächlich Blätter abzupften und fraßen. Drei Etagen tiefen machten es ihnen Impalas nach.
„Mama, das ist wie in einem Haus. Jede Etage wird benutzt.“
„So kann man es nennen. Das hat die Natur gut eingerichtet, da so alle etwas abkriegen. Völlig ohne Fahrstuhl“, fügte sie lachend hinzu.
„Die Viecher sind eben intelligenter als die Menschen. Guck mal, jetzt gehen welche saufen.“
Giraffen mit gespreizten Beinen beugten sich unbeholfen vor, um an das lebensnotwendige Wasser zu gelangen.
„Das ist der Nachteil, wenn man so groß ist“, lachte ihr Bub und sie guckte ihm stolz zu.
Kurz bevor es schlagartig dunkel wurde, färbte sich der Himmel kurzfristig in Purpur, ein dunkelviolett, bevor er dunkelblau anschließend schwarz über ihnen thronte.
Mit dem Einbruch der Nacht hörte man unzählige Geräusche. Hyänen glucksten blöd vor sich hin. Ein lautes Brüllen von einem Löwen erschallte. Zebras hingegen bellten dumpf. Ein Flusspferd schnaubte und irgendwelche Tiere, sie vermutete Affen, kreischten laut. Dazwischen mischten sich andere Töne, vermutlich von Vögeln, dem leisen Säuseln der Blätter in dem Gebüsch, das nah bei der Terrasse stand. Sie hoffte nur, keines dieser Viecher verirrte sich zu ihnen.