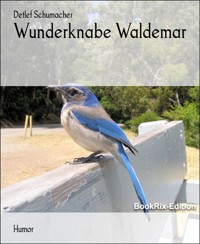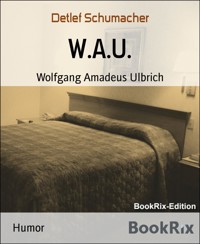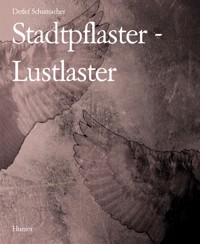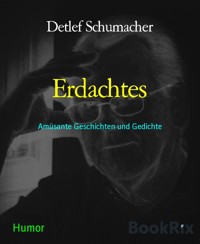0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tabea betrachtet ihre zurückliegenden Lebensjahre, die so jung sind wie sie selbst. Verwegen muten die Abenteuer an, die sie mit ihrer Freundin Isabell erlebt. Ernst zu nehmen sind sie nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tabea Turtel
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenBerufswunsch: Ehefrau
Ich befinde mich derzeit zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr. Ein kompliziertes Alter, meinte mein Alter, also mein Papa. Als er so alt war, hätte er schon mitten im Berufsleben gestanden und ein Ziel vor Augen gehabt. Ich müsste nun endlich auch ein Ziel vor Augen haben. Welches er mir empfehle, fragte ich. Die Frage war ihm zu direkt, weshalb er keine Antwort wusste. Die nahm ihm Mama ab und dirigierte meinen Berufswunsch in Richtung Friseuse. Friseuse sei ein typisch fraulicher Beruf. Schon seit Jahrhunderten würden vor allem Frauen diese Tätigkeit ausüben.
„Deshalb sahen die Menschen in der Vergangenheit auch so struppig aus“, meinte Papa gehässig. Ihm war als Antwort eingefallen, mir Altenpflegerin zu empfehlen. Das sei der Idealjob, da es künftig mehr ältere als jüngere Menschen geben werde. Schon jetzt zeichne sich ab, dass es bald überhaupt keine jungen Menschen mehr gebe, sondern nur noch alte. Und denen müsse die ganze Fürsorge gelten. Ich erkannte, dass Papa vor allem an seine Fürsorge dachte. Auch Mama erkannte das und wies ihn darauf hin, dass eine Friseuse wichtiger sei. Ihr waren ihre Haare wichtig. Papa hatte nur noch wenige.
Nun gerieten sich Beide wegen meiner Azubi-Besoldung und ähnlicher Dinge in die Haare. Mit dem Ergebnis, dass sie mir die Entscheidung überließen, was ich werden wolle. Ich erklärte, dass ich nichts werden wolle, sondern einen reichen Mann heiraten werde. Nicht gleich, aber bald. Im Fernsehen hätte ich einen Film gesehen, der zeigte, wie eine attraktive junge Frau von einem attraktiven reichen Mann zur Ehefrau gemacht wurde.
Mama und Papa guckten mich an, als wäre ich nicht ganz normal. So blicken sie immer, wenn ich sie an meinem Verstand zweifeln.
Mamas Sinne waren derart verwirrt, dass sie fragte, welchen Filmschauspieler ich heiraten wolle. Papa hatte seinen Geisteszustand mehr in der Gewalt und wies mich darauf hin, dass ich zum Heiraten noch zu jung sei. Doch fügte er mit einem wohlwollenden Lächeln hinzu, dass ihm ein wohlhabender Schwiegersohn recht sei. Möglichst mit einem Landbesitz auf Mallorca und einer vor Anker liegenden Luxusjacht.
Ich brachte Beide ins gedankliche Gleichgewicht und sagte, dass mich ein reicher Mann erst begehren müsste. Von meiner ehemaligen Mitschülerin Gudrun Geier wisse ich, dass in unserem Kuhkaff kein wohlhabender Jüngling zu finden sei. Wer sei in Druff, unserem weltabgeschiedenen Dorf, schon reich, außer an Schulden, wie Ingo, der Sohn des Immobilienmaklers Herzog.
Mama gab zu verstehen, dass es in unserem Dorf auch an attraktiven Jungfrauen fehle. Dabei sah sie mich an, als sei sie mir an Schönheit überlegen. Papa machte ihre Bemerkung mit der Aussage zunichte, dass meine Reize völlig ausreichten, um einen Reichen zum Schwiegersohn zu machen. Der müsste nicht unbedingt schön sein. Wichtig sei, dass er zur Mehrung des Familienbesitzes beitrage. Dann versuchte Papa, Mamas Einstellung günstig zu beeinflussen, indem er einen mehrmonatigen Dauerurlaub pro Jahr auf Mallorca in Betracht zog. Sie könne Tag und Nacht am Strand liegen und ihren formvollendeten Körper der Bräunung hingeben. Er zählte weitere Vorzüge des Luxuslebens auf Mallorca auf, immer das Wohlsein Mamas hervorhebend. Um sie restlos zu betören, sagte er, dass sie nicht nur im Mittelmeer, sondern auch im Geld schwimmen werde. Allerdings unterlief ihm nun ein schwerwiegender Fehler, als er meinte, dass der künftige Schwiegersohn auch ein alter Knacker sein könne. Je älter, desto wohlhabender.
Ihr Schwiegersohn dürfe kein Knacker sein, den habe sie hier zu Hause, begehrte Mama auf. Nun erging sie sich in wohltönenden Vorstellungen über Aussehen, Verhalten, Charakterstärken, Willenskräfte und Mannessäfte ihres angedachten Schwiegersohns. Dabei wurde deutlich, dass er vor allem an ihr, seiner Schwiegermutter, Gefallen finden sollte. Nach einigen Ehejahren würde sein Interesse an seiner Ehefrau ohnehin verblassen. Das sei typisch.
Papa wollte kontern, unterließ es aber, weil er den Traum vom Super-Schwiegersohn nicht zunichtemachen wollte. Um Mama im Glückstaumel zu belassen, versprach er, ihr einen Liegestuhl zu schenken. Auf dem könne sie sich für die Mallorca-Aufenthalte schon einliegen. Nun schwelgten Beide in höchsten Tönen, und das erweckte den Eindruck, als wären sie auf dieser Insel schon ansässig. Weil ich wortlos diesem Gedankenaustausch folgte, fragten sie mich plötzlich, ob ich nicht auch eine Meinung habe.
Den Schwanz einziehen
Weil meine Eltern endlich im Reichtum schwelgen und sich auf Mallorca sonnen wollten, drängten sie mich, schnellstens einen Freund zu finden, der diese Wünsche erfüllen könnte. Ich wehrte mich und erinnerte Papa an seine Worte, dass ich zur Eheschließung zu jung sei.
„Papperlapapp“, meinte er, „ich habe auch jung geheiratet. Je eher man heiratet, desto länger dauert das Glück zu zweit.“
Dabei sah er Mama an, als hätte er sich eben in sie verknallt. Mama guckte verknallt zurück. Das war natürlich ein plumper Trick, mich gefügig zu machen. Verliebt waren sie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das erlebte ich fast täglich. Ich wollte nicht eine so glücklose Ehe führen. Meine sollte vom ersten bis zum letzten Tage von Harmonie erfüllt sein. Familiärer Wohlstand als Grundvoraussetzung. Meine Hochzeit sollte nicht auf der verrufenen Insel Mallorca stattfinden, sondern auf Hawaii. Sollte sich anschließend reicher Kindersegen einstellen, wäre mir das egal. Hauptsache, mein Aussehen bliebe stabil und die Kinder gesund. Um deren vernünftige Erziehung müssten sich Au-pair-Mädchen kümmern. Von der negativen Beeinflussung durch die Großeltern würde ich sie fernhalten.
Weil sie Papa nicht länger scheinverliebt angucken wollte, fragte mich Mama, ob ich schon einen festen Freund griffbereit hätte. Sie wisse, dass ich hin und wieder mit irgendeinem Dorftrampel befreundet war, aber verliebt mit allem Drum und Dran sicherlich nicht.
Ich wollte wissen, was sie mit 'allem Drum und Dran' meine. Sie verdrehte die Augen, als müsste sie überlegen, ob sie mich hinreichend aufgeklärt hätte. Papa verdrehte die Augen nicht, sondern beobachtete eine Fliege, die sich die Flügel putzte. Er wollte sich aus diesem Aufklärungsbereich heraushalten. Dennoch war er ganz Ohr, wie meine Aussagen lauten würden.
Ich tat weiterhin naiv, was Mama veranlasste, ihn zu beauftragen, das Drum und Dran zu erklären. Er erschrak so heftig, dass auch die Fliege erschrak. Weil er sich um eine diesbezügliche Erklärung drücken wollte, druckste er, als würden ihn Leibschmerzen quälen. Mama meinte unbeeindruckt, er solle nicht feige den Schwanz einziehen. Weil ich ihm aus der Patsche helfen wollte, denn ihm traten Schweißperlen auf die Stirn, stieß ich einen Erkenntnisruf aus und sagte: „Jetzt verstehe ich! Vom Schwanz einziehen hörte ich bereits. Gudrun Geier hatte uns Mädchen diesbezüglich aufgeklärt.“
Mama machte ein Gesicht, als wäre sie Gudrun Geier sehr dankbar. Eigentlich erstaunlich, denn von dieser frühreifen Dirne, wie sie sie nannte, hatte sie nie viel gehalten. Ich eigentlich auch nicht, doch ohne deren zum Teil säuischen Mitteilungen wäre ich unwissend geblieben.
„Dann ist ja alles klar“, atmete Mama erleichtert auf. Auch Papa. Die Fliege setzte ihr Flügelputzen fort.Ich fuhr fort: „Wenn ein Hund den Schwanz einzieht, hat er Angst. So hatte es Gudrun erklärt.“Auf Mamas Gesicht malte sich Enttäuschung. „Mehr hat sie nicht gesagt?“, fragte sie in stiller Hoffnung, Gudrun hätte vielleicht doch etwas mehr geäußert.
„Sie hatte mehr gesagt“, sagte ich.
Sofort war das Interesse meiner Eltern wieder entfacht.
„Und was?“, bohrte Mama.
Ich antwortete: „Wenn ein Mann den Schwanz einzieht, dann hat auch er Angst.“
Um die Verblüffung meiner Eltern abzukürzen, fragte ich Papa, ob er schon einmal aus Angst den Schwanz eingezogen habe. Er war fassungsloser als Mama. Weil er fürchtete, ich werde noch deutlicher werden, stotterte er, dass er noch nie Angst gehabt habe. Das war natürlich gelogen. Unter anderen Umständen hätte ihm Mama das offen ins Gesicht gesagt. So aber schwieg sie.
Ich grinste und sagte, dass jedermann den Schwanz einziehe, wenn ihm Angst und Bange ist. Das sei eine bekannte Redewendung.
„Ja, ja, natürlich“, schoss es aus Mamas und Papas Mund gleichzeitig.
„Und du weißt natürlich“, tastete sich Mama vorsichtig an mein Allgemeinwissen heran, „wie das Kinderkriegen verhütet werden kann.“
„Selbstverständlich“, erwiderte ich, „den Schwanz einziehen ist eine der Möglichkeiten.“
Mein erstes Liebesverhältnis
Im Kindergartenalter war es mein fester Entschluss, niemals zu heiraten. Nicht ein einziges Mal. Ich wollte meine Kuchenförmchen, mit denen ich Sandkuchen backte, und meine Sandschippchen mit keinem anderen teilen. Als ich vom Kindergarten in die Schule abgeschoben wurde, bekam mein Vorsatz einen Riss. Ich wurde neben einen Jungen platziert, den ich hier noch nie gesehen hatte. Er war mit seinen Eltern in unser Dorf gezogen, um frische Landluft zu inhalieren. In der Stadt wimmele es von Autos und Nutten, sagte er. Ich fragte, was Nutten seien und ob die auch vier Räder haben?
„Bist du doof“, erwiderte Rico, in den ich mich sofort verliebte, weil er so schlau war, „Nutten sind Frauen mit einem verführerischen Fahrgestell ohne Räder.“
Weil ich ihm gefallen wollte, sagte ich: „Verstehe.“
Er akzeptierte das und ernannte mich zu seiner neuen Freundin. Ich sei intelligenter als die, die er in der Stadt zurückgelassen habe.
Meine Eltern interessierte, was ich am ersten Schultag so alles gelernt hatte. Stolz antwortete ich, dass Nutten keine Räder haben. Mama und Papa prallten entsetzt zurück. Ich wertete das als Ausdruck ihrer Unwissenheit, was Nutten sind. Ich erklärte sie ihnen und sagte auch, wer mir dieses Wissen vermittelt hatte. Das hätte ich nicht tun sollen, denn schnurstracks sauste Mama zum Schuldirektor und verlangte die sofortige Entfernung Ricos von meiner Seite. Dieser verrohte Stadtjunge versaue ihre minderjährige Tochter und verleite sie vielleicht zur Unzucht. Möglicherweise benutze er sie als Drogendealerin. Man wisse ja, was in Städten so los ist.
Schuldirektor Gerstensaft war von der Heftigkeit meiner Mama überrascht und wusste zunächst nicht, wie er reagieren sollte. Als er sich gefasst hatte, überschüttete er Mama zunächst mit pädagogischen Weisheiten. Sie hatte ja zum ersten Mal ein Kind in schulische Obhut gegeben. Als er sie ausreichend verwirrt hatte, ließ er wissen, dass Rico neben mir sitzen bleibe. Das sei eine pädagogische Notwendigkeit. Der Knabe habe verlangt, neben einem Mädchen zu sitzen, das blond sei. So falle es ihm leichter, das geistige Niveau dieses Dorfes zu erfassen.
Mama war außer sich. Nicht weil ich blond bin, sondern weil ein hergezogener Stadtschnösel eine Forderung gestellt hatte, die widerspruchslos befolgt worden war. Herr Gerstensaft erklärte, dass Rico der wohlerzogene Sohn der Familie After sei, die seit voriger Woche in unserem Dorf wohne. Herr After sei Professor an der Universität der Kreisstadt und seine Gattin Rechtsanwältin allda. Daraus ergebe sich, dass Rico ein kluger Junge sei. Sein Können könne auf mich abfärben.
Mama bekam Probleme, ihre Lunge ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Sie japste wie ein Karpfen auf dem Trockenen. Herr Gerstensaft sah das mit Besorgnis und führte sie behutsam zu einem Sessel, auf dessen kühles Leder er sie sacht drückte. Sodann entnahm er dem Büroschrank eine Flasche Sekt und zwei Gläser, wobei er sprach: „Zur Beruhigung werden wir erst einmal ein Schlückchen genießen, Frau Turtel.“
Das Öffnen der Sektflasche verursachte einen lauten Knall. Mama stieß erschrocken einen Schrei aus. Der Sektkorken sauste an ihren Kopf und prallte dann gegen die Fensterscheibe, die klirrend zerbarst. Das Knallen, Klirren und Mamas Schrei vernahm die Schulsekretärin, die im Vorzimmer ihre Fingernägel lackierte. Auch sie stieß einen Schrei aus, weil sie glaubte, Herr Gerstensaft habe Mama erschossen. Er war Vorsitzender des örtlichen Selbsthilfevereins und lagerte eine schussbereite Pistole in seinem Schreibtisch.
Weil Mama in Ohnmacht gefallen war, dachte Gerstensaft, der Sektkorken habe sie tödlich getroffen. Er rief die Sekretärin, die ebenfalls bewegungslos war. Sie lag mit geschlossenen Augen auf dem Fußboden des Vorzimmers. Herr Gerstensaft befand sich nun in höchsten Nöten. Er brüllte nach dem Hausmeister, der ihn aber nicht hören konnte, weil er kackend auf der Toilette saß und die Bild-Zeitung las. Gerstensaft verabscheute die Bild-Zeitung und nannte sie „Scheißhauslektüre“. Weil er zwei Frauen auf dem Gewissen hatte, nahm er die Pistole aus dem Schreibtisch, um sich zu erlegen. Daran hinderte ihn die Postzustellerin, die im Büro auftauchte, um Post zuzustellen. Als sie sah, wie Direktor Gerstensaft die Pistole an seine rechte Schläfe hielt, entriss sie ihm die Waffe. Weil er nunmehr froh war, nicht tot zu sein, auch Frau Turtel und die Sekretärin nicht leblos waren, ließ er Rico einen anderen Platz einnehmen. So endete meine erstes Liebesverhältnis.
Onkel Adolf
Nach und nach wuchs ich zu einem prächtigen deutschen Mädel heran. So hatte es Onkel Adolf in seinen biographischen Aufzeichnungen notiert, die auch Verwandte und Bekannte umfassen. Meiner Entwicklung schenkte er besondere Aufmerksamkeit, weil ich – wie er schrieb – blondhaarig, blauäugig und edlen Wuchses sei. Ich sei das typische Erscheinungsbild eines arischen Weibes. Um weitere Details an mir zu erkunden, lud er mich zu sich und zu Kaffee und Kuchen ein. Er und Tante Else, seine fünfte Gattin, empfingen mich freundlich. Ich setzte mich artig auf den mir zugewiesenen Stuhl. Er war gepolstert und ich 12 Jahre alt. Besser gesagt jung, denn Onkel Adolf war älter. Er bewegte sich auf das dreiundachtzigste Lebensjahr zu. Als er mich anlächelte, dachte ich, sein Gesicht fällt auseinander, so zerklüftet war es. Sein rechteckiger Schnurrbart unter der Nase verschob sich bis hinauf zu den Augenbrauen. Tante Else sah nicht ganz so zerklüftet aus, weil sie zwanzig Jahre jünger war. Sie hatte sich vor zehn Jahren in Onkel Adolf und sein Sparbuch verliebt. Sie war die fünfte Vertrauensperson, die dieses Buch bewachte, das er unter dem Kopfkissen versteckt hielt. Die vorangegangenen vier Vertrauenspersonen hatten sein Sparbuch zu einem Barbuch gemacht und die Beträge deutlich reduziert.
Onkel Adolf war ein willensstarker Mann, der gewillt war, bis zu seinem Tode am Leben zu bleiben. Kein Arzt sollte schädigend in sein Leben eingreifen. So geschah es auch bis zu dem Tag, an dem er dem Tod den Löffel reichte. Beim Löffeln von Mohrrübensuppe bekam er einen Schwächeanfall, woraufhin sein Gesicht in die Suppe sank. In dieser ertrank er, weil Tante Else beim Friseur war. Vor vier Wochen trugen wir ihn zu Grabe. Niemand weinte, nur ich. Und zwar deshalb, weil ich ihm einen schöneren Tod gewünscht hätte. Wer möchte schon in Mohrrübensuppe ertrinken? Am Tage seiner Beisetzung dachte ich an den Tag zurück, an dem ich bei ihm Kaffee und Kuchen zu mir genommen hatte. Nachdem ich den letzten Kuchenkrümel verzehrt hatte, führten wir eine angenehme Unterhaltung. Die bestand aus Onkel Adolfs Fragen, meinen Antworten und Tante Elses Zwischenfragen, ob ich noch ein Stück Kuchen wolle. Ich antwortete jedes Mal „Nein!“, doch sie war so vergesslich, dass ich noch x-mal „Nein!“ sagen musste. Unsere Unterhaltung verlief so: Onkel Adolf stellte mir zunächst die Frage, ob ich froh sei, eine Deutsche zu sein. Ich bejahte und fügte hinzu, dass ich als Türkin ein Kopftuch tragen müsste. Kopftücher seien aber altmodisch. Onkel Adolfs Schnurrbart rutschte wieder zu den Augenbrauen, weil ihn meine Aussage freute.
„Kopftücher sind undeutsch“, kommentierte er meine Antwort. Tante Else nickte deutsch.
„Oma Ida trug auch immer ein Kopftuch“, sagte ich. Sofort sauste Onkel Adolfs Schnurrbart wieder unter die Nase. Seine Freude war verblasst. Auch Tante Else guckte verblasst. Ich merkte, dass ich etwas Unangenehmes gesagt hatte. Ich machte ein reumütiges Gesicht und bat Onkel Adolf, in seiner Befragung fortzufahren. Er knüpfte an Oma Idas Kopftuch an und erklärte, dass es ein Unterschied sei, ob eine Türkin oder eine Deutsche ein Kopftuch trage. Eine Deutsche wehre mit diesem Läusen und Schmutzpartikeln, eine Türkin schütze die Läusebrut, die sich in ihren speckigen Haaren angesiedelt hat. Ich sagte, dass sich in meinen Haaren auch einmal eine Laus eingenistet hatte. Die sei aber verstorben, weil Mama mir den Kopf mit Läusepuder desinfiziert hatte.
„Die Laus hätte auch ohne Läusepuder den Tod gefunden“, gab Onkel Adolf zu verstehen, „weil niederes Getier in blonden deutschen Haaren nicht existieren kann.“
Ich erwähnte, dass Mama auch blonde Haare hatte, bis sie sie schwarz färben ließ. Seitdem ähnele sie der bösen Königin in dem Film 'Schneewittchen'. Als ich ihr das sagte, klatschte sie mir eine. Ich verteidigte mich mit dem Hinweis, dass sie mit Kopftuch nicht böse aussehe. Nun trug sie, wenn sie das Haus verließ, immer ein Kopftuch. Das wurde ihr eines Tages zum Verhängnis. Als sie sich in einem Fummelladen der Kreisstadt eine neue Bluse kaufen wollte, wurde sie vom Ladendetektiv zu Boden gedrückt und festgehalten. Weil sie glaubte, er wolle sie vergewaltigen, rief sie um Hilfe. Wenig später erschienen zwei Polizisten, die Mama einem Verhör unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass nicht sie die Türkin war, nach der wegen zahlreicher Diebstähle gefahndet wurde. Man riet ihr, ohne Kopftuch einkaufen zu gehen. „Damit bestätigt sich“, nahm Onkel Adolf wieder das Wort, „dass eine deutsche Frau auch mit Kopftuch keine Kleptomanin ist und sein kann.“
Tante Else nickte und fragte mich, ob ich noch ein Stück Kuchen wolle.
Liebeskummer
Mit meinem körperlichen Wachstum wuchs auch mein Denken. Deshalb passierte es, dass ich meinen Eltern immer mal Fragen stellte, die ihnen unangenehm waren oder die sie nicht beantworten konnten oder wollten. Im Wesentlichen kreisten meine Gedanken um das wichtigste Thema eines jungen weiblichen Menschen, nämlich die Liebe und die mit ihr verbundene Annäherung an das männliche Geschlecht. Das Wort Liebe ist eigentlich eine Sammelbezeichnung für all das, was man mag und einen mit Freude oder Lust erfüllt. Dieser kluge Satz stammte von Gudrun Geier, die uns Mitschülerinnen ununterbrochen mit Weisheiten versorgte, die sie Zeitschriften entnommen hatte, die wir noch nicht lesen durften. Wegen ihrer frühreifen Informationen, denen wir mehr Aufmerksamkeit schenkten als dem Unterricht, wurde sie von Lehrern und Eltern gehasst. Uns Schülerinnen wurde geraten, den obszönen Äußerungen Gudruns kein Ohr zu schenken. Meine Mama steigerte sich in die Bemerkung, dass Gudrun eine „Drecksau“ sei. Als ich sie fragte, ob jede Frau, die sich sexuell betätige, eine Drecksau sei, knallte sie mir eine. Ich vergoss Tränen, weil ich mich ungerecht gestraft fühlte. Mama bereute ihren pädagogischen Fehlschlag und sagte, dass ich als 12jährige meine Aufmerksamkeit dem Lernen widmen solle. Schulisches Lernen sei langweilig und anstrengend, verteidigte ich meine Unlust. Im wahren Leben komme eine Frau mit ganz anderen Dingen in Berührung als mit chemischen Formeln, physikalischen Gesetzen und ähnlichem Krimskrams. So jedenfalls hatte es Gudrun Geier formuliert, ließ ich Mama wissen und hielt meine Hände schützend über den Kopf, weil ich die nächste Backpfeife fürchtete. Zu einer solchen ließ sich Mama aber nicht hinreißen, sondern sagte in mütterlichem Ton, dass sie eine Frau sei und sich mit mir, die ich eine werden werde, unter vier Augen unterhalten wolle.
Das gefiel mir natürlich besser als eine Ohrfeige. So kam es zu einem vertraulichen Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Mama weihte mich in die Geheimnisse einer Frau ein, die selbige beim Kauf von Textilien, Schmuck und Parfümerien beachten solle. In erster Linie müsse sie sich selbst gefallen und in zweiter, den Neid anderer Frauen wecken. Aus eigener Erfahrung zeigte sie auf, mit wieviel Stress und finanziellem Aufwand das verbunden sei. Um diese Störfaktoren einzudämmen, heirate eine Frau. Heiraten sei keine Liebeshandlung, wie allgemein geglaubt wird, sondern die Notwendigkeit, den Ehemann für lebenswichtige Angelegenheiten dienstbar zu machen. Das einzig Schöne an einer Hochzeit sei das Tragen des Hochzeitskleides, die Bewunderung der Braut durch die Gäste und das Gefühl, dem Mann eine unsichtbare Kette angelegt zu haben, von der nur der goldene Ehering zu sehen ist. Der frisch Vermählte schätze sich natürlich glücklich, weil er nicht weiß, dass die Eheschließung reines Blendwerk ist. Was ihn anschließend erwartet, ahnt er nicht. Dass es kein Zuckerschlecken sein wird, haben ihm vielleicht sein Vater, Großvater oder verheiratete Arbeitskollegen gesagt. Mama machte eine Sprechpause und guckte fast verächtlich auf ein gerahmtes Foto, das auf dem Sideboard steht. Es zeigt meinen Papa mit lächelndem Gesicht. Sicherlich war es unmittelbar nach der Hochzeit entstanden, als er noch Lächeln konnte. Ich lächelte zurück, ein wenig wehmütig, weil er mir leid tat.
„Liebst du Papa?“ fragte ich Mama.
Meine Frage überraschte sie. Sie stotterte, dass diese Frage nicht zu unserem Gespräch gehöre. Weil sie mir ansah, dass ich auf einer Antwort beharrte, ließ sie sich in einen Sessel sinken und stöhnte, als litte sie Schmerzen.
„Tut dir etwas weh?“ bekundete ich Mitgefühl.
„Ja“, hauchte sie mit schwacher Stimme und hielt ihre rechte Hand auf die linke Brust, hinter der ihr Mutterherz schlägt.
„Sicherlich ist es Liebeskummer“, tat ich mein Gudrun-Geier-Wissen kund und ließ mich vor ihr auf die Knie sinken. Dann fasste ich ihre linke Hand, streichelte sie und sagte, dass Liebeskummer vergehe, wenn man so den Liebsten streichle.
„Ich habe keinen Liebsten“, sagte sie so leise, dass ich es gerade noch vernehmen konnte.
„Doch, doch“, tröstete ich, „ich werde ihn herein bitten und ihm sagen, dass du ihn liebst.“
Mama sauste aus dem Sessel und war plötzlich gar nicht mehr schmerzerfüllt. Streng wies sie mich an, Papa draußen zu lassen. Er sei nicht ihr Liebster, sondern ihr Ehemann.
Meine Freundin Isabell
Auch diese Geschichte ist ein Rückblick in meine Vergangenheit. Sie liegt drei Jahre zurück. Ich war damals dreizehn, meine Freundin Isabell ebenfalls. Sternzeichenmäßig bin ich Fisch, sie ist Stier. Ihr Vater meint jedoch, sie sei eine Ziege, weil sie manchmal zickig ist. Dafür kann sie nicht, da sie erblich belastet ist. Ihre Mutter ist auch zickig. Wenn Beide sich zoffen, sagen die Leute: „Zickenkrieg bei Krügers.“ Dann fliegen nicht nur böse Worte, sondern auch Tassen und Teller. In letzter Zeit sind diese Kampfhandlungen seltener geworden, weil Krügers Tassen- und Tellerbestand geschrumpft ist.
Isabell Krüger ist meine Freundin seit frühester Kindheit. Wir halten zusammen wie Pech und Schwefel. Manchmal riecht sie auch so. Ihr Spitzname lautet 'Schwefelhölzchen'. Sie führt ihn auf ihr Temperament zurück, denn sie ist feurig wie ein entzündetes Streichholz. Auch hierin ist sie erblich belastet. Während ich eine ruhige und zurückhaltende Person bin, kann sie ihr Temperament oftmals nicht zügeln. So sind wir also zwei Gegensätze, die sich anziehen. Natürlich auch ausziehen, wenn wir Abends zu Bett gehen. Jede getrennt in das ihre. Einmal jedoch bot sich uns die Gelegenheit, in ein Bett zu kriechen, also eine Nacht gemeinsam zu verbringen. Nicht so, wie man das von Lesben weiß, nein, einfach nur so. Eigentlich wollten wir nicht schlafen, sondern die Nacht zum Tage machen. Mit anderen Worte: die Sau rauslassen. Das geschah vor drei Jahren. Herr und Frau Krüger hatten Tochter Isabell wissen lassen, dass sie ein Wochenende nicht zu Hause sein werden. Sie seien zu einer Geburtstagsfeier geladen, die sich von Samstag bis Sonntag erstrecke. Ob Töchterchen tapfer genug sei, eine Nacht allein zu verbringen. Isabell machte ein ängstliches Gesicht und sagte, dass sie sich vor Gespenstern und ähnlichen nächtlichen Spukgestalten fürchte. Das stimmte natürlich nicht, denn die Gespenster würden sich eher vor ihr fürchten. Herr Krüger wollte ihr die Angst nehmen und gestattete, die Bulldogge ausnahmsweise mit im Bett schlafen zu lassen. Das gefiel Isabell nicht, weil die Dogge zu viel Platz einnehmen würde. Lieber wäre ihr, wenn Freundin Tabea bei ihr nächtigen dürfte. Die Eltern gestatteten das und verschwanden frohgemut zur Geburtstagsfeier.
Meine Eltern wollten ihre Einwilligung zunächst versagen, weil sie glaubten, wir würden nur Dummheiten machen. Ich sagte, dass eine Nacht zu kurz sei, um erfolgreich Dummheiten machen zu können. Mama und Papa bestätigten das in Erinnerung an ihre Kindheit und ließen mich ziehen.
Kaum befand ich mich bei Isabell, überlegten wir, wie die Nacht nach unseren Vorstellungen gestaltet werden könnte. Jede Nachtminute schien kostbar. Auch der Vollmond schien. Sein fahles Licht würde uns den Gebrauch einer Taschenlampe ersparen. Zunächst beschlossen wir, nicht vor vier Uhr morgens zu Bett zu gehen. Die erste Nachthälfte wollten wir ausgiebig Fernsehen, und zwar Filme, die Liebe und Sex zum Inhalt haben. Die zweite Nachthälfte wollten wir dem Zufall überlassen. Vielleicht kommen uns Gespenster besuchen, kicherten wir. Wir ließen uns also in Krügers Wohnzimmersessel nieder und zappten mittels Fernbedienung durch alle möglichen Fernsehkanäle. Zur Anhebung der Gemütlichkeit aßen wir Pralinen, die Isabell dem Wohnzimmerschrank entnommen hatte. Die Flasche Rotwein, die verführerisch neben der Konfektschachtel stand, öffneten wir und füllten randvoll unser Glas. Mit jedem Schlückchen Wein stieg unsere Zufriedenheit und wurde uns leichter ums Herz. Ich hatte das Gefühl, nicht im Sessel zu sitzen, sondern in der Zimmerluft zu schweben. Weil im Fernsehen eine Musikgala gezeigt wurde, sangen wir die Lieder laut mit. Wir kannten zwar weder Text noch Melodie, doch störte uns das nicht. Auch die Zuschauer der Gala störte das nicht. Unsere Ausgelassenheit gipfelte im Öffnen des Wohnzimmerfensters, das sich im Obergeschoss befindet. Beschwipst erstiegen wir das Fensterbrett, schunkelten auf diesem hin und her und sangen ausgelassen die Gala-Lieder mit entstellten Texten. Damit uns auch die hören konnten, die die Musik-Gala nicht sahen, grölten wir in die mondbeschienene Nacht hinaus.
Meiers, die das Nachbarhaus der Krügers bewohnen, fühlten sich in ihrer Nachtruhe gestört. Sie gucken immer nur bis 22 Uhr fern, dann legen sie sich zu Bett. Sie sind schon alt und schlafen gern. Unser Fensterbrettgesang sei nach 22 Uhr ertönt, gaben Meiers bei der Polizei zu Protokoll, als sie dort Anzeige gegen uns erstatteten. Weil wir noch minderjährig waren, mussten unsere Eltern für uns büßen. Wir wären dazu auch gar nicht fähig gewesen, weil wir mit Knochenbrüchen im Krankenhaus lagen.