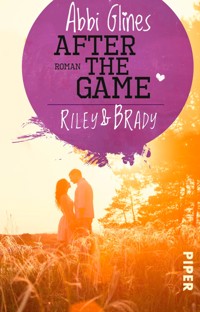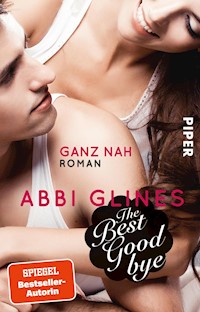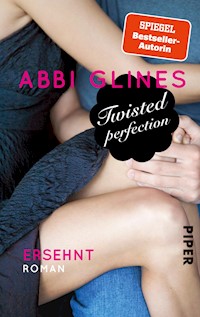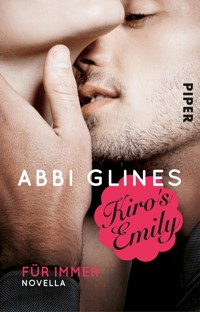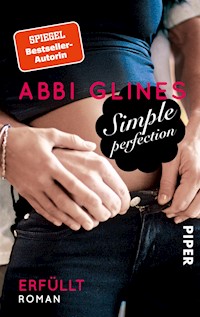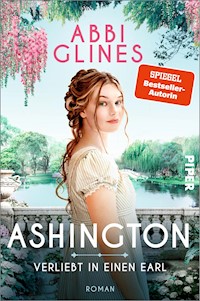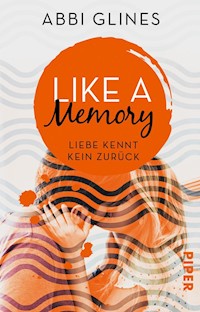7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mase Colt-Manning ist ein waschechter Cowboy aus Texas. Als er nach Florida aufbricht, um seine Halbschwester Harlow im sonnigen Rosemary Beach zu besuchen, verliert er dabei sein Herz – ausgerechnet an die Frau, vor der ihn alle von Anfang an gewarnt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Heidi Lichtblau
ISBN 978-3-492-96949-9 Juni 2015 © 2015 Abbi Glines Titel der amerikanischen Originalausgabe: »When I’m Gone«, Atria Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York 2015 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015 Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München Covermotiv: FinePic, München Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für meinen Sohn Austin. Mögest du zu einem rücksichtsvollen, freundlichen, fürsorglichen und großzügigen Mann heranreifen, der weiß, wie man jemanden wirklich liebt. Solche Männer sind schwer zu finden. Ich hoffe, ich ziehe einen davon groß.
Komm her, Mädel!«, hörte ich meinen Stiefvater Marco durchs Haus brüllen.
Schlagartig drehte sich mir der Magen um, wie er es in Marcos Nähe immer tat. Schließlich wusste ich schon, was er mir antun würde.
Langsam erhob ich mich von meinem Bett und legte das Buch beiseite, das ich gerade gelesen oder besser: zu lesen versucht hatte. Noch war meine Mutter nicht von der Arbeit zurück. Ich hätte einfach nicht so früh aus der Bücherei heimkommen dürfen. Während ich mir dort Bilderbücher angeguckt hatte, waren ein Mann und seine kleine Tochter zu mir gekommen. Der Mann hatte eine Unterhaltung mit mir begonnen, sich nach meinem Namen erkundigt und gefragt, ob ich ein Buch für meine kleine Schwester suche.
Die Frage war mir peinlich gewesen, denn sie erinnerte mich wieder einmal daran, wie dumm ich war.
»Los, Mädel!«, schrie mein Stiefvater.
Inzwischen war er wütend, und ich spürte, wie mir die Tränen kamen. Hätte er mich doch einfach nur geschlagen wie früher, wenn ich schlechte Noten mit nach Hause gebracht hatte, oder mich beschimpft und mir vorgeworfen, zu nichts nütze zu sein! Damals hatte ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass er damit aufgehört hätte. Nichts hatte ich so sehr gefürchtet wie den Gürtel und die Striemen, die er auf meinen Beinen und meinem Po hinterließ, wodurch das Sitzen zur Qual wurde.
Eines Tages dann hatte er tatsächlich davon abgelassen. Und ich hatte mir gewünscht, es wäre alles beim Alten geblieben. Die Schmerzen, die er mir mit dem Gürtel zugefügt hatte, waren nichts im Vergleich zu dem, was er mir nun antat. Alles war besser als das. Selbst der Tod.
Ich öffnete meine Zimmertür, holte tief Luft und sagte mir: Egal, was mein Stiefvater tun wird – bald habe ich es hinter mir. Sobald ich durch meine Putzjobs genügend Geld zusammenhatte, wollte ich von zu Hause abhauen. Meiner Mutter würde ich damit einen Riesengefallen tun. Sie hasste mich schon seit Jahren und empfand mich nur als Last.
Ich steckte mir das T-Shirt in die Shorts und zog an den Hosenbeinen, damit sie mehr von meinen Oberschenkeln verdeckten. Aber das brachte bei meinen langen Beinen ohnehin nichts. Und im Secondhandladen fand ich nie Shorts, die lang genug waren.
Da es bis zur Heimkehr meiner Mutter nur noch eine Stunde dauerte, würde Marco sicher nicht das Risiko eingehen, auf frischer Tat ertappt zu werden. Dabei stellte sich immer noch die Frage, ob Mom – wenn sie einmal überraschend in etwas hereingeplatzt wäre – nicht sowieso mir die Schuld dafür gegeben hätte. Vor vier Jahren hatte sie mir sogar einen Vorwurf daraus gemacht, dass sich mein Körper zu entwickeln begann. Meine Brüste hatten gar nicht aufgehört zu wachsen, und Mom hatte gesagt, ich müsse abspecken, weil mein Hintern zu fett sei. Ich hatte es versucht, aber er war geblieben, wie er war.
Mein Bauch dagegen war ganz flach geworden, wodurch meine Brüste nur umso größer gewirkt hatten. Was Mom gar nicht recht gewesen war. Also hatte ich wieder angefangen zu essen, doch das kleine Bäuchlein von zuvor hatte sich nie mehr eingestellt. Als ich eines Abends in einer abgeschnittenen Jogginghose und einem T-Shirt das Wohnzimmer durchquert hatte, um mir vor dem Schlafengehen noch ein Glas Milch zu holen, hatte sie mir eine runtergehauen und behauptet, ich sähe aus wie eine Nutte. Seitdem hatte sie mir das des Öfteren an den Kopf geworfen und hinzugefügt, ich sei so doof, dass mein Aussehen meine einzige Chance wäre, wenn ich im Leben weiterkommen wolle.
Ich betrat das Wohnzimmer, wo mein Stiefvater mit einem Bier in der Hand auf seinem Fernsehsessel saß und in die Glotze starrte. Wieso war der überhaupt schon so früh zu Hause?
Als ich ins Zimmer kam, ließ er seinen Blick langsam an meinem Körper hinaufwandern. Mich überlief es kalt. Was hätte ich dafür gegeben, schlau und flachbrüstig zu sein! Wenn ich dazu noch kurze, dicke Beine gehabt hätte, wäre mein Leben perfekt gewesen. Mein Gesicht war es bestimmt nicht, das Marco so anzog. Das war eher durchschnittlich. Nein, es war mein Körper. Wie ich den hasste!
Mir wurde übel, und ich kämpfte mit rasendem Herzen gegen meine Tränen an. Marco liebte es, wenn ich weinte. Dann war er erst recht nicht mehr zu halten. Ich nahm mir vor, nicht mehr zu weinen. Zumindest nicht vor ihm.
»Komm schon, setz dich auf meinen Schoß!«, befahl er.
Bloß das nicht! Mehrere Wochen war es mir gelungen, ihm aus dem Weg zu gehen. Seine Hände wieder unter meinem Shirt oder in meinem Höschen zu spüren – das würde ich nicht noch einmal ertragen. Alles, nur das nicht! Da wäre mir lieber, er würde mich umbringen.
Als ich mich nicht rührte, verzog er höhnisch das Gesicht. »Beweg deinen Arsch hierher, du Schlampe, und setz dich auf meinen Schoß. Wird’s bald?«
Meine Augen wurden feucht, und ich kniff sie zu. Ich musste die Tränen aufhalten. Würde er mich doch nur wieder schlagen, denn das würde ich über mich ergehen lassen. Ich packte es nur nicht, wenn er mich begrapschte. Ich hasste die Geräusche, die er dabei machte, und die Sachen, die er sagte. Würde dieser Albtraum denn nie enden?
Mit jeder Sekunde, die ich mich von ihm fernhielt, rückte die Heimkehr meiner Mutter näher. Wenn sie da war, beschimpfte er mich zwar, ließ aber die Finger von mir. Auch wenn meine Mutter mich am liebsten auf den Mond geschossen hätte: Nur sie konnte mich vor Marcos Übergriffen retten.
»Na, mach schon, heul ruhig los. Ich mag das!«, rief er und lachte höhnisch.
Der Sessel knarzte, und ich hörte, wie das Fußteil nach unten knallte. Ich riss die Augen auf. Mein Stiefvater erhob sich. Gar nicht gut. Wegrennen war zwecklos, ich würde ja gar nicht an ihm vorbeikommen. Außer, ich versuchte es durch den Hinterausgang. Doch draußen im Hof wartete Marcos Pitbull-Terrier schon auf mich. Vor drei Jahren hatte er mich gebissen, und ich hätte eigentlich genäht werden müssen, doch mein Stiefvater hatte mich nicht zum Arzt gehen lassen. Stattdessen hatte er gesagt, ich solle mich nicht so anstellen und die Wunde verbinden. Dem Pitbull gegenüber hatte es kein einziges scharfes Wort gegeben.
Die Hundezähne hatten eine hässliche Narbe auf meinem Hüftknochen zurückgelassen.
Ich war nie wieder in den Hinterhof gegangen.
Aber als mein Stiefvater nun auf mich zukam, fragte ich mich, ob es nicht besser wäre, von seinem Hund totgebissen zu werden. Auf einmal klang das gar nicht so schlecht.
Kurz bevor er mich erreicht hatte, entschied ich, dass wirklich alles, was der Hund mir antun konnte, dem vorzuziehen war, was Marco vermutlich mit mir vorhatte. Also lief ich los.
Hinter mir brach Marco in wieherndes Gelächter aus, doch ich rannte weiter. Er glaubte wohl nicht, dass ich mich zur Hintertür hinaustrauen würde. Dabei hätte mich selbst die Hölle nicht abgeschreckt, wenn ich ihm nur entkommen konnte.
Doch die Hintertür war verriegelt. Und ohne Schlüssel bekam ich sie nicht auf. Mist!
Mein Stiefvater packte mich an der Hüfte und zerrte mich zurück, dabei spürte ich, wie er sein hartes Glied gegen mich drückte. Der saure Geschmack von Erbrochenem brannte mir in der Kehle, als ich mich von ihm loszumachen versuchte. »Lass mich!«, schrie ich.
Er umfasste meine Brüste und drückte sie so fest, dass es schmerzte. »Du blöde Gans! Für einen Highschool-Abschluss warst du zu dämlich, aber dein Körper, der ist dafür geschaffen, Männer glücklich zu machen. Kapier das doch endlich!«
Inzwischen strömten mir die Tränen ungehindert über die Wangen. Marco wusste genau, was er sagen musste, um mir wehzutun. »LASS MICH!«, rief ich verzweifelt.
»Wehr dich ruhig, Reese. Du glaubst gar nicht, wie sehr mich das anmacht!«, zischte er mir ins Ohr.
Wie hielt es meine Mutter nur mit diesem Mann aus? War mein richtiger Vater wirklich noch schlimmer als er? Sie hatte ihn nie geheiratet und erzählte mir auch nie etwas von ihm. Nicht mal seinen Namen kannte ich. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass der schreckliche Marco wirklich das kleinere Übel sein sollte.
Noch einmal würde ich das alles nicht über mich ergehen lassen können. Ich hatte lang genug Angst vor ihm gehabt. Entweder würde er mich schlagen, bis ich tot war, oder er würde mich rauswerfen. Beides befürchtete ich schon seit Langem. Meine Mutter hatte mir mal erklärt, bei meinem Anblick würden Männer automatisch an Sex denken, weshalb ich mein Leben lang von ihnen ausgenutzt werden würde. Andauernd lag sie mir damit in den Ohren, ich solle doch endlich verschwinden.
Nun war ich bereit dazu. Ich hatte zwar erst 855Dollar angespart, doch das würde reichen, um mir ein Busticket bis ans andere Ende des Landes zu kaufen und mir dort einen Job zu suchen. Wenn ich lebend aus diesem Haus käme, war genau das mein Plan.
Marco schob die Hand in meine Shorts. Kreischend versuchte ich, mich zu befreien. Seine Hand hatte dort nichts verloren. »Lass mich los!«, brüllte ich laut genug, dass die Nachbarn es hören konnten.
Er zog die Hand wieder hinaus und riss mich so brutal am Arm herum, dass dieser auskugelte. Dann knallte er mich gegen die Tür und schlug mir ins Gesicht, dass mir Hören und Sehen verging. Meine Knie gaben nach. »Jetzt hör schon auf mit dem Gezicke und sei endlich still, du Bitch!«
Er griff nach meinem Shirt, schob es hoch und zerrte meinen BH nach unten. Ich schluchzte hilflos auf. Es würde wieder passieren, und ich konnte nichts dagegen tun.
»Lass sofort meinen Mann in Ruhe, du Flittchen, und verlass auf der Stelle mein Haus! Ich will dich nie wieder hier sehen!«, ertönte in diesem Augenblick die Stimme meiner Mutter, und Marco ließ schnell die Hände sinken. Ich riss mein Shirt nach unten.
Mein Gesicht brannte von dem Hieb, und ich schmeckte Blut auf meinen Lippen.
»RAUS MIT DIR, DU NICHTSNUTZIGE NUTTE!«, schrie meine Mutter.
Dieser Augenblick veränderte alles.
Zwei Jahre später …
Scheiße, verdammte! Was war das nur für ein Krach? Schlaftrunken öffnete ich die Augen und lauschte benommen, bis mir dämmerte, was mich geweckt hatte.
Ein Staubsauger? Und der Gesang einer Frau? Hallo?
Ich rieb mir die Augen und stöhnte frustriert auf, als es vor meiner Tür noch lauter wurde. Ein Staubsauger, eindeutig. Und der Gesang klang wie eine echt miese Version von Miranda Lamberts »Gunpowder & Lead«.
Ein Blick auf mein Handy sagte mir, dass es gerade mal acht war. Ich hatte also noch keine zwei Stunden Schlaf abgekriegt. Nachdem ich die dreißig Stunden davor durchgehend wach gewesen war, sollte ich jetzt von schlechtem Gesang und einem gottverdammten Staubsauger geweckt werden?
Als die Frau vor meiner Tür die ersten beiden Zeilen des Refrains sang, zuckte ich zusammen. Die Gute traf keinen Ton auch nur annähernd und verhunzte damit einen richtig guten Song. Nun hob sie zu allem Überfluss auch noch die Stimme. Ja, verdammt noch mal, wusste sie denn nicht, dass man um acht Uhr früh nicht in anderer Leute Häuser kam und aus voller Kehle sang?
Bei diesem Lärm war an Schlaf überhaupt nicht mehr zu denken. Nannette musste sich als Reinigungskraft eine Vollidiotin ins Haus geholt haben. Andererseits war sie stinksauer, weil ich mich gegen ihren Willen hier einquartiert hatte. Wer weiß, vielleicht zahlte sie dieser Person ja noch was dafür, dass sie direkt vor meiner Schlafzimmertür so einen Radau veranstaltete! Aber Nannette gehörte das Haus nun mal nicht – sondern unserem gemeinsamen Vater Kiro. Und der hatte mir erlaubt, während Nannettes Parisaufenthalt darin zu wohnen, damit ich Zeit mit meiner anderen Schwester Harlow verbringen konnte.
Nun sang die da draußen immer wieder lauthals den Refrain. Was für ein Albtraum! Das musste aufhören. Bevor ich Harlow und ihre kleine Familie besuchte, musste ich dringend noch etwas pennen. Harlow wusste, dass ich hier war, und freute sich schon auf das Wiedersehen. Doch diese Frau auf dem Flur hatte es wirklich raus, mich um meinen Schlaf zu bringen.
Ich schlug die Bettdecke zurück, stand auf und war schon auf dem Weg zur Tür, als ich merkte, dass ich gar nichts anhatte. Während ich nach meiner verdammten Jeans suchte, die ich bei meiner Ankunft ausgezogen und achtlos irgendwohin geschmissen hatte, fing mein Kopf zu pochen an. Aus Schlafmangel vermutlich, was mich nur noch wütender machte. Die Hose war nicht zu finden. Aber ich sah ja alles nur verschwommen, und die dunklen Gardinen waren zugezogen. Egal! Ich griff nach dem Laken, schlang es mir um die Hüften und ging zur Tür.
Gerade als die ersten Zeilen eines neuen Songs erklangen, riss ich die Tür auf. Ach du Schreck, nun vergriff sich diese Möchtegernsängerin an dem Lied »Cruise« von Florida Georgia Line.
Hier draußen war es so hell, dass ich erst mal die Augen zukneifen musste. Shit, sah die Frau mich denn gar nicht?
Nach ein paar Sekunden war ich endlich imstande, die Augen einen Spalt aufzumachen. Mein Blick fiel auf die Rückansicht einer jungen Frau, die sich vorbeugte und dabei mit ihrem runden kleinen Po hin und her wackelte. Langsam öffnete ich meine Augen ganz und sah die längsten Beine, die ich je zu Gesicht gekriegt hatte. Und dieser Hintern! War das eine Sommersprosse oder ein Muttermal unter ihrer linken Pobacke?
Nun richtete sich die Frau wieder auf. Ihre schmale Taille brachte ihr Gesäß nur noch besser zur Geltung. Ungerührt sang sie weiter. Der nächste hohe Ton ließ mich wieder zusammenzucken. Verdammt, Singen war einfach nicht ihr Ding.
In diesem Moment drehte sie sich um. Kaum hatte ich einen bewundernden Blick auf ihre ansehnliche Vorderansicht geworfen, als sie auch schon kreischend den Staubsaugergriff fallen ließ und sich die Stöpsel aus den Ohren zog.
Mit runden himmelblauen Augen sah sie mich entsetzt an und klappte ein paarmal den Mund auf und zu, als wollte sie etwas sagen.
Diese Zeit reichte, um mich im Anblick ihrer vollen rosigen Lippen und der perfekten Form ihres Gesichts zu verlieren. Das blauschwarze Haar hatte sie zu einem Knoten hochgesteckt. Wie lang es wohl sein mochte?
»Es tut mir leid«, brachte sie piepsend heraus, und ich sah ihr wieder in die Augen. Oha, was für eine Traumfrau! Noch dazu hatte sie etwas richtig Exotisches. Bei ihrer Erschaffung musste sich der liebe Gott von allem wirklich nur das Beste herausgepickt haben.
»Mir gar nicht«, erwiderte ich. Schlaf wurde ja sowieso ziemlich überbewertet.
»Ich wusste nicht, äh … Ich dachte, ich wäre allein im Haus. Ich meine, ich wusste nicht, dass gerade jemand hier wohnt. Es stand kein Auto vor dem Haus, und auf mein Klingeln hin hat niemand aufgemacht. Also habe ich den Code eingetippt und bin reingegangen.« Sie klang nicht so, als würde sie aus dem Süden stammen. Vielleicht kam sie aus dem Mittleren Westen?
»Ich bin hergeflogen und habe mir am Flughafen ein Taxi genommen«, erklärte ich.
Sie nickte und sah dann wieder auf ihre Füße. »Ich bin ganz leise, okay? Ich kann ja später noch mal hochkommen. Heute fange ich einfach mal unten an.«
Ich nickte. »Das ist lieb. Danke.«
Sie traute sich kaum, mich anzusehen, und als ihr Blick auf meine Füße fiel, erglühten ihre Wangen. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt, huschte davon und vergaß dabei den Staubsauger. Ich sah ihr nach und genoss den Anblick ihres wippenden Pos. Hoffentlich kam sie mehrmals in der Woche zum Putzen. Beim nächsten Mal würde ich versuchen herauszukriegen, wie sie hieß.
Sobald sie außer Sichtweite war, ging ich in mein Zimmer zurück und schloss die Tür hinter mir. Ich musste an ihr Gesicht denken, als ihr klar geworden war, dass ich nur ein Laken trug, und schmunzelte. Wie kam es, dass Nan eine Putzfee mit so einem Aussehen eingestellt hatte? Diese Frau war einfach der Hammer!
Ich legte mich zurück und schloss die Augen. Das Bild von der Sommersprosse direkt unter dem drallen Hintern kam mir in den Sinn. Was hätte ich dafür gegeben, sie küssen zu können! Es war die süßeste Sommersprosse, die ich je gesehen hatte.
Ogottogottogott!« Ich sank auf das nächste Sofa und hielt mir die Hände vors Gesicht.
Mir war nicht klar gewesen, dass jemand im Haus war. Und dann auch noch ein Mann! Ich hatte ihn aufgeweckt, was ihn geärgert zu haben schien. Zumindest kam es mir so vor, aber ganz sicher war ich mir nicht. Ich war so nervös gewesen, dass er mich feuern würde. Das hier war mein bestbezahlter Job, dabei hatte ich den Besitzer noch gar nicht persönlich kennengelernt. Ich arbeitete für eine Reinigungsfirma, die mir Putzjobs vermittelte. Mit dem Geld, das ich für das wöchentliche Putzen in diesem Haus bekam, konnte ich meine Wohnungsmiete, sämtliche Nebenkosten und mein Essen bezahlen. Meine anderen Putzstellen warfen längst nicht so viel ab. Wenn ich diesen Job verlor, würde ich nichts mehr sparen können und mein Sicherheitsnetz würde wegfallen.
Der Gedanke an den nackten Brustkorb dieses Typen ließ mir keine Ruhe. Ich kniff ganz fest die Augen zusammen und verbannte ihn aus meinem Kopf. Männern traute ich nicht. Abgesehen von meinem schwulen Nachbarn Jimmy. Bei ihm fühlte ich mich sicher, und er hatte mich auch an die Reinigungsfirma vermittelt.
Normalerweise genoss ich den Anblick eines männlichen Brustkorbs ja auch gar nicht. Aber dieses Exemplarhatte es echt in sich. Und die Arme des Mannes waren so kräftig und muskulös … Huch, was dachte ich da eigentlich? Der Typ war wirklich gut gebaut, aber Männer, die in Häusern wie diesem wohnten, wollten von mir garantiert nichts weiter als Gelegenheitssex.
Dieser Mann war reich und megaattraktiv. Möglicherweise hatte er eine Frau in seinem Bett liegen, für die dasselbe galt. Ziemlich sicher sogar. Das größte Schlafzimmer im oberen Stockwerk verfügte sogar über einen begehbaren Schrank mit den schönsten Klamotten, die ich je gesehen hatte. Das Haus schien einer Frau zu gehören, und dieser Typ war bestimmt ihr Freund. Wobei sich dann die Frage stellte, wieso er in einem anderen Zimmer schlief. Doch das ging mich eigentlich nichts an. Es konnte mir egal sein, was für einen heißen Körper dieser Mann hatte oder wie gut geschnitten sein Gesicht mit dem süßen Dreitagebart war – am besten schlug ich ihn mir gleich wieder aus dem Kopf.
Nun musste ich dafür sorgen, dass ich diesen Job nicht verlor. Normalerweise war es ziemlich sauber hier. In den ganzen Monaten, die ich schon hier arbeitete, hatte ich nie jemanden gesehen. Trotzdem machte ich jede Woche sauber, als wäre das Haus bewohnt. Nirgends hätte man auch nur ein Staubkörnchen entdecken können, ja, ich ging sogar so weit, die Speisekammer und den Putzschrank neu zu organisieren, die Küchenschränke zu schrubben und alle Lebensmittel mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum wegzuwerfen.
Ich stand wieder auf und versuchte, nicht länger darüber nachzudenken, wie peinlich es gewesen war, einen Kunden durch lauten Gesang und Staubsaugerlärm direkt vor seiner Tür geweckt zu haben. Wenn er sah, wie blitzblank alles war, würde er hoffentlich ein Auge zudrücken.
Drei Stunden später sah das Erdgeschoss picobello aus. Ich hatte sogar den Kühlschrank und die Tiefkühltruhe komplett ausgewischt, nur damit der Mann da oben so richtig ausschlafen konnte. Nun ging ich in den ersten Stock und reinigte jedes Zimmer so gründlich, bis ich beim besten Willen nichts mehr zu putzen fand und schließlich am Fuß der Treppe zum zweiten Stock stand. Inzwischen war es ein Uhr, und da oben rührte sich noch immer nichts. Drei Schlafzimmer und drei komplette Badezimmer musste ich noch machen, dazu ein Fernsehzimmer und einen Billardraum mit Bar. Letzterer war weit genug vom Zimmer des Typen entfernt, dass ich es sauber machen konnte, ohne ihn zu wecken.
Auf Zehenspitzen bewegte ich mich dorthin. Im Billardraum angekommen, seufzte ich erleichtert auf und schloss die Tür hinter mir. Die Bar war mit allen nur denkbaren Spirituosen bestückt und mit lauter verschiedenen Gläsersorten ausgestattet, von denen ich nicht die geringste Ahnung hatte, zu welchem Getränk sie gehörten. Ich durchquerte den Raum, stellte meinen Eimer mit den Putzutensilien auf dem Boden ab und entschied, noch etwas Zeit mit dem Reinigen der Fenster zu verbringen. Ich zog mir einen Stuhl heran, legte ein sauberes Tuch darüber und stieg hinauf. Die Zimmerdecke war mindestens drei Meter siebzig hoch, und der obere Teil der Fensterscheiben war entsprechend schwer erreichbar. Manchmal nahm ich deshalb eine Leiter mit, hatte heute aber jedes zusätzliche Geklapper vermeiden wollen.
Gerade streckte ich den Arm hoch und wollte mit dem Saubermachen loslegen, als mein Handy klingelte. Mist! Beim Arbeiten stellte ich den Klingelton immer auf ganz laut, damit das Telefon überall im Haus zu hören war. Ich wollte vom Stuhl hinuntersteigen, rutschte jedoch mit dem Fuß aus und verdrehte ihn mir schmerzhaft. Der Stuhl kippelte, und ich griff nach dem Nächstbesten, woran ich mich festhalten konnte: einem wuchtigen, verschnörkelten Spiegel.
Kurz bevor ich auf den Boden krachte, hörte ich, wie Glas zersprang.
Und noch immer klingelte dieses blöde Handy!
Ich drehte mich um und versuchte verzweifelt, es zu fassen zu bekommen – doch vergebens.
In diesem Moment ging die Tür auf. Ich erstarrte.
»Ach du Schreck, was ist passiert? Alles okay mit dir?« Bekleidet mit nichts als einer weißen Boxershorts, kam der Typ, den ich morgens aus dem Schlaf gerissen hatte, zu mir gelaufen. Immerhin war er nicht völlig nackt. Ich riss den Blick von ihm los und holte scharf Luft. O Gott, ich hatte seinen Spiegel demoliert und ihn schon wieder geweckt!
»Es tut mir so leid! Den Spiegel erstatte ich natürlich. Der hat wahrscheinlich einen Haufen gekostet, aber Sie müssen mir einfach nichts mehr zahlen, bis Sie das Geld wieder drinhaben. Ich könnte sogar öfter als einmal in der Woche herkommen, und zwar gratis!«
Sein Gesicht verdüsterte sich, und mir rutschte das Herz in die Hose.
»Sag mal, blutest du etwa? Scheiße, gib mir mal deine Hand.« Er kniete sich hin und legte meine Hand in seine. Tatsächlich steckte ein Glassplitter drin. Aus der Wunde sickerte langsam Blut heraus.
»Oje, das muss sicher genäht werden. Warte kurz, ich zieh nur schnell was an, dann bringe ich dich ins Krankenhaus.« Er richtete sich auf und ging hinaus.
Ich starrte auf die Spiegelscherben und dann zur Tür. Er wollte mich ins Krankenhaus bringen? Wegen dieser Wunde hier? Wenn das meine Agentur erfuhr, war ich meinen Job vermutlich los. Ich durfte nicht zulassen, dass er deswegen so ein Trara machte. Mehr als etwas Desinfektionsmittel und einen Verband brauchte ich gar nicht. Danach würde ich mich um den Scherbenhaufen am Boden kümmern.
Beim Aufstehen ließ mich ein stechender Schmerz im Rücken zusammenzucken. Das würde blaue Flecken geben! Ich entfernte ein paar Glassplitter, die immer noch an meinen Klamotten hingen, wodurch ich mir allerdings nur noch mehr kleine Schnitte an den Fingern zuzog. Das Blut, das auf meine Beine getropft war, ließ alles noch schlimmer aussehen, als es war.
Vorsichtig trat ich aus den Scherben hinaus. Sobald ich mir sicher war, dass ich keine weiteren Splitter hinter mir herschleifte, ging ich zu meinem Putzeimer und nahm ein sauberes Tuch heraus. Dann begab ich mich ins nächstgelegene Badezimmer und säuberte mit dem Tuch meine Beine.
»Was tust du da?« Der Typ klang wütend. Ich riss den Kopf hoch und wich zurück, als er ins Bad hereintrat. Ich hatte den Fuß auf den geschlossenen Toilettendeckel gestellt und nahm ihn nun schnell wieder herunter.
»Tut mir leid, dass ich barfuß bin. Aber ich wollte den Toilettendeckel putzen, sobald ich fertig bin.«
Er sah mich entgeistert an. Mist, ich machte ja alles immer noch schlimmer!
»Der Toilettendeckel ist mir scheißegal. Warum hast du nicht gewartet, bis ich dir aufhelfen konnte? Du hättest in noch mehr Glasscherben treten können!«
Was? Diesmal machte ich eine entgeisterte Miene. Ich blickte einfach nicht durch bei ihm. »Ich habe aufgepasst«, erwiderte ich und fragte mich, wieso er sich so aufregte.
»Na komm. Ich ziehe jetzt die Scherbe raus, säubere die Wunde und verbinde sie. Dann fahren wir los. Du kannst die Scherbe nicht da drinlassen. Die Wunde könnte sich infizieren.«
»Okay.« Nachdem er so wild entschlossen war, mir zu helfen, traute ich mich nicht, Nein zu sagen.
Er wandte sich um und stapfte hinaus und ich hinterher. Nur einmal riskierte ich dabei einen Blick auf seinen Po, und das auch nur, weil es mich interessierte, wie seine Rückansicht in der Jeans aussah, die er nun trug. Auch nicht schlecht! Diese Jeans saß wirklich wie angegossen.
Ich ließ den Blick nach oben wandern und entdeckte, dass er sein Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. So wie es aussah, war es mindestens schulterlang. Das war mir zuvor gar nicht aufgefallen, denn seine schönen Augen und sein markantes Kinn hatten meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen.
Wir erreichten die Tür zu seinem Zimmer. Er trat zur Seite und winkte mich hinein. »Ich habe keine Ahnung, wo Nan ihren Erste-Hilfe-Kasten aufbewahrt, aber ich habe in meiner Reisetasche etwas Verbandszeug dabei. Ich bin letztens von einem Pferd gestürzt, das ich gerade einreite, und habe mir dabei ein paar Kratzer zugezogen.«
Nan? Wer war das denn?
»Wohnen Sie denn gar nicht hier?«
Er hatte einen kleinen blauen Beutel aus seiner Reisetasche gezogen und grinste nun belustigt.
»O Gott, nein!« Er gluckste. »Und hör endlich auf, mich zu siezen. Hast du Nannette schon kennengelernt? Mit der lebt kein Mensch freiwillig im gleichen Haus. Aber da unserem Vater dieses Haus gehört, kann ich hier wohnen, wann immer mir danach ist. Und wenn Nan weg ist, ist mir danach.«
»Bis auf Sie … äh … dich habe ich hier noch nie jemanden gesehen«, sagte ich.
»Das erklärt eine Menge«, meinte er lachend. Dann streckte er mir seine Hand entgegen. »Komm, gib mir deine Hand. Ich mach’s so vorsichtig wie möglich, aber ein bisschen brennen wird’s schon.«
Ich ließ mich eigentlich nicht von Männern berühren. Doch die Art, wie er meine Handfläche musterte, wirkte auf mich vertrauenerweckend. Er war ein netter Kerl, zumindest kam es mir so vor.
Ich legte meine Hand mit der Handfläche nach oben in seine, und er blickte entschuldigend zu mir auf, als sei alles seine Schuld. Ich beobachtete, wie er langsam die Scherbe herauszog und die Wunde mit einem Wattebausch abtupfte, den er zuvor mit Desinfektionsmittel getränkt hatte. Richtig, es brannte, aber ich hatte schon viel Schlimmeres durchgemacht.
Er senkte den Kopf und blies während des Säuberns sanft über meine Wunde. Sein kühler Atem tat gut, und ich beobachtete fasziniert, wie er dabei die Lippen spitzte. Bildete ich mir diesen Mann vielleicht nur ein? Hatte ich mir bei meinem Sturz den Kopf angeschlagen? Oder träumte ich das alles nur?
Er presste den Wattebausch mit dem Daumen fest auf die Wunde und griff mit der anderen Hand nach einem neuen Wattebausch und medizinischem Klebeband. »Leider habe ich keine Salbe dabei, aber Paracetamol hätte ich. Das könntest du gegen die Schmerzen nehmen, bis wir dich ins Krankenhaus gebracht haben.«
Ich nickte nur, denn ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun oder sagen sollen. Bislang hatte es noch nie jemanden gekümmert, wenn ich mich verletzt hatte. Dabei war das oft vorgekommen.
»Ach übrigens, ich heiße Mase«, sagte er und sah kurz zu mir auf, während er mir die Hand verband.
»Den Namen habe ich noch nie gehört, aber er gefällt mir.«
Er lachte auf. »Danke. Hast du vielleicht auch einen Namen?«
Er hatte mich tatsächlich gefragt, wie ich hieß. Bis auf eine Kundin hatte sich nie jemand, für den ich arbeitete, für meinen Namen interessiert.
»Klar. Ich heiße Reese.«
Sie roch wie eine Zimtschnecke. Nach dieser süßen Glasur und dem Zimtduft, bei dem einem das Wasser im Mund zusammenlief. Am liebsten hätte ich ganz tief eingeatmet, wenn er zu mir herüberwehte. Nur mit Mühe schaffte ich es, Reese nicht gleich an mich zu reißen und mein Gesicht an ihrem Hals zu vergraben. Noch nie war ich einer Frau begegnet, die nach Zimt roch. Wer hätte gedacht, dass einen das derart antörnte?
Nachdem ich ihr die Hand verbunden hatte, führte ich sie die Treppe hinunter. Irgendetwas schien sie zu verwirren, doch sie rückte nicht raus damit. Ich fragte sie, ob sie eine Handtasche dabeihabe. Sie nickte und schnappte sie sich vom Tisch neben der Eingangstür, wobei die meisten Frauen diesen ausgeblichenen blauen Rucksack wohl kaum als Handtasche bezeichnet hätten. Reese schulterte ihn und sah besorgt aus.
»Ich bin mit dem Putzen noch gar nicht fertig!«
»Als ob das mit der offenen Wunde noch ginge!« Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen.
»Ach, so schlimm ist es doch gar nicht.« Sie hob ihre verbundene Hand.
Ich schüttelte den Kopf und öffnete die Haustür. »Nö, vergiss es.«
Draußen entdeckte ich, dass man mir inzwischen meinen Pick-up vorbeigebracht hatte. Na prima, nun brauchte ich nicht mit Reese’ Wagen zu fahren. Ich sah mich nach ihrem Auto um.
»Wo steht dein Wagen?«
»Ich habe keinen.«
»Hat jemand dich hergebracht?«, fragte ich, auch wenn mir schon klar war, dass sie gleich von ihrem Freund erzählen würde, der sie hergefahren hatte. Fuck!
»Mein Nachbar arbeitet im Kerrington Country Club. Mit dem kann ich ein Stück mitfahren. Den Rest laufe ich.«
Ein Nachbar, so, so. »Und der fährt dich nicht bis hierher?«
Sie schüttelte den Kopf und sah mich an, als sei ich nicht ganz dicht. »Nein, es ist wirklich nicht weit, und ich laufe ganz gern.«
»Wie heißt denn der Bursche?«, fragte ich.
»Jimmy.«
Mit diesem Jimmy würde ich ein Wörtchen reden müssen. Bei Reese’ Aussehen war es alles andere als ratsam, mutterseelenallein in der Gegend herumzuspazieren. Rosemary Beach mochte ein sicheres Pflaster sein, aber man konnte nie wissen, wer hier alles so durchreiste.
»Bringt Jimmy dich denn nach Hause?«
Als wüsste sie nicht, ob sie mir darauf antworten sollte, warf sie mir einen unsicheren Blick zu. »Manchmal – ja, meistens eigentlich.«
Warum hatte sie denn bloß kein Auto? Sie musste einundzwanzig, zweiundzwanzig sein, war also kein Kind mehr. Sie hatte einen Job und offenbar auch eine Wohnung.
»Und wie kommst du ansonsten nach Hause?« Ich hielt ihr die Pick-up-Tür auf und half ihr mit der anderen Hand beim Einsteigen.
»Dann gehe ich zu Fuß«, erwiderte sie, ohne mich dabei anzusehen.
Als ich einen Blick auf ihre billigen Flipflops warf, bemerkte ich zum ersten Mal ihre perfekten kleinen Zehen, deren Nägel pink lackiert waren. Wieso mussten selbst ihre Füße so sexy sein? Verflixt!
Sie zog ihre Füße zurück, und ich wusste, ihr war mein Blick nicht entgangen. Ich schloss die Wagentür und ging gemächlich zur Fahrerseite. Diese Frau brauchte eindeutig Hilfe, doch leider konnte ich für sie nicht die Welt retten. Schließlich war ich nur eine Woche, maximal zwei Wochen hier, bevor ich wieder zurück nach Texas musste. Da brachte es gar nichts, wegen der Probleme dieser Frau ein Fass aufzumachen.
Gerade wollte ich den Motor anlassen, als das Handy in meiner Hosentasche klingelte. Das musste Harlow sein, die gegen zwei mit mir rechnete, und es war inzwischen schon fast so weit, wie mir ein Blick auf meine Uhr verriet.
»Hey!«, grüßte ich meine Schwester, während ich den Motor des Pick-ups anwarf und Kurs auf die Hauptstraße nahm.
»Na, ausgeschlafen?«, fragte Harlow. Im Hintergrund war Lila Kate, ihre kleine Tochter, zu hören.
»Äh, ja schon«, erwiderte ich. Wie hätte ich ihr auch erklären sollen, wie wenig Schlaf ich abbekommen hatte? Schließlich saß der Grund dafür direkt neben mir.
»Bleibt’s denn bei zwei? Grant meinte, er gibt uns eine Stunde und kommt dann um drei.«
Ich warf einen Blick auf Reese’ verletzte Hand. Bis die verarztet war, konnte es dauern. Und in der Notaufnahme war immer viel Andrang.
»Hier hat es heute Vormittag einen Unfall gegeben. Die Frau, die Nans Haus reinigt, ist von einem Stuhl gestürzt und hat sich dabei eine Schnittwunde zugezogen. Ich bringe Reese, so heißt sie nämlich, in die Notaufnahme, denn ihre Hand muss genäht werden. Es könnte also noch ein Weilchen dauern, bis ich bei dir aufschlage.«
»O nein!« In Harlows Stimme schwang Besorgnis mit. Ihr ausgeprägtes Mitgefühl war einer der vielen Gründe, warum ich sie Nan vorzog. »Ist sonst denn alles okay mit ihr?«
Japp. Reese war nicht mal zusammengezuckt, als ich ihre Handfläche mit Desinfektionsmittel gereinigt hatte. »Ich denke, schon. Der Schnitt ist nur richtig fies und muss medizinisch versorgt werden. Ich muss sie hinterher noch heimbringen, weil Reese kein Auto hat. Das Ganze könnte sich also bis zum Abend hinziehen. Aber du hast mich ja noch den ganzen Rest der Woche«, beruhigte ich sie.
»Lass dir Zeit, und bring Reese erst mal nach Hause. Ich mach mit Lila Kate solange ein Nickerchen. Letzte Nacht war sie viel wach. Sie zahnt nämlich gerade.«
»Na, dann sieh zu, dass du zu deinem Schlaf kommst, meine Süße. Wir sehen uns heute Abend!« Ich beendete das Gespräch.
Reese sah mich erstaunt an. »Hey, du musst wirklich nicht bei mir bleiben! Ich kann doch mit dem Taxi heimfahren.«
Von wegen! Ich war doch kein Waschlappen, der sich einfach aus dem Staub machte, wenn sie genäht werden musste.
»Ich bleibe bei dir«, sagte ich mit fester Stimme.
»Es ist wirklich sehr nett, dass du mich zur Notaufnahme fährst. Aber ich hatte schon schlimmere Schnittwunden als diese hier. Dass die Stelle genäht werden muss, bezweifle ich sowieso. Ich kann dann noch schnell das Haus fertig putzen und mich danach auf den Heimweg machen.«
Hallo? War das ihr Ernst?
»Das wird genäht, und dann bringe ich dich heim, Schluss, aus!« Allmählich wurde ich sauer. Nicht auf sie, wohlgemerkt. Denn wer konnte einer Frau wie ihr denn schon ernsthaft böse sein? Nein, ich war sauer, weil sie zu denken schien, das Nähen sei überflüssig.
Diesmal protestierte sie nicht. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sie inzwischen aufrechter dasaß und sich zur Tür lehnte, als wollte sie größtmöglichen Abstand zwischen uns herstellen. Hatte ich ihr Angst eingejagt?
»Hör mal, Reese, du hast im Haus meiner Schwester gearbeitet und dich dabei verletzt. Da müssen wir doch sicherstellen, dass du anständig versorgt wirst! Ich werde nicht zulassen, dass du das Haus heute noch fertig putzt. Du kommst erst wieder, wenn die Wunde verheilt ist und nichts mehr wehtut. Ich bin die ganze Woche über hier, und im Gegensatz zu meiner Schwester mache ich meinen Dreck auch selbst wieder weg. Ich brauche keine Zugehfrau.«
Sie schaute mich zwar nicht an, nickte aber.
Offenbar bekam ich keine weitere Antwort. Schön. Sollte sie doch schmollen, wenn sie wollte! Und mal ganz im Ernst: Ich wollte mich doch nur darum kümmern, dass ihre Hand möglichst schnell heilte. Wo war da das Problem?
Noch peinlicher konnte es für mich an diesem Tag nicht mehr werden. Für den Rest der Fahrt zum Krankenhaus drehte Mase das Radio laut auf und sagte kein einziges Wort mehr. Entweder war er wütend oder frustriert, das war mir klar. Ich hielt ihn vom Besuch bei einer Frau ab, aber ich hatte ja versucht, ihm das Ganze auszureden! Er wollte einfach nicht hören.
Sobald wir in der Notaufnahme waren, wollte er mir unbedingt ein Mineralwasser besorgen, obwohl ich sagte, ich bräuchte keins. Bis ich zur Untersuchung abgeholt wurde, wechselten wir keine fünf Worte. Gern hätte ich ihm noch einmal gesagt, dass er nicht zu warten brauche und dass es kein Problem für mich sei, ein Taxi zu nehmen, aber ich hatte Angst, er würde mich dann wieder anschnauzen. Ich kannte diesen Mann ja gar nicht und hatte keine Ahnung, wozu er alles fähig war.
Als der Arzt mir eine Spritze gab, hielt Mase mir die andere Hand und sagte, ich dürfe ruhig fest zudrücken. Wie meinte er das überhaupt? Dachte er, ich würde die Schmerzen sonst nicht aushalten? Es ging doch nur um eine Spritze! Auch als der Schnitt mit fünf Stichen genäht wurde, ließ er meine Hand nicht los.
Währenddessen lenkte er mich ab, indem er mir Witze erzählte. Sie waren zwar reichlich abgedroschen, aber ich lachte trotzdem. Ich konnte mich nicht erinnern, dass jemals einer versucht hätte, mich zum Lachen zu bringen. Und ganz sicher wurde mir zum ersten Mal ein Witz erzählt, in dem es nicht um mich ging.
Inzwischen waren wir mit dem Auto vor dem Haus angekommen, in dem meine Wohnung lag. Die ganze Fahrt über hatte Mase geschwiegen. Mehr als einmal hatte es gewirkt, als wollte er etwas sagen, doch er hatte es sich dann anscheinend verkniffen. Schließlich hatte er wieder das Radio angestellt, was für mich ein klares Signal war, dass er nicht mehr reden wollte.
Das nahm ich ihm nicht krumm. Immerhin hatte er meinetwegen das Date mit seiner Freundin oder wem auch immer verschieben müssen. Und doch war er die ganze Zeit über so nett gewesen – nein, mehr als das: richtig fürsorglich! Nun war er in Gedanken sicher wieder bei der Frau, die auf ihn wartete.
In der Vergangenheit war ich schon als »Babe«, »Sugar« und »heißes Girl« bezeichnet worden, was mich immer hatte zusammenzucken lassen. Man hatte mir auch noch andere, weniger schmeichelhafte Namen gegeben, nie aber hatte mich jemand »meine Süße« genannt. Wie es sich wohl anfühlte, wenn ein Mann in diesem Ton mit einem sprach und es wirklich so meinte? Wenn man wusste, dass er einem nie wehtun wollen würde?
Als Mase den Pick-up geparkt hatte, wusste ich, dass ich mich bedanken und ihn dann wegschicken musste.
»Danke noch mal, dass du mich zur Notaufnahme gebracht hast, und für das Mineralwasser, und dafür … ähm … dafür, dass du meine Hand gehalten hast. Das war wirklich nett von dir. Tut mir leid, dass ich dir dadurch den ganzen Tag verpatzt habe. Am Sonntag komme ich noch mal zum Putzen. An dem Tag muss ich in keinem anderen Haus arbeiten. Da reist du ja wieder ab … stimmt’s?«
Mase sah mich an und seufzte. »Japp, am Sonntag mache ich mich auf die Heimreise. Zumindest ist das bislang so geplant. Aber mach dir wegen dem Haus keinen Kopf, bevor deine Hand geheilt ist, okay? Nan kommt erst in einem Monat wieder nach Hause. Sie ist in Paris.«
Paris. Wow! Für mich war es unvorstellbar, in eine Stadt wie Paris zu reisen. Ich fragte mich, wie diese Nan wohl war. Wenn sie seine Schwester war, musste sie supergut aussehen.
»Danke, das ist aber nett.« Anscheinend konnte ich nicht aufhören, mich bei ihm zu bedanken. Ich angelte mir meinen Rucksack und öffnete die Tür auf der Beifahrerseite.
»Warte, ich helfe dir runter«, sagte Mase. Das hatte er bisher bei jedem Einsteigen und Aussteigen getan. Als glaubte er, ich könne nicht allein runterhüpfen, ohne mich zu verletzen. Na ja, nach dem heutigen Tag musste er mich ja auch für einen Tollpatsch halten!