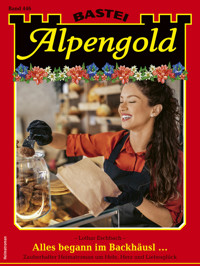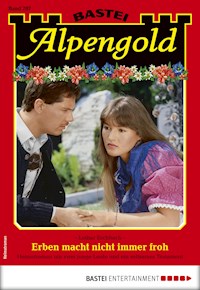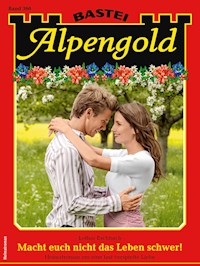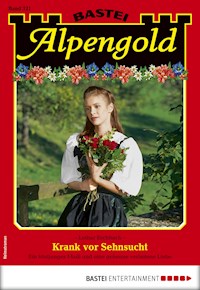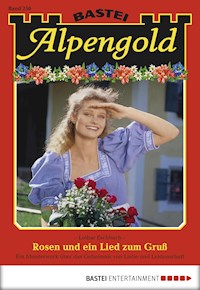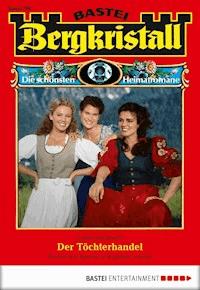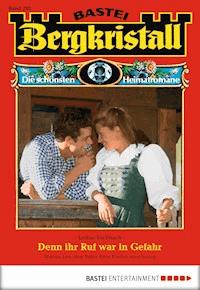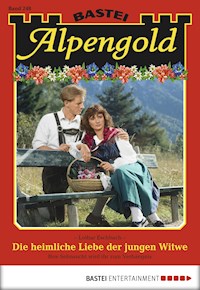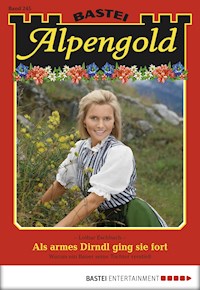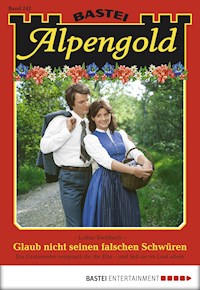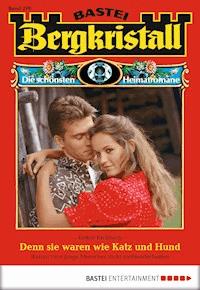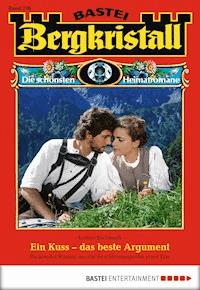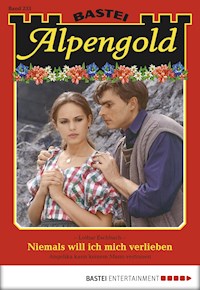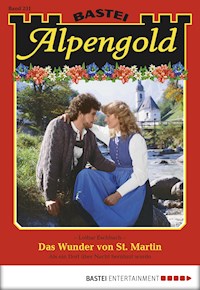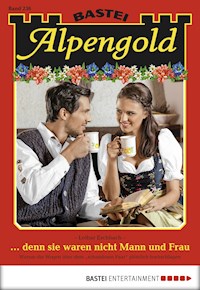
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alpengold
- Sprache: Deutsch
Jetzt hört aber doch alles auf! Da leben die beiden jungen Leute schamlos in einer "wilden Ehe" zusammen und zerstören die Moral im guten christlichen Rottenau!
Die Wogen der Empörung schlagen hoch. Besonders die Zeitungsfrau Kathl und Hedwig, die Pfarrköchin, können sich nicht genug über dieses "g'schlamperte Verhältnis" aufregen. Beni und Mariele, denen die Angriffe gelten, ahnen bis jetzt noch nicht, was sie ausgelöst haben. Sie lieben sich einfach und leben zusammen. Denn es gibt einen triftigen Grund, warum Beni meint, sein Mariele nicht heiraten zu dürfen. Doch die Kathl und die Hedwig haben nichts Eiligeres zu tun, als gegen solche Zustände massiv einzuschreiten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
… denn sie waren nicht Mann und Frau
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Verlagsleiter Romanhefte: Dr. Florian Marzin
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: shutterstock / Kzenon
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-4240-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
… denn sie waren nicht Mann und Frau
Warum die Wogen der Empörung über dem »schamlosen Paar« hochschlagen
Von Lothar Eschbach
Jetzt hört aber doch alles auf! Da leben die beiden jungen Leute schamlos in einer »wilden Ehe« zusammen und zerstören die Moral im guten christlichen Rottenau!
Die Wogen der Empörung schlagen hoch. Besonders die Zeitungsfrau Kathl und Hedwig, die Pfarrköchin, können sich nicht genug über dieses »g’schlamperte Verhältnis« aufregen. Beni und Mariele, denen die Angriffe gelten, ahnen bis jetzt noch nicht, was sie ausgelöst haben. Sie lieben sich einfach und leben zusammen. Denn es gibt einen triftigen Grund, warum Beni meint, sein Mariele nicht heiraten zu dürfen. Doch die Kathl und die Hedwig haben nichts Eiligeres zu tun, als gegen solche Zustände massiv einzuschreiten …
Pfarrer Lommer kam mit langsamen, schweren Schritten in die Werkstatt.
»Grüß dich Gott, Beni«, schnaufte er und blieb neben der Tür stehen. Das Asthma machte ihm wieder mal schwer zu schaffen. Er rang heftig nach Luft und presste die Hand auf die Brust, was ihm aber auch keine Erleichterung verschaffte.
Benedikt legte das Werkzeug beiseite und wandte sich um.
»Grüß Gott, Hochwürden. Gell, heute geht’s Ihnen aber gar net gut?«
Pfarrer Lommer nickte und ließ sich auf dem Holzschemel nieder, den ihm Beni, wie Benedikt von seinen Freunden gerufen wurde, schnell hinschob.
»Bei dir riecht’s allweil so gut. Ich mag den Holzgeruch für mein Leben gern. Manchmal glaub ich sogar, dass ich dann leichter schnaufen kann.« Pfarrer Lommer blickte sich interessiert in der Schreinerwerkstatt um. »Was werkelst du denn grad, Beni? Bist am Schnitzen, gell?«
Benedikt nickte. »Ich restauriere den Hauptaltar für die Gnadenkapelle am Michelsberg. Ist ein Haufen Arbeit, Hochwürden. Und spätestens bis zum Patronatstag soll alles fertig sein!«
Pfarrer Lommer seufzte. »Dann trau ich mich ja gar net zu sagen, was ich vorzubringen hab, wenn du so überlastet bist, Beni.«
Benedikt Grundmann setzte sich auf die Hobelbank. Er war ein blonder, gut aussehender »Riese«, dem man vom Äußeren her gar nicht zutraute, mit so kunstvollen und feinen Dingen umzugehen, wie es seine Arbeit erforderte.
Benedikt war ein äußerst begabter Bursche. In erster Linie Kunstschreiner, aber auch Restaurator und Maler, der im ganzen oberbayerischen Raum bekannt war. Trotz seiner einunddreißig Jahre ging ihm der Ruf voraus, die »alten Meister« am besten restaurieren zu können.
In seiner Werkstatt, die den ganzen hinteren Teil des kleinen Hauses für sich beanspruchte, waren schon recht bedeutende Leute ein- und ausgegangen. Vor allem die Herren von den bayerischen Museen, aber auch viele Kritiker, darunter auch der Erzbischof von München.
»Was haben Sie denn auf dem Herzen, Hochwürden, dass es Sie gar so bedrückt?«
»Gestern war die entscheidende Sitzung des Kirchenrats«, begann Pfarrer Lommer zu erzählen. »Du wirst es net glauben, aber endlich haben sie uns die dringenden Reparaturarbeiten am Hochaltar und für den Chor bewilligt.«
»Aber das war doch auch nötig, Hochwürden! Der heilige Antonius in der rechten Altarnische hat mir schon lange so ausgesehen, als ob er runterfallen wollte. Überall blättert die Farbe ab. Und das Blattgold ist kaum noch zu erkennen. Ganz zu schweigen von der wackligen Balustrade am Chor!«
»Wem sagst du das, Beni«, seufzte der Pfarrer. »Aber das Geld halt! Von München kriegen wir bloß einen kleinen Zuschuss, alles andere müssen wir selber aufbringen.« Er lächelte, als er fortfuhr: »Aber jetzt hab ich alles zusammen. Jetzt brauchst du bloß noch zusagen, wann du endlich mit der Restaurierung beginnen kannst.«
Benedikt nickte. »Anfangen kann ich schon nächste Woche. Aber ich kann halt net durcharbeiten. Die Arbeiten für die Gnadenkapelle müssen fertig werden. Pünktlich! Sonst zerreißt er mich, der Pfarrer Geißler. Das hat er mir schon angedroht, bevor ich überhaupt angefangen habe«, fügte er grinsend hinzu.
»Mein Gott, der Geißler. Die der zerrissen hat, die sind alle ganz und leben noch. Der macht halt so seine Sprüche, das kennst doch. Aber ich seh’s schon ein, die Gnadenkapelle muss fertig werden. Wie wär’s denn, wenn du heute Abend bei mir vorbeikämst? Dann schauen wir uns alles in der Kirche an. Und wenn du ein paar Leute brauchst, die dir beim Gerüstbauen zur Hand gehen, dann schaff ich die schon her. Da soll’s dir an nix fehlen.«
»Ist recht, Hochwürden. Bis Weihnachten erstrahlt unsere Kirche wieder in neuem Glanz. Und solange die Tage noch so hell sind wie jetzt, kann ich bis neune arbeiten. Wir werden’s schon schaffen.«
Pfarrer Lommer erhob sich ächzend und streckte dem Beni die Hand hin.
»Dann bis zum Abend, Beni. Und wenn du magst, kannst bei uns zu Abend essen. Die Hedwig will einen Apfelstrudel machen, hat sie mir vorhin verraten. Wahrscheinlich rechnet sie damit, dass ich dich einlade.«
»Danke schön, Hochwürden. Bei einem Apfelstrudel kann ich eh net Nein sagen. Ist’s recht, wenn ich um sieben vorbeikomme?«
Pfarrer Lommer nickte, dann ging er genauso langsam, wie er gekommen war, zur Tür hinaus. Draußen blieb er einen Moment stehen und atmete ein paarmal tief durch. Er war froh, dass er den Gang zum Benedikt hinter sich hatte. Denn es war gar net so einfach gewesen, den Auftrag für ihn beim Kirchenrat durchzusetzen.
Benedikt hatte nicht nur Freunde im Dorf, denn er pflegte jedem ins Gesicht zu sagen, was er dachte. Und viele vertrugen das nicht, besonders, wenn sie sich vom Benedikt angegriffen fühlten.
Beni nahm kein Blatt vor den Mund. Und manchmal war er schon etwas »spaßig«, wie die Bauern zu einem sagen, der ab und zu aus der Reihe tanzte.
Um die Meinung der Leute kümmerte sich der Benedikt überhaupt nicht. Was sie von ihm redeten, war ihm völlig »wurscht«. Er lebte so, wie er es für richtig hielt. Dass er dabei manchmal aneckte, ließ sich natürlich nicht vermeiden.
Pfarrer Lommer dachte an verschiedene Begebenheiten, die ihm ein paar Männer aus dem Kirchenrat gestern vorgehalten hatten, weil sie nicht wollten, dass der Benedikt den Auftrag für die Kirchenrestaurierung bekam. Auch wenn sie anerkannten, dass er der Beste für die Arbeit war. Besonders der Kolbinger-Wilhelm, der als einer der reichsten Bauern von Rottenau gern überall das Sagen haben wollte, gehörte zu Benedikts größten Widersachern.
Aber Pfarrer Lommer hatte sich durchgesetzt, auch wenn der Kolbinger gebrummt und geknurrt und den Grundmann-Benedikt einen ganz »zuwideren Kerl« genannt hatte.
Pfarrer Lommer war erst vierundsechzig. Aber er hatte schon viel mitgemacht in seinem Leben. Als Jugendlicher war er schwer mit seinem Mofa verunglückt. Einige der Verletzungen, unter anderem ein Riss in der Lunge, bereiteten ihm bis heute Schwierigkeiten.
Aber er war das, was man einen »guten Hirten« für seine Gemeinde nannte. Manchmal ein bisserl autoritär und diktatorisch. Aber das brauchten seine Bauern. Sie wollten nicht nur von der Kanzel herunter angedonnert werden, sie brauchten auch sonst mal einen kräftigen Zuspruch. Und daran ließ es Pfarrer Lommer nie fehlen.
***
Kinder kamen die Dorfstraße entlang, blieben stehen und grüßten: »Gelobt sei Jesus Christus …«
»In Ewigkeit …«, erwiderte der Pfarrer, griff in die weiten Taschen seines schwarzen Oberrocks und holte ein paar Bonbons heraus.
Die Kinder wussten, dass der Hochwürden Bonbons für sie hatte. Und deshalb warteten sie fast immer auf ihre Belohnung, wenn sie ihm begegneten.
»Na, Peterchen«, sagte er zu einem etwa fünf Jahre alten Knirps, der ihn mit großen, dunklen Augen anblickte. »Wie geht’s denn allweil daheim? Alles gesund?«
»Ja, Hochwürden«, piepste der Hellhauser-Peter. Für ihn kam der Herr Pfarrer gleich nach dem lieben Gott. Wenn ihn Pfarrer Lommer ansprach, war ihm immer ganz andächtig zumute. Er nahm seinen um ein Jahr jüngeren Bruder Heinzi bei der Hand, flüsterte ihm zu, dass er einen »Diener« vor dem Hochwürden machen sollte, machte selbst einen und setzte, zusammen mit den anderen Kindern, den Weg fort.
»Kind müsste man noch sein«, seufzte der Pfarrer. Er hatte die schönste Zeit seines Lebens nicht vergessen. Und manchmal, wenn er so still seines Weges ging und sonst nichts weiter zu denken hatte, sah er immer wieder das wunderschöne Haus seiner längst verstorbenen Eltern vor Augen. Er würde den Tag nie vergessen, als er ausgezogen war, um Theologie zu studieren. Damals hatte er noch nicht ahnen können, dass er eines Tages in Rottenau, ganz in der Nähe seiner Heimatstadt Bad Tölz, Pfarrer sein würde.
Er brauchte fast eine halbe Stunde bis zum Pfarrhaus, denn das Haus vom Benedikt lag etwas abseits vom Dorf und ganz am südlichsten Ende.
»Der Benedikt«, murmelte Pfarrer Lommer vor sich hin, als er das Friedhofstürl öffnete, um den Weg zum Pfarrhaus abzukürzen. »Der Benedikt ist schon einer …«
Aber was er für einer war, das führte er nicht weiter aus.
***
Peter und Heinzi, die beiden Brüder, hielten sich noch immer fest an den Händen, als sie in den Hof einmarschierten.
Ihre Stiefschwester Mariele fütterte gerade die Hühner. Als sie die Buben ankommen sah, stellte sie das Gefäß mit dem Weizen auf den Boden und breitete die Arme aus. Die Buben begannen sofort zu rennen, wer als Erster die große Schwester erreichen würde.
Natürlich wurde der Peter Sieger. Heinzi kamen auch gleich die Tränen.
Mariele nahm den einen in den linken, den anderen in den rechten Arm und schwenkte die Kinder im Kreis herum, bis Heinzis Tränen versiegt waren.
Sie wollte sie gerade auf dem Boden absetzen, als die Selma, die man früher einmal die »schöne Selma« genannt hatte, aus der Tür des Wohnhauses stürzte.
»Sofort setzt du die Kinder ab!«, keifte sie. »Sie können sich ja den Tod holen, so erhitzt wie sie sind!« Sie riss ihrer Stieftochter die Buben aus der Hand und schickte sie ins Haus. »Und dir sag ich’s zum letzten Mal! Lass meine Buben in Frieden. Meinst du net, dass dir das endlich mal in dein Hirn reingeht?«
»Aber, Selma …«
»Du sollst net immer Selma zu mir sagen«, fing die Hellhauserin sofort wieder an zu schreien. Ihre schwarzen Augen funkelten böse, und ihr Mund wurde zu einem schmalen Strich. »Ich bin deine Mutter und …«
»Stiefmutter, und das lässt du mich ja auch jeden Tag spüren. Es ist bald nimmer auszuhalten mit dir, so wie du dich gegen den Max und mich benimmst.«
»Wenn’s dir net passt, dann musst du’s halt ändern. Ich brauch dich net auf dem Hof. Und je eher du gehst, desto lieber ist es mir.«
»Und der Max soll gleich mitgehen, was?«
»Freilich …« Die Selma lächelte böse. »Sonst kommt eh kein Frieden auf den Hof. Meinst du vielleicht, ich wüsste nicht, wie du und der Max über mich denkt? Für euch bin ich doch bloß geduldet! Ihr werdet es mir nie verzeihen, dass ich euren Vater geheiratet hab, nachdem er Witwer geworden ist.«
Mariele blieb ganz ruhig. »Ich hab dir schon oft gesagt, dass wir nix gegen dich haben. Wir machen unsere Arbeit, und du machst die deine. Aber den Kult, den du mit den Buben treibst, der ist ja nimmer zum Anschauen. Mir tun die zwei kleinen Kerle leid, denn so, wie du sie erziehst, werden das nie Bauern!«
»Bauern! Da lach ich ja! Kannst du mir sagen, wo die ihre Landwirtschaft betreiben sollen? Den Hof kriegt ja der Max. Und was bleibt dann für den Peter und den Heinzi? Die Knechte können sie spielen bei ihrem Stiefbruder. Und das lass ich net zu. Die Buben haben die gleichen Rechte wie ihr, dass du’s nur weißt.«
»Das musst du mit dem Vater ausmachen, Selma. Jedenfalls lass ich mich von dir net länger schikanieren. Nix kann ich dir recht machen. An allem hast du was auszusetzen.«
Selma drängte sich näher an Mariele heran. Es sah fast bedrohlich aus, wie sie ihr auf den Leib rückte.
»Jetzt sind wir allein. Niemand hört uns. Und deshalb will ich dir meine klare Meinung sagen: Such dir was anderes! Ich mag dich nimmer auf dem Hof, verstehst du? Und beim Vater brauchst dich deswegen net zu beklagen. Ich leugne alles.« Sie lächelte gehässig. »Ich hab nix zu dir gesagt. Jedenfalls wird es Zeit, dass du vom Tisch verschwindest.«
»Und wenn ich gegangen bin, dann wirst du den Max rausekeln, gell?«
»Vielleicht? Wer kann’s wissen? Für vier Kinder ist eben kein Platz auf dem Hof.«
»Du sollst deinen Willen haben, Selma. Denn du machst mir sowieso nur das Leben zur Hölle. Und damit endlich eine Ruhe wird im Haus, pack ich meine Sachen heute noch.«
Selma triumphierte. »Das ist aber mal vernünftig. Soll ich dir beim Einpacken ein bisserl helfen?«
»Damit du auch siehst, dass ich nicht etwa einen Schinken mitnehme? Ach Selma«, seufzte das Mariele. »Jetzt werde ich dir auch mal was sagen: Ganz schlecht bist du net, sonst hätte dich der Vater net geheiratet. Aber wie du uns Ältere aus dem Haus zu treiben versuchst, das ist eine Lumperei. Ich wünsch dir net, dass du mal dafür bezahlen musst.«
»Was ich bezahl oder net bezahl, darüber brauchst dir dein hübsches Köpferl net zu zerbrechen. Schau zu, dass du weiterkommst. Dann wird bei uns alles gleich anders werden.«
Mariele ließ ihre Stiefmutter stehen und ging in ihr Zimmer. Sie hatte Tränen in den Augen, denn sie hing an dem Hof, der ihre Heimat war.
Immer wieder von einem Schluchzen unterbrochen, begann sie zwei große Koffer zu packen.
»O Mama«, schluchzte sie, als sie das Bild ihrer verstorbenen Mutter von der Wand nahm und zwischen den Kleidern und Blusen verstaute. »Alles ist anders geworden, seit du uns verlassen hast. Es ist nimmer der Hellhauser-Hof, den du gekannt hast.«
Sie verschloss die Koffer und stellte sie in die Ecke. Dann holte sie den großen Wanderrucksack aus dem Schrank und eine fast ebenso große Leinentasche, die sie mit all den Sachen füllte, die sie in den nächsten Tagen brauchen würde. Die Koffer wollte sie abholen lassen, sobald sie eine Stellung gefunden hatte.
Ganz zum Schluss nahm sie ihr Sparbüchl aus der Truhe. Befriedigt nickte sie, als sie den nicht unbedeutenden Betrag las, der dort eingetragen stand. Etwas Bargeld besaß sie auch noch, das sie in ihrer Handtasche verstaute.
Mariele öffnete das Fenster und blickte in den Hof hinunter. Dann hinüber zu den Bergen, die nach ungefähr tausend Metern steil anstiegen und die bis zum heutigen Tag zu ihrem Leben gehört hatten wie die Kühe, Pferde und Schweine, die Hühner und die Tauben.