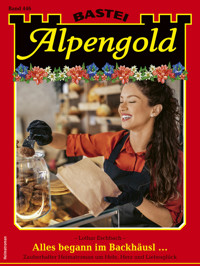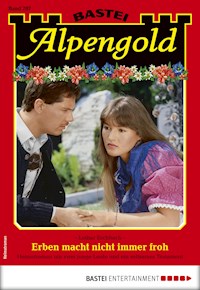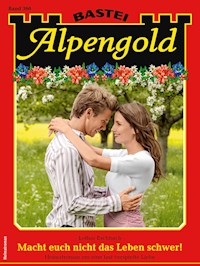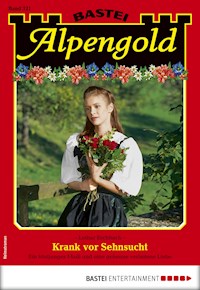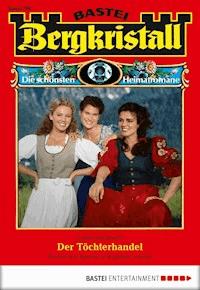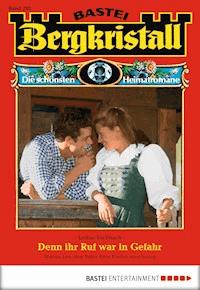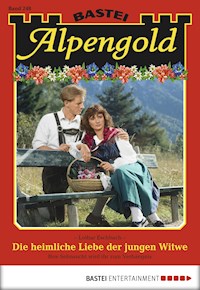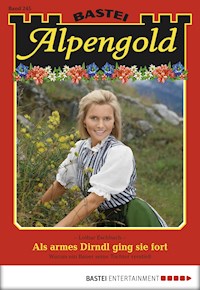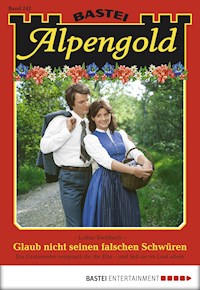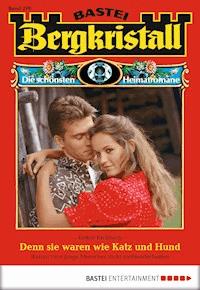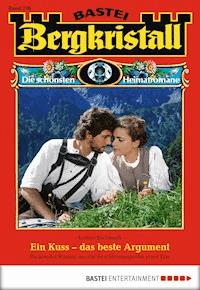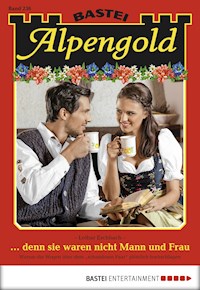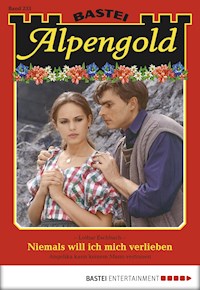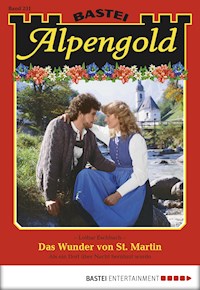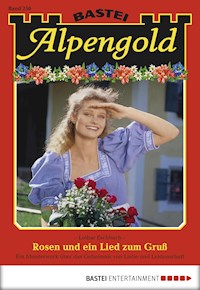
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alpengold
- Sprache: Deutsch
Andächtig lauschen die Besucher des Festgottesdienstes in der Dorfkirche zu Grainbach den Klängen der Orgel. Dann erhebt sich eine kräftige Männerstimme. Die Menschen in der Kirche vergessen schier das Atmen, als nun das Ave Maria erklingt. Männer und Frauen schämen sich nicht, dass ihnen vor Rührung Tränen über die Wangen laufen.
Auch Heidi Kreutzer, ein junges Mädchen, das in Grainbach Urlaub macht, ist von dieser "goldenen Stimme" begeistert. Und als sie nach der Messe den Sänger kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Nur noch ein Gedanke wirbelt in ihrem Kopf: Wie kann sie den attraktiven Mann für sich gewinnen? Und dann hat sie einen Plan: Sie verspricht ihm eine große Karriere ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 112
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Rosen und ein Lied zum Gruß
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Michael Wolf / Bastei Verlag
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-5183-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Rosen und ein Lied zum Gruß
Ein Meisterwerk über das Geheimnis von Liebe und Leidenschaft
Von Lothar Eschbach
Andächtig lauschen die Besucher des Festgottesdienstes in der Dorfkirche zu Grainbach den Klängen der Orgel. Dann erhebt sich eine kräftige Männerstimme. Die Menschen in der Kirche vergessen schier das Atmen, als nun dasAve Mariaerklingt. Männer und Frauen schämen sich nicht, dass ihnen vor Rührung Tränen über die Wangen laufen.
Auch Heidi Kreutzer, ein junges Mädchen, das in Grainbach Urlaub macht, ist von dieser »goldenen Stimme« begeistert. Und als sie nach der Messe den Sänger kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Nur noch ein Gedanke wirbelt in ihrem Kopf: Wie kann sie den attraktiven Mann für sich gewinnen? Und dann hat sie einen Plan: Sie verspricht ihm eine große Karriere …
Das Dorf Grainbach hatte nur knapp vierhundert Einwohner, aber diese vierhundert waren stolz. Manche nannten sie auch eingebildet und hochtrabend, je nachdem, ob man den Grainbachern wohlwollend gegenüberstand oder nicht.
Die Grainbacher waren wohlhabende Leute. Bauern mit großen Höfen, viel Wald und schönem Viehbestand. Weit abgelegen von den großen Durchgangsstraßen, die den Ferienverkehr wie eine Sintflut durchs Land ergossen, konnten sich die Grainbacher ihre Idylle bewahren.
Bis Matthias Weichenrieder, dem größten und reichsten Bauern des Dorfes, die Stille und Versunkenheit nicht mehr passte. Er wollte die »große Welt« nach Grainbach holen, wollte den Fremden die Schönheit der Landschaft verkaufen und ein rechtes Geschäft dabei machen.
Alle Voraussetzungen waren gegeben. Zwei Kilometer hinter dem Dorf lag der Hintersee, wahrscheinlich so genannt, weil er hinter dem Dorf lag, das sich ja schon früher als Mittelpunkt des bayerischen Alpenlandes betrachtet hatte.
Matthias Weichenrieder hatte also am Ortsausgang, mitten in einen herrlichen Obstgarten hinein, eine Fremdenpension gebaut. Und weil die gleich im ersten Jahr den Sommer über ausgebucht war, versuchten die übrigen Bauern, nachzuziehen.
Nur scheuten sie die hohen Investitionen eines Neubaus. Also wurden die ehemaligen, meist sowieso leerstehenden Gesindekammern notdürftig hergerichtet und damit in das Fremdenverkehrsgeschäft eingestiegen.
Die Gäste nahmen die Primitivität der Unterkünfte in Kauf, zahlten die zum Teil unverschämt hohen Preise, weil eben das Dorf und die Umgebung gar so schön waren und man hier die Natur noch unverfälscht genießen konnte.
Die Dörfler rieben sich die Hände, spotteten auch mal über die dummen Städter, denen man das Geld gehörig aus der Tasche ziehen konnte, und vermarkteten die Luft, den Wald, die Wiesen und den See, weil es die Bauern nichts kostete, aber recht viel einbrachte.
Es gab nur einen Gasthof in Grainbach. Den Gasthof »Zur Linde«. Hier mussten alle Urlauber essen, wenn sie es nicht vorzogen, in den nächst größeren Kurort zu fahren, der elf Kilometer von Grainbach entfernt lag.
In der guten Stube des Weichenriederschen Wohnhauses, das mitten im Dorf, der Kirche und dem Gasthof gegenüber, lag, hielten Vater und Sohn Saisonbilanz.
Benno rieb sich die Hände. »Bis zum 20. September ist alles ausgebucht, und das, obwohl wir in diesem Jahr mit den Preisen gleich um zwei Euro pro Bett aufgestiegen sind. Was sagst du jetzt, Vater? Hab ich recht gehabt oder net?«
»Übertreiben darfst du net, Burschi«, meinte sein Vater.
»Aber wo wir doch sozusagen ein Monopol haben! Wer kann denn das schon bieten? Jedes Zimmer mit Balkon und eigenem Bad. Schau sie dir doch einmal an, die Löcher, die die anderen für teures Geld vermieten! Da müssen sie zum Teil noch neben dem Stall aufs Häusl gehen. Und in der Hygiene, das weißt du doch, Vater, sind die Städtischen empfindlich. Und ich sag dir, das ist unsere Chance! In ein oder zwei Jahren geht nix mehr mit den Gesindekammern. Bis dahin müssen wir den Markt in Grainbach beherrschen. Wir müssen bauen, bauen und noch einmal bauen. Das Bauland gehört doch sowieso uns.«
»Aber das muss alles finanziert werden«, wandte der Vater ein, der nicht so ein Hitzkopf war wie sein Sohn.
»Nächstes Jahr wird geheiratet, und die Margit bringt einen schönen Batzen als Heiratsgut.«
»Um das Geld geht es net, Burschi, Geld haben die Weichenrieders selbst genug auf der Bank. Aber du musst weiterdenken! Überleg es dir, Burschi, wie du mich überzeugen kannst. Und dann reden wir weiter …«
Benno schluckte ein bisserl, weil er es überhaupt nicht leiden konnte, wenn jemand nicht seiner Meinung war.
»Gut, Vater«, erwiderte er nach einer Weile. »Ich beweise dir, was ich für ein Unternehmer bin. Staunen wirst du, grad die Augen wird es dir raustreiben, wenn du siehst, wie ich das Geschäft aufziehen tu.«
»Wenn du dich nur nicht übernimmst, Burschi! Die Stadtleut mögen es nämlich auch net, wenn man sie ausnimmt wie die gestopften Weihnachtsgänse. Pass ein bisserl auf, dass der Schuss net nach hinten losgeht …«
***
Es war ein weißer Mercedes, allerneuestes Modell, der langsam die Straße herunterkam. Am Steuer des eleganten Wagens saß eine schlanke Blondine, leicht unterkühlt und gelangweilt.
»Ich schätze, dass wir uns ganz schön verfahren haben«, sagte sie zu der neben ihr sitzenden Freundin. »Hier ist die Welt doch zu Ende, hier gibt es nicht mal mehr richtige Kühe.«
»Vielleicht täuschst du dich, Sabine. Dort steht ein hölzerner Wegweiser. Nach Grainbach sechs Kilometer …«
»Grainbach? Nie gehört. Ich bin dafür, den Weg zurückzufahren. Schauen wir doch in Garmisch vorbei und gehen heute Abend ins Spielkasino. Hast du keine Lust?«
Ihre Freundin Heidi schüttelte den Kopf.
»Ehrlich gesagt, nein. Jeden Abend die gleichen dummen und arroganten Gesichter, die mir bloß erzählen, was sie für schöne Villen haben und wo in aller Welt sie Golf spielen. Also wirklich, Sabine, die können mir gestohlen bleiben.«
Sabine Stiegelmayer lächelte. »Willst du vielleicht lieber über dem Kuhstall schlafen?«
»Nicht unbedingt, aber wir können uns dieses Grainbach ja wenigstens ansehen. Die Gegend hier ist doch bezaubernd.«
»Vielleicht sind es die Einheimischen auch«, spottete Sabine. »Aber bitte, wir haben ja Zeit …«
Sie bog in die geschotterte Straße ein und fuhr mit Tempo Dreißig an den Wiesen vorbei, holperte über eine Holzbrücke, durchquerte ein kleines Wäldchen, um dann urplötzlich das Panorama eines Tales vor sich zu haben, wie man es sich schöner nicht malen kann.
»Oh!«, stieß sie beinahe erschrocken hervor und brachte den Mercedes zum Stehen. »Das ist wirklich was zum Anschauen. So was Hübsches hab ich noch nie gesehen!«
»Ein Traum«, stellte Heidi Kreutzer fest. »Sollen wir hier ein paar Tage bleiben? Es wird doch so etwas Ähnliches wie einen Gasthof geben.«
Die beiden jungen Damen – es war schwer zu sagen, wer die hübschere war – machten einen ausgesprochen unternehmungslustigen Eindruck. Sabine Stiegelmayer war mehr der sportliche Typ, die brünette Heidi wirkte nachdenklicher und versonnen.
»Weißt du was?«, meinte ihre Freundin. »Wir fahren mal erst ganz langsam durchs Dorf und schauen uns alles an. Wenn wir was finden, ist es gut, wenn nicht, fahren wir wieder zurück. Bist du einverstanden?«
»Mit allem!« Heidi nickte. »Aber jetzt fahr endlich los. Ich bin schon wahnsinnig gespannt, wie das Dorf aus der Nähe aussieht.«
Sie erregten natürlich ein ungeheures Aufsehen. Obwohl um diese Zeit, es war früher Nachmittag, nur wenige Bauern und Feriengäste unterwegs waren, blieben fast alle stehen, als die beiden Damen im Schritttempo an ihnen vorbeifuhren.
»Was sagst du jetzt?«, fragte Heidi und deutete auf die barocke Zwiebelkirche, vor deren Eingang zwei riesige Linden ihre Äste ausbreiteten.
»Gasthof ›Zur Linde‹», erwiderte Sabine und zeigte auf die gegenüberliegende Seite. »Sollen wir mal fragen, ob ein Zimmer frei ist?«
Heidi hüpfte ungeduldig auf dem Ledersitz herum.
»Erst will ich das ganze Dorf sehen, dann treffen wir unsere Entscheidung, einverstanden?«
Sabine nickte und fuhr langsam weiter. Es war wie ein Spießrutenlaufen, aber ein sehr angenehmes natürlich, denn die Bewunderung in den Blicken der Betrachtenden war unverkennbar.
»Halt an!«, bat Heidi plötzlich. »Kannst du das Schild lesen? Pension Seeblick, man müsste also annehmen, dass es hier auch einen See gibt. Außerdem ist das Haus wunderschön mitten zwischen die Obstbäume gestellt. Das weit heruntergezogene Dach mit den kleinen Fenstern im Mauerwerk finde ich herrlich. Und überall an den Balkonen sind Blumen. Fragen wir doch mal, ob noch etwas frei ist.«
Sabine bog in den Sandweg ab und hielt direkt vor der Haustür. Kaum stand der Wagen, stürzte ein junger Mann heraus, der genauso aussah, wie sich die Städter einen Bauernburschen vorstellen: Kniebundhosen, weißes Leinenhemd, blonde Haare mit einem rötlichen Schimmer und unter der Nase einen heranwachsenden Schnauzbart.
»Grüß Gott«, sagte er mit strahlendem Lächeln und ließ dabei eine Reihe perlweißer Zähne sehen.
»Grüß Gott«, erwiderten auch die beiden jungen Frauen, und Sabine, die gern ihre Wirkung ausprobierte, schenkte ihm das bezauberndste Lächeln, das sie auf ihre dezent geschminkten Lippen bringen konnte. »Sind Sie der Besitzer dieser reizend gelegenen Pension, Herr … Herr …«
»… Weichenrieder, Benno Weichenrieder«, stellte er sich vor und bekam knallrote Ohren.
»Sind bei Ihnen zufällig noch zwei Zimmer frei? Wir finden es so wunderschön bei Ihnen, dass wir gern ein bisschen bleiben würden.«
Sein Gesicht verdüsterte sich.
»Leider net, also, das ist wirklich ein Pech. Aber wir sind vollständig besetzt. Sie … Sie dürfen mir glauben, dass ich Sie herzlich gern in der Pension Seeblick aufgenommen hätte.«
»Dann, Herr Weichenrieder«, stachelte ihn Sabine an, während sie ausstieg, »dann zeigen Sie mal, dass Sie als Hotelier über genügend Organisationstalent verfügen, um unsere Unterbringung möglich zu machen.«
»Gewiss, sehr, sehr gern, ich werde alles tun, was möglich ist. Aber zwei Einzelzimmer …?« Er zuckte die Schultern.
»Es darf notfalls auch ein großes Doppelzimmer sein.« Sie kam immer näher, bis sie schließlich nur noch knapp einen halben Meter vor ihm stand.
Ihr Parfüm hüllte ihn ein und schien ihm den Atem zu nehmen. Fasziniert starrte er auf die durchsichtige Chiffonbluse, die mehr preisgab, als sie verhüllte.
So etwas möchte ich einmal im Arm halten, schoss es durch seinen Kopf. Die Frau ist ja überirdisch schön …
»Ich … ich werd alles tun, was in meinen Kräften steht. Aber ein halbes Stünderl Zeit müssen Sie mir schon geben.«
»Gern, lieber Herr Weichenrieder«, gurrte Sabine, der es einen Mordsspaß machte, Benno durcheinanderzubringen. »Wie weit ist es denn bis zum See? Wir können ja den Wagen bei Ihnen stehen lassen.«
»Nicht weit, gar net weit, Sie brauchen bloß den Weg weiterzulaufen. Gleich hinter dem Wäldchen liegt er schon.«
»Dann also, bis gleich, Herr Weichenrieder. Und wir hoffen, dass Sie uns nicht enttäuschen werden.«
Sie schenkte ihm noch einen verheißungsvollen Blick, der Benno vollständig zum Rotieren brachte und verließ mit ihrer Freundin das Grundstück.
***
Am Anfang des Dorfes, etwas von der Straße abgesetzt, lag das kleine Anwesen der Verena Fuchsgruber. Es bestand aus einem ehemaligen Bauernhaus, einem winzigen Stall und einer Scheune. Aber rings um das Grundstück lagen die herrlichsten Wiesen, ab und zu von einer Obstbaumgruppe unterbrochen.
Verena Fuchsgruber war die Witwe des Revierförsters Ludwig Fuchsgruber, der vor sieben Jahren durch eine Steinlawine ums Leben gekommen war. Seit dieser Zeit lebte sie allein mit ihrem dreiundzwanzigjährigen Sohn Rudolf, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten und als Jungförster beim bayerischen Staat angestellt war.
Rudi, wie ihn alle in Grainbach nannten, war ein Freund vom Benno Weichenrieder, obwohl sie völlig verschiedene Typen waren.
Benno war ein Draufgänger, der einer zünftigen Rauferei nicht aus dem Weg ging; Rudi war still und zurückhaltend, eher sensibel als robust, und so war er am liebsten allein in Gottes freier Natur.
Der Herrgott hatte den Rudi Fuchsgruber unter den Grainbachern besonders ausgezeichnet. Er hatte ihm eine goldene Stimme geschenkt, die der Bursch an hohen kirchlichen Festtagen beim Gottesdienst erklingen ließ.
Seine Mutter lebte, wie Witwen manchmal auch heute noch leben: zurückgezogen von der Welt, kaum noch unter die Leute gehend und mit sich und ihren Gedanken allein. Sie konnte es noch immer nicht verwinden, dass gerade ihr so ein hartes Schicksal durch den frühen Tod ihres Mannes auferlegt wurde. Sie verlangte und erwartete nichts mehr vom Leben.
Sie saß auf der Bank vor dem Haus und putzte die Bohnen, die sie eben aus dem Gemüsegarten geholt hatte. Ihr Sohn saß neben ihr und trank eine Schorle.
»Soll ich dir net ein bisserl helfen, Mutter?«, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Wenn du magst, lies mir was aus der Zeitung vor. Oder noch besser, erzähl mir, was sich so im Revier tut.«
»Wenig, Mutter. Ich glaub, ich muss sagen: Gott sei Dank wenig. Auf Weilheim zu fangen die Bäum auch schon an zu kränkeln, aber bei uns ist der Wald in Ordnung. Ich frag mich bloß, wie lang wird das noch gutgehen. Niemand tut was, und die Fabriken blasen weiter ihren Schwefel in die Luft, als ob es gar kein Waldsterben bei uns gäbe.«
»Früher ist halt alles anders und vor allem besser gewesen«, mäkelte seine Mutter. »Wenn ich bloß daran denke, was es damals noch für Wiesenblumen gegeben hat. Im Juli waren die Almen voll von Arnika. Damals hat man die Blume noch net unter Naturschutz zu stellen brauchen. Da hat jeder pflücken dürfen, was er braucht hat. Aber heut …«