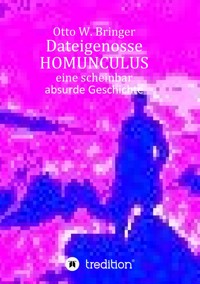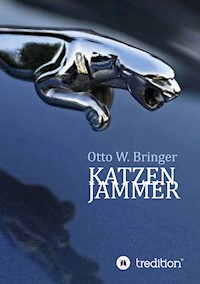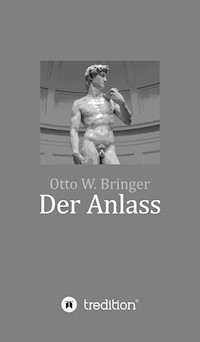4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust«, stöhnt Goethes Faust in seinem Meisterwerk »O lerne nie die andre kennen«. Ein jeder weiß oder spürt: Mal bin ich gut, mal bin ich schlecht, tröstet sich mit dem Wissen: Alle sind so konstruiert. Was soll's? Ich bin so wie ich bin. Da sind dann andere, die sagen: Ich will meine Möglichkeiten ausschöpfen. Tun, zu was es mich motiviert. Denken, träumen, handeln nach meinen Vorstellungen - und seien sie noch so verrückt und aus der Zeit gefallen. Eko, der Erzähler, begabt mit großer Fantasie, spürte nach dem Tod seiner geliebten Rose: diese zweite Seele lebt! Er verzweifelte zuerst, dann trieb sie ihn zu schreiben. Er schrieb Liebesbriefe an die Tote, Romane, Anklagen gegen den Zeitgeist, verwandelt Fotos in Gemälde, stellte sie aus in der Stadt, fuhr auf seinem Konzertflügel wie auf einem Traktor nach Italien. Alles Fantastische verwandelte er in neue Wirklichkeiten, stürzte ab und stand wieder auf. Er zweifelte dann und wann: Bin ich der, der ich bin? Philosophierte über Gott, den Sinn seines Lebens - das ein doppeltes ist: Real das eine, fantasiert das zweite. So ineinander verwoben, dass man glaubt, beide sind eines und wahr. Er begegnete der geliebten Frau, liebte sie, trankt mit ihr Vin Rosé aus der Provence. Wie im früheren Leben. Ich werde zweihundert, sagte er …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Otto W. Bringer
ALTER EGO Das andere Ich
Ein Geständnis
Copyright: © 2017 Otto W. Bringer
Satz: Erik Kinting –www.buchlektorat.net
Umschlaggestaltung und Fotos vom Autor.
Erschienen bei tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
,Ja, der Alltag ist in der Regel profan, unfrei, eintönig langweilig. Im Vergleich zu dem, was er noch sein könnte. Um sich das aber vorstellen zu können, braucht man Fantasie, Imaginationen, ja Illusionen. Abenteuer, die imaginieren, sind stets spannender als die, die man tatsächlich erlebt.
Mario Vargas Llosa
Literatur-Nobelpreisträger
Ich heiße Emil Konstantin Brotbecker. Bitte beachten, Becker mit e, nicht mit ä. In unserer Familie hat keiner Brote gebacken. Nur Kuchen meine zweite Mama. An jedem Sonntagvormittag nach dem Hochamt um Elf. Das Gebäck hatte genug Zeit abzukühlen bis nachmittags um Vier. Wenn wir Sechs, Papa, Mama und meine drei jüngeren Geschwister, am runden Tisch im Wohnzimmer Platz genommen hatten. Aufgeregt starrten auf den Kuchen in der Mitte des Tisches. Warteten auf Stiefmamas „Erst wird gebetet.“ Mussten bei jedem Essen auf solcherart Startsignale warten. Regelmäßig das Gebet vor und nach dem Mittag- und Abendessen. Auch bei der sonntäglichen Kaffeetafel.
Der einzige Tag in der Woche, an dem wir Kinder das Wohnzimmer betreten durften. Um Kaffee zu trinken oder mit den Großeltern beider Seiten Namenstag oder einen runden Geburtstag zu feiern. Wir Kinder bekamen dickflüssige Schokolade in bunten Keramikbechern. Die Eltern tranken ein schwarzes Getränk aus Porzellantassen. Echt Meißen, sagten sie. Der Kaffee käme aus Abessinien oder Mittelamerika. Weil nur dort das Klima für den Anbau von Kaffee günstig sei. Wir waren mit solchen Auskünften zufrieden. Noch keine Ahnung, welche Wirkungen Kaffee haben kann.
Die Wirkungen von Schokolade haben wir mehr als einmal erprobt und genossen. Schmierten uns den pappigen Rest aus dem Becherboden gegenseitig ins Gesicht, wenn keiner aufpasste. Leckten es dem anderen wieder von Nase und Wangen. Glücklich wie am Weihnachtsabend.
Nicht jeden Sonntag gab es Kaffee. Denn der war teuer. Öfter tranken sie Kaffeeersatz. Aus dunkel gerösteten, gemahlenen Gerstenkörnern. Papa sagte Muckefuck. Mama überzeugt, es schmecke wie Kaffee aus Honduras. Papa dagegen behauptete wie ungewaschene Schweißfüße. Trank ihn trotzdem, um den Frieden zu bewahren. Weil Sonntag war. Wir hatten unseren Spaß mit heißer Schokolade.
Warum sie mich Emil Konstantin nannten, wusste ich damals nicht. Glaubte aber, meine echte Mama und Papa hatten sich was dabei gedacht. Damals war es üblich, Kindern den Namen von Opa und Oma zu geben. Oder berühmter Leute. Von Kaisern zum Beispiel. Oder Heiligen. Mein Papa hätte mich sicher lieber Wilhelm genannt. Sein Vater, mein Großvater und dessen Vater hießen Wilhelm. Generationen sollten um die Jahrhundertwende Wilhelm heißen. Wie die letzten deutschen Kaiser, Wilhelm I. und Wilhelm II. Ich stelle mir vor, meine richtige Mama mochte den Kaiser nicht. Einen anderen im Kopf.
Vielleicht wünschte sie sich den Emil. Eines Abends, glaube ich war 5 Jahre, las sie mir keine der üblichen Lausbubengeschichten vor, sondern erzählte eine wahre Geschichte. Betonte das Wort wahre und errötete leicht, als sie es aussprach: „Ich hatte schon vor deiner Geburt Emil Jannings im Kopf. Wollte im Kino «Der blaue Engel» sehen. Man redete damals so viel darüber und ich war neugierig. Meine Mama aber war dagegen. Sie hatte den Film gesehen und meinte, es würde mir nicht gut tun, so kurz vor der Heirat. Ging stattdessen mit meinem Verlobten, deinem Vater, in «Faust, ein deutsches Volksmärchen». Auch mit Emil Jannings. Diesmal in der Titelrolle des Faust. Ein Kerl von Mann. Camilla Horn das schöne, aber unglückliche Gretchen.
Dein Papa ein stattlicher Zweimetermann, als ich ihn kennenlernte. Er gestand mir damals, ich sähe Gretchen ähnlich.“ Errötete wieder, als sie es mir erzählte. Fuhr fort: „Jetzt wusste ich, wir sind füreinander geschaffen. Legten sofort den Termin für die Hochzeit fest. Beschlossen unseren Erstgeborenen Emil zu nennen.“
Da wusste ich endlich, warum ich Emil heiße. Aber warum noch Konstantin? Ein Name genügt doch. Könnte sein, dass Mama einen zweiten Namen wünschte. Zwei Vornamen waren üblich. Auch dieser Konstantin muss ihr wohl sehr viel bedeutet haben.
Später, als sie schon sechs Jahre tot war, lernte ich auf dem Gymnasium die Geschichte der Römer kennen. Auch deren großen Kaiser Konstantin. Der sah vor seinem Kampf gegen Konkurrent Maxentius am Himmel das Zeichen des Kreuzes. Hörte eine Stimme: „In hoc signo vinces“ In diesem Zeichen wirst du siegen. Befahl, es auf die Fahnen seiner Regimenter zu heften. Und siegte. Die Milwische Brücke nahe Rom, an der es geschah, wird in der Geschichtsschreibung als Beginn des christlichen Abendlandes gepriesen. Alle Menschen dieses neuen Glaubens konnten ab da offen und ungestraft ihre Religion ausüben. Nach den schlimmen Verfolgungen durch Kaiser Diocletian.
Ob meine gläubige Mama mir deshalb den Zweitnamen Konstantin gab? Heute würde ich sie fragen, lebte sie noch. Tote kann man nicht mehr fragen. Finde mich damit ab, wohl oder übel. Meine Version musste mir genügen. Es hätte sich nichts geändert, wenn sie es mir erzählt hätte. Ich heiße Emil Konstantin. Und muss mich damit abfinden.
Bis Jahrzehnte später Marga, meine Frau starb, Rose, eine neue in mein Leben sprang mit vielen ihrer Freunde als Gratisgeschenk dazu. Ein neues Leben begann und schien auf Ewigkeiten ausgelegt. Es animierte mich zu Höhenflügen. Dichtete, fotografierte und malte kleine Aquarelle in Ocker, Grün und Blau. Eines Tages offenbarte mir Roses Freundin Barbara: „Emil Konstantin gefällt mir nicht. Viel zu lang. Viel zu umständlich. Auszusprechen brauchte es zwei Sekunden. Die man besser nutzen könnte, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Ich nenne dich Eko. Emil und Konstantin abgekürzt. Merkfähig und schnell ausgesprochen. Noch nie dagewesener Name. Hoffe, du bist d’ accorde.“ Sie war Französischlehrerin und ließ es mich wissen. Konnte ich da sagen: Non Madame?
„Avec plaisir“ und begann mich daran zu gewöhnen. Stellte mich vor den Spiegel, mein Gesicht zu sehen, ob es noch das ist, was ich kenne seit achtundfünfzig Jahren. Oder sich veränderte, wenn ich Eko sage. Redete wie mit einem Dritten: „Hallo Eko, was hältst du davon, heute Abend mit mir ins Kino zu gehen? Meine Stimme erkannte ich sofort. Das Kino in Düsseldorf kenne ich auch. Der neue Name Eko klang wie ego. Nur härter wegen des k.
Ego, so lernte ich im Lateinunterricht, heißt ich. Nichts anderes als ich. Der römische Philosoph Seneca sprach auch von einem anderen Ich. Nannte es Alter Ego. Ein Mensch ist nicht eine Person, sondern zwei. Die eine will so, die andere so. Eine weniger als Gott in drei Personen, die alle dasselbe wollen. Wie die Kirche immer wieder betont. Gründe vorschiebt, die man akzeptieren kann oder nicht. Glauben ist eine andere Sache. Aber ein Name ist Fakt, kein Glaubensbekenntnis. Mit der Zeit gefiel mir dieser Eko. Blieb dabei. Obwohl ich mein halbes Leben lang immer mal wieder anders gerufen wurde.
In der ersten Klasse wollte man mich hänseln, rief Emílie! Vielleicht weil ich oft ein geblümtes Hemd trug. Meine Stiefmutter liebte Geblümtes. Wenn Papa gute Laune hatte, rief er mich Jünken oder Kappesköppken. Düsseldorfer Dialekt. Kleiner Junge oder Kohlköpfchen in der Hochsprache. Er meinte es gut. Seine Stimme wurde weicher, wenn er ’s aussprach. Es fühlte sich an wie eine Liebkosung. Nie hatte er mich umarmt. Genauso wenig wie meine Stiefmutter. Mag sein, sie glaubten, Nähe gefährde ihre Autorität. Selber so erzogen.
Nur meine leibliche Mama Elli umarmte mich. Zärtlich und heftig zugleich. Nicht nur vor dem Einschlafen. Auch jedes Mal, wenn ihr auf der Geige eine Sonatine von Hayden oder Mozart gelungen war. Sie war sehr begabt und spielt in jeder freien Viertelstunde. Ich war gerade sechs, als sie starb. Papas zweite Frau Auguste war vollkommen unmusikalisch. Wenn sie Emil Konstantin rief, klang es wie ein Befehl. Ihr Gesicht schien versteinert.
Zum Ausgleich riefen mich Pfadfinderfreunde Émiko. Mit der Betonung auf der ersten Silbe. Das fand ich gut. Hat Kumpelhaftes. Ein Kumpel wollte ich sein. Der Vater meiner zweiten Frau Rose verschluckte den Emil total. Nannte mich Constantínus mit C, wenn er mir zum Geburtstag schrieb. Betonte die dritte Silbe, wenn wir miteinander redeten. Hing ein -us- daran. Meinte, Lateinisch klänge es schöner. Außerdem sei es ein Zeichen höherer Bildung. Beim Angesprochenen und dem, der es sagt. Als Lateinschüler kapierte ich es sofort. Und war stolz darauf als ein solcher anerkannt zu werden. Wusste ich doch, der römische Kaiser Constantinus machte Byzanz zu seiner Residenz und gab ihr seinen Namen: Constantinopolis, Stadt des Konstantin. Derselbe, den meine Mama sicher im Kopfe hatte, bevor sie mich taufen ließen. Dass Konstantinopel jetzt Istanbul heißt, wird mich ärgern bis zum Jüngsten Tag.
Rose, meine Neue liebte mich sehr, wie auch ich sie sehr liebte. Von der ersten Sekunde an. Nannte mich Chou, schon drei Wochen nachdem wir uns kennengelernt hatten. Nicht ChouChou wie Franzosen den Liebling in ihren Familien. Beschränkte sich auf ein Chou. Schneller ausgesprochen und meint dasselbe: Liebling. Chou ist Französisch und heißt auf Deutsch Kappes oder Kohl, um es vornehmer auszudrücken. Papas Liebkosung wieder aktuell, nachdem Rose mich so nannte. Was aber Kohl mit Liebling zu tun hat, weiß ich bis heute nicht. Kohl mag ja gut sein für Suppen und Sauerkraut. Zu was bin ich gut?
Mein Selbstbewusstsein entwickelte sich peu à peu. Nach jedem Erfolg ein bisschen mehr. Jahre später zu voller Größe aufgegangen wie Mohnblüte in der Morgensonne. Als mich alle Welt Eko rief, war ich ich. Ego und Alter Ego. Emil und Konstantin begraben. Nur noch im Geburtsregister und auf diversen Ausweisen. Bei Geschäftspartnern und Studenten in der Akademie heiße ich Brotbecker. Mit e, nicht mit ä.
Rose sei Dank. Seit achtundzwanzig Jahren meine Frau. Nachdem Marga, die erste sich ohne Anlass, wie mir schien, aus diesem Leben verabschiedete. Psychisch krank und nicht mehr gebraucht. So las ich es in ihrem Abschiedsbrief. War lange Wochen ratlos und traurig. Fragte mich: Bin ich schuld an ihrem Suizid? Hatte mich in der letzten Zeit nicht viel um sie gekümmert. Gerade zwei Kunden verloren. Fühlte mich wie ein reuiger Sünder. Und wusste, es hilft nichts.
Nach diesem Elend kam Rose wie ein Engel in mein Leben. Und ich war glücklich wie nie zuvor. Schrieb Gedichte noch und noch. Dieses Glück in Worten zu verewigen. Schrieb Konzepte für Firmen, die ich als Kunden gewinnen wollte. Und gewann. Taumelte von Erfolg zu Erfolg. In einem der wenigen nüchternen Augenblicke wurde mir bewusst, ich kann schreiben. Andere mit Worten animieren danach zu handeln. Gedichte schön klingen lassen, ohne dass sie sich reimen müssen wie früher. Schildern so, dass Bilder in Köpfen entstehen. Nachdenken lassen über das, was plötzlich wichtig ist. Bedeutung hat für mich und andere. Ist es der liebe Gott meiner Kindheit, der es mir eingibt? Oder Apollo, griechischer Gott der Künste? Wer oder was es auch ist, das mich beflügelt. Ich bin ein Optimist und hoffe, alles wird gut.
1
Übermorgen werde ich Achtzig. Alt wie ein Opa, geht mir flüchtig durch den Kopf. Denke, andere sind bereits Ur-Opa. Kann nichts mehr nachholen. Habe keine Enkel, Urenkel nicht dass ich wüsste. Meine Töchter sind mit ihrem Beruf verheiratet. Und erfolgreich. Géla als Kostümbildnerin an der «Opera modern» in Yew York. Ule, die jüngste, Tanztherapeutin in Hamburg. Sie haben einen Freund, aber keine Kinder. Sie müssen sich mögen wie Adam und Eva im Paradies vor dem Rausschmiss. Doro, die dritte verheiratet, geschieden. Mit einem Schwarzen nach Afrika gegangen. Und seit 11 Jahren tot, begraben in einem afrikanischen Kral.
Meinen 80en Geburtstag will ich im «Altenberger Hof» feiern. Groß mit allen Geschwistern, noch lebenden Verwandten und Freunden. Viele Kinder werden dabei sein. Enkel meines Bruders. Hübsch, Enkel zu haben, denke ich. Auf dem linken Knie den Jungen, dem rechten das Mädchen. Solange sie klein sind und niedlich. Jungbrunnen geht mir durch den Kopf. Wische den Gedanken wieder weg, konzentriere mich auf das Fest.
Groß soll mein Achtzigster gefeiert werden. 80 schon eine Zäsur in meinem Leben. Wir haben unser Haus verkauft. Vieles, an dem wir hingen wie am Leben. Den geliebten Bösendorfer- Flügel inklusive. Nur die Betten und das chinesische Altarschränkchen, ein paar Bilder mitgenommen, ein Viertel unserer Bücher. Die venezianische Maske der Medusa. Den 80x80 cm Badezimmerspiegel, das breite Waschbecken, in dem ein Baby plantschen kann. Möbel, Hausrat und Bücher verschenkt.
Meine Rose hat ein Lungenemphysem. Atemprobleme schon lange, bevor wir uns kennenlernten. Sie ließ es mich all die Jahre nicht spüren. Ich ahnungslos, bis es schlimmer wurde. Sie mich fragte: „Was wirst du tun, wenn ich einmal nicht mehr bei dir bin?“ Ab da merkte ich, dass sie immer häufiger stehen blieb, Sauerstoff inhalierte. Und rasch müde wurde. Schwor mir: Ich will ihr das Leben so leicht wie möglich machen. Wie lange mag es gut gehen? Frage nicht weiter, hoffe wider alle Hoffnung. Ich bin geboren um lange zu leben, zu lieben. Fühle mich jung, kreativ und voller Elan. Rede es mir immer wieder ein. Sodass ich es letzten Endes glaube. Rose ist und bleibt die große Liebe meines Lebens. Jünger als ich schien sie nicht älter zu werden. Immer noch eine schöne Frau. Gesicht eines Engels. Ihre Augen sind jetzt verschattet. Als horche sie nach innen, ob es atmet? Ich nehme es hin, blind vor Glück wie in all den Jahren vorher. Sie wird nicht sterben, nie.
Wird sie wirklich nicht sterben? Wenn ich darüber nachdenke wie unter Zwang, habe ich eine Vision im Kopf. Oder ist es mein Alter Ego, das fantasiert? Alles bleibt wunderbar, geht weiter wie bisher. Stelle mir vor, wir würden beide reifer, gelassener. Hätten Kinder und Enkel, mit denen wir ganz von vorne beginnen könnten. Und alles besser machen. Erleben, wie sie größer werden, intelligenter. Von mir als Opa hätten sie die Gene der Kreativität. Von Rose das weltoffene Temperament. Der Junge ein Künstler. Das Mädchen wortgewandt wie seine Mama.
Wische die Vision weg. Hier spielt die Musik. Der Organist des gotischen Doms soll für mich die Sonate von Camillo Schumann in a-moll spielen. Musik an der Grenze zur Moderne. Aber klangmächtig wie Bach. Mit allen neunundachtzig Registern auf vier Manualen und Pedal. Die wundersame Gewalt der Töne in den Gewölben widerhallen lassen. Um in den Herzen aller zu bleiben, die mit mir gekommen sind.
Altenberg war und ist für mich immer noch etwas Besonderes. Mit dem gotischen Dom, schlank hoch aufragendes Himmelsgewölbe. Geradezu karg, von nüchterner Einfachheit der Innenraum. Prinzip der Zisterzienser. Für die Jugend bis heute ein Ort, Gemeinschaft zu üben. Pfadfinder trafen sich dort einmal im Jahr. Wohnten in ehemaligen Mönchszellen des Klosters. Ich, einer von ihnen damals. Freute mich riesig dabei zu sein. Eine Woche den elterlichen Zwängen zu entrinnen. Sang mit allen im Chor dreistimmig Kirchen- und Wanderlieder. Murmelte Gebete, schwieg und dachte nach. Über Gott und Engel und Teufel. Den Sprung in die Ewigkeit zu wagen riskierte ich lieber nicht. Wer weiß, was mich dort erwartet? Spielte lieber Tischtennis auf dem Platz. Träumte am nächtlichen Lagerfeuer vom Helden, der ich sein wollte. An meine Familie mit Eltern, Tanten und Großvätern dachte ich nicht. Und nicht an ein Leben nach dem Tod.
Im «Altenberger Hof» ist die Tafel festlich gedeckt. Kerzen in silbernen Leuchtern, weiße, gelbe, rosa und lila Anemonen in gläsernen Vasen. Das Essen schmeckt. Freund Aloys lobt mich über den grünen Klee. Ich sei Apoll und Dionysos. Feingeist und pragmatischer Genießer in einer Person. Alle freudig erregt. Nur meine Rose nachdenklich, nach innen. Nie mehr seit diesem Abend wie früher. Lächelte und lächelte nicht. Wir zogen ins Seniorenstift.
„Lasst uns noch einmal Urlaub in Montegrotto machen“, schlage ich ihr vor. „Bin sicher, es wird deiner Lunge gut tun.“ Es änderte sich nichts. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Quäle mein Gehirn, herauszufinden, womit ich ihr das Leben erleichtern könnte. Ein Leben, das keines mehr ist wie es war. Obwohl ich es ihr und mir so sehr wünsche. Lenke mich ab und fotografiere. Portraits von Obst und Gemüse. Verwandele sie im Computer in Gemälde, Kreidezeichnungen oder Holzschnitte. Riskiere zu abstrahieren. Es wurden schöne Metaphern des Lebens, wie ich meinte. Reifen und lösen sich auf in Abwesenheit. Sie sollen ausgestellt werden zum 25. Jubiläum des Hauses. Es gelingt mir die Kultur-Referentin für meine Art der Verfremdung zu gewinnen. Später auch für Vorträge über Kunst und Architektur.
Bewohner halten uns für Außenseiter. „Was wollen Sie denn hier im Seniorenstift?“ Fragt eine Frau, als wir ihr verliebt Arm in Arm und lachend begegneten. Sie schiebt einen Rollator vor sich her. Ihr Mann sieht mich an, als wäre ich ein übrig gebliebener Hippie, mit Kinnbart und langen Haaren. Später, als meine Bilder an allen Wänden hingen, war ich für nicht wenige der Sonderling. Verkanntes Genie. Oder vom Alleinsein um den Verstand gebracht. Ein halbes Jahr später nach Roses Tod. So anders sei alles, was ich mache. Bilder ausstelle, die sie nicht für Kunst halten. Goldgerahmte Drucke von Degas’ Tänzerin, Raffaels Madonna und Spitzwegs Poet in ihren Appartements. Neben Fotos von ihnen als Kinder, die sie wünschen wieder zu sein. Im Speisesaal hat uns nie einer gesehen. Weil wir in der Stadt essen oder selber kochen. Gemeinschaft mit so vielen Grauhaarigen schreckte uns ab. Gemeinschaftsküche sowieso. Wir hatten uns selbst verwöhnt und stellten hohe Ansprüche. Auch ans Essen.
Langsam begriffen, dass wir es sind, die dieses Leben führen. Als plötzlich alles anders kommt. Rose hat starke Schmerzen handbreit über dem Hüftknochen. Dr. Mendel, unser Hausarzt, diagnostiziert Darmverschluss. Tatütata in die Klinik. Ich sitze jeden Tag an ihrem Bett. Bibbere und bet zur Heiligen Mutter Maria vor ihrem Altar im Freiburger Münster. Zünde jedes Mal eine Kerze an. „Ave Maria, mater dei, ora pro nobis!“ Katholizität sitzt tief. Vier Wochen REHA. Wir hoffen das Schlimmste überstanden. Kurz darauf der zweite Darmverschluss. Operation. REHA. Vier Wochen später der dritte. Noch nicht entlassen, einen Tumor im Gehirn entdeckt. Zum vierten Mal operiert. Vier lange Narkosen hatten den Rest ihrer kranken Lunge zerstört.
„Die Tage sind dunkel wie nie – lass es genug sein Herr – schick deinen hellsten Engel – an Weihnacht wäre schön.“
Die Ärzte wissen nicht weiter. Vielleicht eine Maximaltherapie? Viel helfen wird ’s nicht. Möchten Sie ’s trotzdem? Was soll ich antworten? Habe ihr Gesicht vor mir. Die Augen geschlossen, als wäre sie schon jenseits dieser Welt. „Fragen Sie sie selbst.“ Ich war nicht fähig, ja zu sagen oder nein. „Frau Brotbecker, Möchten sie, dass wir Ihnen noch einmal eine Infusion geben? Viel können wir Ihnen nicht versprechen.“ Sie bewegt den Kopf heftig nach links, nach rechts. Nein!
Heiligabend 2009 sitze ich wieder an ihrem Bett. Abwesend und doch ihr so nah, dass es schmerzt. Sie liegt wie tot, die Augen geschlossen. Beuge mich über sie, die rechte Wange auf ihre Brust gepresst. Fühlen, was zu mir gehört. Und bald nicht mehr. Weine. Weine wie nie in meinem Leben. Mein ganzes Sein verflüssigt sich in Tränen. Bis nichts mehr da ist nur noch Meer, so tief, so weit. Und ich versinke. Habe ihr die Verantwortung zugeschoben. Mich zu entlasten. Spüre plötzlich ihre Hand. Streichelt meinen Kopf. Mit letztem Atem haucht: „Ich liebe dich.“ Ich kann es nicht fassen. Starre auf ihr Gesicht wie hypnotisiert. Und warte. Gleich schlägt sie die Augen auf, sieht mich an. Hoffe wider alle Hoffnung. Die Kerze auf dem Nachttisch flackert, erlischt. Nichts mehr. Küsse ihre noch warme Stirn. Und denke an nichts. Die Welt ist draußen, irgendwo.
Die Wochen danach Routine. Nur das getan, was getan werden musste. Gesteuert von Notwendigkeiten. Im Hirn fremdes, fühlloses Stück Stein. Steine im Bauch, den Füßen, in allem, was mich weiterbringen könnte. Hing wie ein Felsstück am Abhang eines Lebens, das nicht meines war. Nichts rührte mich von der Stelle. Könnte ich doch fallen. Dahin, wo meine Rose ist, ins dunkle Nirgendwo. Doch Rose eine Fremde, so weit weg von mir. Wochen vergingen, bis sie wieder bei mir war. Meine Gefühle, meine Gedanken bewegte. Bewegt immer nur in eine Richtung: Was ging in ihrem Kopf vor? An was dachte sie zuletzt? Hatte sie himmelschreiende Angst vor dem Aus?
Dem endgültigen, hinter dem das Nichts lauert. Oder hatte sie sich arrangiert mit dem Unausweichlichen? Ihr Gesicht entspannt zuletzt. Wie bei allen Toten. Aber die Frage bleibt.
Warum habe ich sie nicht nochmal behandeln lassen. Vielleicht hätte es doch geholfen. Warum habe ich sie nicht getröstet? Als alles entschieden war. Obwohl ich nicht weiß mit was ich es hätte tun sollen. Worte berühren nur den Rand der Dinge. Fast ein ganzes Jahr mich noch gefragt, gefragt, gefragt und nie eine Antwort bekommen. Antwort, die es nicht geben kann. Gemerkt, ich bin allein. Und werde es lange sein.
Beginne zu schreiben. Ob ein Buch daraus wird weiß ich nicht. Über das Leben eines, der allein ist. Angewiesen auf das, was er erinnert. Beobachtet, was um ihn herum passiert. Und alles, was er sich vorstellen kann in seiner Fantasie. Heraus kommt immer dasselbe, über das ich schreibe: Alle Gedanken drehen sich um Rose, Rose, Rose. Allein sein ist weiß Gott ein Anlass sich zu drehen, sich zu besaufen oder zu fantasieren. Beschließe, meinen Computer updaten zu lassen und tippe los.
Sieben Jahre lebe ich jetzt im Seniorenstift. Mit dreihundert auf das runde hundert zu schleichenden Mitbewohnern. Weniger Männer als Frauen, die ihre Partner meist überleben, weil sie von Natur aus prädestiniert sind für das Leben. Das Gebäude konzipiert für Leute, die in ihrem Arbeitsleben einiges mehr verdient haben als die Putzfrau, die einmal pro Woche mein Appartement reinigt. Aber die Gute weiß genau, was sie tun muss. Die Augen auf alles gerichtet, was ihrem Blick für Sauberkeit im Wege ist. Im Gegensatz zu den meisten ihrer Urlaubsvertreterinnen, die kommen, wischen, saugen mit der Krachmaschine, weg sind sie.
Rose hatte der unsrigen mit allen Details erklärt was und wie sie es gerne hätte. Alldieweil sie auch eine schnelle ist, macht sie in derselben Zeit mehr als der Standard vorgibt. Weil ich ihr hin und wieder eine Tafel Schokolade, Weihnachten einen Panettone zuschiebe, ist sie noch schneller. Engagiert sich, als wäre es die eigene Wohnung. Fragt: „solle mer nit noch de Schrank innedrin schö sauber mache? Nächst Woch komm ich mit de große Maschin, mach de Flecke weg aufm Teppich.“
In meiner aktiven Zeit war ich nach dem Studium der Architektur Unternehmensberater. Und künstlerisch aktiv in meiner freien Zeit. Besaß eine mittelgroße Agentur für Kommunikation und das Vertrauen vieler Firmenchefs. Was mir, Partner und Mitarbeitern fast durchgängig ein gutes Einkommen sicherte. Einmal in der Woche hockte ich in der Akademie zusammen mit dreißig bis vierzig Studierenden. Ihnen das ABC von Kommunikation zu verklickern, die verkauft. Heute würde ich es anders machen: Vertrauen herstellen. Zwischen denen, die anbieten und denen, die abnehmen. Anordnen und ausführen. Reden und zuhören. Wörtlich genommen.
Ich konnte mir einen Jaguar leisten. Nach meinem Ausstieg mit 73 aus dem Agenturgeschäft und noch sieben Jahren Selbständigkeit tauschte ich den großen gegen den kleineren Jaguar S-Type. Neues Modell, orientiert am Design des legendären Vorgängers. S-Type, der letzte, der noch wie ein Jaguar aussieht. Fahre ihn jetzt im vierzehnten Jahr. Kaufe keinen neuen. Weil die Modelle mir nicht mehr gefallen. Aussehen wie alle anderen der gehobenen Klasse. Die im Windkanal errechnet, statt wie früher im Kopf eigensinniger Designer ersonnen werden.
Bei mir aber ist Autofahren mehr noch Nostalgie. Ein dickes Paket von Erinnerungen macht sich schwupps in meinem Wagen breit, sobald der Motor anspringt. Nicht tot zu kriegen dieses Denken an. Unmöglich es hinter mir zu lassen, so schnell ich auch fahre. Mein bisheriges Leben fährt mit.
Schnelles Fahren aber hält sich jetzt in Grenzen. In meinem Alter ist Vorsicht die Mutter der Karambolage. Die 235 PS müssen sich nach dem Tod meiner Frau mit Tempo achtzig zufrieden geben. Dem nahen schwarzen Wald auf der rechten Seite des Rheins und dem Elsass auf der linken. Allein traue ich mich nicht mehr 4000 Kilometer zu fahren. Obwohl ich mich für vieles noch fähig halte. Damals bis zur Amalfitana und zurück. Auf den Spuren des Stauferkaisers Friedrich II. nach Apulien. An die Loire, Dordogne, Provence, Côte d´ Azur. Mallorca mit Wagen und Fähre. Iberische Halbinsel. Nordseeküste. England. Ägypten. Wir wechselten uns ab am Steuer. Umwege und Zwischenaufenthalte willkommen. Da wo es schön war blieben wir.
Alles noch im Kopf über meine von Genen und Training gut ausgebildeten Sinnesorgane. Duft von Bouillabaisse in der Nase, wenn nur den Name schon fällt. Auf der Zunge Bistecca Fiorentina. In den Ohren Bachs wunderbare Cellosonate im tausendjährigen Dom von Ravello. Gespielt vom weltbesten Cellisten Mstlaw Rostropowitsch. Brahms’ Gutenachtlied in der Klosterscheune von Meslay, Loire. Fado in Lissabon. Den näselnden Singsang im Al Khalili, Kairo. Die Knef in Köln. Paolo Conte, den singenden Rechtsanwalt aus Piemont in Düsseldorf. Bildete mir ein, sogar den Gesang der Nachtigall zu hören in burgundischen Nächten. Als hätte meine Seele darauf gewartet. Die immerfort sägenden Zikaden in der Provence aber weckten mich nicht aus dem Schlaf.
Auch Roses kluge Worte fanden meine Ohren. Das linke früher als das fast taube rechte. Schnelle Pfeile, die schon im Gehörgang saßen, bevor ich sie begriffen hatte. Trotzdem harmonierten wir anstrengungslos, weil wir uns liebten. Sahen, rochen, hörten, fühlten, schmeckten die Welt als wären wir eine Person. Mit unterschiedlichen Neigungen sie zu deuten.
In unseren Augen die ganze Welt. Gleichzeitig wahrgenommen. Verschieden erlebt und immer wieder in Gesprächen aufleben lassen. Das Rot des Mohns, Ultramarin der Iris. Unverkennbares Markenzeichen des französischen Malers Yves Klein. Menschen- und Gotteshäuser aus dem hellen Stein der Gegend. Oder toskanarot gebackenen Ziegeln. Zu Gebirgen aufgeschichtet bis an die Wolken.
Kathedralen von Gestern und Heute lassen das Tempo der Zeit erkennen. Stalagmiten in Tropfsteinhöhlen ihre Langsamkeit. Straßen, die Städte in Viertel, Achtel oder Hundertstel teilen. Schlösser, in denen von schönen Prinzessinnen nur noch Bilder zu sehen sind. Gärten nur noch blumige Erinnerungen.
Und immer wieder Kunst. Bilder, Skulpturen, Bauwerke auf unseren Reisen bewundert. In Details verliebt. Vor Grünewalds Isenheimer Himmelfahrt auf die Knie gesunken. Giottos Fresken bestaunt. Michelangelos David. Palladios Villen, Dome unbekannter Baumeister. Die Farbwunder im faksimilierten Stundenbuch des Duc de Berry geschaut und gelesen, was wir nicht wussten. Die neuen Wilden in ihren farbigen Exzessen begrüßt. Wenn wir nicht die Augen gehabt, hätten wir nicht den schönen Schein von Wirklichkeiten entdeckt. Das Hintergründige geahnt. Die Meerbrasse im Salzmantel geschmeckt.
Auch fremde Menschen nahmen wir zuerst mit unseren Augen wahr. Gesichter, Figura und Kleidung. Neugierig, was sich dahinter verbirgt. Sprache gestottert. Freunde geworden nicht selten. Gemeinsam mit ihnen Kürbisse geerntet im Garten hinter dem Haus. Am Tisch mit der ganzen Familie die sattgelb schäumende Suppe gegessen. Von farbigen Tellern aus Gmundener Keramik, waren wir in der Steiermark. Jeder Tag unterwegs ein Fest für die Augen.
Nichts vergessen, was wichtig und weniger wichtig war. Auch ganz Gewöhnliches, Alltägliches bleibt präsent. Wenn Rose sich nach dem „Schlaf gut“ mit großem Schwung umdrehte. Als freute sie sich in Morpheus Armen zu versinken. Um von ewigen Göttern zu träumen. Der flüchtige Morgenkuss. „Fahr vorsichtig.“ Unvergessen das leidenschaftliche Miteinander wo auch immer. Alles erlebt mit meiner Rose. Gesehen, gefühlt, gehört, geschnuppert und geschmeckt. Alles im Gehirn gespeichert.
Meine Sinne sensibilisiert durch 28 Jahre Rosenduft. Leitfaden durch die Zeit. Unterwegs und Zuhause. Nenne die neue Wohnstatt Zuhause, auch wenn es keinen Vergleich mit unserem Haus bei Düsseldorf aushält. Nur noch zweimal vier Wände, ein Flur, in dem meine Bilder hängen. Portraits von Rose, Bilder mit stets wechselnden Motiven. Bücher und DVDs gestapelt. Einzig die Betten und das rot lackierte chinesische Altarschränkchen fanden Platz. Darüber meine Urgroßmutter, gemalt von ihrem Bruder Fritz Beincke. Bekannter Maler im 19ten Jahrhundert.
Sie schaut mich unentwegt an, wenn ich vorbeigehe. Öfter als einmal am Tag. Noch wenn ich das Haus verlasse, spüre ich ihren Blick im Rücken. Sie muss eine starke Frau gewesen sein. Über Generationen hinweg verlangt sie Aufmerksamkeit. Versuche mich dieser Suggestion zu entziehen und schaffe es nicht. Liebe die Freiheit – und bin gefesselt. Von schöner Kunst, sage ich mir immer wieder und fühle mich frei. Für den Moment, an dem ich es sage.
Über den Betten das Schlangenhaupt der Medusa. Von Göttin Athene im Zorn verunstaltete Geliebte des Meeresgottes Poseidon. Schlangen statt Haare und Klauen statt Hände und Füße. Eifersuchtsdrama in Gestalt einer ausdrucksstarken Maske für Venedigs Karneval. Erinnert an Rose und tröstet mich, weil es schöne Kunst ist. Das Bad einrichten lassen mit unseren Sachen. Alles andere neu und weiß für ein bescheideneres Leben. Von dem wir wussten, es ist der letzte Akt unseres ganz persönlichen Melodrams. Schlussakkord gewissermaßen.
Der frühe Tod meiner Rose schrillte Missklang in meine Vorstellungen von gelassenem Alt werden. Von Tränen und Fassungslosigkeit komponiertes dramma melancholica. Grund, das Bett als mein Zuhause einzurichten?
Auch wenn nachtdunkle Traurigkeit mich überfällt, will ich nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Obschon die Last der Gedanken schwer ist. Wärme lockt. Ein Rest von Roses letztem Parfüm, die Stirn in ihr Kopfkissen zu drücken. Das kühle Linnen zu spüren und bleiben bis mich der Atem verlässt. Rose erinnerte mich einmal an Winston Churchill, der im Bett seine Memoiren und viel Gescheites schrieb. Dafür den Literatur-Nobelpreis gewann. Ich solle es auch mal versuchen. Sie setzte große Hoffnungen in mich.
Irgendwann vielleicht, dachte ich damals. Fragte mich, wie fang ich ’s nur an? Heute weiß ich, dass ich schreiben kann. Halte Augen, Ohren, Nase und Mund auf. Den Verstand bereit. Sage mir, nimm alles auf, was ist und noch kommt. Ich will bereit sein, mich dem Endgültigen zu stellen. In Fragen eindringen und nach Antworten suchen. Die mich quälten sonst bis an mein Ende. Will erfahren Schönes und Hässliches. Freud und Leid. Mit allen Konsequenzen. Wie damals in der Klinik. Wollte dabei sein, als man die noch offene Operationswunde meiner Rose mit flüchtigen Stichen wieder vernähte. Als lohnte Sorgfalt sich nicht mehr. Eine Woche bevor der Tod das arme Menschenkind dahin holte, wo alle landen. Und bleiben wo angeblich der Pfeffer wächst.
Ja, ja die Erinnerungen. Alles erinnert mich an Rose. Alles. Wo immer ich mich aufhalte im Appartement. Wohin ich fahre, an was ich denke. Was ich sehe. Den Parfüm-Flacon im Bad, dessen Puste verstopft ist von Abwesenheit. Den rosa Bademantel schlapp am Porzellanhaken aus Mallorca. Traurig wie ein gehäutetes Kaninchen. Rote Slipper, liegen gebliebene Modelaune zwischen Schrank und Fußleiste.
Kamelhaarmantel am Reck. Fünf Jahre kein Benzinbad mehr gesehen. Salzfass, Mehl-und Thunfischdose im Schrank, der Zuckertopf. Gewürze jede Menge. Die gläsernen Preziosen für den Weihnachtsbaum in der Schublade neben den Servietten. «Die Gräfin» im Regal, nicht mehr zu Ende gelesenes Buch über die Dönhoff von Klaus Harpprecht.
Und die Gespräche mit ihr über alles, was sie gelesen und in ihrem klugen Köpfchen zu Ihrem gemacht hat. Immer wieder abrufen konnte im Gegensatz zu mir. Historische Figuren, besonders Frauen ihre Favoriten. Ihre Zeit, ihre Macht oder Ohnmacht. Wir hatten genug Gesprächsstoff für lange Abende.
Auch Bilder sind es, die an Rose erinnern. Schönes und Eindrucksvolles in den Ländern Europas wird wach, sobald ich im Auto sitze. Fotos sind nichts dagegen. Unsere Reisen durch Italien, Spanien, Frankreich und England eingeschmolzen in die Neuronen meines Gehirns. Bleiben als Bilder mit Farben, Gerüchen, Gefühlen, Geschmack dort bis zum letzten Atemzug. Bleiben.
Aber der Platz neben mir im Wagen ist leer. Nichts Blutvolles, nichts Stoffliches, das ich berühren, fassen könnte. Nur Gedanken. Unendlich traurige Gedanken. Abstrakta im konkreten Hirn. Wünsche mir sehnlichst, sie säße dort wieder. Redete mit mir, streichelte mein Knie, tupfte ein Küsschen auf die rechte Wange. Hauch eines Engels denke ich, verdrücke eine Träne. Es denkt und denkt und kann nicht aufhören zu denken. Tags nicht, nachts nicht. Im Auto schon gar nicht. Könnte es noch einmal sein wie früher, flehe ich. Lasse die Tränen laufen.
Ja, ja die Gedanken. Sie sind die schlimmsten Quälgeister. Schlimmer als Dinge und Bilder. Sie lassen sich nicht vermeiden, verkaufen oder verbrennen. Im Gegenteil, sie zünden ein Feuer an. Und die Nervenzellen im Gehirn vibrieren vor Angst, nie begreifen zu können was war. Es ist kein Leben mehr wie früher nach meinem Achtzigsten.
2
Nichts wie es war all die Jahre. Hatte ich mir etwas in den Kopf gesetzt, bekam ich es. Ein leeres Dachgeschoss gesehen und kurz entschlossen ausgebaut. Die erste eigene Wohnung für mich, Frau und drei Kinder. Neue Kunden brauchte die Agentur und ich gewann einen nach dem anderen. Erfolgreich zumeist viele Jahre. Frankreich im Kopf, mit Rose für drei Wochen an die Loire gefahren. Die Idee, zum 75sten ihrer Mama eine Tonbildschau über ihr Leben zu produzieren. Noch heute schwärmen die Überlebenden von diesem Abend auf der schönen Burg am Rhein.
Wollte ich etwas erreichen, erreichte ich es. Zwangen mich verlorene Kunden zu sparen, investierte ich ins Neugeschäft. Musste ich mit Bandscheibenschmerzen im Bett bleiben, ließ ich Mitarbeiter und Kunden kommen. Zu klären, was nötig war.
Als Rose in mein Leben sprang, liebte ich sie wie keine Frau vor ihr. Nutzte jede Gelegenheit, ihr nahe zu sein, sie zu umarmen, zu küssen. Weil ich selber umarmt und geküsst werden wollte. Habe ich alles getan aus Eigennutz? Der bessere Liebhaber zu sein? Der bessere Architekt? Musikus? Maler? Dichter?
Jetzt lass ich alles auf mich zukommen. Ich will gelassen sein, nehme ich mir vor. Ob ich es schaffe gelassen zu bleiben? Das Feuer in meinem Hirn brennt wie eh und je. Gespannt, was sich das Schicksal noch ausgedacht hat. Mich zu prüfen, anzuspornen oder zu beruhigen. Nicht den Schimmer einer Ahnung, welche Folgen es haben könnte.
Eines Tages spaziere ich in Richtung Merzhausen. Vorbei an eingezäunten Grundstücken, Brombeersträuchern, Hecken, einer Kastanie. Stolzer Baum, unterm Blätterdach an weit ausgebreiteten Armen ungezählte reife Früchte. Braune Kugeln in stacheligen Schalen. Plötzlich klickt es in meinen Ohren. Eine war heruntergefallen. Sehe, sie rollt eine leichte Schräge herunter. Bleibt liegen. Schale aufgeplatzt, die braune Kugel glänzt mich an. Denke, es könnte etwas bedeuten. Aber was? Klang es nicht wie ein Weckruf? Wache auf Eko und lebe!
Rasch den Block aus der Tasche und hetze den Stift übers Papier, festzuhalten die Metapher: Wie wenn nach der Winterstarre das Samenkorn sich aufrappelt, keimt, sprießt, unaufhaltsam wächst und größer wird. Ein Baum. Und dann die prallen Früchte herunterfallen auf den Asphalt vor dem Haus. Und beim Aufschlagen einen Klick von sich geben wie reife Kastanien.
Wer oder was auch immer hatte dieses Klick in mein Hirn implantiert? Ein Ding wie ein Chip, auf das ich keinen Einfluss habe. Das ich nicht steuern kann. Einschalten, abschalten. Dieses Etwas ist da. Macht sich breit in meinem ganzen Körper, allen Gedanken. Geht weg und kommt wieder und geht und kommt. Und klickt. Und klickt. Lust überkommt mich. Und unsägliche Neugier. Hat sich mein Alter Ego eingeschaltet, mich zu retten? Antwort zu geben auf alle Fragen? Mich treibt zu denken, zu tun, wozu mir bisher der Mut fehlte? Inspiriert mich zu meinem ersten Buch. Gedacht und schon da: «Rose lebt». Ja, sie ist nicht tot. Lebt in allem, was war, heute ist und morgen. Verwandelt alles. Nicht zuletzt auch mich selbst. Jetzt fängt ein neues Leben an.
Vergangenheit und Zukunft, alles ist Gegenwart. Ich und mein zweites Ich. Bin zwei jetzt und doch einer! Der die unendlichen Möglichkeiten seines doppelten Ego ausschöpfen kann. Welche Bereicherung! Doppelt leben wie gedopt.
Neue Bücher entstehen. Über unsere Ferien in Italien, Frankreich und auf Mallorca. Fallen mir aus dem Ärmel, den ich nur zu schütteln brauche. Und schon ist alles da: Landschaft, Stadt und stiller Weiler. Das Tal der Loire, das Meer. Schlösser und Kathedralen, geschmückt mit Fresken und Skulpturen, die immer schön sein werden. Auch wenn Revolutionäre ihnen die Köpfe abgeschlagen haben. Begegnungen mit Menschen. Gemeinsam gefeiert, Taufe und die Nacht in ein neues Jahr. Alles lebt wieder auf. Rose in allem, was war und nie mehr verschwinden wird. Solange ich lesen und träumen kann.
Eine Woche später unterwegs im Wagen Richtung Tuniberg. Dem rebreichen Hügel nahe Freiburg. Meine Gedanken wieder bei der Liebsten. Unseren täglichen Ausflügen auf diesen Weinberg. Von irisblauen Hängen schweift der Blick bis zu den Vogesen. Wir saßen auf dem brüchigen Holzbänkchen und schauten. Alles im Kopf was sich denken lässt. Dehnten die Zeit so lange, bis es keine Zeit mehr war. Ein großer Milan schwang sich im Aufwind nach oben. Kreiste, kreiste noch einmal und segelte seitwärts davon. Die ersten Trauben müssten bereits geerntet sein. Rose mochte Trauben. Besonders die dunklen, die später als tiefdunkelrotvioletter Spätburgunder im Glase funkeln.
Der beste vom Winzer Landmann in Waltershofen. Sein Weinfeld direkt unter dem Bänkchen, auf dem wir lernten das Nichtstun zu genießen. Während unter uns polnische und rumänische Gastarbeiter freiwillig Hände, Rücken und Beine strapazierten. Für einen Lohn, den sie in an ihre arbeitslosen Familien in der Heimat überwiesen. Deutsche sahen wir keine.
Heute sehe ich darüber hinweg. Sonne wärmt mit 20 Grad Celsius. Ein ungewöhnlich freundlicher Herbstmorgen. Die Natur hat bereits ihren Farbkasten geöffnet. Alle Welt wartet auf vielerlei Buntes. Setze mich wieder ins Auto, fahre einfach so ins Blaue. Öffne das Schiebedach. Denke an die Silvesternacht in Palma de Mallorca. Offenes Verdeck erinnert immer an Palma. Die Fahrt zurück in die Finka am Meer. Damals. Millionen Sterne funkelten in der klaren Winternacht. Wenn ich immer wieder mal einen raschen Blick nach oben warf. Den Himmel sah und den Engel neben mir fühlte.
Aus den vier Lautsprechern klang Mozarts Klaviersonate in a-dur. Gespielt von Alfred Brendel. Ein gewaltigeres Unisono von Frau und Mann, Rose und mir, konnte es nicht geben. Wie wenn Himmel und Erde sich in den Armen lägen. Wir glitten dahin und schwiegen. Lauschten den silbernen, den goldenen Tönen, spürten den Herzschlag des anderen wie unseren eigenen.
Genau das will ich wieder erleben. In derselben Stimmung über die Hügel gleiten. Hinauf, hinunter und wieder hinauf. In den sanften Kurven, die Neigung spüren. Vom anderen weg, zum anderen hin. Wie Wellen kommen und gehen und wiederkommen. Erwarte ein Wunder. Wenn ich schon keinen Flügel mehr habe, dann wenigstens Klaviermusik im Auto.
Pech, dass mein kleiner Jaguar nur eine Vorrichtung für Tonkassetten hat. Kassetten gibt es nicht mehr. Nicht mal mehr antiquarisch. Den kompletten Vorrat hatte ich vor dem Umzug verschenkt. Es gab schon CDs. Was tun? Kurz entschlossen kaufe ich eine CD mit Mozarts Sonate a-dur, gespielt von Alfred Brendel. Einen CD-Player mit allem Zubehör. Montiere ihn in meinem Wagen mit einigem Ungeschick. Endlich, nach zwei ärgerlichen Wochen dann funktioniert es. Mozart erklingt in meinen Ohren wie ein Ostermorgen.
Seit Palma de Mallorca übte ich auf meinem Klavier diese Sonate. Traktierte die weißen, die schwarzen Tasten, bis sie annähernd klangen wie sie sollten. Diese Sonate war meine liebste, als ich sie zu spielen begann. Das erste Andante grazioso schaffte ich mit weniger Mühe. Klingt ja auch schön. Heiter und leichthin wie ein Sommertag. Nimmt den Spieler mit auf die Reise. Auch ohne Fingersatz und Schulmeistereien im Vorfeld. Spielte es immer wieder. Insgeheim hoffend, irgendwann zehn Prozent von Brendels Könnerschaft zu erreichen. Ließ es wieder, als Rose mich nach etlichen verrutschten Tönen anflehte, aufzuhören. Sie hörte lieber, wenn ich frei heraus fantasierte. In Dur oder Moll. So wie mir gerade war. So liebte sie mich. Und war sehr glücklich.
Jetzt habe ich kein Korrektiv mehr. Kein Klavier. Nur die CD und mein Gehör. Wolfgang Amadeus wird mir helfen. Setze mich von hoffnungsvollen Gefühlen bewegt ins Auto und schaltet den Player ein. Fahre hügelab, hügelan der Mittagssonne entgegen. Den Genies Wolfgang Amadeus und seinem Interpreten Alfred aus den Lautsprechern folgend. Ton für Ton. Takt für Takt. Die fünf Finger beider Hände am Volant hüpfen wie auf Tasten. Schwarzen, weißen mit den drei Kreuzen. Erinnere Palma und fühle Rose neben mir. Streichele die dicke Backe ihres Sitzpolsters. Flüstere te amo, singe je t´aime, schreie: Rose ich liebe Dich. Kein Mensch hört mich, weiß ich. Aber sie hört mich. Sie hat immer gehört, wenn ich etwas auf dem Herzen hatte. Warum nicht auch jetzt?
„Ich weiß ja, dass Du mich liebst.“ Ihre Stimme klingt entfernt. Wie aus der Küche nebenan. Es hört sich an wie weiches Moll. Dringt in meine Ohren, mein Bewusstsein und macht mich verrückt. Ver . . . rückt ein ganzes Stück weg von der Wirklichkeit. „Ich möchte auf dem Birkenbänkchen sitzen“, sagt sie. „Mit dem Blick auf die blassblaue Silhouette des Schwarzwaldes.“ So abwesend blass mag sie ihn leiden, den schwarzen Wald. In großer Entfernung nicht mehr finster. Leute dort sollen noch an Hexen glauben. Zehn Vaterunser beten, wenn ’s donnert. Den Fernseher abschalten. Und zittern, bis alles vorbei ist. Mag ja sein, dass alte Leute so leben. Die Jungen arbeiten lange schon in Städten, in denen es zumindest eine Disco gibt. Willige Mädchen und freche Jungs.
Natürlich fahre ich wie immer bis auf das Rasenstück neben der Bank. Steige aus, öffne die Wagentür an ihrer Seite. Wische mit dem Tempotuch über die Bank. Ihr heller Leinenrock soll keine grünen Flecken bekommen. Dann setze ich mich neben sie. Hole zwei Hustelinchen aus der Tasche. Eines für sie, eines für mich. Wickele ihr Bonbon aus dem lila Papierchen. Sie greift es mit spitzen Fingern. Steckt es zwischen die Lippen und lutscht vernehmbar. Ich meines auch. Werfe das lila Minimum in den drahtigen Abfallkorb neben der Bank. Zu ausgetrunkenen Coladosen, leer gerauchten Zigarettenpackungen, einem zerknautschten Tempotuch und einem unbenutzten Kondom in der Cellophanhülle.
Im Korb liegen die lila Papierchen eine Weile. Am Ort der Vorschrift. Bis eine plötzliche Böe die federleichten herauswirbelt und den Hang hinunter treibt, den Rebstöcken vor die Füße. Ärgerlich. Ich kann nicht mehr gut klettern. Lasse das bisschen Lila liegen, wo es liegt. Hoffe, es weicht im Regen auf, verfault und wird zu erdfarbigem Dung. Spätestens im nächsten Jahr. Gewissen beruhigt.
Wir reden wenig, wie meistens an solchen Sonnentagen. Hoch oben über den Dingen. Schauen, nichts anderes als schauen, denken an alles und nichts. Vermeide es nach rechts zu blicken. Weiß, Rose sitzt an meiner Seite. Fühle Nähe, Wärme und bin glücklich. Seltsamerweise sehr glücklich sogar. Möchtest Du fahren?“ frage ich sie noch. Setze mich aber selbst ans Steuer, als sie nicht gleich reagiert. Ein kleiner Mittagimbiss wartet. Wieder zuhause hole ich das Töpfchen mit badischem Wurstsalat aus dem Kühlschrank. Zwei Teller und Bestecke auf den Tisch. Ihr Platz mir gegenüber ist immer gedeckt seit sie nicht mehr bei mir ist. Eine Rose im Glas. Die Kerze im Ständer. Rose lächelt.
„Ich tränke gerne einen Gutedel dazu, ist eine Flasche im Kühlschrank?“ Ihre Stimme klingt entfernt. Ich hatte die letzte gestern mit Trenkle, meinem Fotospezialisten geleert. Laufe zum Aufzug, in den Keller zu fahren. Dort hat jeder im gekühlten Raum drei Meter Regal für seine Lieblingsweine. 36 maximal. Vor dem Aufzug wartet Frau Verführt. Gestützt auf einen schwarzen Rollator. 90jährige Nachbarin. Sie war Lehrerin, unverheiratet. Ohne eigene Kinder. Einen Namen, der Fantasie Anlass gibt zu spekulieren. „Keine Sorge Herr Brotbecker, ich will Sie nicht verführen.“ Schon bin ich wieder in meinem normalen Leben. Wie schnell das geht. Soeben noch das glatte Gesicht meiner Rose gesehen, jetzt das zerknitterte der Nachbarin. Quel difference. Wo bin ich wirklich?
Höre aufmerksam zu, als Frau Verführt erzählt, sie liebt Kinder. Von Natur aus und langem Berufsleben. Sieben Patenkinder besuchen sie regelmäßig. Auch wenn kein Geburtstag ist. Es radaut im Gang und kracht und lacht, wenn sie da sind. Ich freue mich, wenn Leben in die Ruhe springt. Aufwirbelt für eine Stunde, Einsamkeit zu vergessen. Jetzt spreche ich mit der alten Dame über dies und das, bis wir im Erdgeschoss ankommen. Ich muss noch eins tiefer. Es wird kühl. Richtig kalt, als ich die Kühlraumtür öffne. Immer noch im ersten Leben. Die Temperatur dort unten knapp über Null. Wie kurz vor dem letzten Schluck. Dem allerletzten. Denke ich flüchtig.
Wieder oben, ist Rose nicht mehr da. Im Bad? Schon im Bett? Anderes nicht denkbar. Da wird mir klar, mein Leben ist jetzt zweigeteilt. Ich lebe gewissermaßen ein doppeltes Leben. Beide sind mir wichtig. Weil ich in beiden die Hauptrolle spiele. Auch wenn es für andere den Eindruck macht, ich sei verrückt. Ich selber bin von meinem anderen Ich regelrecht begeistert. Wie von dem, das am 30. März 1927 auf die Welt kam. Mit dem künstlerischen Erbe seiner Mama und seines Urgroßonkels Fritz. Mein ganzes Sein steckt in beiden. Nichts ändere ich daran. Selbst wenn ich es könnte. Auf Roses Grabstein ist mein Name unter ihrem bereits eingraviert. Ohne das Datum des Todesjahres. Ins Gras beißen muss ich so oder so. Sage ich mir.
Bis dahin aber will ich eine Doppelrolle spielen. Die des Mannes, der sich selber liebt. Den Realisten und Fantasten. Die des Mannes, der seine Rose liebt, mehr als je zu ihren Lebzeiten. Liebt alles, was sie liebte, Blumen, Kinder, edle Pferde, Freunde und ganz alltägliche Dinge. Weil Liebe nicht stirbt, solange Gedanken Herzen bewegen. Geist Materie bezwingt. Erinnerungen und Träume das Sein verwandeln.
Als ich mich am späten Abend an meinen Schreibtisch setze, den Computer einschalte, das Bildprogramm suche wie unter manischem Zwang, ist es wieder um mich geschehen. Hatte Fotos unserer Reise an die Dordogne geklickt. Schöne Frau, die mir zulächelt. Über den Teller gebeugt, auf dem schneeweißer Kabeljau in hummerroter Sauce schwimmt. Im geschliffenen Glas Sancerre blanc. Stehe auf, hole aus dem Keller den letzten Sancerre blanc. Und trinke mich in die zweite Rolle. Tränen in den Augen und lache. Und bin ein anderer als der ich war. Eben noch am Aufzug.
Ich will in beiden leben, schwöre ich mir! Auch wenn andere mich für verrückt halten. Bin ja ver . . . rückt im Sinne des Wortes. Anderswo als soeben vor einer Minute. Ein anderer Mensch. An einem anderen Ort. Zu anderer Zeit. Mit anderen Gedanken. So anders alles, dass ich selber manchmal nicht mehr weiß, wer ich wirklich bin. Ist das schlimm? Zwei Existenzen? Doppelte Chancen, mich zu korrigieren. Den einen. Den anderen. Mit beiden wirklich werden zu lassen, was einer nicht kann. Vielleicht aber machen mich beide Rollen im psychiatrischen Sinne verrückt. Auch egal, tröste ich mich.
Dann bin ich allem Banalen entflohen. Der grinsenden Direktorin, die Merkel sein möchte und nicht darf. Den betulichen Damen und Herren am Empfang. Bewohnern, die den Tod zu ignorieren scheinen. Lachen, scherzen, erzählen von gestern und morgen, als wären sie jung und hätten Pläne wer weiß wie viele. Als könnte Leugnen den ungebetenen Gast aus ihrem Leben verdrängen. Entflohen auch dem pausenlosen Kulturtheater, das mit Vorträgen, Filmen, Konzerten jedem etwas bieten will. Populäres gewinnt. Ausstellungen mit Bildern von Hinz und Kunz mal schöner, mal weniger. Und jedes Mal ein anderer frommer Spruch im Wochenblatt.
Gründer des Hauses ist ein protestantischer Pfarrer. Es scheint als habe er nichts anderes im Sinn als Geld zu verdienen, um immer neue Häuser zu bauen. Zweiundzwanzig sind es bis heute. Man könnte meinen, er glaubte an die Prädestinationslehre Calvins: Unser Leben ist von Gott vorherbestimmt. Erfolg auf Erden haben heißt Gottes Willen erfüllen. Und somit in den Himmel kommen. Soll er doch glauben was er will in München. Weit weg von unserer Wirklichkeit. Denke laut, um zu hören, was mich bewegt. Ich kenne eine andere Stelle in der Bibel: Eher kommt ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Wer hat Recht? Die alte Frage. Denke nicht weiter.
Am nächsten Morgen sitze ich wie jeden Tag zwischen Neun und Zehn wieder am Tisch. Es ist ein quadratischer Tisch im großen Wohnraum. Auf vier massiven Stempeln. Selbst entworfen für unser letztes Zuhause. Dunkelkirschrot lackierte Mitte unserer Wohnung. Mitte unseres Lebens. Zu zweit, mit den Kindern, Gästen aus Familie oder Freunden zusammen sein. Essen, trinken und reden. Zweck des Daseins letzten Endes. Am Ende der Zeit.
Nach Roses Tod hängte ich sechs Fotos von ihr an die Wand gegenüber. Sehe sie also jeden Tag, wenn ich am Tisch sitze, esse, trinke und nachdenke. Allein oder mit den wenigen, die mich noch besuchen. Gerne gut essen und trinken. Ich koche wie ein Professioneller, sagen meine Gäste. Wie Rose zu Lebzeiten. Nur anderes. Vorzugsweise Meerestiere.
Liegt es an Roses Fotos? Alle sechs erinnern an das, was im Meer schwimmt. Auf dem Dach unserer Finca am Strand von Colonia aufgenommen. Erster gemeinsamer Urlaub auf Mallorca. Sie war unsere Isla d’ amor, Liebesinsel. Die Bilder zeigen es ohne Schminke und Pose. Rose mit dunkler Sonnenbrille. Schaut aus dem Bild wie Mona Lisa. Geheimnisse etliche. Wir kennen uns erst fünf Monate. Dann zeigt sie sich im Profil. Das rotblonde Haar gelöst. Aus der Unschärfe des Vordergrundes taucht ihre nackte Schulter auf wie eine Einladung zum Streicheln. Auf dem Dach der Finca weht Meerwind ihr himmelblaublütenduftendes Seidenkleid in die Waagerechte. Das Foto mit dem nackten Po meiner ins Meer steigenden Aphrodite habe ich auf den Kopf gestellt. Der Farbbalance wegen, wie ich jedem erkläre, der nicht fragt.
Ließ alle sechs Motive auf Leinen drucken und auf Keilrahmen spannen. Hängte sie rechts und links meines Gemäldes, auf dem dunkelgrün, blau und violett abstrahierte Olivenbäume mit der Mittagssonne um die Vorherrschaft ringen. Mein erster Versuch, Realitäten anders zu sehen.
Wenn ich so sitze und den schönsten Teil meines bisherigen Lebens betrachte, bin ich ein anderer. Reiche meiner Frau den Brotkorb über den Tisch, die Butter. Schneide vom Leerdamerstück eine extra dünne Scheibe. Gieße Rose zuerst den Tee in die Tasse. Bevor ich mich selber bediene. „Gut geschlafen?“ Gelernt ist gelernt. Geht nie verloren, so alt man wird. Ich denke nicht nach über Lernen und Altern. Von der Wand vis à vis rauschen Bilder in meinen Kopf und Worte. Töne. Himmelhoch jauchzende, zu Tode betrübte. Wie die vierte Symphonie von Johannes Brahms. Wir hörten das Meisterwerk mit den Berliner Philharmonikern unter Claudio Abado. Rose hingerissen damals. Ich hin und her gerissen jeden Morgen, den der Kalender kommen lässt.
Vergesse zu essen. Betrachte die Bilder, denke ohne denken zu wollen. Es denkt und macht mich willenlos. Meer rauscht und schäumt und jubelt, nähert sich und wogt zurück. Mit silbernen Wellenkämmen über dem dunkel schimmernden Blaugrün unvergessener Zeit. In dessen dunkelster Tiefe graue Gambas unruhig hin und her rudern, als könnten sie so den Netzen entgehen. Und den Tod in der Glut des Grills vermeiden. Rot wollen sie partout nicht werden. Wenn sie wüssten!
Eines spätsommerlichen Abends in der Cala Vicenç. Mit heißem Herzen puhlten wir ihre Schwänze aus den glühendroten Schalen. Die Abendsonne errötete vor Neid, als wir die vom Panzer befreiten in feinste Knoblauchmajonäse tauchten. Die Augen schlossen und schweigend kauten und schluckten. Des Fleisches Süße noch lange im Mund. Gambas müssten eigentlich dabei sitzen. Sehen, wie ausgelassen und feierlich zugleich ihr Leben endet. Willkommen geheißen in ausgehungerten Bäuchen. Geht mir durch den Kopf. Angetörnt von unkontrollierten Gedanken.
Erinnere leidenschaftliche Fressorgien bei Nico, dem Restaurantbesitzer in der Lloncha von Colonia San Jorge. Mit Gambas und hellem Inselwein. Drei Dutzend der kleinen süßen mussten dran glauben. Erinnere, dass Bertolt Brecht in seiner Dreigroschenoper Mackie Messer lauthals singen lässt: „Denn der Haifisch, der hat Zähne, große Fische fressen kleine. Gut, dass es an Mallorcas Felsenküsten keine Haie gibt. Nur Immobilienhaie. Aber genug Gambas für Feinschmecker wie mich. Anderswo werden sie von größeren Fischen für kleine Fische gehalten. Verschlungen, ihre Panzer ausgespuckt.
Ich hab dich zum Fressen gern. Sagt ein junger Mann zu seinem Mädchen. Ohne darüber nachzudenken wie das wohl schmecken könnte. Wie man hört, fressen sich Menschen gegenseitig schon lange nicht mehr. Nur noch sinnbildlich: Du bist mein täglich Brot. Die Anzahl der Garneelen-Verschlinger aber wächst und wächst. Clevere Asiaten züchten sie in Riesenbecken. Frieren sie ein und verstopfen die Tiefkühlregale der Supermärkte in aller Welt. Einfältige Zeitgenossen garnieren ihre Tische mit den vorgekochten, aufgetauten rosa Schwänzen. Je größer desto mehr Eindruck schindet man bei den Gästen. Größe ist ihr Qualitätsmerkmal. Bei mir jedenfalls nicht. Ich weiß:
Wer je die dunklen Knopfaugen einer zierlichen, lebenden Gamba gesehen, den Kitzel der Tentakel auf der Hand gespürt, die Meeresfrische auf der Zunge geschmeckt hat, kennt den Unterschied. Beim Verzehr rauschen in den Ohren unablässig Wind und Wellen. Im Bauch schläft die Sorge um morgen und übermorgen. So war es, so ist es immer noch. Ohne es gemerkt zu haben bin ich zurück von der Stippvisite in meinem zweiten Leben.
Frühstücke zu Ende und spüle von Hand Tasse, Teller, Besteck rasch im Becken. Maschine hat keinen Platz in der kleinen Pantry. Freue mich trotzdem. Weil mir etwas eingefallen ist. Setze mich an den Computer, tippe das Suchwort Gamba ein und kenne nach Sekunden die Adresse. Bestelle zwei Dutzend frisch bei Soller auf Mallorca gefangene. Gehe davon aus, dass sie noch leben. So wie wir sie kauften bisher in Langenfeld.
Zum festlichen Essen lade ich Rotraut Lutz ein. Roses Freundin und mitfühlende Kreatur. Es wird ein Rosenfest werden. Denkt mein anderes Ich und freut sich zum dritten Mal. Lebende Gambas sind selten. Sehr selten. Mein Doppelleben muss als Revanche gefeiert werden. Erinnere mich.
Nach Roses Tod am Abend vor Weihnachten im Jahre 2009 luden Lutzens mich zum gemeinsamen Essen im Kreise ihrer großen Familie. Spontan wie echte Freunde es tun. Ich sollte nicht allein sein. Dieter hatte Gambas aus