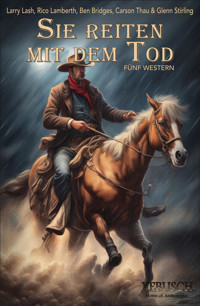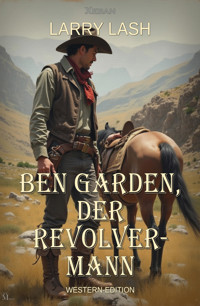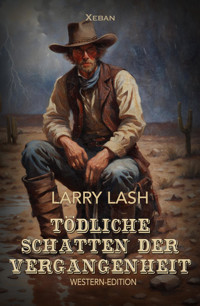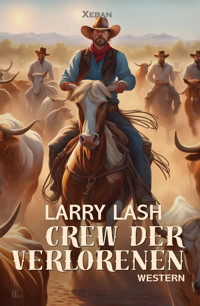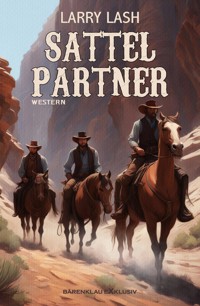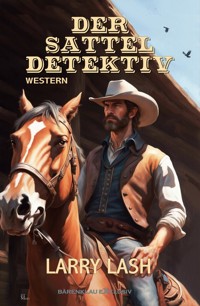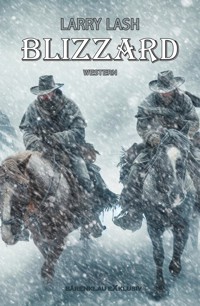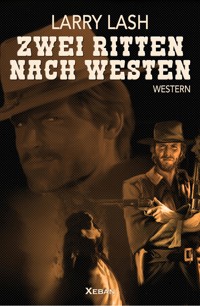3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bernhard Bömke, der Mann, der Larry Lash war.
Einer der erfolgreichsten Autoren der Leihbuchära, der neben Abenteuer- und Liebesromanen an die dreihundert Western schrieb, erzählt uns in seinen eigenen Worten, ausgewählte Facetten aus seinem Leben, die für ihn wichtig waren. Besonders intensiv widmet er sich hierbei seinen zum Teil ergreifenden Erlebnissen von der Kindheit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als müsste er sich etwas von der Seele schreiben. Andere Lebensabschnitte werden dagegen nur skizziert.
Dabei wird deutlich, wie er letztlich zu dem Menschen wurde, der er war: ein wunderbarer Vater, liebevoller Ehemann und Partner, ein begnadeter Schriftsteller, dem die Fantasie nie auszugehen schien, sowie ein leidenschaftlicher Maler.
Sein schriftstellerisches Lebenswerk wird momentan unter dem Pseudonym Larry Lash als eBook sowie Taschenbuch und einige ausgewählte Werke auch als Hardcover neu aufgelegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Larry Lash
Aufbruch aus der
Endlichkeit
Die autorisierte Biografie von Berhard Bömke,
dem Mann, der Larry Lash war
zusammengetragen von Kerstin Peschel
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © Christian Dörge mit einem Foto der Familie Bömke, 2021
Lektorat/Korrektorat: Kerstin Peschel, Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Aufbruch aus der Endlichkeit
Vorwort
Erster Teil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Zweiter Teil
37
38
39
Nachwort
Anhang
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
Bernhard Bömke, der Mann, der Larry Lash war.
Einer der erfolgreichsten Autoren der Leihbuchära, der neben Abenteuer- und Liebesromanen an die dreihundert Western schrieb, erzählt uns in seinen eigenen Worten, ausgewählte Facetten aus seinem Leben, die für ihn wichtig waren. Besonders intensiv widmet er sich hierbei seinen zum Teil ergreifenden Erlebnissen von der Kindheit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, als müsste er sich etwas von der Seele schreiben. Andere Lebensabschnitte werden dagegen nur skizziert.
Dabei wird deutlich, wie er letztlich zu dem Menschen wurde, der er war: ein wunderbarer Vater, liebevoller Ehemann und Partner, ein begnadeter Schriftsteller, dem die Fantasie nie auszugehen schien, sowie ein leidenschaftlicher Maler.
Sein schriftstellerisches Lebenswerk wird momentan unter dem Pseudonym Larry Lash als eBook sowie Taschenbuch und einige ausgewählte Werke auch als Hardcover neu aufgelegt.
***
Meiner lieben Frau Irmtraut gewidmet.
Die größte Freude in meinem Leben war, sie kennenzulernen.
Sie verzauberte mich so sehr, dass ich mein Junggesellenleben
aufgab und sie heiratete. Danke für deine Liebe, deine Güte und dein Verständnis, du bist mit uns, deiner Familie, durch Dick und Dünn gegangen, ohne Dank zu erwarten.
Beten allein nützt nichts,
Gott kann nur die Kraft geben,
Handeln müssen wir selbst.
(Bernhard Bömke)
Man soll immer auf Wunder hoffen,
sich aber nicht darauf verlassen.
(unbekannt)
Aufbruch aus der Endlichkeit
Vorwort
Bei dem hier vorliegenden Buch, handelt es sich zum Teil um die Autobiografie meines Vaters Bernhard Albrecht Heinrich Bömke, der am 31.07.1921 in Buer geboren wurde und am 04.03.2002 in Westerholt (Herten) verstorben ist.
Vervollständigende Daten, Fakten und Ereignisse über diese Autobiografie hinaus wurden durch intensive Gespräche mit unserer Familie von Kerstin Peschel zusammengetragen und anschließend von ihr in Worte gefasst. Dieser Abschnitt befindet sich im Anschluss an die Aufzeichnungen meines Vaters.
Ich, Martin Bömke, bin ein sogenannter Nachzügler der Familie und habe viele bedeutende Lebensabschnitte meines Vaters nicht selbst miterleben können, jedoch durch häufige Gespräche mit ihm sowie meiner Mutter diese Wissenslücken gefüllt.
Mein Vater, der für mich immer ein offenes Ohr hatte, war meiner Mutter bis zu seinem Tod ein liebevoller Ehemann und meinen beiden Brüdern und mir stets fürsorglicher Vater und Mentor. Für ihn ging die Familie über alles. Ein großes Manko war jedoch sein Geschäftssinn. Wenn es um Verträge oder das Haushalten ging, überließ er das stets meiner Mutter, was sie bravourös meisterte, wie ich im Nachhinein anerkennen muss.
Seine Tätigkeiten als Künstler, als erfolgreicher Westernautor, als Maler, als Bildhauer war für uns als Familie nichts Besonderes, da es für uns zum täglichen Leben gehörte. Jetzt nach so vielen Jahren glaube ich, dass wir, seine Familie, ihm vielleicht auch dadurch nie die Anerkennung für seine geleistete Arbeit entgegenbrachten, die er mit Sicherheit verdient, sich vielleicht auch im Stillen gewünscht hätte.
Die Romane meines Vaters waren nie einfach nur Romane, die Bilder nie nur einfache Bilder, egal in welcher Technik sie angefertigt wurden. In seinen Werken ob geschrieben oder gemalt wurden immer Botschaften verschlüsselt oder eindeutig dem aufmerksamen Leser oder Betrachter übermittelt.
Er setzte sich gegen den Gebrauch von Drogen im Sport ein und kämpfte gegen Apartheid, Krankheiten sowie Umweltverschmutzung an. Auch die Moral und Doppelzüngigkeit der Politiker war ihm stets ein Dorn im Auge. Sicherlich war er ein unruhiger, suchender Geist.
Trotz der zum Teil düsteren Bilder, die er zeichnete, war er ein glücklicher, zufriedener Mensch, der sich in seiner Familie, sowie in der Nähe seiner Freunde am wohlsten fühlte. So wie der Hauch seines Lebens langsam versiegte, so verfinsterten sich auch seine Bilder. Trotzdem ließ ihn die Malerei nicht los. Im Gegenteil, sie gab ihm bis zum letzten Atemzug Kraft. Seine Schaffenskraft endete wenige Stunden vor seinem Tod …
Er war ein großartiger Mensch. Weltoffenheit, Weitsicht und die Angst ums Überleben der Spezies Mensch waren ihm mit das Wichtigste. Sein tiefer Glaube, seine Familie und Freunde halfen ihm dabei.
Er war aber auch einer der ersten und erfolgreichsten Westernautoren der jungen Bundesrepublik nach dem zweiten Weltkrieg. Er veröffentlichte seine Werke unter elf Pseudonymen und schrieb etwa dreihundert Westernromane. Seine Romane waren auch als Übersetzung in Belgien und Frankreich zu lesen.
Der WDR widmete ihm im Radio eine eigene Sendung über seine Tätigkeit mit dem Titel: »Larry Lash reitet nicht mehr. Über das Ende der Wild West-Romane«.
Sein komplettes schriftstellerisches Lebenswerk wird seit dem Frühjahr 2016 im Verlag Edition Bärenklau unter seinem bevorzugten Pseudonym Larry Lash herausgegeben. Die Romane sind als E-Books und werden auch als Printausgabe wieder erhältlich sein.
Dort wurde auch sein letzter Roman DER TRAUMFLUSS veröffentlicht. Der Wunsch meines Vaters war, dass dieser Roman posthum erscheint. Dieser Wunsch wurde ihm erfüllt.
Diese Biografie kann nur einen kleinen Einblick in das Leben meines Vaters geben, denn sechzehn dicke Aktenordner sind gefüllt mit Zeitungsartikeln über sein Schaffen.
Ich möchte mich auch an dieser Stelle bei Kerstin Peschel und Jörg Munsonius von ganzen Herzen bedanken. Ohne ihre kongeniale Unterstützung wäre diese Biografie in dieser Form nicht zustande gekommen. Mein Dank gilt auch meiner Lebensgefährtin Stefanie Grasse, für ihre tatkräftige Hilfe bei der Aufarbeitung und Archivierung seines Lebenswerkes. Mir ist bewusst, wie sehr mein Vater, sie ins Herz geschlossen hat. Mein Vater: der Ehemann, Großvater, Mentor, Künstler und Schriftsteller …
- Martin Bömke, Juli 2021
Erster Teil
1
Der Erste Weltkrieg steckte noch allen Leuten in den Knochen, als ich am 31.07.1921 das Licht der Welt erblickte. Mein Vater war Bergmann, er arbeitete auf denselben Pütt (Zeche), wo auch meine Großväter, meine Onkel, die Nachbarn und Bekannte ihren Lohn verdienten.
Hugo Ost, Hugo eins, zwei und drei waren sogenannte Familienpütts. Ringsum hoben sich ihre Fördertürme gen Himmel, standen die Waschanlagen, die großen Hallen, Kühltürme, Lager, Kokereien, Halden. Abraumberge breiteten sich aus, zogen Schienenstränge durchs Land. Die Luft trug den Kohlenstaub über die Stadt und ließ die Häuser verrußen.
Grauschwarz, wie die Haldenberge vor der Tür schien die ganze Stadt unansehnlich dahinzudämmern, von den Kolonnen der Bergmänner abgesehen, die zur Morgen-, Mittag- und Abendschicht gingen.
Nun, ich kann mich nicht erinnern, dass eine Kaffeeflasche über eine Wiege hing, auch nicht daran, dass Vaters jüngster Bruder bei meinem Anblick ausrief: »Was für ein alter, verhutzelter Mann. Aus dem wird nichts, ist ja kaum zwei Pfund schwer, der wird von dannen pilgern, bevor er gehen kann!« Er sprach aus, was meinen Eltern Kummer machte. Ich war zu schwach, hutzlich, zeigte nichts her, war kein Bub für stattliche Eltern, kein Kind zum Vorzeigen. Nur meine Großmutter väterlicher Seite lächelte und sagte: »Was ihm fehlt, wird angefuttert!«
Sehr viel später wäre ich froh gewesen, das Angefutterte wieder rasch und gründlich loszuwerden. Doch so weit war es noch lange nicht. Die Dürregestalt meines Körpers sollte anhalten, bis zu meiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft; also viele Jahre später, in denen das Leben mich noch kräftig beutelte.
Wir waren nicht reich. Mein Vater verdiente gut. Er gehörte zu den Spitzenverdienern unter Tage. Er war ein fleißiger Mann, der keine Krankfeierschicht kannte, der selbst dann zur Arbeit ging, wenn er den Kopf unterm Arm nehmen musste, es ihm also wirklich schlecht ging und eigentlich den Arzt aufsuchen sollte. Er klagte oder murrte nie und seine Bescheidenheit war sprichwörtlich.
Ich hatte das Glück, im Haus meines Großvaters geboren zu werden. Es war ein großes Haus für mehrere Familien. Mein Großvater wollte sie alle um sich haben, seine Kinder und Enkel.
Er hatte das Haus gebaut, um seiner Familie Schutz zu geben und das zu einer Zeit, wo man sich Fragen musste: »Woher kam das viele Geld?« Vier Familien konnten darin leben. In seinem Haus waren es enge Verwandte: Großeltern, Onkel, zwei Tanten mit ihren Töchtern, meine Eltern und ich. Ich wurde vom Großvater verwöhnt und geliebt. Aus dieser Liebe zu meinem Großvater entstand ein besonders inniges Verhältnis und manchmal sagte er mir Dinge, die sich erst viele Jahre später erfüllen sollten: »Auf diesem Grundstück hier, wird einmal ein Gebäude stehen, wo gebetet wird, eine Kirche oder ein kleiner Dom.«
Viele Jahre später, lange nach dem Tod meines Großvaters wurde es wahr. Er hieß mit Vornamen Gottlieb. Er passte zu ihm, denn seine Fürsorglichkeit, seine uneigennützige Liebe zu uns allen zeigte sich auch, dass er einer der ersten Sozialdemokraten im Schlachtfeld war.
Schlachtfeld? Das war ein Bergarbeiterviertel in Gelsenkirchen-Buer, nach den Straßennamen der Schlachten und Heerführer im ersten Weltkrieg benannt. Sedan, Königgrätz, Wrangel, Moltke und die Düppelstraße. Mein Großvater hatte dunkelrote Haare, blaue Augen, war gedrungen und breitschultrig. Als ich zwei Jahre alt war, hat er mich mitsamt einem Tisch mithilfe seiner Zähne emporgehoben. Sein Lieblingslied, das er mir als Kind vorsang, habe ich meiner Enkelin beigebracht: »Freiheit die ich meine!« Sie singt es wie ich einst.
Freiheit des Geistes war sein Ideal, damals, in den zwanziger Jahren, nicht zu verwirklichen. Um sie zu verwirklichen, musste man unabhängig sein. Damals und heute immerdar ist Freiheit ein göttlicher Hauch, der uns streift, doch niemals greifbar wird.
Für jeden ist Freiheit etwas anderes. Für Großvater mit der Sehnsucht verknüpft, die masurische Heimat wiederzusehen, dort zu bleiben und zu sterben. Er verwirklichte seinen Wunsch, als er Rentner wurde. Er war nicht zu halten. Er wollte mich mitnehmen, meine Eltern schlugen es ihm ab und so zog er mit der Großmutter, die ich ebenfalls sehr liebte in seine ferne Heimat mit nur wenig Glück, ein umfallender Baum erschlug ihn, löschte sein Leben aus, ließ meine Großmutter nach Westfalen zurückkehren, in eine andere Welt, denn die Häuser waren verkauft worden, von der Inflation geschluckt. Alle Familienmitglieder waren verstreut. Der einstige Zusammenhalt löste sich auf. Es gab kaum noch Verbindungen untereinander. Sie wichen sich aus. Jede Familie hatte mit sich selbst zu tun und so wanderte Großmutter von einer zur anderen, blieb Monate, Jahre, für mich war sie in meiner Jugend die Mutter, die Frau, die für mich da war und sich rührend um mich sorgte.
Sie war tatkräftig, forsch, konnte für andere und sich selbst einstehen und dabei von einer geistigen Gewandtheit die immer wieder Anerkennung fand. Nur von Großvaters Ahnen sprach sie leise, so als ob niemand ungewollt etwas mitbekommen sollte. Vielleicht war auch etwas wie Zynismus oder Abwehr in ihr, gegen die Familie ihres Mannes deren Ahnen blaublütig vom Staat und Obrigkeit nicht gezügelt werden konnten. Im Gegenteil, zu der Großmutter mütterlicherseits, war sie eine Frau, die genau wusste was sie wollte. Es wurde auch vom Großvater anerkannt und beide waren ein ideales Paar.
Neuerdings, im Jahr 1990, setzten sich Prof. Dr. Mammen und seine Gattin durch die Ahnenforschung mit dem Thema der Baginski auseinander. Was auch immer für blaublütige Vorfahren da angetanzt kamen. Es berührt mich kaum und dürfte auf mein Leben keinen Einfluss haben. Ein stilles Lächeln wäre alles und Dankbarkeit, denn auch sie stehen in der Ahnenkette, durch die ich wurde … Was soll’s, ich bleibe bei meinen Erinnerungen der Kindheit.
Mit fünf Jahren wurde ich eingeschult. Damals war ich so mager, dass man meine Rippen unter der Haut zählen konnte. Ich war verträumt, verspielt, ein Junge, der durch Wiesen und Wälder, über die Wege und Halden und am liebsten durch den Bach von Haus Hamm watete und Fische fing. Ich wusste, wo es Kammmolche, Feuersalamander und Kröten gab, wusste wo die schönsten Butterblumen und das Wiesenschaumkraut wuchs, und ich träumte von Feen und Elfen, Riesen und Zwergen, von versunkenen Welten, riesigen Vögeln, von Schmetterlingen und herrlichen Blumen und von weißen Lichtgestalten.
Damals war ich in eine wundersame Welt eingefangen, die mir allein offenblieb. Die Kehrseite der Medaille war, dass ich oft unter Mittelohrentzündungen litt, sodass meine Umwelt und vor allen der Lehrer immer nachfragen musste. Ich musste in der Schulklasse ganz vorne sitzen, um besser hören zu können. Doch wenn wieder einmal das Ohr entzündet war, bekam ich nur wenig mit und dann war der Prügelstrafe nicht auszuweichen. Es gab Lehrer die die Schüler einer ganzen Klasse den Hosenboden mit dem Stock trommelten und andere, denen man die Handfläche zeigte und ihren Stock auf den Fingerspitzen spürte. Nur vereinzelte Kinder brachten es fertig, ihre Väter so zu motivieren, dass sie wutentbrannt zur Schule eilten, um sich den Schlagwütigen Erzieher zu greifen, um mit eigenen Fäusten eine Lektion zu erteilen.
Mein Vater lehnte solche Art Selbstjustiz ab, obwohl ich ihn flehentlich bat, doch alle Lehrer k.o. zu schlagen. Er schlug keine Lehrer, Frauen, Kinder, dafür aber Männer, wenn sie es herausforderten.
Einige taten es. Es zeigte sich sehr schnell, dass sie schlechte Karten erwischt hatten. Raufbolde gleich welcher Art hatten keine Chance. Nun, welcher Junge würde nicht stolz darauf sein, einen Vater zu haben, der nicht nur kämpfen konnte, sondern Witz und Humor hatte. Beißende Ironie und bezaubernde Galanterie miteinander verquickte und damit umzugehen verstand. Seine Fantasie bezauberte uns Kinder, wenn er uns aus dem Stegreif, selbsterfundene Märchen erzählte, die er beliebig verlängerte und uns Kindern so manche schöne Stunde bescherte. Zu diesen Märchenstunden kamen Kinder aus der Nachbarschaft, die Walneys, meine Basen und Vettern, sodass bis zu fünfzehn Zuhörer sich versammelten.
Nur meine eigene Mutter war nicht dabei. Sie zog es vor, mit ihren Schwestern zusammen zu sein, um bei Kaffee und Kuchen Gedanken auszutauschen, ein Quetschen zu halten, zu lachen und miteinander zu singen. Mutters Geschwister waren sehr musikalisch. Sie spielten Instrumente und beim Zusammensein wurde meistens gesungen.
Vierzehn Geschwister hatte meine Mutter. Erwachsen wurden nur Martha, Maria, Franziska, Olga, Hanna, Franz, Arthur und Josef.
Sie alle wohnten mit ihren Familien in der Nähe. Eine Schwester meiner Oma mütterlicherseits ging nach Hamburg, heiratete dort einen Beamten von der Post und aus dieser Ehe stammte eine Tochter, die sie mit einem englischen Kapitän vermählten. Die anderen Geschwister meiner Großmutter, habe ich nie kennengelernt. Nur die Tante aus Hamburg. Und das nur, weil meine Neugier mich, als ich im Krieg bei der Kriegsmarine zwei Tage Urlaub hatte, ausnutzte, um sie zu besuchen.
Mutters Geschwister, meine Tanten und Onkel, waren lebensbejahende, fröhliche Menschen, vielleicht mussten sie deshalb hart erfahren, dass das Leben auf dieser Welt voller Haken und Ösen ist, ein Aufenthalt im Vorhof der Hölle.
Marthas Mann trank gern und manchmal zu viel. Als hart arbeitender Bergmann war es zu seiner Zeit nichts Ungewöhnliches, doch die Familie litt darunter. Der erstgeborene Sohn Hans heiratete zu schnell eine Frau, die ihn betrog, Hörner aufsetzte und demütigte. Hans setzte seinem jungen Leben selbst ein Ende. Seine Eltern, sein Bruder und seine Schwester haben diesen Freitod nie vergessen, nie verwunden.
Mutters Schwester Maria wohnte mit ihrem Mann, der Tochter und dem Sohn, gleich neben uns im gleichen Zweifamilienhaus, sozusagen Tür an Tür. Wir hatten die eine, Tante Marias und Familie die zweite Hälfte des Hauses. Doch sie sah ich immer, sie hielt sich mehr bei uns, als in ihren eigenen vier Wänden auf. Ihre Familie war für mich immer wie hinter dichten Schleiern verborgen.
Maria mischte mit, von morgens bis abends. Sie wusste was getan werden musste, was für unser Heil gut war. Wie die Gesundheit erhalten, was auf den Tisch gesetzt werden musste, wie meine Eltern und die bei uns lebende Mutter meines Vaters meine Geschwister und mich erziehen mussten. Sie frühstückte bei uns, sie war beim Mittagessen und zum Abendbrot da und nahm noch etwas für die Verwandten hinter dem Schleier mit.
Sie war die beste Auskunftei im ganzen Viertel. Meine Mutter verstand sich gut mit ihr, obwohl auch sie von Marias Frömmelei nicht gerade begeistert war, dennoch konnte Maria sie gegen mich aufbringen, wenn sie es wollte und das wollte sie oft, sehr zu meinem Nachteil. Mit Argusaugen überwachte sie, ob ich nicht die Morgenmesse versäumte.
Morgenmesse war Pflicht und wer die mied, bekam in der Schule Prügel, wurde gnadenlos an den Pranger gestellt. Vieleicht wollte sie auch nur verhindern, dass mir die Prügelstrafe erspart wurde. Tante Maria ist auch heute noch in meinem Gedächtnis als eine Frau, die wieselflink hin und her huschte, hinter dem Nebelvorhang und zurück in unsere Räume, manchmal mit ihren Kindern, niemals mit ihrem Mann, Onkel Max, so hieß er, blieb auf der anderen Seite in seiner Wohnung, die ich selten betrat, die wie unsere eigene die gleiche Anzahl von Zimmern hatte, für uns aber weit Ferner, als Irland lag.
Im Alter erkrankte Maria an Zucker. Sie starb an dieser Krankheit. Ihr Gatte heiratete ein zweites Mal, nachdem die Kinder ihre eigenen Wege gingen und lebte lange. Als er starb waren seine Kinder verheiratet und hatten ihre eigenen Familien.
Hubert, der Sohn starb nach einem Autounfall. Seine Ehe war kinderlos. Magarete, seine Schwester hat ihren Mann ebenfalls verloren. Aus ihrer Ehe mit Otto kam Mechthild.
Man sieht, dass das Leben weitergeht, dass es nach uns andere Menschen geben wird, dass wir nur in einer Kette stehen, die wer weiß wo herkommt und hingeht. Jedes Glied dieser langen Kette ist eine Welt für sich. Hubert war so eine Welt. Ein Mann der Kaninchen züchtete, der alle Rassen kannte und Preisrichter wurde. Er war Sprengmeister, ging seiner Arbeit und dem Hobby nach, liebte seine Frau und sein Häuschen.
Sein Schwager Otto aber war ein Original. Der Rum machte ihm zu schaffen, formte einen Gallenstein wie ein Fässchen und Otto betrachtete den Stein nach der Operation sehr nachdenklich.
Er zog aber keine Lehren daraus. Ich habe ihn kaum nüchtern gesehen. Dann und wann war er es. Aber auch dann nahm er seine blaue Mütze nicht ab und schaute aus dem Fenster auf das Leben und Treiben der Straße, die nach dem Krieg mit Türken belagert war. Seine Mütze wurde nur selten abgenommen …
Ob er sie auch im Bett aufhatte, kann ich nicht berichten. Anzunehmen, dass er sie im Himmel aufhat, eine andere Sache.
Mutters Schwester Franziska wohnte nur einen Steinwurf entfernt. Ihr Mann Lorenz kam aus Jugoslawien, fünf Kinder entsprangen der Ehe. Lorenz war ein fleißiger Arbeiter, der für seinen Sohn und vier Töchter immer zur Stelle war. Er starb jung und auch Tante Franziska war kein langes Leben beschieden. Eine Lungenentzündung raffte sie dahin.
Hannah, die jüngste Schwester meiner Mutter, hatte eine große Hochzeit. Sie war sehr musikalisch, spielte Klavier, Gitarre und Akkordeon. Ihr Mann war ein nervöser Typ. Immer auf der Suche nach etwas Besserem. Diese Suche ließ ihn im Alter Zeuge Jehovas werden. Ob ihn das geholfen hat, seinen inneren Frieden zu finden, konnte ich nicht klären. Er starb, als ich ihn fragen und besuchen wollte wenige Tage vorher.
Zwei Söhne, drei Töchter und seine Frau folgten seinem Sarg.
Von Mutters Bruder Franz weiß ich nicht viel. Er hatte Frau und Kinder, ließ sich scheiden und lebte einsam, ein Mann, der nicht auszuloten war und mit dem wir keinen Kontakt hatten. Dennoch tauchte er dann und wann aus irgendeiner Versenkung auf, zeigte sich, wenn man es nicht erwartete und schien genau zu wissen, wann die Feste gefeiert, Kuchen und Alkohol zu haben waren.
Damals gab es noch selbstgemachten Wein und Likör, dem man seine eigene Note aufdrückte und Fusel aus geheimnisvollen Quellen … Damals war die Hausmusik noch zu hören, sangen die Leute, feierten fröhlich, und Jung und Alt waren beisammen, bildeten eine Gemeinschaft. Der Zusammenhalt schuf die Großfamilie in der man aufeinander Rücksichten nahm.
Franz brachte den jüngsten Bruder meiner Mutter mit, Josef, der seinen rechten Arm im Gedinge auf der Zeche verloren hatte und zum Angestellten umgeschult in der Verwaltung tätig war. Josef war Schauspieler und Trinker zugleich. Zwei Ehen scheiterten daran. Entweder er schauspielerte nach dem Trinken zu sehr, oder das Trinken überschattete seine Schauspielkunst.
Und schließlich wünschte ihm seine beiden Ehefrauen, dass er zum Teufel gehe. Ich glaube der wollte ihn auch nicht, es war zu viel Explosives, Pures in Josef, da nutzte es ihm auch nichts mehr, dass er sich wie der Filmschauspieler Heesters kleidete, dass er trotz allem ein Unikum war. Seine Auftritte auf Hochzeiten, Kindtaufen und Beerdigungen mit Zylinder, Frack und Mantel und weißen wehendem Schal, ließen ihn als einen Fremdkörper erscheinen.
Nervenstark spielte er seine Rolle, und wer ihn nicht genau kannte, fragte: »Wer ist dieser schöne Mann, dem die Frauenherzen nur so zuflogen.« Sicherlich hat er einige glücklich gemacht, jedenfalls hat er keine dritte Ehe geschlossen. Ob er bei den Engeln ist? Oder beim Teufel, den er wie alle anderen auch fürchtete, nur Gott weiß es. Möge er Frieden gefunden haben … Frieden.
Onkel Arthur, Mutters dritter Bruder der Mittlere von den beiden Vorgenannten, war ein Prachtkerl. Breitschultrig, gut gewachsen, stark … Er war belesen, hatte Fantasie und war für mich ein lieber Onkel. Ich durfte auf seinen Schultern reiten und er spielte mit mir Indianer, Old Shatterhand und Winnetou.
Wenn er zu uns kam, war es für mich, als schien die Sonne heller, als würde der Tag freundlicher und gäbe es keine Schatten mehr.
Seine erste Frau starb ihm zu früh und ließ ihm zwei Kinder zurück, Werner und Adelheid.
Er heiratete noch einmal und für mich war es sonderbar zu sehen, dass seine zweite Frau wie die Erste zartgliedrig, dunkelhaarig fast eine Zwillingsschwester der Ersten hätte sein können. Ich weiß nicht, wie viel Kinder seine zweite Frau bekam, nur dass sie eine Tochter mit in die Ehe brachte und weitere Kinder meinem Onkel schenkte. Sicherlich ist es, dass Verwandte auseinanderstreben, nach einem Gesetz, dass nun mal in uns allen lebendig ist. Ich weiß nur, dass sein Ältester auf einer Zeche im Ruhrgebiet Steiger ist und dass er noch einen zweiten Sohn hat … Aber das ist auch schon alles.
Viele meiner Verwandten sind in Amerika, aber sie gehören zur väterlichen Seite. Sie haben die Warnung meines Großvaters nicht begriffen, der zu ihnen und seinem Sohn, meinen Vater, sagte:
»Dieser verbogene Löffel in meinen Händen ist das Einzige, was ich aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit nach Deutschland brachte, bleibt daheim und macht hier euer Glück!«
Sie gingen trotzdem. Die Brüder und Schwestern meiner Mutter blieben. Sie gingen nicht in das »verrückte, maßlose Land«, wie mein Großvater zu sagen pflegte, dorthin, wo der grenzenlose Egoismus alles übertraf und Zeit zu Geld machte.
Sicherlich sahen sie, dass mein Großvater nicht nur als Schachthauer, sondern auch mit einem Lebensmittelladen sein Geld verdiente, sahen, dass er Häuser sein Eigen nannte, dass er sich um seine Familie kümmert, dass er ein Mensch war, der anfing im kleinen Kreis auf Harmonie zu bauen, alles tat, um seine Kinder aus der rußigen Bergmannswelt hinaus, in ein besseres Leben zu rühren. Nun, man lebte nicht schlecht, aber auch nicht gut. Fast alle Bergleute waren bestrebt den eigenen Kindern das »Glück Auf« zu ersparen. Sie taten alles, sodass sie studieren konnten, einen anderen Beruf ergriffen, aus der Welt der schwarzen Diamanten hinaus ins Licht der Sonne treten konnten.
Es geschah zu viel da unten. »Glück Auf« heißt es für alle, die dort unten arbeiten und nicht wissen, was der nächste Herzschlag bringt. Der Tod stand dabei, fuhr mit in die Tiefe, begleitete die Männer unter Tage. Viele verletzten sich, andere starben. Nicht alle kamen zurück ans Tageslicht und damals gab es auch Pferde da unten, Weggefährten der Bergleute, die die Sonne nicht mehr sahen, fast blind durch die Strecken stampften.
Glück auf. Ich bin ein Kind des Reviers und werde es immer sein. Tief in mir ist es, als ob eine Woge von Stolz aus der Vergangenheit in die Zukunft zeigt. Ich bedauerte es schon als Kind, dass Großvater die Gemeinschaft im großen Haus nicht aufrechterhalten konnte. Sie brach eines Tages auseinander. Vaters Schwager, dreifacher Meister in Metallberufen, der Erste, der ein Auto fuhr. Zither spielte und eine Tanzschule eröffnete, zog mit Frau und Tochter als Erster aus dem großen Haus nach Oberhauser.
Zurück blieben Ludwig, Paul und Willi, meine Großeltern, meine Mutter und ich, denn auch Tante Gertrud hatte das Haus verlassen und war nach Erle gezogen, wo sie mit ihrem Mann Gustav ein Kiosk betrieb. Tante Gertrud starb durch einen Unfall sehr früh, als meine Cousine noch ein kleines Kind war. Noch bevor sie starb, bat sie ihren Mann Gustav, dass er ihre Freundin Wilhelmine heiraten sollte, damit ihre Tochter Edith eine gute Mutter haben würde. Und das war Wilhelmine dann auch in vorbildlicher Weise. Das große Haus aber wurde bald von allen anderen Familienmitgliedern verlassen. Opas Traum war zerschlagen, meine Eltern zogen in die Zechenwohnung.
Für mich war dieser Umzug wie eine Strafe, ließ ich doch meine Großeltern zurück, die mir besonders lieb waren.
Von nun an machte sich die Familie meiner Mutter breit und das aus allen Richtungen. Ihre Schwestern wohnten ringsum und eine gleich nebenan, im gleichen Haus, wie durch einen Nebelvorhang getrennt.
Nebelvorhang sage ich, weil ich kaum dahinter schauend, die Wohnung beteten habe. Es war eine andere Welt, in die sich Tante Maria, wann immer sie es wollte, zurückziehen konnte, doch das tat sie nur, wenn sie meine Mutter gegen mich aufgebracht hatte. Sie lebte mit uns, nahm die Mahlzeiten ein und trug davon vieles zu ihrer Familie, zum Onkel Max, ihrer Tochter Margarete und Hubert, ihrem Sohn. Tante Maria stieg wie ein Engel zu uns in die Tiefe der Erdgebundenen, bevormundete uns alle, gab Ratschläge, Anweisungen, hatte es besonders auf mich abgesehen, um mich aus der Welt meiner Träume zu holen.
Ihr Sohn Hubert besuchte das Konservatorium, spielte Geige und Schifferklavier. Er war einige Jahre älter als ich. Kein Wunder, dass wir uns kaum sahen. Einmal in der Schule, als ich, damals sieben Jahre alt, von der Lehrerin Frau Lemming angehalten wurde, auf der großen Schultafel in der Entlassungsklasse, der Vierzehnjährigen Mammuts und Eiszeitmenschen zu zeichnen. Dann sahen wir uns ab und zu – flüchtig.
Marias Tochter Margarete sollte für ein besseres Leben vorbereitet werden, und Onkel Max hielt sich ebenfalls für einen großartigen Naturmenschen, der seine Wege alleine aussucht. Sein Hobby waren lange Wanderungen durch Wald, Fels, Wiesen und Acker. Das Geigenspiel und die Ausbildung von Hubert, der als Künstler eines Tages sein Geld verdienen sollte.
Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht sehr mochte. Ich ging ihm aus dem Weg, sobald ich ihn sah. Und auch dann, wenn die Familienfeiern und die aus Familienmitgliedern aufgestellte Hauskapelle spielte, konnte ich mich nicht für ihn erwärmen. Er strahlte eine gewisse Kälte aus, die nicht nur mich auf Abstand hielt. Onkel Max konnte auf niemanden zugehen. Im Grunde war er ein einsamer Mann: ohne Freunde, ohne Wärme. Er wurde über neunzig Jahre alt. Er heiratete nach Marias Tod noch einmal und zog mit dieser Frau ruhelos von einem Ort zum anderen. Erst sein Tod beendete das Wanderdasein.
Sein Sohn Hubert wurde Sprengmeister auf Hugo und züchtete Kaninchen. Sein Traum als Virtuose einmal als strahlender Stern in Konzertsälen zu glänzen, wurde begraben, und das Schifferklavier wurde ihm gestohlen.
Damals hatte ein jeder seine Träume, sicherlich ist es auch heute so. Aber hier im Ruhrgebiet, wo Ruß und Staub, Dunst und Qualm, aus riesigen Schloten, Öfen, über Halden und Zechen, Häusern und Feldern sich ablagerten, wo Arm und Reich zusammenprallten, hatte ein jeder seine Wünsche: sehnte sich nach Licht und strahlendem Himmel, nach einem besseren Leben in einer schöneren Welt.
Zwar tauchten dann und wann Zigeuner auf, die Tanzbären mit sich führten. Hunde und Affen zeigten ihre Kunststücke. Leierkastenmänner und Frauen kamen bis in die Hinterhöfe.
Dann und wann durfte man für einige Pfennige in eines der Kinos gehen.
Ganz selten fuhr ein Auto vorbei. Umso mehr Pferdewagen und Karren, Kutschen und Eselgespanne ließen sich sehen. Die korpulenten Frauen der Bergarbeitersiedlungen schimpften über die Knaben, die auf den Straßen Völkerball, Fußball und Pinneken kloppen spielten. Manche Scheibe ging zu Bruch, manches Kind wurde verletzt. Die Spiele der Jugendlichen führten bis zu Straßenschlachten, wo man sich mit Lehmklumpen und ausgerissenen Grünkohlstrünken bewarf. Erst viel später, als die Nazis kamen, wurden durch das Jungvolk solche Straßenschlachten eingestellt und das Marschieren und Strammstehen angeordnet, und aus war es mit der Zeit der Wild-West-Romantik, der Einzelwesen und Individualisten.
Es stimmt, die dicken Frauen der Bergmannsiedlung sahen dem Treiben aus ihren Fenstern gelassen zu und ihre sehr dünnen, von der Arbeit ausgemergelten Männer hatten nichts gegen die Lehm- und Kohlstrunkwerferei einzuwenden, solange sie nicht selbst getroffen wurden. Man konnte den Erwachsenen nicht absprechen, dass sie für schwarzen Humor nicht ein besonderes Auge hatten.
Im Revier war man miteinander sehr duldsam.
Man lachte nicht über den dicken Otto und seiner noch dickeren Frau, die auf zwei Stühlen Platz nahm, wenn sie sich hinsetzte.
Man lachte nicht über den Taxifahrer, der einen Achsenbruch feststellte, als er Ottos Frau einmal zum Krankenhaus bringen wollte, auch nicht, als die Liebenswerte in ihrer Vergesslichkeit anstatt Papier in die Ofenfeuerung zu werfen, ihr eigenes Gebiss in die Flammenglut warf.
Damals gab es nur die Ofenfeuerung in der Kolonie. Kein Gas, keine Elektroheizung … Bergleute bekamen ihren Anteil an Kohlen frei Haus geliefert und jeder Keller barg das schwarze Gold.
Kleine Unternehmer machten Geschäfte. Einer davon wohnte in unserer Nähe. Sein Gaul glich einer Schindmähre und schien uns Kinder Aufforderung zu sein, zu reiten.
Vom Misthaufen konnte das Pferd bestiegen werden. Wer Pech hatte fiel gleich hier weich und roch danach sehr intensiv und konnte sicher sein, dass die fällige Prügel ihm das Reiten verleiden würde. Runterfallen konnte man aber auch, wenn man die Einfriedung passierte, das Pferd scheute oder bockte, manchmal auch unverhofft zur Seite sprang. Meine Reitversuche endeten oft mit Gestank, zerrissenen Hosen und fälliger Prügel von meiner Mutter – eigenhändig ausgeführt.
Doch als ich eines Tages in die Aalkuhle, die Latrine, des Nachbarn fiel, als diese fast leer war und ich somit einem Ertrinkungstod entging, bekam ich keine Hiebe. Im Gegenteil, zuerst war es der Nachbar, der versäumt hatte den Deckel aufzulegen, bevor er den Garten mit der stinkenden Brühe bedeckte und er eine weiße Nasenspitze bekam, als er mich auf dem Grund der zwei Meter tiefen Grube stehen sah. Er fischte mich mit seinen Händen heraus.
»Gott steh mir bei«, hörte ich ihn sagen, als er mich meiner Mutter übergab. Er zitterte am ganzen Körper, als wäre nicht ich, der total durchnässt dastand, sondern er es, der die dicke Brühe abbekommen hätte, dann schüttelte er sich und weinte.
Ich aber wurde geschrubbt, geseift, getaucht, dass mir hören und sehen verging. Aber ich bekam keine Prügel und das war fast ein Wunder, denn ich brachte dieses Mal einen Gestank ins Haus, dass einem alle guten Geister davonliefen und in Ewigkeit nicht mehr zurückkommen würden.
So ungefähr beschrieb es mein Vater, der eine besonders empfindliche Nase sein Eigen nannte. Nun, ich habe es verwunden, ich konnte am nächsten Tag wieder zur Schule gehen, so als wäre nichts geschehen. Unser Nachbar brachte Süßigkeiten, die ich mit meinen Schwestern teilte. Von der Bergwerksverwaltung kam an die Mieter der Siedlung ein Rundschreiben, doch mehr auf Mist- und Aalkuhlen zu achten. Es half einige Jahre lang, dass man sich in Acht nahm, doch später verfielen die Mistkuhlendeckel und neue Systeme machten die Aalkuhlen überflüssig.
Die neue Zeit mit der Elektrizität löste die Gasflamme ab. Das Industriezeitalter blieb auch vor der Siedlung der Bergleute nicht stehen.
Nach drei Tagen verflüchtigte sich der schreckliche Geruch endgültig.
Liebevoll wurde ich von meiner Oma gepflegt, die nach Opas Tod in Ostpreußen bei uns lebte. Sie muss wohl damals erkannt haben, dass meine Mutter meine beiden Schwestern besonders bevorzugte, vor allem aber die jüngste, meine Schwester Ruth.
Ich weiß nicht warum, aber ich spürte es: Wenn etwas gemacht werden musste; Botengänge, kleine Arbeiten, kam nur ich infrage, die Schwestern wurden verschont. Weihnachten wurden sie so sehr mit Geschenken bevorzugt, dass es einem bitter aufstoßen konnte.
Bei Geburtstagen fiel es meiner Oma ebenfalls auf, wie sehr ich gegen die Schwestern in der Behandlung abfiel. Sie versuchte es meinen Eltern klar zu machen, wurde aber abgewiesen. Sie schloss sich mir fester an und ich war glücklich, wenn wir wanderten, wenn sie mich mitnahm, wenn sie erzählte. Behutsam lernte ich durch sie, dass nur die Liebe auf dieser Welt das Leben erträglich macht, dass durch sie Toleranz möglich, der Hass abgeschaltet, dass der Mensch auf einen langen Weg durch die Zeiten sich so wandeln wird, dass er vom Geist her das Gute suchen und diese Erde als Wartestation ansehen wird.
Meine Großmutter wird immer in meinen Gedanken lebendig sein.
Weder meiner Mutter, noch meinem Vater habe ich jemals Vorwürfe darüber gemacht, dass sie meine Schwestern mir vorzogen. Was auch immer sie dazu veranlasste, ich weiß es nicht. Vielleicht war auch ich schuld daran, denn ich habe mich nie nach Mutters Seite ausrichten können, so sehr man sich auch bemühte. Diese Großfamilie war nicht nach meinem Geschmack, sie hockte zu oft beisammen.
Mutters Schwestern vor allen waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Dieser Gruppe bin ich immer ein wenig mehr aus dem Wege gegangen.
Nicht, weil die Zeiten schlecht waren, weil die Unruhen jener Tage die Menschen zu schaffen machte. Es kam so einiges zusammen, sodass die Sorgen vor der Zukunft, den Bergleuten das Leben im Revier sauer machte: Erwerbslosigkeit, Massenentlassungen, Armut, Kurzarbeit und weiß der Himmel was noch alles.
Die Fakten sind ungezählt und ich kann und will nicht die Geschichte des Reviers, sondern nur meine eigene, bescheidene zu Papier bringen. Ich kann nur niederschreiben, was ich erlebte und was mich bewegte. Und das kann nur bedeuten, dass es durch eine ganz private Perspektive gesehen wurde und keinen Anspruch auf der Weisheit letzten Schluss erhebt.
Zurück, zu der Zeit, als ich noch sieben Jahre alt war, als das Leben begann, voller Abenteuer, voller Würze und einer geheimnisvollen Erwartung die tief Innen mich ausfüllte und noch heute ist, wie damals.
2
Da waren die Tomaten. Meine Tante Hannah, Mutters jüngste Schwester, gab mir eine. Sie sagte: »Meine neue Apfelsorte!« Sie lachte, sie lachte nur noch mehr, als ich hineinbiss und sofort alles ausspie und vor Ekel steif und starr dastand. Damals mochte ich keine Tomaten und das hat sich bis zum heutigen Tage so erhalten.
Eine gute Erfahrung machte ich durch meinen Onkel Arthur.
Eines Tages setzte er mir einen Kopfhörer auf, bediente einen kleinen Kasten an dem der Hörer angeschlossen war. Ein Rauschen ertönte und dahinein erklang dünn hörbare Musik aus dem Äther, wie von Geisterstimmen überlagert menschliche Laute. Es erinnerte ans Grammophon, die Stimme seines Herrn, die aus dem Trichter hörbar wurde, wenn man die Kurbel drehte, die Platte auflegte und die Nadel die Rillen abtastete.
Sicher, es gab Tasteninstrumente vielfacher Art, die mechanische Musik machten. Wir in der Kolonie brauchten sie nicht. Familienmitglieder trafen sich sonntags zum gemeinsamen Musizieren. Mein Vater besaß ein Cello, meine Mutter eine gute Stimme und sang leidenschaftlich, genauso ihre Schwestern. Onkel Max und Sohn Hubert spielten Geige, Tante Hannah Klavier und Akkordeon. Onkel Johann Mandoline. Schlagzeug spielte Josef, Mutters jüngster Bruder.
Zuhörer fanden sich immer ein. Platz gab es, Zuspruch, Lob und dann ging die Schoppenflasche reihum, manchmal wurde eine richtige Feier aus dem Zusammentreffen der Musikanten. Kein Wunder, dass es eine gewisse Harmonie der Menschen mit sich brachte, dass Kinderschützenfeste, Nachbarschaftsfeten, Feiertage, Feste aller Art in sich einschloss, dass man eng zusammenrückte und wie in einer großen Familie lebte.
Meine Schwester Ruth wurde Kinderschützen-Königin und der König wurde Alfred Müller. Beide wurden mit Zepter und Krone sowie Krepppapierschärpen geschmückt. Holzschwerter und Gewehre, Papierhelme und angemalte Schnauzer, ließen die Buben fast ausrasten, die Mädchen durften die weißen Kommunionskleidchen anziehen. Sie durften leuchtende Schleifen, Papier- und Seidenblumen, Schmuck und Zierrat tragen.
Sie brauchten nicht vor dem vierrädrigen Handkarren als Pferdchen verkleidet Königin und König im Festzug über die holprigen Wege ziehen. Nur wenn wir Glück hatten, brachte der Nachbar seine dürre Rosinante, ein echtes Pferd mit dem Karren. Dann war der Jubel besonders groß. Pferd und Wagen wurden bekränzt und zur Freude aller an der Spitze des Kinderfestzuges beordert.
Der Umzug führte durch den ganzen Gurkenbau, so hießen die Straßen im Volksmund. Dann wurde gefeiert, auch die Alten feierten mit und das bis in die Nacht hinein.
Kinderschützenfeste wurden fast immer so geplant, dass sie nach dem Fronleichnam-Zug stattfanden, sodass die Papier- und Blumengirlanden eine weitere Verwertung fanden.
Für uns war es eine schöne Zeit, wenn es »Mit dem Pfeil und Bogen« darum ging, König zu werden, um der Beste im Pfeilschießen zu sein.
Ich war es nicht. Ich war einer von denen, die hinter dem Karren marschierten und her trotteten. Mein Ehrgeiz war schon damals schlecht entwickelt. Mir genügte das Zusehen, das Beobachten. Mir genügte das Dabeisein. Nicht immer ging alles glatt. Einmal beim Schützenfest traf es Rudi, er fiel hin und Schaum lief von seinen Lippen. Sein Körper krümmte sich auf. Mein Vater forderte einen Mann auf zu helfen und man trug Rudi ins Haus.
Bald darauf kam der Arzt, wenig später war der Anfall vorbei und Rudi konnte weiterfeiern. Mit seinem Freund spielte uns Rudi oft Kasperletheater vor. Gegen einen Obolus von fünf Pfennigen durften wir Kleineren teilhaben, wie Kasperle sich durchs Leben schlug und in allen Situationen Herr und Meister blieb.
Rudis Leben zeigte dann auch, dass er anderen klarmachte, wo es lang ging. Er wurde Lehrer und Schulleiter – und ist jetzt, wie auch ich im Ruhestand.
Aber es gab auch andere Schicksale, die bereits in der Jugend jeden Ausblick auf eine gute Zukunft ausschlossen.
Zwei Jungen in direkter Nachbarschaft wurden kriminell. Einer davon, ein angenommenes Kind, der andere ein Rotschopf mit hemmungslosem Drang, Gewalt auszuüben. Beide mussten ins Erziehungsheim und wurden ihren Eltern fortgenommen. Was aus ihnen wurde?
Ich weiß es nicht.
Damals grassierten ansteckende Krankheiten, die man kaum in den Griff bekam. Masern, Scharlach, Diphterie und wer weiß noch alles. Es war eine schlimme Zeit. Im Krankenhaus »Isolierhaus« genannt, sah ich vom Fenster zur Besuchszeit auf Mutter und Vater, die dreißig Meter entfernt, auf der Straße standen und uns zuwinkten. Nur die Zeichensprache wurde eingesetzt, hören konnte man nicht, dafür sorgten die geschlossenen Fenster. Trotzdem bekam ich heraus, dass ein Nachbarsjunge an der gleichen Krankheit gestorben war, die mich dorthin gebracht hatte.
In meiner Verzweiflung hatte ich das Essen verweigert und musste hinnehmen, dass die Nonnen mich in eine kleine Kammer sperrten, wo ich einige Stunden lang nur auf den alten Friedhof starren konnte, mit seinen verfallenen Kreuzen und dunklen Grabeinfassungen.
Dort unten langen nahe Anverwandte, Tanten und Onkel … Leute aus der Kolonie, die ich gekannt hatte, die hier ihren letzten Frieden fanden.
Viele Jahre später würde Rektor Beckmann dort liegen und mein Sohn Reinhard sollte auf dem gleichen Zimmer im Isolierhaus, von der gleichen Krankheit betroffen, durch das Fenster auf den alten Friedhof blicken. Was für eine Welt?
Nebenan befand sich meine Schwester und ich durfte sie nicht einmal besuchen. Sie litt wie ich an Scharlach. Ich sah sie erst wieder am Entlassungstag, als wir von den Eltern abgeholt nach Hause durften.
Es war Sommer geworden, die Resser Schweiz, in der Nähe von Westerholt lockte. Sie war eine Badeanstalt, die leider viel zu schnell aus der Landschaft verschwand. Als sie existierte, ertrank meine Schwester Feoria fast bei dem Versuch, allein schwimmen zu wollen. In letzter Sekunde wurde sie von meinem Vater aus dem Wasser geholt. Er konnte noch, bevor der Bademeister eingriff, helfen. Nach diesem vergeblichen Schwimmversuch wollte Feoria lieber ihre Schwimmversuche im Stadtwald fortsetzen, wo sie sich von der großen Rutsche ins Becken tragen lassen konnte, oder sie wollte nach Erlemann, einem Freibad in Bülse, wo es außerdem noch Tennisplätze und ein großes Lokal gab. Sie setzte sich durch, denn sie war Vaters Liebling, der ihr fast jeden Wunsch erfüllte. Erlemanns Erbsensuppe, so nannten wir das Wasser der Anlage, konnte sich nicht mit dem Wasser der Resser Schweiz messen, denn es war undurchsichtig, trüb und gelbegrün. Es hatte den Vorteil, dass man tauchend sich in einer nebligen Wand einbilden konnte, auf dem Mond zu sein. Für den Bademeister aber war dieses Wasser ein Grund, keine Nacht ruhig zu schlafen.
Die schönste Badeanstalt war indes das Gladbecker Stadion. Es lag im Grüngürtel einer Stadt, die nicht weit entfernt leicht mit dem Fahrrad, aber auch zu Fuß zu erreichen war. Wir gingen zu Fuß durch Hege, eine damals ausgesprochene Bauernlandschaft mit schönen Wiesen, Kornfeldern und Äckern. Kühe und Pferde weideten gutes Gras. Blumen standen am Wegesrand und Schmetterlinge flatterten um uns. Vögel ließen ihre Lieder erschallen. Staub wirbelte in leichten Wolken von unseren nackten Füßen, emporgeschleudert, in die laue Sommerluft.
Nach getaner Arbeit zog es meinen Vater zur Badeanstalt und wir Kinder durften mit. Nicht nur, um herumzutoben, zu schwimmen, freien Auslauf zu haben, wir durften auch Vater beobachten, der seinen athletisch gebauten Körper bewundern ließ. Im Ringkampf und Sport war er geübt und erfahren. Nicht so beim Zehnmetersprung vom Turm, wo er zu tief tauchte und einige Kratzer abbekam.
Nun, es hatte ihm nicht geschadet. Ein Pflaster genügte und in wenigen Tagen sah man keinen Kratzer mehr, seine Haut war glatt wie je zuvor. Er begnügte sich nun, vom Startblock ins Wasser zu springen und meine Schwimmkünste zu überwachen. Ich wiederum überwachte ihn und sah, wie er von vielen Badenixen bewundert wurde und angestarrt, gelassen die Bewunderung hinnahm, wie einer, der es gewöhnt war.
Im Ersten Weitkrieg, so sagte meine Oma, als ihr Sohn, mein Vater, bei der Marine in der Skagerrak-Schlacht vom untergehenden Torpedoboot seinen Kapitän rettete, war die ganze Familie auf ihn besonders stolz und als der Kaiser Glückwunsch und Bild mit eigenhändiger Unterschrift schickte, war Ludwig der Star, auf den alle blickten. Er verlor kaum seine Ruhe. Mir war er besonders zugeneigt, wir wurden Freunde. Doch seine Neigung, dem schönen Geschlecht wie ein Kavalier der alten Schule gegenüberzutreten, brachte meine Mutter oft in Rage. Kein Wunder, dass meine temperamentvolle Mutter ihn Vorhaltungen machte und dass ein Kind so etwas auch mitbekommt und belastet.
Ich wuchs also in einer Gegend, in einem Haus, in einer Familie auf, wo es an Spannungen nicht fehlte. Das alles prägt und formt mich, ganz besonders aber das Erlebnis, als ich als vierjähriger in der Silvesternacht die Hilfe- und Todesschreie des Hugo Philipp hörte, die unsere Leute bei der kleinen Freier von den Stühlen rissen.
Sie stürzten nach draußen. Es war dunkel. Gestalten liefen davon, wurden dennoch erkannt, denn die halbe Nachbarschaft war zur Hilfe ins Freie gestürzt. Damals verkroch, versteckte man sich noch nicht, wenn jemand nach Hilfe schrie, damals wurde ein Notruf ernst genommen, alarmierte die Bereitschaft, sofort zu handeln Damals verschloss man noch nicht die Ohren, die Augen, den Mund, um seine eigene Erbärmlichkeit nicht zu gefährden.
Hier lag Hugo, ein 18-Jähriger, den alle kannten, und starb. Er war tot, bevor der Arzt kam. Erstochen, niedergestreckt im eigenen Blut, sein junges Leben meuchlings beendet. Und zum ersten Mal in meinem Leben kroch das Grauen in mir hoch, ließ mich spüren, dass mein Herz hämmerte, meine Kehle sich zuschnürte, dass ein Widerwillen und Ekel gegen die Gewalt in mir lebendig wurden. Nur wenige Schritte vor unserer Haustür war das Ungeheure geschehen, schnell, gnadenlos, jede Hilfe kam zu spät …
Als Hugo aufgebahrt in der Nachbarwohnung lag, war ich dabei, wie seine Brüder weinten, wie ich in einem Meer der Trauer versank und es kaum wagte, auf das bleiche Gesicht des Toten zu schauen. Hinter mir schluchzte seine Mutter, starr und steif stand sein Vater. Wie aus der Ferne drangen die Stimmen der Frauen zu mir, die den Rosenkranz beteten. Der Sarg wurde geschlossen, auf den Leichenwagen gehoben, der von schwarzen Pferden gezogen, sich auf den Marsch zum Friedhof machte. Ein langer Trauerzug, an dem alle Nachbarn teilnahmen, folgte.
»Erde zu Erde, Staub zu Staub.« Es war der eisige Hauch eines unsichtbaren Gletschers, der meinen Nacken streifte. Ich umklammerte die Hand meines Vaters, der Schnee knirschte unter meinen Schuhsohlen, die Kälte biss in meine Wangen …
Aus, vorbei … Hugo, der mich oft auf den alten Gaul des Schrotthändlers gesetzt hatte, war aus meinem Leben verbannt.
»Komm, Bernhard!«, hörte ich meinen Vater sagen. »Wir gehen nach Hause.«
»Die anderen gehen zum Kampmannssaal«, sagte ich.
»Gott bewahre mich davor«, erwiderte mein Vater. »Ich würde keinen Bissen herunterbringen. Sein Tod war zu schrecklich. Wir alle müssen gehen. Es ist ein Muss, dem sich Keiner entziehen kann.«
»Warum gehen die anderen zu Kampmann?«
»Leichenschmaus … essen und trinken … Manchmal artet es in einer Sauferei aus. Vielleicht saufen sie nur, weil sie leben und glauben zu überleben, sie wissen, morgen kannst du der Nächste sein. Sie bemitleiden sich selbst.«
»Wann muss ich gehen?«, fragte ich. »Wie viel Zeit habe ich?« Mit vier Jahren nach der Zeit zu fragen, stimmt mich heute traurig, denn die Zeit schließt den Raum ein. Zwei Größenordnungen die zusammengehören. Ich war gespannt auf seine Antwort.
»Nun, das steht in den Sternen und dann wird deine Angst nicht mehr sein«, sagte er und fuhr lächelnd fort. »Hoffentlich erlebst du keine Beerdigung, wo die Musik spielt oder ein Taubenfreund seine Tauben über das Grab, als letzten Wunsch aufsteigen lässt. Das halten die Nerven nicht aus und man sollte niemanden Leid zufügen.«
»Tut man das wirklich, Vater?«
Jäger blasen ins Horn. Soldaten schießen Salut, man will solidarisch sein. Gefühle, Kameradschaft – über den Tod hinaus zeigen, dass man eine Erinnerung aufrechthält. Doch der Tod wirft uns alle aus dem Rennen, denn vergessen werden alle, mag nur genug Zeit vergehen.