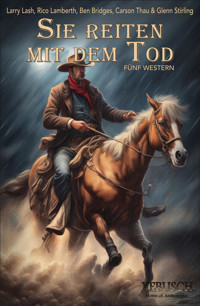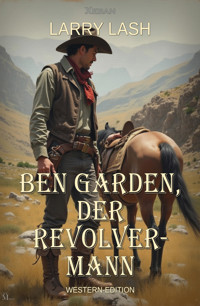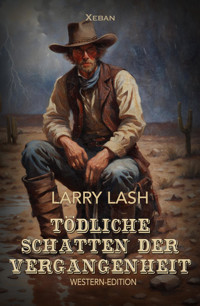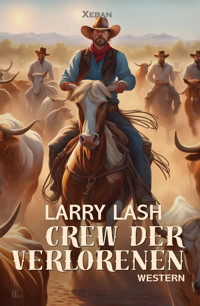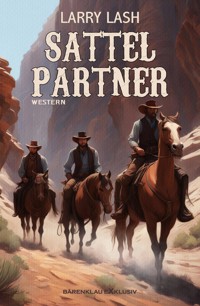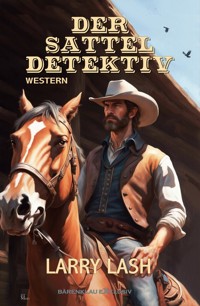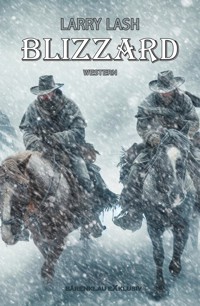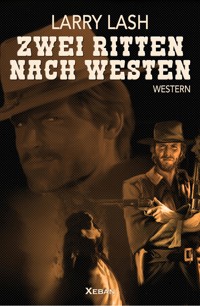3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1794. Die Grenze, die frontier, steht in Flammen. Immer mehr Weiße strömen ins Land, auf der Suche nach Raum, um sich niederzulassen. Immer unbarmherziger dringen die neuen Siedler ins Landesinnere vor; immer heftiger und verzweifelter setzen sich die Indianer zur Wehr, die ihren Lebensraum nicht kampflos aufgeben wollen. Und immer brutaler wird der Krieg zwischen den Bleichgesichtern und den Ureinwohnern.
Inmitten der sich bekämpfenden Parteien führen die Menschen, die an der Grenze leben, einen harten Kampf ums Überleben in diesem unwirtlichen Lebensraum. Dazu gehört auch die Familie Greer. Eines Nachts verlieren die drei Brüder ihre Familie durch einen Indianerüberfall, die Verlobte des einen Bruders wird verschleppt.
Auf der verzweifelten Suche nach der jungen Frau treffen die Greers eine Gruppe von Weißen, die aus Fort Wright flüchten mussten, der letzten Zuflucht – so scheint es – vor dem Nichts. Die Gruppen schließen sich zusammen; sie wissen, ihre einzige Chance aufs Überleben ist, sich durchzuschlagen zu den letzten Bastionen der weißen Eindringlinge. Vor ihnen liegt ein Trail durch die Hölle – rund zweihundert Meilen durch Sümpfe, durch Blizzards, begleitet von hungrigen Wölfen und blutdürstigen Indianern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Larry Lash
Der Trail
durch
die Hölle
Western
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer mit Bärenklau Exklusiv nach Motiven, 2024
Korrektorat: Falk Nagel
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau (OT), Gemeinde Oberkrämer. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Der Trail durch die Hölle
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Der Autor Larry Lash
Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash
Das Buch
1794. Die Grenze, die frontier, steht in Flammen. Immer mehr Weiße strömen ins Land, auf der Suche nach Raum, um sich niederzulassen. Immer unbarmherziger dringen die neuen Siedler ins Landesinnere vor; immer heftiger und verzweifelter setzen sich die Indianer zur Wehr, die ihren Lebensraum nicht kampflos aufgeben wollen. Und immer brutaler wird der Krieg zwischen den Bleichgesichtern und den Ureinwohnern.
Inmitten der sich bekämpfenden Parteien führen die Menschen, die an der Grenze leben, einen harten Kampf ums Überleben in diesem unwirtlichen Lebensraum. Dazu gehört auch die Familie Greer. Eines Nachts verlieren die drei Brüder ihre Familie durch einen Indianerüberfall, die Verlobte des einen Bruders wird verschleppt.
Auf der verzweifelten Suche nach der jungen Frau treffen die Greers eine Gruppe von Weißen, die aus Fort Wright flüchten mussten, der letzten Zuflucht – so scheint es – vor dem Nichts. Die Gruppen schließen sich zusammen; sie wissen, ihre einzige Chance aufs Überleben ist, sich durchzuschlagen zu den letzten Bastionen der weißen Eindringlinge. Vor ihnen liegt ein Trail durch die Hölle – rund zweihundert Meilen durch Sümpfe, durch Blizzards, begleitet von hungrigen Wölfen und blutdürstigen Indianern …
***
Der Trail durch die Hölle
Western von Larry Lash
1. Kapitel
Es war spät geworden. Mitternacht war längst vorüber, und Carmen Greer war immer noch wach und beschäftigt. Obwohl sie einen arbeitsreichen Tag hinter sich gebracht hatte, hart geschuftet und sich abgerackert hatte, brauchte sie die Nachtstunden, um an den Felljacken ihrer Söhne zu nähen. Was tat man nicht alles, wenn der Winter bevorstand und die rauen Herbststürme verrieten, dass der Blizzardgott bald mit seinem eisigen Atem über das Land fegen würde, um alles mit seiner weißen Last zuzudecken. Trübe brannten die Talgkerzen, die von Hand gefertigt waren. Ganz tief beugte Carmen Greer sich über die Arbeit. Das schlechte Licht tat ihren Augen weh und hatte sie entzündet. Es waren große Augen in einem verrunzelten, herb geschnittenen Gesicht. Es waren die Augen einer Frau, die im ständigen, harten Lebenskampf an der Grenze zur Wildnis müde geworden war. Hier, an der Grenze, wurde niemandem etwas geschenkt, weder Männern noch Frauen. Wer krank und anfällig war, schied aus dem Leben, und nur das Urgesunde konnte sein Dasein fristen.
Täglich musste der Kampf aufgenommen werden. Eine dünn gegerbte Hirschblase als Vorhang vor der Nordluke anzubringen, wurde schon als bedenklicher Luxus angesehen. Eisen war wertvoller als Gold. Die festen Blockhütten hatte man, ohne einen Nagel zu verwenden, errichtet. Sie wurden auch so den Erfordernissen gerecht.
Die alte Frau, die über ihre Arbeit gebeugt saß, hörte vom nahen Walde das Schreien des Uhus. Sie und auch die Ihren waren an die nächtlichen Geräusche des Waldes gewöhnt. Sie gehörten zu den Menschen, die der Zivilisation den Rücken gekehrt hatten und die lieber auf einige Annehmlichkeiten verzichteten und dafür die Freiheit bevorzugten. Diese Freiheit zwang ihnen den Kampf auf, den Kampf ums Dasein. Der Tisch war aber stets gedeckt bei ihnen. Die Wälder waren voller Wild. Hirschbraten und Truthahnkeule waren tägliche Leckerbissen, denen nur eins fehlte, nämlich eine Prise Salz. Salz gehörte zu den Dingen, die geradezu unerschwinglich teuer waren. Einen Scheffel Salz zu besitzen, hieß vermögend sein. Haustiere gab es nur wenige. Hühner, einige Milchkühe, Schafe oder Ziegen galten schon als großer Besitz. Pferde waren sehr gefragt, denn ein Mann der Pferde besaß, konnte sie als Tragtiere für das erlegte Wild benutzen. Er brauchte die Last so nicht selbst fortzuschaffen. Ein Pferdebesitzer hatte es schon zu etwas Besonderem gebracht. Es war also kein Wunder, dass auf Pferdediebstahl die Todesstrafe stand. Es bestand aber kein Recht oder Gesetz, denn das war etwas, was es nur dm Osten gab. Ein Pferdedieb wurde ohne lange Umstände vom Leben zum Tod befördert, so war es Brauch und Sitte. Es sollte noch lange so an der Grenze bleiben. Rau war das Land, unergründlich in seiner Weite. Die Prärien, Gebirge, Savannen und die sumpfigen Uferwälder waren unerforscht. Hart waren die Siedler, jene Menschen englischer oder irischer Abkunft, die in jedem Andersgläubigen einen Teufel sahen und jeden, der nicht in ihre Gemeinschaft hineinpasste, kurzerhand zeigten, wer die wirklichen Herren im Lande waren. Sie verachteten die französischen Buschläufer, die so gut auf die indianischen Gepflogenheiten eingingen und sehr bald Freunde der Indianer wurden, dass sie wie die Quäker kaum einen wirklichen Feind bei den Stämmen der roten Nation hatten. Man schrieb das Jahr 1794, und sicherlich wussten die Menschen hier nichts von den Machtbestrebungen der Engländer und Franzosen oder wollten nichts davon wissen. Die Hinterwäldler lebten in ihrer eigenen Welt, und die war ohne jeden politischen Machthintergrund gefährlich und hart genug.
Die Arbeit der alten Frau ging nicht mehr so recht vorwärts. Die Übermüdung zeigte sich deutlich in ihrem Gesicht. Die Frau ließ das gegerbte Leder sinken, durch das die Nadel nicht mehr hin durch wollte. Sie saß da mit gebeugten Schultern, als hätte ihr das Leben in zu früher Jugend schon zu schwere Lasten aufgebürdet. Einen Moment lang lauschte sie und schien dann beruhigt zu sein, als sie die regelmäßigen Atemzüge ihrer Familienmitglieder aus dem Nebenraum hörte. Dass sich einer ihrer erwachsenen Söhne unruhig wälzte, konnte sie gut verstehen. Sicherlich war es Skip, der älteste, der in wenigen Wochen Hochzeit machen würde. Man würde dem jungen Paar dann das rohe Blockhaus in Gemeinschaftsarbeit an einem Tage errichten. Ein kleiner Acker und einige Hände voll Mais in die jungfräuliche Erde gesät würden genügen, um den Anfang zum gemeinsamen Leben zu machen.
Skip hatte bereits seinen Nebenbuhler, wie es an der Grenze üblich war, in einem Zweikampf besiegt. Das war hier so, wenn zwei Männer um die gleiche Frau warben. Wenn man Verständnis für ein solches Duell aufbringen will, muss man die Maßstäbe der damaligen Zeit anlegen, als die Natur noch unkomplizierte Menschen zeugte.
In einem solchen Lande sorgte schon das Naturgesetz dafür, dass nur die Starken überlebten. Das Duell, das Skip mit seinem Gegner austrug, war für diesen tödlich verlaufen. Nach den Gesetzen der Hinterwäldler hatte mit dem Ende des Kampfes alles seine Richtigkeit. Erst in der Brautnacht würden sich die jungen Burschen einen Spaß daraus machen, Skips Mädchen zu entführen. Dabei kam es nicht selten zu harten und bitteren Kämpfen, was ganz im Gegensatz zu den sonstigen Sitten und der Moralstrenge der puritanischen Bevölkerung an der Grenze stand.
Ja, kein Wunder, dass Skip unruhig schlief und sicher schon jetzt davon träumte, wie er sich mit seinen Altersgenossen, die einen derben Spaß machen würden, herumschlug. Die Jugend brauchte den Kampf, um sich zu stählen. Weichlinge hatten keine Bleibe in diesem Lande, das von jedem das Letzte forderte. Für den morgigen Tag hatte man sich vorgenommen, ein kleines Fort in Gemeinschaftsarbeit zu errichten.
Die alte müde Frau, die ihre Handarbeit jetzt endgültig aus dem Schoß nahm und auf den klobigen Tisch legte, hatte in ihrem Leben oft genug der Errichtung eines solchen Forts zugesehen. Man errichtete es ganz aus Holz. Die Ecktürme ragten mit ihrem Obergeschoss um drei Fuß über den Palisadenzaun hinaus. Als Mädchen hatte sie lange und bange Stunden zusammen mit ihren Angehörigen in einem solchen Fort verbracht, als es von unzähligen Indianern angegriffen wurde. Sie konnte sich noch genau daran erinnern, wie man nach langer Belagerung die Frauen dazu zwang, Maiskolben von dem um das Feld angelegten Maisfeld zu holen, damit die Männer sich für den weiteren Kampf stärken konnten.
Ja, jetzt war man dabei, sich zu wappnen. Man würde ein neues Fort errichten, in dem man Lebensmittel lagern würde. Man wollte es um eine Quelle herum errichten und so stark befestigen, dass man es hinter den Palisaden im Notfalle lange Wochen aushalten konnte. Eine noch so starke feindliche Indianerschar würde dann unverrichteter Dinge ohne Skalp und Beute wieder abziehen und in den Urwäldern verschwinden müssen.
Die alte Frau war so in ihre Gedanken versunken, dass sie plötzlich aufschreckte und hellwach wurde, als sie in der Nacht Hufschlag hörte, der sich rasch näherte. Sie weckte ohne lange Überlegung Skip ihren Ältesten. Aus dem Schlaf erwachend, erhob er sich gleich einer großen Raubkatze geschmeidig von seinem Felllager. Skip war nicht im Geringsten schlaftrunken, wie man es häufig bei Menschen mit festem Schlaf findet. Er hatte schon früh seinen Vater vertreten müssen. Vor vier Jahren hatte er ihn, von Indianern getötet, nur wenige Schritte vom Hause gefunden. Die Sorge für die Familie war seitdem auf ihn übergegangen. Nach altem Siedlerbrauch stand das dem ältesten Sohne zu, und zwar so lange, bis er selbst eine Familie gegründet hatte oder die Mutter erneut heiratete und damit einen Beschützer nahm. Letzteres war nicht gerade selten an der Grenze, denn eine Frau brauchte einen Beschützer.
Carmen Greer hatte nicht noch einmal heiraten wollen. Sie hatte ihren Mann sehr geliebt. Er war unvergessen in ihr, dass sie sich nicht dazu entschließen konnte, einem der vielen Bewerber das Jawort zu geben. Sicherlich fühlte sie sich auch schon zu alt und abgearbeitet, zu müde, um es noch einmal an der Seite eines Mannes zu versuchen. Sie wusste, dass ihre Kinder ihr keine Schwierigkeiten bereitet hätten. Ihre Söhne waren nach dem harten Gesetz der Grenze erzogen worden und kannten keine Skrupel. So jung sie auch noch waren, so achtete man sie doch als vollwertige Mitglieder in der Gemeinschaft der Harterprobten. Ein Mann galt hier als vollwertig, wenn er schießen konnte und stark genug war, um zu kämpfen. Niemand fragte dann danach, wie alt er war. An der Grenze zählte die echte Mannbarkeit, und die hatten alle drei ihrer Söhne. Skip, der Älteste, war auch entschieden der Stärkste von ihnen.
Nur einen Augenblick lang stand er jetzt neben seiner Mutter. Seine dunklen Augen begegneten den ihren. Sie schienen sich mit einem Blick zu verständigen. Es fiel kein Wort. Wenn die Menschen an der Grenze Gefahr witterten, waren sie schweigsam. Sie waren nur ausgelassen, ja übertrieben lustig, wenn sie eines ihrer wenigen Feste feierten. Mit einer schnellen Handbewegung langte Skip sich jetzt die Rifle vom Haken. In diesem Augenblick meldete sich Dan Greer von seinem Lager.
»Was ist los?«
Er richtete sich halb auf und schlug die Decke zurück. Wie alle Männer der Grenze hatte auch er seine Kleidung an und brauchte sich nicht erst lange anzuziehen, sondern nur noch wie Skip und der Jüngste der drei, Tom, in die bereitstehenden Mokassins zu schlüpfen.
Waffen hatte man genug zur Auswahl, Pistolen, Äxte und Rifles. Mochten die Waffen auch noch so sehr primitiv sein, so gab es doch viele an der Grenze, die sie geschickt zu handhaben wussten und in Treffsicherheit und Schnelligkeit den Schützen aus späteren Generationen kaum nachstanden.
Tom erhob sich jetzt ebenfalls von seinem Felllager. Alle drei standen jetzt bewaffnet bereit. Skip hatte die Rifle in der Hand, Dan eine Pistole und Tom die Schmetteraxt. Man konnte klar erkennen, welche Art von Waffen die drei jungen Männer bevorzugten.
Tom, der Jüngste, der zur Schmetteraxt gegriffen hatte, unterschied sich auch äußerlich von seinen beiden Brüdern. Er war dunkler als diese, hatte pechschwarzes Haar und glich mehr einem Indianer. Er zog Pfeil und Bogen der Feuerwaffe vor, und wenn man bedenkt, dass man zur damaligen Zeit schneller einen Pfeil von der Sehne geschnellt hatte, als umständlich eine Feuerwaffe nachzuladen, so hatte er keine unpraktischen Waffen gewählt. Mit Pfeil und Bogen konnte Tom ebenso geschickt und schnell umgehen wie ein echter Indianer. Im Nahkampf bevorzugte er wie die Indianer die Schmetteraxt, und die lag ihm wie angegossen in der Rechten.
Der Hufschlag draußen in der Nacht brach jäh ab. Man hörte deutlich, wie der Reiter das Pferd mit harter Hand zum Halt brachte, wie die Hufe auf dem nassen Boden rutschten und die taumelnden Schritte eines Mannes sich näherten. Dem ha ten Schlagen einer Faust auf die Bohlentür folgte eine tiefe Stimme, die rief: »Macht auf, Freunde, um der Barmherzigkeit willen, macht auf!«
Wer den unbarmherzigen Westen kennt, kann das Zögern der Greers verstehen. Nur zu oft waren Menschen auf einen solchen Anruf hin eingedrungen. Das gnadenlose Schicksal vieler Menschen, die auf eine solche Bitte zu schnell Einlass gewährten, stand wie eine dunkle Drohung im Raum. Es gab Indianer, die ein gutes Englisch sprachen und mit diesem Trick einer unheimlichen Horde von beilschwingenden Männern den Weg in eine einsam gelegene Siedlerhütte öffneten. Wenige Augenblicke später hatten die Menschen in ihrem Blut gelegen und waren des Haarschmuckes beraubt gewesen. Kein Wunder also, dass die Greers, die durch eine harte Schule der Erfahrung gegangen waren, einen Augenblick lang zögerten, doch nur einen Augenblick. Dann sagte Carmen Greer ruhig:
»Aufmachen und die Tür sofort wieder schließen. Lasst ihn herein!«
Es gab keine Widerrede, keinen Einwand, keine Bedenken. Eine Mutter hatte an der Grenze im Heim unbedingte Vorrangstellung, und es würde keinem Mann einfallen, sich ihren Anweisungen zu widersetzen.
Dan und Tom stellten sich links und rechts der Tür auf, Dan mit der Pistole und Tom mit der Schmetteraxt, die in seiner Rechten hin und her pendelte, als wollte er ihr Gewicht prüfen. Skip schob den schweren Riegel geräuschlos zurück und riss mit einem Ruck die Tür nach innen auf. Ein bärtiger Mann stürzte herein und fiel lang auf den Lehmfußboden hin.
»Die Tür zu!«, rief er Skip zu, doch das brauchte Skip nicht erst gesagt zu werden.
Die Tür schlug zu. In die Tür eingeschlagene Kugeln zeigten deutlich, dass es höchste Zeit gewesen war. Draußen wieherte das zu Tode getroffene Pferd des hereingestürzten Mannes grell auf. Es klang schaurig in der Nacht. Aus der Nordluke heraus feuerte Dan seine Pistole auf huschende Gestalten ab, die schon ganz nahe an die Blockhütte herangekommen waren. Im Feuerstoß brach eine Gestalt zusammen, die gerade über das verendete, am Boden liegende Pferd zum Sprung angesetzt hatte. Während Tom seine Schmetteraxt eintauschte gegen Pfeil und Bogen, um ebenfalls durch eine der schießschartenartigen Luken in den Kampf einzugreifen, beugte sich Skip über den bärtigen Mann, den er jetzt erst dm trüben Talglicht erkannte.
»Du, Jim?«
Der Mann, der ihm seine Tochter zur Frau geben wollte, sah übel zugerichtet aus. Durch sein blutverkrustetes Gesicht war er nicht gleich zu erkennen gewesen. Der Mann blutete aus mehreren Wunden. Die Kleidung war an mehreren Stellen zerrissen. Vergebens bemühte er sich jetzt, sich vom Boden aufzurichten. Durch den starken Blutverlust war der Körper zu sehr geschwächt worden. Man sah deutlich, dass er mit dem Tode rang.
»Die Hölle ist los! Die Chippeways und Pottowatonies, diese roten Teufel, haben uns überfallen. Blut floss in den finsteren Wäldern, Blut färbte auch das Wasser der Flüsse. Der Mitschikinikwa, der Miami-Häuptling, dieser düstere Mensch, hat sein Versprechen wahr gemacht, dass er die Grenze in Brand stecken will … überall raucht es bereits … jeden Augenblick können sie hier sein, die vereinigten Horden … flieht… flieht, bevor es zu spät ist …!«
Keiner der Greers antwortete. Es war, als käme die schlimme Nachricht nicht unerwartet für sie. Ja, täglich hatte man damit rechnen müssen. Es war immer das gleiche, der rote Mann bäumte sich immer wieder auf, immer wieder warf er sich den Weißen entgegen, um seine Heimat, seine Jagdgründe zu verteidigen.
»Jim, was ist bei dir geschehen, wo ist Loretta? Wo die kleine Mary, deine Frau und deine Eltern? Wo sind sie alle, wo?«, fragte Skip heiser. Man merkte seiner Stimme deutlich die Erregung an.
»Ich weiß es nicht, Skip … ich weiß nur, dass ich sterben muss … der Krieg zieht blutrot herauf … wir armen Teufel an der Grenze müssen es ausbaden… du und deine Familie mit eingeschlossen … so sieht unsere mit Blut erkämpfte Freiheit aus …«
Seine Stimme erlosch. Draußen schlugen Kugeln gegen die Wände. Von der Nordluke her hörte man Dan mit bitterer Ironie sagen: »Die Narren sind die Indianer, Jim!«
Jim hörte es nicht mehr. Er war tot. Seine gebrochenen Augen blickten ins Leere.
2. Kapitel
Es gärte an der Grenze. Noch nie war sie so unruhig und so gefährlich wie in den letzten Jahren gewesen. Es hieß, dass William Wells, der lange Jahre bei den Miamis gelebt hatte, sich von ihnen losgesagt hatte, dass er bei General Wayne aufgenommen worden war und als Feldhauptmann General Waynes Scoutkommando angehöre. Das alles und noch eine Menge mehr wussten die Greers, denn an der Grenze blieb nichts verborgen. Man wusste, dass die Engländer eine Entscheidung suchten, eine Entscheidung, die den jungen Rebellen Staat der Amerikaner zerschlagen sollte. Man wusste, dass die Hinterwäldler Kentuckys, die sich vom alten Europa losgesagt hatten und freie Amerikaner geworden waren, schon seit Langem damit gerechnet hatten, dass England sich den Rebellenstaat nicht gefallen lassen würde und dass der Krieg unausweichlich war. Nur der Himmel mochte wissen, was die sonst allen Machtbestrebungen abholden Hinterwäldler veranlasste, sich wie ein Mann zu erheben. War es um der Freiheit willen? Vorerst war noch nichts entschieden, doch die Chippeways waren da.
Es gab keinen Zweifel. Dan erkannte sie zuerst, jene heidnischen Krieger, die in Tapferkeit, Verschlagenheit und Kampfesmut kaum ihresgleichen unter ihren Rasseangehörigen hatten. Jetzt schrillte ihr Kriegsschrei durch die Nacht und ließ die Pferde im verschlossenen Stall mit den Hufen ausfeuern.
Dem toten Jim Harvey konnte niemand mehr helfen, jetzt galt es das eigene Leben so teuer wie möglich zu verkaufen, einer Übermacht der Indianer standzuhalten, zu kämpfen und alles zu tun, um mit dem Leben davonzukommen. Auf Hilfe von außen konnte man nicht rechnen. Die Nachbarn? – Der nächste war Jim Harvey gewesen.
Man wohnte hier weit auseinander, damit einer dem anderen nicht ins Gehege kam, wenn es um Wildbret ging. Die Hinterwäldler liebten es so und nahmen gern die größere Gefahr in Kauf.
In diesem Moment dröhnten Beilschläge gegen die Tür. Die Pferde schlugen noch wilder mit den Hufen gegen die Stallwand.
»Die Pferde sind verloren«, sagte Skip, als er wieder einen Schuss aus seiner Rifle abgefeuert hatte, laut in den pulverschwangeren Raum hinein.
Seine Brüder antworteten nicht. Ihre Gesichter waren wie das seine von Pulverrauch verschmiert. Carmen Greer lud Dan die Pistolen auf. Sie stand nicht wie von Entsetzen gelähmt da und unfähig sich zu rühren, sie tat, was sie konnte, um ihren Söhnen das Schießen zu erleichtern. Sie tat es mit der Ruhe, wie sie nur von einer Grenzfrau aufgebracht werden konnte, die viel Schweres hinter sich gebracht hatte und gewohnt war, der Gefahr, ja dem Tod in die Augen zu schauen.
»Schießt, Boys, schießt!«, feuerte sie ihre Söhne an. »Sie werden Brandpfeile abschießen, sie wer den nicht abziehen, wenn sie sich nicht blutige Köpfe geholt haben. Denkt an euren Vater!«
Tom, der Jüngste, der gerade einen Pfeil durch die Luke nach draußen schwirren ließ, antwortete, wobei er einen neuen Pfeil aus dem Köcher zog: »Sie bekommen es mit den Pfeilen, die sie selbst herstellten und die sie mir für falschen Mondscheinbrandy verkauften. Jeder Schuss befördert einen Hundesohn zur Hölle!«
Er brach ab. Geräusche auf dem Dach zeigten an, dass es mehreren Indianern gelungen war, sich auf das Dach zu schwingen. Die alte Frau rannte zum Kamin, ergriff Reisig und warf schnell davon auf die Glut, dass es in hellen Flammen aufging. Tom lehnte den Bogen gegen die Wand und griff zur Schmetteraxt. Als der erste Krieger durch die Kaminöffnung heruntersprang, ergriff Carmen Greer den vom Feuerschein geblendeten Roten und stieß ihn in Richtung auf Tom zu, der zum Schlag ausholte und den Gegner traf, ihn mit der Schmetteraxt wie einen Baum fällte.
»Das war für die kleine Mary Harvey!«, stieß Tom wild hervor. Seine Augen rollten. Er kümmerte sich nicht um den toten Feind, der keine zwei Schritte neben dem Feuer liegenblieb. Er warf sich gegen den zweiten Indianer, den seine Mutter nicht wie den ersten vom Feuer hatte verdrängen können. Vom Messer des Roten getroffen, sank seine Mutter lautlos zusammen. Der wilde Zorn in Tom verlieh ihm die Kraft, nicht zurückzuschrecken, sondern kräftig zuzuschlagen, der Zorn verlieh ihm die Schnelligkeit, die nötig war, um diesen gefährlichen Gegner zu bezwingen. Wieder traf die Schmetteraxt, und das mit grellen Kriegsfarben beschmierte Gesicht sackte vor ihm weg. Dann stand er über dem zu Boden gegangenen Gegner, der sich nicht mehr regte und rührte, dessen Federschmuck sich seltsam in der vom Reisigfeuer erhellten und mit beißendem Pulverqualm erfüllten Hütte ausnahm.