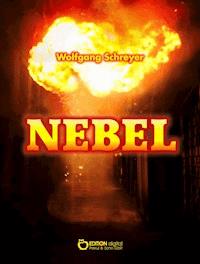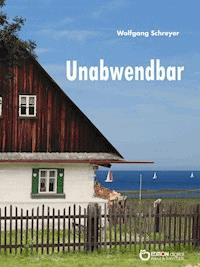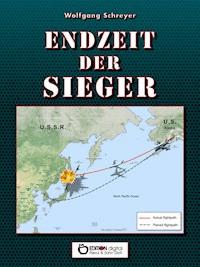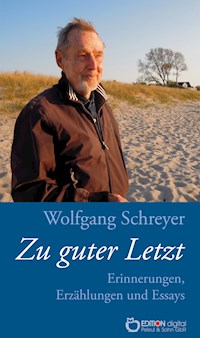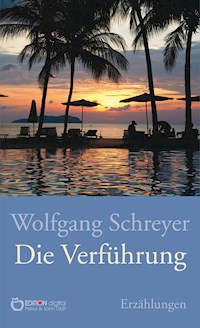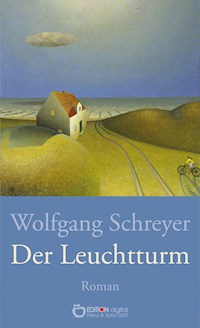8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Nach jahrelangem Materialstudium schrieb Wolfgang Schreyer dieses Tatsachenbuch — die fesselnde Geschichte der Luftaufklärung und Luftspionage. Sein Thema reicht von Alaska bis Israel, von Nicaragua bis Sibirien, vom ersten Späh-Ballon im Jahre 1794 bis zum modernen Foto-Satelliten. Was der Welt lange Zeit verborgen gehalten wurde, wird hier im einzelnen berichtet: Illegale Flüge von Sportfliegern, Abenteurern und Göring-Piloten, der Radarkrieg am Ärmelkanal, die britische Luftaufklärung des V-Waffen-Zentrums Peenemünde, antisowjetische Geheimaktionen der fünfziger Jahre wie U-2-Flüge, B-52-Vorstöße und die Operation „Moby Dick", Spähunternehmen der 1960er Jahre — die „Voodoo"-Flüge über Frankreich und Cuba und der Einsatz von Robotern über der Demokratischen Republik Vietnam. In dokumentarisch belegten Szenen nimmt der Leser teil an Stabsbesprechungen am Tirpitzufer, an der Themse und am Potomac River; an internationalen Pressekonferenzen, Gerichtsverhandlungen und der Einweisung von Spionagefliegern. Es begegnen ihm namhafte Wissenschaftler, Diplomaten, Konzernvertreter, Juristen, Politiker und Generale. Er erlebt Luftkämpfe über der Ostsee und dem Eismeer, eine Notlandung in Japan sowie Beginn und Verlauf der USA-Aggression gegen Vietnam. Der Autor schildert den Entwicklungsgang strategischer Erfindungen (Höhenflug, Luftbild, Radar, Infrarot, Satelliten-Erkundung) und entwirrt das daran geknüpfte Netz technischer Tricks. Gestützt auf Expertengutachten erläutert er die Details so anschaulich, dass auch Leser ohne Fachkenntnisse seiner Darstellung gespannt folgen. Dieses spannend geschriebene und ausgezeichnet recherchierte Buch ist ein Stück Zeitgeschichte. Es erschien in verkürzter Fassung erstmals 1962 unter dem Titel "Piratenchronik". Das eBook enthält die 4. neu bearbeitete und erweiterte Auflage, die 1968 im Deutschen Militärverlag, Berlin erschienen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Augen am Himmel – Eine Piratenchronik
978-3-86394-097-3 (E-Book)
Dem E-Book liegt die 4. überarbeitete und erweiterte Auflage zugrunde. Sie erschien 1968 im Deutschen Militärverlag, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Die Schlammpumpe
Als Dr. Jones vor dem Foto steht, ahnt er wieder die Gefahr, die seinem Lande droht. Seit ein paar Monaten wird er das Gefühl nicht los, auf der Gegenseite stünde eine verhängnisvolle Entwicklung kurz vorm Abschluss. Zahllose Gerüchte gibt es, widersprechende Informationen, Gefangenenaussagen und schwer überprüfbare Agentenmeldungen – wo ist ein einziger klarer Beweis? Wird er ihn hier bei den RAF-Auswertern finden? Er hofft es mit der Ungeduld eines Mannes, der nicht glauben will, dass er seit dreieinhalb Jahren einem Phantom nachjagt. Er ist an diesem Ostermorgen eigens nach Medmenham gekommen, damit sein Verdacht endlich bestätigt werde.
Das Foto, das man ihm vorlegt, ist ein Luftbild, geschossen von einer "Mosquito" in großer Höhe über dem Nordzipfel der Insel Usedom. Captain Kenny hat es so stark vergrößern lassen, dass es den ganzen Tisch bedeckt. Sonst begutachtet André Kenny Fabriken, Bahnhöfe, Kraftwerke – zerbombte und unzerstörte, um sie von der Liste zu streichen oder neu daraufzusetzen. Er ist Abteilungsleiter für Industrieauswertung in der Zentralauswertungseinheit der Königlichen Luftstreitkräfte in Medmenham. "Da oben steht nichts Besonderes mehr, Sir", sagt er und wischt über das Nordende des Peenemünder Hakens. "Anscheinend Landgewinnungsarbeiten..."
Dr. Jones tippt auf einen lang gestreckten, nach Nordwest weisenden Schatten dicht am Strand. "Und das hier, Captain?"
"Wir haben dieses Objekt als eine Pumpmaschine identifiziert", antwortet Kenny. "Offenbar zapfen die Deutschen damit Schlamm aus dem Meer und lassen ihn dort trocknen."
Dr. Jones schüttelt den Kopf, ihn überzeugt die Auskunft nicht. Die Deutschen haben andere Sorgen, Land entreißen sie lieber ihren Nachbarn als der See. Er lässt sich eine Lupe geben und starrt auf die vermeintliche Pumpe, bis sie ihm verschwimmt... Es ist Ostersonntag 1943. Trügerische Ruhe an den Fronten. In Tunesien rüstet General Alexander zum Schlag gegen den letzten Brückenkopf der Achsenmächte auf afrikanischem Boden. Im Osten erstickt jede Bewegung im Frühjahrsschlamm. Dennoch beginnen die Deutschen, einem Agentenbericht zufolge, rund um den Kursker Bogen vierhunderttausend Mann und dreitausend Panzer zusammenzuziehen. Vor fünf Tagen hat Hitler das Unternehmen "Zitadelle" befohlen, "als ersten der diesjährigen Angriffsschläge, der uns die Initiative für dieses Frühjahr und den Sommer bringen muss". Und tausend Kilometer hinter der Front zerstampft die SS das Warschauer Ghetto.
Deutschland ist, nach Stalingrad, ein verwundetes, zu allem fähiges Raubtier. Noch immer sind es hauptsächlich die sowjetischen Truppen, die es niederhalten und zurücktreiben. Amerika hat im Pazifik zu tun, Großbritannien führt seine Bomberoffensiven. Eben hat Winston Churchill an Stalin geschrieben: "In dieser Woche haben wir drei erfolgreiche Angriffe geflogen, nämlich auf Spezia, Stuttgart, und vergangene Nacht sowohl auf die Škoda-Werke in Plzeň wie auf Mannheim... Obgleich die Fotografien zeigen, dass ungefähr ein Drittel von Essen in Trümmern liegt, macht der Feind große Anstrengungen, um die Kruppwerke in Gang zu halten... Wir haben aus diesem Grunde den Kruppwerken noch mal 800 Tonnen verpasst. Außerdem haben wir vorige Woche Duisburg 1450 Tonnen zukommen lassen, die schwerste Bombenlast, die bisher bei einem einzigen Angriff abgeworfen wurde. Stettin bekam 782 Tonnen ab und Rostock 117..."(Briefwechsel Stalins mit Churchill, Attlee, Roosevelt und Truman 1941–1945, Berlin 1961, S. 148 u. 158.)
Dr. R. V. Jones weiß die Zahlen auswendig. Seit man ihn im September 1939 aus seinem Oxforder Universitätslabor geholt und zum Chef der "Wissenschaftlichen Abwehr" im britischen Luftfahrtministerium ernannt hat, ist er jeder Entwicklung, jeder Tendenz und Spielart des Luftkriegs nachgegangen. Dabei ist ihm unumstößlich klar geworden, dass die Deutschen Vergeltung üben wollen, dass es nicht leeres Gerede war, als Hitler neulich mit dem deutschen Erfindergenie drohte, das nicht müßig gewesen sei und neue Waffen geschmiedet habe. Die Ostfront beansprucht ihre Luftwaffe, ihr Kriegspotential, daher fehlt es ihnen an konventionellen Abwehrmitteln; ihre "Festung Europa" ist ein Haus ohne Dach. Doch sie arbeiten pausenlos an Geheimwaffen für einen Gegenschlag, und zwar, wie Dr. Jones weiß, seit langem.
Schon vor dreieinhalb Jahren nämlich, nach seinem Blitzsieg über Polen, hatte Hitler in Danzig eine neue Waffe erwähnt, mit der Deutschland nicht angegriffen werden könne. Damals war Großbritannien aufgewacht – über feindliche Waffenprojekte wusste man nichts. Schleunigst hatte der RAF-Generalstab seiner Abwehr eine naturwissenschaftliche und eine technische Unterabteilung angegliedert und Physiker wie ihn, Jones, in leitende Positionen eingesetzt. Er besann sich noch genau auf den schweren Anfang. Seine erste Maßnahme war, mit der ihm als Wissenschaftler eigenen Akribie alle Agentenberichte über Geheimwaffen zu sichten, die dem Secret Service seit 1934 zugegangen waren. Die meisten klangen höchst unklar, manche erschienen ihm einfach grotesk. Sein Unternehmen ähnelte dem Versuch, aus einem Gemisch verschmutzter Flüssigkeiten eine unbekannte Substanz herauszudestillieren.
Am 11. November 1939 legte er, wie David Irving in seinem 1965 in London erschienenen Buch "Operation Crossbow" berichtet, die Analyse vor. Die Zusammenfassung lautete: "Eine Anzahl von Waffen wird (in den Agentenberichten) mehrmals erwähnt, und einige müssen ernsthaft in Betracht gezogen werden. Dazu gehören: bakterielle Kriegführung; neue Kampfstoffe; Flammenwerfer; Gleitbomben, Lufttorpedos und unbemannte Flugzeuge; weittragende Geschütze und Raketen; neue Torpedos, Minen und Unterseeboote; Todesstrahlen, Strahlen, die Motoren ausschalten; magnetische Minen."
Über deutsche Raketenprogramme lagen zu diesem Zeitpunkt nur zwei Auskünfte vor, ein "Gerüchtebericht" und eine anonyme Nachricht. Sie war im letzten Moment vom britischen Marineattaché in Oslo übermittelt worden und sprach von einer Versuchsanstalt irgendwo an der deutschen Ostseeküste. So nebulos sie auch waren, ohne eine der beiden Auskünfte wäre das Stichwort "Raketen" nicht in die Zusammenfassung hineingelangt. Doch Jones hatte sich außerstande gesehen, den Wert dieser Meldung zu beurteilen. Überhaupt war es sein Problem, echte Nachrichten aus dem Informationsstrom, der seinen Schreibtisch überschwemmte, herauszufischen und sie von den üblichen Verunreinigungen zu befreien. Das weitaus meiste, was seine Dienststelle erreichte, war ein wunderliches Gemisch aus Daherfabuliertem, Missverstandenem und jenen gesteuerten Falschmeldungen, die der deutsche Geheimdienst – wie jeder andere – massenhaft ausstreute, um wirkliche Entwicklungen zu verschleiern und verlustreiche Reaktionen zu provozieren. So genanntes Spielmaterial, glaubwürdig zubereitete Fehlinformationen, machten Jones viel zu schaffen.
So hatte er drei Jahre hindurch im Dunkeln getappt, bis das Geraune um eine deutsche Raketenentwicklung plötzlich schwoll. Der erste Hinweis kam von einem dänischen Chemiker, den Jones für zuverlässig hielt. In einem Berliner Weinlokal hatte der Däne eine Unterhaltung belauscht, aus der hervorging, dass Ende November 1942 "bei Swinemünde" mit einer "großen Rakete" experimentiert worden sei. Ein weiterer Agentenbericht umriss den Versuchsort genauer: Peenemünde am Nordzipfel von Usedom. Diese Angabe machte es erstmals möglich, die Luftstreitkräfte einzuschalten: Am 9. Februar wurde Bildaufklärung über Peenemünde befohlen. Die Kameraaugen der "Mosquitos" sollten erspähen, das Negativ sollte festhalten, was die Agenten so ungenau beschrieben, weil keiner von ihnen es je erblickt hatte.
Aber, wie es scheint, sieht auch dieses Auge nicht eben scharf. Enttäuscht legt Dr. Jones die Lupe hin. Schon oft hat er auf Luftbildern rätselhafte Dinge entdeckt – Einzelheiten, die einfach nicht zu bestimmen sind. Faktoren wie Luftunruhe, Staub, Dunst, Kontrastarmut, Vibrationen, Schwankungen des Beobachtungsinstruments gegenüber dem Objekt schränken die Vergrößerungsfähigkeit ein. Er kennt die Faustregel der Bildauswerter, nach der das Identifizieren eines Ziels eine fünfmal höhere Auflösung verlangt als die bloße Ortung. Und das Auflösungsvermögen der Filme bleibt noch immer hinter dem der Kameraoptik zurück. Daher kann er jetzt beim besten Willen dem Captain Kenny nicht widersprechen, der den Schatten am Strand für eine Schlammpumpe hält.
"Bitte verständigen Sie mich, sobald neues Material vorliegt", sagt er. "Wir vermuten, dass die Deutschen eine Art Schleuder haben, irgendeine Form von weittragenden Werfern, die in der Lage sind, von der französischen Küste bis nach London zu feuern. Der Werfer könnte einem Stück Eisenbahngleis ähneln. Ich wäre Ihnen deshalb dankbar, wenn Sie sorgfältig auf alle verdächtigen Montagen von Schienen oder Gerüsten achten wollten."
"Sehr wohl, Sir", antwortet Kenny.
Dr. Jones verabschiedet sich. "Wir sollten auch nach anderen Indizien suchen", bemerkt er an der Tür. "Sie treiben ihre Raketen mit festem Brennstoff an, vielleicht mit Cordit. Ein Sprengstoffwerk müsste also in der Nähe sein... Hoffentlich höre ich bald von Ihnen."
Zelte im Unterholz
Neben der Bentley-Limousine, die den Abwehrchef in sein Londoner Büro zurückbringen soll, steht ein flüchtiger Bekannter: Major Cummings von der Geschichtsabteilung des RAF-Stabs. Er hat auf eine Fahrgelegenheit gewartet, offenbar steht ihm kein eigener Wagen zu. "Was halten Sie eigentlich von unserer Luftaufklärung?", fragt Jones ihn, als der Bentley losrollt.
"Sie ist der nützlichste Teil der Royal Air Force", antwortet Cummings ohne Zögern. "Sie könnte es jedenfalls sein, wenn man mehr für sie tun würde. Aber sie wird unterschätzt. Wichtig sind uns einzig Harris' Bomber, allenfalls noch die Jagdflieger, die von ihrem Ruhm aus dem Herbst 1940 zehren. Der Aufklärer bringt ja keine Resultate, die so ins Auge fallen wie verbrannte Städte." Er lacht – ein kurzes Lachen, das bitter und trocken und ein wenig verächtlich klingt.
"Mir scheint manchmal, die Luftaufklärung findet gar nichts mehr, das kleiner ist als Berlin."
"Weil man nichts anderes von ihr verlangt! Wir haben vergessen, was sie leisten kann und dass die Geschichte des Luftkriegs mit ihr angefangen hat."
Dr. Jones lehnt sich in das Fondpolster zurück. Draußen flitzt eine Reihe blühender Apfelbäume vorbei. Soll er mit Cummings lieber über das Wetter sprechen? Er kennt dessen ketzerische Einstellung zur Bomberoffensive, seine Kritik an RAF-Stabschef Sir Charles Portal. "Übertreiben Sie nicht etwas?", fragt er schließlich.
"Gewiss nicht", sagt Cummings. "Seit es organisierte Heere gibt, gilt die ständige Sorge aller Befehlshaber dem, was der Feind heimlich tut. Nichts gegen Ihre Dienststelle, Doktor – aber in alten Zeiten hatten Kundschafter nicht dieselbe Bedeutung wie heutzutage. Wenn es ernst wurde, kamen sie oft zu spät. Die Feldherrn verließen sich weniger auf Spione, vielmehr schickten sie Beobachter auf Bergkuppen oder Baumkronen, um ihren Blick zu weiten, und setzten sie in Sättel, damit die Nachrichtenübermittlung rascher vonstatten ging. Von der Antike bis zur Neuzeit war die Kavalleriepatrouille das beste Informationsmittel. Bis man den Ballon erfand und eine Etage höher stieg."
Dr. Jones schweigt, ihm gefällt an Cummings immer wieder der wissenschaftliche Stil, die souveräne Betrachtungsweise. Er hat sich schon manchmal gefragt, ob diese Art, gelassen auf Jahrtausende zu blicken, der Karriere des Majors dienlich ist, dessen Kenntnisse in erheblichem Gegensatz zu der Geringschätzung stehen, die man ihm im Stab entgegenbringt. "Damals", hört er ihn sagen, "beschloss der französische Wohlfahrtsausschuss, seine Streitkräfte mit gasgefüllten Fesselballons auszurüsten, damit, wie es wörtlich hieß, 'Vorposten aus der Luft die Bewegungen des Feindes verfolgen könnten'. Während des ersten Koalitionskriegs der europäischen Majestäten gegen das bürgerliche Frankreich entstand also eine Ballonfahrerkompanie. Ihr verdankte General Jourdan am 26. Juni 1794 seinen Sieg über die Österreicher bei Fleurus."("Interavia", Genf, Nr. 2/1964.)
"Das blieb ein Einzelerfolg, nicht wahr?"
"Zunächst ja. Aber nachdem sechzig Jahre später der Pariser Félix Nadar – ein Zeichner, Schriftsteller und Ballonfahrer – die Luftfotografie erfunden hatte, nahm sich ein amerikanischer Professor namens Thaddeus Lowe der Sache an. Er machte daraus ein Instrument der militärischen Aufklärung. Denn der missionarische Geist Amerikas war schon in jenen Tagen nicht ausschließlich friedlich. Ohne auch nur guten Tag zu sagen, hatten die Yankees Indianer, Holländer, Spanier, Franzosen und Engländer vertrieben, waren über Mexiko hergefallen, hatten sich Texas und Kalifornien genommen und stürzten sich nun wie besessen in ihren Bürgerkrieg. Dabei ernannten sie Lowe zum Chefaeronautiker der Potomac-Armee. Im Juni 1861 stieg er über Virginia auf und erstattete dem Nordstaaten-General McDonald einen völlig zutreffenden Bericht über die Stellungen der Rebellentruppen. Dieser Lowe war ein ziemlich heller Kopf. Er benutzte ein auf dem Potomac operierendes Schiff als Ballonträger, nahm eine Kamera in den Ballonkorb mit und bediente sich zur Nachrichtenübermittlung des eben erfundenen Telegrafen... Langweilt es Sie?"
"Keineswegs", sagte Jones.
"Einer seiner Ballonführer, ein gewisser John LaMountain, startete sogar nachts, um die Zeltlichter der Südstaatler zu zählen. Aber das wurde deren Befehlshaber, General Beauregard, hinterbracht, er ergriff recht moderne Gegenmaßnahmen. Beauregard ließ sämtliche Zelte im dichten Unterholz verstecken und befahl, die Lampen zu löschen. Verdunkelung, Doktor! Außerdem ordnete er an, in beträchtlicher Entfernung viele Täuschungslichter aufzustellen. Anstelle seiner schwachen Kräfte sollte der Feind eine überlegene Truppenmacht vermuten... Bis zum Marokko-Konflikt 1907 ist der Fesselballon das einzige Instrument der Luftaufklärung geblieben. Dann erwuchs ihm im Militärflugzeug nicht nur ein Rivale, sondern auch ein gefährlicher Gegner."
"Waren Ballonaufnahmen nicht qualitativ besser?", Dr. Jones denkt an die Schlammpumpe.
"Es gab ganz ausgezeichnete", antwortet Cummings. "Wenn Sie einmal Zeit finden, mich zu besuchen, zeige ich Ihnen gern unser historisches Archiv. Wir haben darin auch das erste Buch über Militärflugzeuge, natürlich verfasst von einem Franzosen. Darin rangiert der Aufklärer an erster Stelle. 'Wir beginnen mit den Aufklärern, denn es leuchtet ein, dass man sie im Kriege als erste brauchen wird', heißt es da. 'Sie werden entsprechend ihren Aufgaben zu gestalten sein. Vor allen anderen Eigenschaften wird man der Geschwindigkeit und der Eignung zu langen Flügen den Vorzug geben.' Als das von Clément Ader in seinem 1911 in Paris erschienenen Buch "L'Aviation Militaire" geschrieben wurde, hielt man Beobachtungshöhen von tausend Metern für astronomisch und bestaunte Maschinen, die eine Geschwindigkeit von fünfundsiebzig Kilometern in der Stunde erreichten."
Der Major macht eine Pause, wie um sich zu vergewissern, dass Dr. Jones ihm noch zuhört. Offenbar ist er daran gewöhnt, nicht ernst genommen zu werden. "Als der erste Weltkrieg ausbrach, setzten die Armeen aller Beteiligten zunächst unbewaffnete Flugzeuge ein zur Artilleriebeobachtung und Gefechtsaufklärung", fährt er fort. "Das MG-bestückte Jagdflugzeug entstand erst daraufhin, und zwar eigens zu dem Zweck, die lästigen Späher des Gegners zu vertreiben, ob sie nun im Fesselballon saßen oder im Flugzeug. Die ersten Luftkämpfe der Kriegsgeschichte wurden um der Aufklärung willen geführt."
"Deren Ergebnisse waren doch anfangs ziemlich mager?", fragt Jones. "Wie ich hörte, hielten die Beobachter dunkle Asphaltstreifen auf den Straßen für marschierende Kolonnen und verwechselten Friedhöfe mit Zeltlagern."
"Das ist richtig, Doktor. Andererseits erzielten sie verblüffende Erfolge. Die Deutschen gewannen ihre erste große Schlacht durch einen Blick aus der Vogelschau. Dank abgeworfener Meldungen ihrer 14. Fliegerabteilung erkannten sie einen russischen Entsatzversuch, wehrten ihn ab und schlugen die bei Tannenberg eingekreiste Narew-Armee des Zaren. Wir waren aber auch nicht müßig. Unser Royal Flying Corps fotografierte im März 1915 das gesamte deutsche Grabensystem vor der 1. britischen Armee; es bereitete damit die siegreiche alliierte Offensive von Neuve Chapelle vor. Bordsender verbesserten die Nachrichtenübermittlung, auch das Tempo der Bildherstellung und -auswertung nahm sprunghaft zu. Piloten des amerikanischen Expeditionskorps lieferten während der Argonnenoffensive binnen vier Tagen sechsundfünfzigtausend Luftaufnahmen ab! Gegen Kriegsende hatten die Deutschen zweitausend Kameras für Luftbildaufnahmen und hundert automatische Luftbildkameras für Reihenaufnahmen in Gebrauch. An normalen Tagen schossen sie viertausend Fotos. Wir brachten es etwa auf tausend."
"Sie sind ein wandelndes Lexikon", spottet Jones gutmütig. "Es wundert mich gar nicht, dass man Ihnen keinen Wagen bewilligt, wenn Sie weiter nichts tun als in der Vergangenheit zu graben. So also sieht der Beitrag Ihrer Abteilung zu 'Blut, Schweiß und Tränen' aus."
"Nun, Tränen kommen einem schon, wenn man erleben muss, dass nur noch das Bomberkommando zählt. So war es vor drei Jahren bei den Deutschen auch, und sie haben die Schwächen ihrer Luftaufklärung teuer genug bezahlt... Wir schließen eben eine Untersuchung ab über die Ursachen ihrer damaligen Niederlage. Der Hauptgrund ist, glaube ich, aufgedeckt. Wir stochern keineswegs nur im Schutt vergangener Kriege."
"Sie machen mich neugierig."
"Das Resultat dürfte Sie erschrecken, Sir. Göring hätte die Luftschlacht über England gewinnen können, wenn seine Aufklärung intakt gewesen wäre. Als er am 1. August 1940 losschlug, rechnete er nur noch mit dreihundert einsatzfähigen britischen Jagdflugzeugen, während wir tatsächlich siebenhundert hatten. Er selbst besaß allerdings etwa tausend, dazu tausend Bomber und dreihundert Stukas. Aber wie verfuhr man in seinem Stab? Man buchte einfach jede RAF-Staffel ab, deren Horst erfolgreich bombardiert worden war. Nach einem Schlag auf Biggin Hill etwa galten die dort stationierten drei Jagdflugzeugstaffeln als vernichtet. Keine Luftaufklärung verriet ihm, dass die Staffeln noch immer teils von Biggin Hill, teils von Ausweichplätzen aufstiegen. Wie die Vernehmungsprotokolle einiger seiner Offiziere bezeugen, die wir in Afrika gefasst haben, griff er uns praktisch mit verbundenen Augen an."
"Ich würde meinen, Major, er ist an unserem Radar gescheitert."
"Das Radarnetz war unsere Stärke und Schwäche zugleich. Die Geräte signalisierten jeden hoch anfliegenden Gegner auf zweihundert Kilometer Entfernung, aber sie spüren noch heute keine Tiefflieger auf. Dieser Art des Angriffs war das Land nackt ausgeliefert – Göring hat es nicht genutzt. Hätte er den Kanal in hundert Meter Höhe überfliegen lassen, von kleinen Rudeln, die alle fünfzig Kilometer ihre Flugrichtung geändert hätten, um unser Beobachterkorps zu täuschen, dann hätte seine Luftwaffe mit Sicherheit die zweiunddreißig Ziele zerstören können, um die es damals ging: die neunzehn Radarstationen zwischen der Wash und Portland, die elf Jägerflugplätze an der Südküste und bei London, dazu die Hauptquartiere der 11. Jägergruppe in Uxbridge und des RAF-Jägerkommandos. Nach vierzehn Tagen wären unsere Radaraugen erblindet, unsere Jagdflugzeuge vernichtet gewesen.(Siehe J. E. Johnson, Full Circle, London 1964, S. 51.) Aber er sah seine Chance nicht, weil seine Feindaufklärung versagte. Andernfalls wäre der Weg für die drei deutschen Landungsarmeen frei gewesen, und die Luftwaffe hätte zur nächsten Phase übergehen können – der Isolierung des Schlachtfelds durch Zerstörung unserer Häfen und Bahnhöfe, der südenglischen Städte, Straßen und Brücken."
Die Darstellung beeindruckt Dr. Jones. Er schweigt, während der Wagen jetzt die Außenbezirke Londons durchquert. Das Kriegsglück ist unbeständig wie der Sonnenschein im April, denkt er. Wenn Cummings recht hat, verdankt England seine Rettung feindlichen Fehlern. Vielleicht jedoch muss es demnächst für eigenes Versagen viel schwerer büßen! Ihn fröstelt es plötzlich, er hat eine Vision. Er sieht Raketen in das Häusermeer Großlondons stürzen, meint den Doppelknall platzender Schallmauern zu hören, gefolgt von Detonationen; über den Dächern erheben sich Rauchpilze und strudelnde Wolken aus Ziegelstaub. Was wird die Spitze der Raketen bergen, ein paar Tonnen gewöhnlichen Sprengstoffs oder eine Atomladung? Auf alliierter Seite weiß niemand, wo die deutsche Kernforschung steht. Churchill und Eisenhower befürchten, Hitler könne versuchen, die geplante Frankreich-Invasion zumindest mit atomarem Abfall zu bremsen.(Siehe Michel Bar-Zohar, La chasse aux savants allemands, Paris 1965.) Was aber droht London?... Er beschließt in diesem Moment, nicht zu ruhen, bis er Gewissheit hat.
Mosquitos contra Geheimwaffen
"Am 29. April 1943 verbreitete die Zentralauswertungseinheit Medmenham den ersten Bildaufklärerbericht über Peenemünde", schreibt der britische Luftkriegshistoriker David Irving 22 Jahre später. "Er stützte sich auf die letzten vier Aufklärungsflüge. Darin waren fünf der Gebäudegruppen und Anlagen auf dem Peenemünder Haken beschrieben, nicht jedoch der Flugplatz, auf dem – den Briten unbekannt – Entwicklung und Erprobung von Flügelgeschossen (der späteren V 1) stattfanden. Und wieder war Kennys Industrieabteilung, die bereits die Schleuder der Flügelgeschosse als Schlammpumpe identifiziert hatte, zu Fehlschlüssen gelangt: Zwei hohe Fabrikgebäude bezeichnete sie als 'möglicherweise Nitrierhäuser' – tatsächlich stellten sie aber das Versuchswerk für Fertigung und Montage der A 4-Raketen dar (der späteren V 2).
Als Kennys Gruppe ihre Aufmerksamkeit auf das Kraftwerk richtete, wurde sie abermals vom Pech verfolgt: 'Das Kraftwerk weist zur Zeit der Luftaufnahme keinerlei Zeichen einer Tätigkeit auf, abgesehen von den Brennstoffvorräten auf dem Kohlenhof. Nicht einer der sechs Schornsteine auf dem Kesselhaus raucht.' Tatsächlich arbeiteten die Generatoren aber auf Hochtouren; die Deutschen hatten allerdings elektrostatische Staub- und Rauchfänger in die Schornsteine eingebaut, um den Rauchausstoß auf ein Minimum zu reduzieren.
Der folgenschwerste Irrtum unterlief der Kenny-Gruppe jedoch, als sie ein Objekt lediglich als 'ein großes Gebäude von 65 m mal 45 m' abtat. Denn dieses Gebäude war die empfindlichste Anlage im ganzen Peenemünder Gebiet – sie stellte flüssigen Sauerstoff her. Hätte Duncan Sandys (Churchills Schwiegersohn und von diesem mit der Bekämpfung feindlicher Geheimwaffen beauftragt) zu dieser Zeit gewusst, dass die Peenemünder Anstalt mit einer sehr großen Anlage zur Herstellung von flüssigem Sauerstoff ausgerüstet war, hätte er nicht übersehen können, dass dies wahrscheinlich ein wesentlicher Bestandteil des Raketentreibstoffs war.
Doch die Bildauswerter in Medmenham waren angewiesen worden, sorgfältig nach Beweisen für die Herstellung von Raketen mit konventionellem Brennstoffantrieb, möglicherweise Cordit, zu suchen – und so fanden sie diese Beweise: 'Der allgemeine Eindruck der Fabrik, die auf einer Lichtung im Walde liegt, deutet darauf hin, dass sie zur Herstellung von Explosivstoffen benutzt werden könnte.'
Auf die geheimnisvolle elliptische Erdanlage mit Gruppen hoher Gebäude, Laufkränen, Gruben, Kleinstbunkern und unerklärlichen Fetzen weißen Dampfes konzentrierten die Kenny-Leute ihre größte Aufmerksamkeit. Hier übertrafen sie sich selbst an Genauigkeit. Keiner von ihnen wagte eine offizielle Vermutung über den Zweck dieser großzügig angelegten Erdanlage, doch jeder war wohl davon überzeugt, dass dies der Startplatz einer Rakete sein müsse: 'Man sieht eine große Wolke von weißem Rauch oder Dampf... Auf dem Foto 5010 erkennt man ein etwa siebeneinhalb Meter langes Objekt... Als Foto 5011 vier Sekunden später aufgenommen wurde, war dieses Objekt verschwunden.'
Die Berichte der Heeresanstalt Peenemünde geben einen Hinweis darauf, was geschah, als diese Fotos aufgenommen wurden: Am 22. April, dem Tag dieses Aufklärungsfluges, stand das einundzwanzigste Fertigungsmuster der Rakete 'A 4' auf Prüfstand VII der elliptischen Erdanlage. Kennys 'Wolke' war die Kondenswolke, als flüssiger Sauerstoff in die Tanks der Rakete gepumpt wurde. Um 15.25 Uhr, kurz nachdem die Aufklärer-Mosquito über Peenemünde hinweggeflogen war, hatte von Braun mit dem Countdown für den Abschuss begonnen, der einer der erfolgreichsten aller frühen Peenemünder Raketenstarts werden sollte: Das 'A 4' flog 260 Kilometer weit die Ostsee-Schussbahn entlang."(Zitiert nach: "Der Spiegel", Hamburg, Nr. 44/1965.)
Duncan Sandys unterrichtet das britische Kabinett am 17. Mai 1943. Ebenso wie Dr. Jones sieht er in London das Ziel eines möglichen Raketenangriffs. Er fordert Bombenschläge auf Usedom und auf verdächtige Baustellen jenseits des Kanals. Die RAF soll alle Fotos, die seit dem Jahresbeginn bis zu 200 Kilometer Entfernung von London aufgenommen worden sind, auf ungewöhnliche Strukturen hin prüfen und eventuelle Lücken durch Bildflüge schließen. Doch sein Vorschlag, Peenemünde zu attackieren, wird zurückgestellt. Die RAF lässt sich nicht drängen. Bei einem Präzisionsschlag aus geringer Höhe fürchtet sie schwere Verluste; die Nächte sind kurz, der Anflug ist weit, das Angriffsziel schwierig. Und Lord Cherwell, die graue Eminenz des Kabinetts, opponiert gleichfalls. Für ihn, den Churchill-Günstling, ist der fünfunddreißigjährige Sandys ein frecher Rivale. In seiner Eifersucht geht er so weit, den Deutschen die Fähigkeit abzusprechen, eine brauchbare Fernrakete zu bauen.
Da erbringt die Bildaufklärung neue Beweise. Auf einem der Peenemünde-Fotos entdeckt Captain Kenny zylindrische Objekte – weiße Striche von anderthalb Millimeter Länge auf grauem Grund. Es ist der Aufklärungsflug N/853, der dieses Resultat liefert. Mitte Juni beschreibt Kenny die rätselhaften Striche vorsichtig als "etwa zwölf Meter hohe und 1,2 Meter dicke Säulen". Dr. Jones hält sie mit Sicherheit für Raketen, er verständigt Lord Cherwell und Duncan Sandys. Zwei Wochen später beschließt der Verteidigungsausschuss des britischen Kabinetts, "die aufmerksamste und strengste Erkundung des nordfranzösischen Gebiets innerhalb eines Radius von 240 Kilometern von London aufzubauen und aufrechtzuerhalten". Pläne für eine Teilevakuierung der Hauptstadt werden ausgearbeitet, 30 000 stählerne Unterstände – nach dem britischen Innenminister "Morrison-Bunker" genannt – unauffällig herbeigeschafft. Man streicht den Bau von zwei Schlachtschiffen, um Stahl für den Luftschutz zu haben. Der Angriff auf die Versuchsstation Peenemünde soll mit Vorrang als "schwerstmöglicher Nachtangriff des Bomberkommandos" geflogen werden. Er soll in erster Linie den deutschen Wissenschaftlern gelten, ohne die die Raketen nicht bis zur Serienreife vervollkommnet werden können.
Zu diesem Zeitpunkt ahnt in Großbritannien niemand etwas von dem V-1-Flügelgeschoss, jenem unbemannten Düsenflugkörper, den die Luftwaffe am Weststrand des Peenemünder Hakens erprobt. Ein Jahr später wird er sich als Hauptgefahr erweisen, doch jetzt denkt man nur an Peenemünde-Ost, will den Punkt treffen, an dem das Heer die spätere V-2-Rakete zusammensetzt und testet.
Am 17. August 1943 rollt die Operation "Hydra" an. Vormittags hat die 8. amerikanische Luftflotte bei dem Versuch, die Schweinfurter Kugellagerwerke zu vernichten, hohe Verluste erlitten. Um zehn Uhr abends steigen 500 viermotorige RAF-Bombenflugzeuge, 65 Pfadfindermaschinen und acht "Mosquitos" von ihren Horsten auf. Während die "Mosquitos" große Mengen Metallfolien und Leuchtzeichen über Berlin abwerfen und mit ihrem Scheinangriff 200 deutsche Nachtjäger binden, schlägt die Bomberarmada auf Peenemünde los. Es ist eine Vollmondnacht, doch künstlicher Nebel verwischt die Küstenlinie im Zielgebiet. Ein Teil der funk- und radargesteuerten Pfadfinder setzt die Markierungen drei Kilometer zu weit südlich, ein Fehler, der sechshundert ausländischen Zwangsarbeitern im Lager Trassenheide das Leben kostet. Auch schießen 30 verspätet über Usedom eintreffende deutsche Nachtjagdflugzeuge 42 der angreifenden Bomber ab. Immerhin haben die 1814 Tonnen abgeworfener Bomben die deutsche Geheimwaffenentwicklung um zwei Monate zurückgeworfen.
Am nächsten Morgen fotografiert eine "Mosquito" die Versuchsanstalt. In Medmenham beugt man sich über die Bilder. Kein Zweifel, das Entwicklungswerk hat schwer gelitten; von 80 Gebäuden liegen 50 in Trümmern. Gründlich zerstampft ist die Wohnsiedlung; hier sind, wie man später erfährt, 178 Deutsche umgekommen. Doch dann erschrickt Dr. Jones – er findet von den 30 Baracken des Zwangsarbeiterlagers nur noch zwölf! Jäh erinnert er sich der zwei Gewährsmänner, luxemburgische Arbeiter, denen seine Dienststelle viel verdankt... Er wird nach dem Angriff nie mehr etwas von diesen tapferen Männern hören.
Während die V-2-Fertigung verlagert werden muss – Testraketen steigen bald nahe dem südpolnischen Debice auf –, ist das Flügelgeschoss dem Schlag entgangen. Erst als am 22. August ein Irrläufer auf Bornholm einschlägt, erfährt Großbritannien durch einen dänischen Agenten von seiner Existenz. Im Verteidigungsausschuss kursieren die Skizzen dieses Dänen. Innenminister Morrison erschreckt das Kabinett mit einer Schätzung, nach der monatlich 108 000 Londoner getötet würden, wenn stündlich ein Ferngeschoss auf die Hauptstadt niederfalle. Ein neuer Evakuierungsplan wird beschlossen.
Lord Cherwell widerspricht hartnäckig. Noch am 8. November erklärt er die Raketengeschichte für ein Täuschungsmanöver: Die Deutschen wollten von etwas anderem ablenken. Tatsächlich legen Kennys Leute auf dieser Sitzung, die im Kriegskabinettsgebäude am Parlamentsplatz stattfindet, unerwartet neue Dokumente vor. Sie haben zwischen Cherbourg und Calais 19 Baustellen aufgespürt – immer sieht man auf den Fotos zwischen gleichartigen Gebäuden eine Betonbahn, deren Mittelachse auf London gerichtet ist! Eines steht fest, dies sind keine Startplätze für senkrecht abhebende Raketen. Will der Feind von hier aus düsengetriebene Flügelgeschosse à la Bornholm starten lassen? Hinter der neuen Gefahr verblasst die Raketendrohung; entgegen Jones' Rat reißt man das Steuer nun völlig herum.
Durch ein Loch in der Wolkendecke fotografierte eine "Mosquito" zwanzig Tage später den Nordwestzipfel von Usedom. Die Aufnahmen sind unscharf, zeigen jedoch drei Rampen, die denen längs der Kanalküste aufs Haar gleichen. Und eine davon ist auf die Südspitze von Bornholm gerichtet, wo im August das Flügelgeschoss niederging. Eine RAF-Fotointerpretin namens Constance Babington-Smith erkennt sogar ein kleines, offenbar unbemanntes Flugzeug. Damit ist die Beweiskette geschlossen.
Am 15. Dezember ersucht der RAF-Stab die 8. amerikanische Luftflotte, sich an den Vernichtungsangriffen auf die Abschuss-Stellen jenseits des Kanals zu beteiligen. Rund 23 000 Tonnen Bomben fallen bis zum 12. Juni 1944 auf Startplätze, die schon seit Januar aufgegeben worden sind. Denn die faschistische Luftwaffe hat inzwischen einfachere, vorfabrizierte Katapulte in Stellung gebracht; Ende April erst werden sie von jenen Bildaufklärern ausgemacht, die Nordfrankreich zum vierten Mal fotografieren.
Sind wir Gott?
Eine Woche nach der Normandie-Invasion, in der Nacht zum 13. Juni, schlagen vier Flügelgeschosse in Großlondon ein – Fehlschüsse, wie Dr. Jones vermutet. Wirklich ist der übereilt befohlene Eröffnungsschlag missglückt, wie so vieles an Hitlers Vergeltungswaffen. Lord Cherwell triumphiert; Jones beschwört ihn, dies nicht mit einem Lachen abzutun. Captain André Kenny, inzwischen von Medmenham zur Abwehr versetzt, springt am Fallschirm über Frankreich ab. Er soll den Einsatzkommandeur der Flügelgeschosse, Oberst Wachtel (Max Wachtel, der, wie "Der Spiegel" in seiner Nr. 49/1965 zu berichten weiß, später Flughafendirektor von Hamburg-Fuhlsbüttel war.), ausschalten.
Am 15. Juni 1944, kurz vor Mitternacht, setzt reguläres V-1-Feuer auf "Ziel Nr. 42" – die britische Hauptstadt – ein. Der PK-Mann Dr. Holzamer, heute Fernsehintendant in Mainz, spricht seinen ersten "Ohrenzeugenbericht von der Kanalfront" ins Mikrofon: "Donnernd zieht, während der Kriegsberichter das Erlebnis für die Heimat, für die Ohren der Welt festhält, V 1 seine Bahn..."
Im Morgengrauen meldet ein deutsches Aufklärungsflugzeug starken Feuerschein überm Zielgebiet. Erwartungsvoll fliegt Hitler nach Soissons; er hofft, die Westalliierten zu einer zweiten Landung im schwer befestigten Abschnitt Calais zu provozieren. Als ein V-1-Irrläufer in der Nähe des Konferenzortes einschlägt, macht er sich davon. Am nächsten Tag wird das fünfhundertste Flügelgeschoss gestartet; es tötet nahe dem Buckinghampalast 121 Menschen. Doch der alliierte Invasionsplan bleibt unverändert. Churchill versichert Eisenhower, London werde die Prüfung ertragen. Er fühlt sich von dem Flügelgeschoss "wieder in die Frontlinie gestellt", wirkt plötzlich zehn Jahre jünger. Acht Jägerstaffeln und 480 Sperrballons setzt er gegen die V 1 ein, deren Abschuss-Stellen das Bomberkommando neuerdings mit fünfeinhalb Tonnen schweren Erdbebenbomben ("Tallboy") belegt.
Am 28. Juni stürzt ein Flügelgeschoss auf das Luftfahrtministerium und bringt 198 Menschen um. Das Kabinett erwägt, Giftgas gegen die V-1-Startplätze einzusetzen. Den Stabschefs ist dieser Gedanke schon früher gekommen; man könnte den Gaskrieg mit überlegener Luftmacht tief ins feindliche Hinterland tragen. Doch die Abwehr warnt vor der fortgeschrittenen Kampfstofftechnik der Deutschen. Auch die Amerikaner protestieren: Der Gaskrieg lasse sich nicht auf die V-1-Basen beschränken, er werde zur weiteren Verzettelung der alliierten Luftstreitkräfte führen.
Insgesamt steigen 10 452 Flügelgeschosse auf; knapp ein Viertel erreicht London und tötet 6000 Menschen. Ihr Zielpunkt ist Tower Bridge, die Einschläge streuen in weitem Umkreis. Churchill nennt sie "eine Waffe, die buchstäblich keinen Unterschied macht". Sein Kabinett beschließt, wie David Irving in N. 48/1965 des Hamburger Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" sagt, aus moralischen Gründen, dass zwar versucht werden darf, den Feind zu verwirren, nicht aber, das Feuer auf andere Stadtteile zu lenken. Eben das tut die britische Abwehr. Mit einem von Dr. Jones erdachten speziellen Trick lanciert sie Agentenmeldungen über angebliche Einschlagstellen, und auf Lord Cherwells Rat hin fälscht sie Todesanzeigen in der Londoner Presse. Am 2. August – der Zielpunkt Tower Bridge ist gerade erstmals getroffen, die Brücke stark beschädigt worden – bittet Duncan Sandys den Premier, die Kabinettsentscheidung aufzuheben. Dem der Labour Party angehörenden Innenminister kommen Skrupel. Erregt ruft er: "Wer sind wir, dass wir handeln dürfen wie Gott?" Das Kabinett stimmt Morrison zu, die Abwehr aber setzt ihr Täuschungsmanöver heimlich fort. Mehr als drei Viertel der Flügelgeschosse fallen nun auf die Industrie- und Arbeiterviertel südlich der Themse.
Anfang September überrennt das alliierte Invasionsheer die Abschuss-Stellen am Pas de Calais. Die Gefahr scheint vorüber; man macht die Räumung der Hauptstadt rückgängig und greift deutsche Raketenziele nicht mehr vorrangig an. Da fällt am 8. September das erste von 517 V-2-Geschossen auf London. An verschiedenen Punkten der City hören Jones und Sandys den Doppelknall und rufen gleichzeitig erschrocken: "Eine Rakete!" Sie wissen, man kann Raketen zurzeit weder abschießen noch ihren Steuermechanismus stören. Es gibt gegen sie überhaupt keine Abwehr; ihre Startrampen in Holland sind beweglich und schwer zu treffen. Churchill fährt Jones an: "Wir sind beim Schlafen erwischt worden!"
Dabei hat Dr. Jones ständig vor der Rakete gewarnt – ja, er hat sie beträchtlich überschätzt. Ein V-2-Irrläufer ist schon am 13. Juni nach 320 Flugkilometern in Südwestschweden niedergegangen. Eine "Mosquito" hat daraufhin zwei britische Fliegerhauptleute heimlich nach Schweden gebracht. Stockholm hat die Trümmer freigegeben, sie sind von einem USA-Lastflugzeug zur RAF-Erprobungsstelle Farnborough geschafft worden. Seit Mitte Juli 1944 weiß der Abwehrchef: Flüssige Brennstoffe treiben die Rakete an, Alkohol und Sauerstoff. Auf sein Drängen hin haben Fernaufklärungsflugzeuge das Testgelände nordöstlich von Debice fotografiert; die polnische Untergrundarmee ist von ihm angehalten worden, Berichte zu liefern.
Und schon am 13. Juli hat Churchill seine Botschaft Nr. 295 an Stalin gerichtet: "Es gibt bestimmte Beweise, wonach die Deutschen eine beträchtliche Zeit lang ihre Versuche... von Debice in Polen aus durchgeführt haben. Entsprechend unseren Informationen hat dieses Raketengeschoss eine Sprengladung von 12 000 Pfund (= fünfeinhalb Tonnen; tatsächlich wog sie knapp eine Tonne – W. Sch.), und die Wirksamkeit unserer Gegenmaßnahmen hängt sehr davon ab, wie viel wir über diese Waffe in Erfahrung bringen können. Debice liegt auf dem Weg Ihrer siegreich vordringenden Armeen... Ich wäre Ihnen, Marschall Stalin, deshalb dankbar, wenn Sie entsprechende Anweisungen zum Schutz solcher Apparaturen und Einrichtungen bei Debice geben würden,... und wenn Sie es uns ermöglichten, diese Versuchsstation durch unsere Spezialisten untersuchen zu lassen."
Stalin verspricht das; sogleich teilt ihm Churchill die geographischen Koordinaten der Versuchsstation mit (Siehe Briefwechsel Stalins..., a. a. O., S. 297.). Via Teheran entsendet er eine Expertengruppe und schickt am 27. Juli sogar Fernaufklärer in den Raum Debice, der längst Operationsgebiet der sowjetischen Luftstreitkräfte ist. Die RAF meldet ihm, die Versuchsstation auf dem rechten Ufer der Wisloka sei aufgegeben worden; Moskau hingegen erklärt, Debice befinde sich noch in deutscher Hand. Tatsächlich stoßen Sowjettruppen erst am Ende der ersten Augustwoche zur Wisloka vor, an die sich nun für fünf Monate die Deutschen klammern. Churchill ist verstimmt, weil seine Experten erst am 2. September ins Frontgebiet reisen dürfen. Immerhin bergen sie bei Debice anderthalb Tonnen V-2-Material und lassen sich von polnischen Augenzeugen berichten. Ihren glücklichsten Fund fischen sie aus den Latrinen der Versuchsanstalt: Schnitzel eines Raketenprüfberichts, der das Fassungsvermögen der Treibstofftanks verrät. Diese Erkenntnis erlaubt entscheidende Rückschlüsse.
Nachdem Ende März 1945 die letzten Ferngeschosse London heimgesucht haben, zieht Dr. Jones Bilanz. Bei einem Stückpreis von nur 3500 Mark hat Hitlers Flügelgeschoss sich als relativ wirksam erwiesen. Bis zu 20 000 Häuser täglich sind in der Hauptstadt beschädigt oder zerstört worden, ein Sechstel der kriegswichtigen Produktionskapazität Londons ist ausgefallen. Die alliierten Gesamtverluste durch die V 1 betragen 570 Millionen Mark; für ihre Entwicklung, Herstellung und den Einsatz hat der Feind nur 150 Millionen aufgewendet. Es ist also eine "rentable Waffe", wenn auch nicht die Waffe gewesen, von der sich die deutschen Faschisten eine kriegsentscheidende Wirkung versprochen hatten.
Nicht so die V 2. Sie hat – obschon eine beachtliche technische Leistung – rund das Vierzigfache der V 1 gekostet. Weshalb haben die Deutschen ein Jahrzehnt intensiver Forschung, eine Milliarde Mark und Mengen kostbaren Materials darauf verwandt, eine Sprengladung ins Ziel zu bringen, nicht schwerer als die der preiswerten Flügelgeschosse? Jones ist die Antwort klar, er sieht sie fälschlicherweise im "deutschen Volkscharakter": Keine andere Waffe hat Naziführer und Militärs so fasziniert wie diese himmelstürmende Rakete. Denn sachliche Gründe, so scheint es ihm, rechtfertigen das V-2-Programm nicht. Sie ist letztlich gebaut worden, um den "deutschen Durst nach Romantik zu stillen".
Um diese Zeit forschen amerikanische Geheimdienstler noch fieberhaft nach einer dritten faschistischen Vergeltungswaffe, die sie am meisten fürchten. Seit 1944 sind sie überzeugt, Hitler lasse an einer Atombombe arbeiten und werde sie womöglich eher haben als Amerika. Vor der Normandie-Landung fordert Eisenhower einen Posten Geigerzähler an; seine Sanitätsoffiziere lässt er auf "seltsame Symptome einer unbekannten Krankheit" hinweisen, also auf die Möglichkeit radioaktiver Verseuchungen. Beim Einmarsch in Paris verhören die Geheimdienstler Prof. Joliot-Curie, der sie zu beruhigen sucht. Vergebens! Sie stellen fest, die Deutschen haben Thorium aus Frankreich abtransportiert, ein Element, das erst im Endstadium des Bombenbaus benötigt wird.
Ihre Suche nimmt groteske Formen an. Einer Agentenmeldung zufolge entwickelt der Feind im schwäbischen Hechingen einen Explosivstoff von 1000facher TNT-Sprengkraft. Hastig angeforderte Luftbilder ergeben eine rätselhafte Bautätigkeit auf der Schwäbischen Alb. Als die 1. amerikanische Armee im März den Rhein erreicht, ziehen die Abwehrleute Flusswasser auf Flaschen; die Washingtoner Zentrale prüft es auf Radioaktivität. Dann aber zerbröckelt ihr Verdacht. Sie finden das Thorium in einer Nazifirma, die sich schon auf Nachkriegskosmetika umstellt ("Blendend weiße Zähne mit Thorium-Zahnpasta"). Und neue Luftaufnahmen zeigen, dass bei Hechingen eine Erdölraffinerie entsteht (Siehe Michel Bar-Zohar, a. a. O.).
In Straßburger Krankenhäusern jedoch fallen den Amerikanern vier als Ärzte verkleidete Atomforscher in die Hand. Sie bestätigen ihnen, was Joliot-Curie gesagt hat: Eine faschistische Atombombe ist keineswegs in Sicht. Gegenüber den Vereinigten Staaten, die ihr "Projekt Manhattan" mit zwei Millionen Dollar vorantreiben, sind die Deutschen um fünf Jahre zurück.
Von seinem schlimmsten Alpdruck befreit, macht der USA-Geheimdienst nun Jagd auf Wissenschaftler wie von Weizsäcker, von Laue und Heisenberg. Er sammelt, meist ohne Wissen der Alliierten, alles spaltbare Material ein. Deutschlands größter Vorrat, 1100 Tonnen Uranerz, wird in einem Staßfurter Kalibergwerk entdeckt. Vor Ankunft der Sowjetarmee füllt man das Uran in 20 000 Kleinfässer und schafft es, so wie die Wissenschaftler, nach Amerika (Siehe Tatsachenbericht Gefährlich wie am ersten Tag von Dieter Wolf. In: "Neues Deutschland", Berlin, vom 28. Juni bis 9. Juli 1966.).
Zeuge der Anklage
Colonel John H. Amen, beigeordneter Ankläger für die Vereinigten Staaten, hatte sich erhoben und zum Gerichtsvorsitzenden gesagt: "Eure Lordschaft! Ich möchte als Zeugen für die Anklagevertretung Herrn Erwin von Lahousen vernehmen." Und ein hochgewachsener Mann in deutscher Offiziersuniform ohne Schulterstücke und Abzeichen war, gebeugt schreitend, in den großen Saal des Nürnberger Gerichtsgebäudes getreten und hatte im Zeugenstuhl Platz genommen. Auf der Anklagebank entstand eine Bewegung. Jodl und Keitel begannen zu flüstern. Göring starrte den Zeugen an. Es war der 30. November 1945.
In jenen Wochen rechnete die Weltöffentlichkeit stündlich mit neuen Enthüllungen. Das Nürnberger Militärtribunal riss dem deutschen Faschismus die letzte Maske herunter. Seite um Seite der Geheimgeschichte des "Dritten Reiches" blätterten die amerikanischen, sowjetischen, britischen und französischen Ankläger auf. Im Zuge ihrer Beweisaufnahme kamen immer neue Verbrechen ans Tageslicht.
An diesem Novembertag war die Pressetribüne bis auf den letzten Platz besetzt. Dreihundert Korrespondenten großer internationaler Zeitungen und Nachrichtenagenturen richteten sich gespannt auf, als der Name Lahousen fiel. Von der Wandtäfelung unterhalb der Decke glitten einige Holzscheiben beiseite; sie gaben Mikrofone frei. Ein zwei Meter langes Stahlrohr schob sich herein, es richtete seine fotografischen Linsen von der Seite her auf die Anklagebank. Die Glasaugen der Kameras und die Radioohren des ganzen Erdballs öffneten sich im Gerichtssaal, bereit, zu sehen und zu hören.
Die Vernehmung dauerte stundenlang. Nazigeneral von Lahousen beantwortete die Fragen langsam, oft erst nach reiflicher Überlegung. Sein Gesicht verriet Ergebenheit und gesammelte Ruhe. Die Dolmetscher, die jedes im Prozess gesprochene Wort sofort ins Englische, Russische, Französische und Deutsche übertrugen, hatten mit ihm keine Mühe. Und Lahousen hatte viel zu berichten. Er war eine Schlüsselfigur des deutschen Geheimdienstes gewesen, ein As der Militärspionage. Fünf Jahre hindurch hatte er als Leiter der "Abwehr II" jede Art von Zersetzungsarbeit geleistet.
Seine Agenten hatten lange vor Kriegsausbruch – als Spezialisten getarnt – heimlich Rumäniens Ölfelder besetzt, später irische Rebellen im Kampf gegen England unterstützt, die Ukraine terrorisiert, in neutralen Häfen britische Schiffe beschädigt, auf portugiesischem Boden Sprengladungen in US-Passagierflugzeuge gelegt und in der Uniform des Gegners alliierte Posten lautlos getötet; einige waren sogar im U-Boot an der amerikanischen Ostküste gelandet, um in den USA Öltanks und Flugzeugwerke zu zerstören. Lahousen war der ranghöchste Wehrmachtsfachmann für Sabotage.
Es war gegen Ende des Verhörs, niemand erwartete mehr Sensationen, als Colonel Amen fragte: "War ihnen Oberst Rowehl bekannt?" – Lahousen bejahte. "Rowehl war Oberst der Luftwaffe", sagte er und griff nach dem Wasserglas. "Rowehl hatte eine Sonderstaffel für Höhenflug, die mit dem Amt Ausland/Abwehr in der Aufklärung gewisser Gebiete beziehungsweise Staaten zusammenarbeitete."
"Waren Sie je zugegen", fragte Amen, "wenn er Canaris berichtete?" – "Ja, ich war ab und zu anwesend", antwortete Lahousen leise, in seinem weichen österreichischen Tonfall. Und während er Rowehls Flüge beschrieb, auch von dem Bildmaterial sprach, das sie erbrachten und das die "Abwehr I, Gruppe Luft" auszuwerten pflegte, dachte er an seinen Vorgesetzten Admiral Canaris, den Spionagechef Hitlerdeutschlands. Im Jahre 1937 war er ihm zum ersten Mal begegnet: einem kleingewachsenen, weißhaarigen Zivilisten mit rosigen Wangen und schwerer Nase, der ihm die Hand geschüttelt und ihn "mein lieber Major" genannt hatte.
Canaris kam damals nach Wien, um im Rahmen seines Dienstbereichs – der Militärspionage – Österreichs Annexion vorzubereiten: Er drang auf enge Zusammenarbeit seines Geheimdienstes mit dem österreichischen Verteidigungsministerium. In der Nachrichtenabteilung dieses Ministeriums war Lahousen, der im k.-u.-k.-Heer der Habsburger Monarchie gedient und später die Wiener Kriegsakademie absolviert hatte, Sachbearbeiter für die Tschechoslowakei.
In puncto Tschechoslowakei bestand seit 1934 ein reger Informationsaustausch zwischen der deutschen "Abwehr", Österreichs Militärspionage und dem so genannten 2. Büro des ungarischen Generalstabs. Die drei Staaten versorgten einander mit Spionageresultaten; in Lahousens Hand liefen einige Fäden zusammen. Er half Hitlers Generalen, den Aufmarschplan gegen die ČSR zu entwerfen, noch bevor sein eigenes Vaterland verschluckt worden war. Danach wurde er Canaris' Vertrauter und durfte von April 1938 an zunächst die gesamten Wühl- und Spähaktionen gegen Deutschlands östliche und südöstliche Nachbarn leiten.
Welch Aufstieg, was für ein Wirkungsfeld! Damals hatte ihn seine Karriere steil emporgetragen auf einsame Kommandohöhen. Und während nun die Stimme des Anklägers wie von weither an sein Ohr drang, vergegenwärtigte sich der General für einen Augenblick den Glanz vergangener Tage...
Aber diese Zeiten kehrten nicht wieder, das war ihm nie so klar geworden wie vorhin, als ihn zwei weißbehelmte Militärpolizisten aus seiner Zelle im Zeugenflügel geholt und über viele Treppen geführt hatten. Die Amerikaner hatten das ganze weitläufige Gebäude, das einst Justizpalast und Haftanstalt gewesen war, mit Posten umstellt. Die meisten Zimmer waren laut Aufschrift für Deutsche gesperrt. Hinter den Türen roch es nach Kaffee und Spiegeleiern mit Speck... Lahousen schluckte Speichel hinunter. Aus Radios und Plattenspielern schallten amerikanische Schlager durch die Korridore: "Smoke gets in your eyes" und "Sentimental journey". Die Sieger saßen hier, für lange Zeit, sie saßen zu Gericht. Zwecklos, zu leugnen! Man musste reden und auf ihr Verständnis hoffen.
Geheimflug-Sonderstaffel Rowehl
Lahousen reißt sich zusammen. Er hört den amerikanischen Ankläger fragen: "Wussten Sie, über welchen Gebieten die Aufklärungsflüge unternommen wurden?" – "Sie wurden unternommen über Polen, dann England und im Südostraum", antwortet er müde, von der endlosen Befragung erschöpft. "Näher kann ich das nicht bezeichnen. Ich weiß nur, dass diese Staffel in Budapest eingesetzt war für Erkundungszwecke, Aufklärungszwecke." Das Wort Spionage umgeht er.
"Sahen Sie selbst einige dieser Fotografien?" – Lahousens Blick streift die Anklagebank, gleitet über die einundzwanzig Gestalten hin, die einst seine Führer gewesen sind. Görings Gesicht ist rot. Es muss Göring gewesen sein, der eben halblaut "Schweinehund" gerufen hat... "Ja", sagte er. Es geht hier um den eigenen Hals! Er zieht langsam ein Taschentuch und wischt sich über die Stirn.
Colonel Amen: "Wollen Sie dem Gerichtshof die Daten geben, an denen Ihres Wissens diese Aufklärungsflüge über London und Leningrad gemacht wurden?"
Lahousen: "Die genauen Daten kann ich nicht angeben. Ich erinnere mich nur durch meine Anwesenheit bei Besprechungen zwischen Rowehl und Canaris daran – Pieckenbrock war auch ab und zu anwesend –, dass diese Aufklärungsflüge in den genannten Räumen stattgefunden haben; dass Bildmaterial vorgelegen hat; dass die Staffel von ungarischen Flugplätzen, also aus dem Raum Budapest, geflogen ist, weil ich selbst einmal mit so einer Maschine von Budapest nach Berlin zurückgeflogen bin und weil ich einige Leute, also einige Piloten aus dieser ihrer Tätigkeit kannte."
Colonel Amen: "Ich will Sie nun über das Jahr oder die Jahre befragen, während deren diese Erkundungsflüge unternommen wurden."
Lahousen: "Sie wurden im Jahre 1939, und zwar vor Beginn des Polen-Feldzugs, unternommen."
Colonel Amen: "Wurden diese Flüge geheim gehalten?"
Lahousen: "Ja. Sie wurden naturgemäß geheim gehalten."
Nachdem das Gericht sich vertagt hatte, drängten die Korrespondenten hinaus. Die Welt erfuhr zum ersten Mal von einer eigentümlichen, bis dahin unbekannten Art, das Völkerrecht zu verletzen und fremde Souveränität mit Füßen zu treten. In den Spalten der Weltpresse erschien über Nacht ein neues Wort: Luftspionage. Aber Ende 1945 bedeutete das wenig. Es war nur einer der zahllosen faschistischen Rechtsbrüche, die damals bekannt wurden – eine Methode zur Kriegsvorbereitung neben anderen. Die Zeitungen waren voll von schlimmeren Verbrechen. Auch hatte Lahousen nicht alles gesagt, was von Seiten der Nazigeneralität zu dem Thema zu sagen war.
Den ehemaligen Luftwaffenchef Göring freilich belastete diese Aussage schwer. Sein Verteidiger, Dr. Stahmer, versuchte deshalb schon am nächsten Prozesstag, sie zu erschüttern. Eindringlich fragte er Lahousen im Gegenverhör, ob er die Luftaufnahmen persönlich gesehen habe, die Rowehls Sonderstaffel vor Kriegsausbruch über England gemacht hatte, ob seine ganze Darstellung auf eigener Anschauung beruhe. Vergebens! Lahousen bestätigte es. Er antwortete dem Verteidiger gereizt, ging jedoch über seine erste Aussage nicht hinaus.
Görings letzter Trick
Ein Vierteljahr später, am 18. März 1946, brachte ein zweiter Verteidiger, Dr. Siemers, die Affäre Rowehl nochmals vorm Militärtribunal zur Sprache. In dieser Prozessphase sagten die Angeklagten, soweit sie es wünschten, gemäß der angelsächsischen Verfahrensordnung in eigener Sache aus. Der Massenmörder Kaltenbrunner war schon aufgetreten, nun schritt Göring mit frecher Sicherheit von der Anklagebank zum Zeugenstand und sah sich herausfordernd um.
Dr. Siemers gab ihm das Stichwort. Er las aus Jodls Kriegstagebuch folgende Eintragung vor: "13. Februar 1940 – Durch Admiral Canaris erfahren, dass Staffel Rowehl mit Masse von Bulgarien aus gegen den Kaukasus eingesetzt werden soll. Luftwaffe muss erklären, von wem dieser abwegige Gedanke kommt." Und er bat Göring zu sagen, was er damals mit diesem Einsatz bezweckt habe.
Göring hob den Kopf, ruckartig, wie ein Raubtier. Er war nicht mehr so fett wie früher, aber noch genauso verschlagen und überdies gewillt, dem Gericht seine Verachtung zu zeigen. Nach allem, was seit der Weihnachtspause in diesem Saal gegen ihn vorgebracht worden war, rechnete er mit dem Todesurteil. Eitel wie eh' und je, wollte er nur noch bluffen. Die anderen duckten sich, er wünschte als Löwe dazustehen. Lahousen hatte gesprochen, weil er auf Milde hoffte; Göring sprach, um als Gangster, der nichts bereut, in die Geschichte einzugehen. Er stand zum letzten Mal auf der Bühne, und das kostete er aus.
"Dies hängt damit zusammen, dass Canaris bei seinen Beziehungen zu dieser Staffel, welcher er selbst häufig Abwehr- oder Spionageaufgaben gestellt hat, von meiner Absicht dieses Einsatzes der Staffel Rowehl, den ich an sich außerordentlich geheim halten wollte, erfahren und dies scheinbar dem Oberkommando der Wehrmacht mitgeteilt hat", begann er in seinem schauerlichen Deutsch. "Dort konnte das Unternehmen nicht verstanden werden. Meine Absicht dabei – und ich hatte dies persönlich angeordnet – war eine ganz klare. Der Ausdruck, dass sie in Richtung Kaukasus aufklären sollte, stimmt nicht ganz. In Richtung auf Kaukasus, Syrien und Türkei wäre richtiger ausgedrückt gewesen. Mir waren mehr und mehr Nachrichten zugegangen, dass von Vorderasien aus Unternehmungen laufen sollten gegen die Ölfelder des Kaukasus und Baku..."
Mit erhobener Stimme fuhr Göring fort: "Ich habe diese Agentennachrichten durch sehr zuverlässige Leute nachprüfen lassen und dabei festgestellt, dass tatsächlich in Syrien eine Armee zusammengestellt wurde unter dem General Weygand, die den Namen 'Orient-Armee' erhielt. Mehr aber interessierte mich die Zusammenziehung von Flugstaffeln im syrischen Gebiet, und zwar nicht nur französischer, sondern auch englischer... Mit der Türkei war verhandelt worden zwecks Überfliegen ihres Gebiets, um die Absicht durchzuführen, schlagartig seitens dieser englisch-französischen Luftgeschwader das Bakugebiet zu bombardieren und damit die russischen Ölfelder schwerstens anzuschlagen und für ihre Lieferung nach Deutschland auszuschalten."
Was der so genannte "Reichsmarschall" dem alliierten Gericht da höhnisch entgegenhielt, hatte sich wirklich zugetragen. Im März 1940 hatte der Oberste Interalliierte Rat den britischen und den französischen Generalstab angewiesen, die Bombardierung der kaukasischen Ölfelder vorzubereiten. Der für die zweite Junihälfte geplante Schlag fiel nicht, weil Frankreich zusammenbrach; die Idee aber wurde nicht aufgegeben. Noch am 31. Januar 1941 schrieb Winston Churchill – wie er in Band III seiner Memoiren auf Seite 31 mitteilt – dem damaligen türkischen Präsidenten, nichts könne "mehr dazu beitragen, Russland von Hilfeleistungen, selbst indirekten, für Deutschland abzuhalten als die Versammlung starker britischer Bomberstreitkräfte, die die Ölfelder Bakus (von türkischen Basen aus) angreifen können." Jedoch die Türken sträubten sich, und Hitlers Überfall auf die Sowjetunion nahm dem Plan seinen letzten Sinn.
Der piratenhafte Gedanke, das Industriezentrum eines neutralen Staates ohne Warnung aus der Luft zu zerstören, war den Westalliierten in den ersten Kriegsmonaten gekommen: Sie wollten die Lücken ihres Blockaderings schließen, auch um den Preis eines ungeheuerlichen Völkerrechtsbruchs. Zu jener Zeit ging der Krieg um die Interessen der herrschenden Klassen: um die Vorherrschaft in Europa, ja letztlich um die Weltherrschaft, um Rohstoffquellen und Einflusssphären; die Völker führten noch nicht ihren antifaschistischen Befreiungskampf. An Westwall und Maginotlinie lagen sich Hitlerdeutschland und die anglofranzösische Koalition untätig gegenüber. Insgeheim aber schmiedeten beide Hauptquartiere Pläne, den Krieg auf Kosten neutraler Staaten auszuweiten, fremdes Blut zu vergießen und – wenn irgend möglich – auch in sowjetisches Gebiet einzufallen. Außer in Finnland erblickten die Westmächte im Nahen Osten eine hierfür geeignete Aufmarschbasis.
Dieselben Plätze suchte sich aber auch der deutsche Faschismus zu sichern. Die Naziführung war zwar an der Schwächung der Sowjetunion interessiert, nicht aber an der Zerstörung der Ölgebiete. Sie bereitete schon damals, kaum sieben Monate nach dem Abschluss des Nichtangriffsabkommens mit der Sowjetunion, den Überfall auf den Vertragspartner vor und betrachtete seine Reichtümer als sichere Beute, die sie sich von keinem anderen streitig machen ließ. Sie entsandte einen Fachmann ihrer "Abwehr" in das iranisch-sowjetische Grenzgebiet, der über seinen Einsatz später ("Der Geheime Nachrichtendienst" S. 156/158) folgendes schrieb: "Ich war der einzige Offizier der Wehrmacht, der einmal (1915/16) Krieg in Nordpersien gesehen hatte. Der Chef der Abteilung Landesverteidigung OKW, Oberst Warlimont, regte bei Admiral Canaris an, dass ich eine militärgeographische Erkundung in Aserbeidschan durchführen und dabei auch versuchen sollte, Näheres über die Größe und Kampfkraft der Weygand-Armee zu erfahren. Ich wurde zum Konsul in Täbris ernannt und reiste im März 1940 aus."
Wochenlang durchstreifte der spionierende Konsul das potenzielle Durchmarschgebiet der Weygand-Armee und fand dabei heraus, dass die Westalliierten gar keine Landoffensive, sondern einen Bomberschlag führen wollten – ein Plan, der den deutschen Fachmann in Erstaunen setzte: "Interessant ist vielleicht noch die Frage, ob die ganze Aktion überflüssig war, weil sie auf falschen Voraussetzungen beruhte, oder ob auf alliierter Seite wirklich der Plan erwogen worden ist, Baku anzugreifen. Während des Frankreichfeldzuges fielen (in La Charité) die Geheimakten des französischen Generalstabs in deutsche Hand. Aus ihnen ergab sich, dass... im Januar 1940 der französische Ministerpräsident Daladier den Generalstabschef General Gamelin und den Chef der Marineleitung Admiral Darlan anwies, zu untersuchen, welche Möglichkeiten beständen, einen Angriff auf Baku durchzuführen. Die beiden erörterten die Sache mit den Engländern. Es ist charakteristisch für das alliierte und für das deutsche Denken, dass jene zu Planungen für eine kombinierte See- und Luftunternehmung kamen, während auf deutscher Seite von der Möglichkeit einer Heeresoperation ausgegangen wurde. Dies wurde von den Alliierten offenbar gar nicht in Erwägung gezogen; sonst hätten sich Spuren ihrer Erkundungstätigkeit in Nordpersien finden müssen. Eine See- und Luftaktion setzte aber voraus, dass die Dardanellen geöffnet würden und dass die Türken die Erlaubnis zum Überfliegen türkischen Gebietes erteilten... Es ist merkwürdig, dass die einfache Heeresaktion, welche nur ein Durchschreiten irakischen und persischen Gebiets bedeutet hätte, gar nicht bedacht und stattdessen ein Feldzugsplan erörtert wurde, dem derart schwere politische Hindernisse entgegenstanden." So umstrichen zwei imperialistische Raubkatzen einander in Vorderasien: die eine jung und gierig, die andere alt und schlau. Und beide waren entschlossen, das Völkerrecht zu brechen; Tausende Kilometer abseits ihrer Heimatterritorien sondierten sie durch "Späh-" und "Vorbereitungsflüge" die Lage mit dem Ziel, die neutrale Sowjetunion zu überfallen.
"Erst später...", schloss Göring mit der Genugtuung des Gangsters über einen gelungenen Stoß, "erfolgte eine absolute Bestätigung dieser Absichten durch das Auffinden der geheimen französischen Generalstabsberichte und der Sitzungen des obersten gemeinsamen Kriegsrates zwischen England und Frankreich,... dass eine ausgiebige Bombardierung der gesamten russischen Ölfelder schlagartig und überraschend vorgesehen war..."
Das Gericht schwieg dazu. Der britische Gerichtsvorsitzende unterbrach den Angeklagten nicht. Eins jedoch vergaß Göring zu erwähnen: dass der deutsche Imperialismus zwei Jahre später bei seinem Versuch, nach dem Kaukasusöl zu greifen, die furchtbarste Niederlage erlitten hatte, die ihm je bereitet worden ist.
Wölfe im Fuchsbau
Was die Gerichtsstenografen in Nürnberg protokollierten, lag länger zurück, als man damals allgemein glaubte. Denn entgegen Lahousens Aussage hatten die Nazis nicht erst 1939, kurz vor Kriegsausbruch, mit ihrer Luftspionage begonnen. Schon fünf Jahre vorher, im Spätherbst 1934, hatten in Berlin W 35 drei maßgebliche Personen das Unternehmen "Neutralitätsbruch" erörtert und waren zu dem Schluss gekommen, Deutschland dürfe das Völkerrecht verletzen, sofern es keiner merke.
Die Unterredung fand – fünf Minuten vom Tiergarten entfernt – in jenem ehemals hochherrschaftlichen Haus am Tirpitzufer Nr. 74–76 statt, das von 1920 bis 1945 Zentrale der "Abwehr" gewesen ist. Das Personal der deutschen Militärspionage nannte es "Fuchsbau", wegen seiner halbdunklen Korridore, Vorder- und Hintertreppen und unübersichtlichen Zimmerfluchten. Das Haus grenzte unmittelbar an das Reichskriegsministerium. Wer nicht Bescheid wusste, verlief sich darin. Und über zwei Höfe gelangte man, ohne die Straße betreten zu müssen, zum Reichswehr-Hauptquartier in der Bendlerstraße.
Im obersten Stockwerk residiert der Chef, traditionsgemäß ein Offizier der Kriegsmarine. An jenem Dezembertag 1934 ist der Posten unbesetzt. Nach Streitigkeiten mit dem "Reichsführer SS" ist der bisherige Nachrichtenchef bei Kriegsminister Blomberg in Ungnade gefallen. Aber seit einer Woche ist ein Nachfolger da: Kapitän zur See Canaris. Er liest Akten, konferiert, empfängt Besucher; arbeitet sich ein, um den Posten offiziell am 1. Januar 1935 anzutreten.
Canaris lehnt fröstelnd an der Terrassenbrüstung und blickt hinab auf das Wasser des Landwehrkanals – es ist trübe, spiegelt tiefziehende Wolken –, als ihm seine Vorzimmersekretärin die Herren v. Solm und Willberg meldet. Den ersten kennt Canaris nicht. Ihm ist aber, als wäre ihm der Name Dr. v. Solm kürzlich in Verbindung mit der SS-Führung genannt worden. Also Vorsicht!... Von Willberg weiß er, dass er Oberst im Reichsluftfahrtministerium ist, Weltkriegsflieger war und schon in den frühen zwanziger Jahren, damals noch Major, im Reichswehrministerium ein getarntes Luftwaffenreferat geleitet hat.
Während Canaris durch die Glastür in sein Büro zurückkehrt, fällt ihm eine "Times"-Meldung ein: Am 28. November 1934 hat der britische Premier Baldwin vorm Unterhaus erklärt, Deutschland habe, obwohl es laut Versailler Vertrag überhaupt keine Luftstreitkräfte besitzen dürfe, schon wieder sechshundert bis tausend Militärflugzeuge. Die Hitlerregierung dementierte nicht.
Der Abwehrchef begrüßt seine Besucher, bietet zu rauchen an. Herr v. Solm trägt Zivil. Er stellt sich als Syndikus der zum Krupp-Imperium gehörenden DESCHIMAG vor, die kürzlich in Bremen die Weserflug-GmbH gegründet hat; diese Tochtergesellschaft wird demnächst damit beginnen, die gängigsten Junkers- und Dornierflugzeuge in Lizenz nachzubauen. Wie Solm durchblicken lässt, sitzt er im Vorstand des Reichsverbandes der deutschen Luftfahrtindustriellen, ferner bei der Focke-Wulf AG im Aufsichtsrat und verfügt auch über Verbindungen zu Messerschmitt, Arado und zum Henschel-Konzern, der soeben bei Berlin-Schönefeld eine Flugzeugfabrik nebst Werkflugplatz aus dem Boden stampft. Canaris versteht: Herr v. Solm vertritt einen erheblichen Teil der deutschen Luftrüstung bei der Reichsregierung. Aber weshalb kommt er zu ihm? Die "Abwehr" vergibt keine Rüstungsaufträge.
Oberst Willberg setzt seine Aktentasche ab, er beginnt forsch: "Herr Canaris, ich spreche jetzt im Auftrage des Reichsluftfahrtministers persönlich. Ihre Arbeit hier und unsere im Ministerium berühren sich in einem sehr wesentlichen Punkt. General Göring wünscht, dass wir uns da abstimmen. Die Sache, die ich Ihnen darstellen möchte, geht nämlich nur, wenn Abwehr und Flieger Hand in Hand arbeiten."
Während er fortfährt, legt er die Fingerspitzen aneinander und studiert das Mienenspiel seines Gegenübers. Von dieser Aussprache hängt viel ab. Deshalb hat sich Willberg über den neuen Mann der "Abwehr" genau informiert. Er weiß: Canaris ist der Sohn eines Ruhrhütten-Direktors und sechsundvierzig Jahre alt. 1916 hat er in Madrid der kaiserlichen Kriegsmarine Agentendienste geleistet. 1919 gehörte er dem Militärgericht an, das die Mörder Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts freisprach; obendrein verhalf er einem der Täter zur Flucht ins Ausland. Obschon ein enger Vertrauter des sozialdemokratischen Reichswehrministers Noske, hat er 1920 am Kapp-Putsch teilgenommen. Verlässlicher Mann!
Und immer, wie sie alle, das große Ziel vor Augen, das General von Seeckt klar umrissen hat: "Wir müssen wieder mächtig werden, und sobald wir wieder Macht haben, nehmen wir uns natürlich alles wieder zurück, was wir verloren haben." Die heilige Pflicht des Offizierkorps der Reichswehr! Schon 1924 ist Canaris in geheimer Mission nach Japan gereist, bald darauf nach Spanien und Argentinien. In Spanien ließ er den Typ des 750-t-U-Bootes entwickeln. Auch nach Holland und Finnland hat er den Deutschland verbotenen U-Boot-Bau verlegt. Angriffe der Linkspresse und ein Skandal im Reichstag haben ihn in der Marine populär gemacht und bei Hitler empfohlen. Er hat für die getarnte Flottenrüstung gearbeitet, so wie Willberg sich unermüdlich für die verbotene Luftrüstung eingesetzt hat. Sie sind Kameraden und werden einander verstehen.
Unterdessen sieht sich Dr. v. Solm ungeniert im Zimmer um. Es ist knapp mittelgroß und stillos möbliert. Nicht mal ein anständiger Teppich. Auf dem Tisch – ein Schiffsmodell. In der Ecke ein Feldbett, daneben ein kleiner Panzerschrank. Kein Vergleich mit den Renaissancesälen, die den NS-Größen heutzutage als Arbeitsraum dienen. Das verblichene Sofa, auf dem Willberg sitzt – geradezu spartanisch! Als man vorhin heraufkam, hat der Fahrstuhl versagt. Hier erinnert nichts an das zwielichtige Gewerbe eines Spionagedirektors. Canaris' Schreibtisch birgt weder Panzerstahl noch Maschinenpistolen, die sich unsichtbar auf den Besucher richten, wie das bei Himmlers Nachrichtenchef Heydrich ist. Auch Abhöreinrichtungen und die Alarmanlage, mit der Heydrich von seinem Sessel aus das ganze Gebäude blockieren kann, dürften fehlen. Und von den Selen-Fotozellen, mit denen der SD seine Räume sichert, hat man hier wohl noch nichts gehört.
Fliegende Untertassen von 1934
Der Krupp-Syndikus kennt sich nicht nur bei der Reichswehr und in Görings Luftfahrtministerium in der Behrenstraße 68–70 aus, sondern auch im Geheimen Staatspolizeiamt, Prinz-Albrecht-Straße 8. Dort sitzen im Gebäude der ehemaligen Kunsthochschule, zwei Stockwerke über den Folterkellern, prominente Freunde. Denn er ist frühzeitig der SS beigetreten und hat ihr Geldspenden der Industrie verschafft. Das macht sich nun bezahlt.
1934 ist das SS-Führerkorps noch klein. Es distanziert sich von der plebejischen SA-Meute, die Hitler mit Hilfe der Röhm-Affäre vom 30. Juni entmündigte. Es nennt sich "Elite der Nation". Ihm anzugehören gilt auch unter Akademikern, zumal in Wirtschaftskreisen, als durchaus passend. Als SS-Offizier riecht man nicht nach "Straße". Man steht nicht im Verdacht, die NS-Sozialphrasen jemals ernst genommen zu haben. Und die Unternehmerinteressen lassen sich gut vertreten, wenn man einen SS-Rang hat... Reitstiefel und Lametta, das hebt das Geschäft.
Kraft seiner SS-Verbindung hat Solm kürzlich den Dr. Goebbels in der Voßstraße zu folgenden abenteuerlichen Schlagzeilen inspirieren können: "Rote Fliegerpest über Berlin! Ausländische Flugzeuge unbekannten Typs unerkannt entkommen. Das schutzlose Deutschland. Morgen können es schon Gas- oder Brandbomben sein!" In dieser Verlautbarung des Propagandaministeriums, die alle deutschen Zeitungen abdrucken mussten, war von Flugblattabwürfen über dem Regierungsviertel die Rede gewesen. Mangels schneller Maschinen sei die Luftpolizei machtlos gewesen, auch tapfere Sportflieger hätten den Feind nicht stellen können, er sei ihnen entwischt.
Herr v. Solm lächelt dünn, reibt unbehaglich die Hände. Er weiß, die Flugblätter gab es wirklich. Mitglieder der illegalen Kommunistischen Partei hatten sie mittels eines Verzögerungsmechanismus von Hausdächern ausgestreut. Unbekannte Flugzeuge hingegen hatte kein Berliner gesehen. Der "Völkische Beobachter" aber heulte: "Jeder Vogel darf sich wehren, wenn sein Nest angegriffen wird. Nur Deutschland muss mit gestutzten Schwingen zuschauen, wie sein Nest beschmutzt und demnächst vielleicht sogar zerstört wird... Es gilt, die nunmehr unerträgliche Schutzlosigkeit des deutschen Luftraums zu beseitigen!"
Während Dr. v. Solm Willbergs Darstellung mit halbem Ohr lauscht, schweift sein Blick im Raum umher. Über dem Feldbett – eine Weltkarte. Daneben eine Fotografie des spanischen Generals Franco. Auf dem Kaminsims ein Foto des Rauhaardackels "Seppl", den Canaris gleichfalls ins Herz geschlossen hat. An der Schmalwand eine Art Teufelsfratze, ein Geschenk des japanischen Botschafters Oshima. Und schließlich das Bild des früheren deutschen Geheimdienstchefs, des Obersten Nikolai. Hier bleibt Solms Blick haften. Die Erinnerung an Canaris' berühmtesten Amtsvorgänger, den sagenumwobenen Leiter der Abteilung III b des Weltkriegsgeneralstabs, vermischt sich in seinem Kopf minutenlang mit dem, was Willberg redet.
Das Auge des Obersts Nikolai
Willbergs Eröffnungen lag ein Sachverhalt zugrunde, der Canaris keineswegs neu war: Seit geraumer Zeit hatte ein tiefgreifender Wandel das Spionagewesen erfasst. Die technische und auch die politische Entwicklung stülpten es um; sie waren damals im Begriff, die Arbeitsweise aller imperialistischen Geheimdienste radikal zu verändern. Die deutsche "Abwehr" bildete keine Ausnahme, im Gegenteil, sie war entschlossen, auf schmutzigen Wegen voranzumarschieren. Canaris' Aufträge gingen weiter als die seiner Vorgänger.
Zu Beginn des Jahrhunderts hatte man Geheimnachrichten noch ausschließlich durch Agenten beschafft. Neben der herkömmlichen Gepflogenheit, über ihr diplomatisches Auslandspersonal Informationen einzuholen, schickten die Großmächte eine Handvoll Halbweltexistenzen, Abenteurer oder Offiziere in Zivil in die Nachbarländer. Diese beobachteten Flottenbewegungen in den Häfen, skizzierten Festungsanlagen und versuchten, Bürger des fremden Staates zu bestechen – gelegentlich auch zu erpressen –, um spezielle Angaben zu erhalten. Die ausspionierten Fakten brachten sie mit unsichtbaren Tinten zu Papier und leiteten sie durch Kuriere, oft auch auf dem normalen Postweg, an die auswertende Zentrale ihres Landes weiter.
Im ersten Weltkrieg zeigte es sich zum ersten Mal, dass das Aufklärungsflugzeug oft mehr vermochte als der simple Agent. Bei günstigem Wetter konnte es schneller herausbekommen, was der Gegner tat. Die üblichen Anzeichen bevorstehender Offensiven, wie Truppenverschiebungen und vermehrte Munitionstransporte, waren auf Luftbildern klar zu erkennen. Die Piloten meldeten sie meist eher als die Spione, deren Schwierigkeit – trotz der neu aufkommenden Agentenfunkgeräte – die Nachrichtenübermittlung blieb. Es gab noch einen Unterschied: Abgestürzte Flieger kamen in Gefangenschaft. Luftaufklärung ist – im Kriege! – erlaubt, auf Spionage steht Todesstrafe.
Beide Begriffe miteinander zu vermischen, blieb Deutschlands Militaristen vorbehalten. Als die deutsche Bourgeoisie sich Ende der zwanziger Jahre wieder stark genug fühlte, um erneut eine aggressive Außenpolitik zu treiben, baute sie zunächst ihren Geheimdienst wieder aus. Im Kriegsministerium saß noch immer Oberst Nikolai. Ihm standen bald mehr Geldmittel zur Verfügung als der kaiserlichen Militärspionage, die bis 1912 mit 300 000 Goldmark jährlich ausgekommen war. Aber schon Nikolai sah sich vor einer veränderten Situation. Die schnell voranschreitende Technik beherrschte jetzt das Feld.
Früher galt Industriespionage als die Privatsache konkurrierender Firmen, die einander gewinnbringende Patente abjagen wollten. Inzwischen war sie Staatsangelegenheit geworden. Wer nunmehr am imperialistischen Machtkampf teilnehmen wollte, der musste eine Vielzahl wirtschaftlicher Informationen sammeln, aus denen sich der Rüstungsstand, das militärische Potential und etwa bevorstehende kriegswichtige Erfindungen ableiten ließen. Dies galt besonders für Deutschland, das auf synthetischen Gummi, Sprengstoff und Treibstoff angewiesen war, wenn es noch einmal mit besserem Erfolg auf Raub ausgehen wollte.
In dieser Situation boten deutsche Großunternehmen dem Oberst Nikolai technische Hilfe an. Ihm standen in der Sowjetunion zeitweilig konzessionierte Firmen wie Borsig und Froelich-Klüpfel-Dehlmann zur Verfügung. In den meisten anderen Ländern bediente er sich des als "Statistische Abteilung" raffiniert getarnten Nachrichtendienstes der IG Farben, der nachweislich seit 1928 staatliche Spionageaufträge erledigte und bis 1944 Material in ungeheurer Fülle lieferte.
Herbert von Dirksen, zur Weimarer Zeit deutscher Botschafter in Moskau, schrieb in seinen 1949 veröffentlichten Memoiren über die deutschen Spezialisten in der UdSSR: "Mindestens 5000 von ihnen waren über die weithin verstreuten industriellen Unternehmungen des riesigen Sowjetlandes verteilt;... die Mehrzahl war jenseits des Urals tätig oder im Donbass, im Kaukasus oder in noch entfernteren Bezirken." Sie waren "arbeitslos geworden durch die deutsche Wirtschaftskrise und froh über die Anstellung im fernen Russland.... Den Spitzenkräften wurden Gehälter von 60 000 bis 80 000 Goldmark jährlich ausbezahlt, während der Durchschnitt 6000 bis 8000 Goldmark im Jahr erhielt."
Und er umschrieb ihre Spionagetätigkeit so: "Diese über ganz Russland verstreuten Ingenieure... stellten eine wertvolle Informationsquelle für mich dar. Die hervorragenden unter ihnen hielten enge Fühlung mit der Botschaft und den Konsulaten; auf diese Art waren wir nicht nur über die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, sondern auch über andere Fragen, wie die allgemeine Stimmung und die Entwicklung innerhalb der Partei, gründlich unterrichtet. Ich glaube nicht, dass irgendein Land vorher oder nachher über ein so eingehendes Informationsmaterial verfügte wie Deutschland während dieser Jahre."
Damit noch nicht zufrieden, erwog die Reichswehrleitung schon frühzeitig, sich wirtschafts- und wehrgeographische Daten durch illegale Luftaufklärung zu beschaffen. Der Gedanke, für einen künftigen Revanchekrieg Zielunterlagen erfliegen zu lassen, ließ Weltkriegspiloten wie Willberg nicht los. Man entschied sich zunächst für wenige Probeaktionen. Das "Auge des Oberst Nikolai", wie man die Fernaufklärer 1915–1918 gelegentlich genannt hatte, sollte wieder von fremden Himmeln herunterspähen – diesmal im tiefsten Frieden.
Nur eine Erwägung stand dem entgegen: Aufklärungsflugzeuge waren im Weltkrieg oft erkannt und abgeschossen worden. Wegen ihrer größeren Treibstofflast, der fotografischen Apparate und des Beobachters, den sie mitführen mussten, konnten sie sich in der Kampfleistung nie mit feindlichen Jagdeinsitzern messen. 1918 hatte die Höchstgeschwindigkeit der Aufklärer 180 km/h, ihre Dienstgipfelhöhe 5000 m betragen. Die entsprechenden Ziffern lauteten für Jagdflugzeuge: 220 km/h und 7000 m; außerdem waren sie wendiger und statt mit einem mit zwei Maschinengewehren bestückt.
Zwar war bis 1930 die Entwicklung weitergediehen. Stärkere Motoren, Leichtmetallbau, Versenkung der Nietköpfe und glatte Außenhaut steigerten die Geschwindigkeiten von Jahr zu Jahr. Doch an der prinzipiellen Überlegenheit der Jagdabwehr hatte sich nichts geändert. Ein Risiko aber mochte die Reichswehr nicht eingehen. Es durfte keinen Zwischenfall geben. Die offiziell abgerüstete und, ach, so friedfertige Weimarer Republik konnte es sich schon innenpolitisch kaum leisten, dass ihre Spähunternehmen ans Licht der Öffentlichkeit kamen. Die KPD hatte die heimliche Luftrüstung mehrfach im Reichstag scharf angeprangert. Ein Sturm der Entrüstung wäre gefolgt; er hätte womöglich das Kabinett Brüning, das den Übergang zur faschistischen Diktatur vorbereiten sollte, hinweggefegt.
Da erwies sich die Industrie wiederum als Nothelfer. Wie stets, wenn das Vaterland rief, sprang sie selbstlos in die Bresche. Die Junkers-Werke, damals noch in Privatbesitz, experimentierten just in jenen Tagen mit leichten Maschinen, die vermöge ihrer druckfesten Kabinen imstande waren, 10 000 m, ja 11 000 m hochzuklettern – eine vor dreißig Jahren sensationelle Leistung. Schon am 26. Mai 1929 hatte der Junkers-Pilot W. Neuenhofen mit einem Rekordflugzeug vom Typ W 34 die damals enorme Höhe von 12 739 m erreicht – ein für längere Zeit einzig dastehender Erfolg. Für systematische Erprobungen brachte Junkers Anfang 1931 das erste deutsche Höhenforschungsflugzeug heraus, die Ju 49.
Mit solchen Experimenten bezweckten die Flugzeughersteller ursprünglich, exportfähige Modelle für den Weltmarkt zu entwickeln. Im Liniendienst zwischen Argentinien und Chile brauchte man Passagierflugzeuge, die notfalls die 7000 m hohen Andengipfel überfliegen konnten. Die Reichsregierung subventionierte solche Entwicklungsvorhaben im Interesse der deutschen "Weltgeltung". Tatsächlich wurden die Expansionsbestrebungen der deutschen Wirtschaft gefördert, wenn die Lufthansa AG – etwa durch Beteiligung am Condor-Syndikat in Brasilien – ihr Streckennetz von China bis Südamerika um den halben Erdball spannte. Das waren Auslandsaufgaben, die das deutsche Finanzkapital der Luftfahrt längst gestellt hatte – meist über das von ihm abhängige Verkehrsministerium der Weimarer Republik, das zu Lasten des Steuerzahlers dann der Lufthansa AG Zuschüsse zahlte und die Entwicklungskosten der neuen Modelle trug.
All dies kam den Plänen der Generalität nun glänzend entgegen. Die schon Ende der zwanziger Jahre gegründeten militärischen Flugerprobungsstellen Travemünde und Rechlin trieben die Forschung voran. Spezialflugzeuge wie die Ju-49 und die W-34 flogen hoch genug, um für die Luftabwehr unerreichbar zu sein. Sie waren akustisch kaum wahrzunehmen und selbst mit starken Fernrohren schwer auszumachen. Keine Flakgranate stieg so hoch, und wenn die damaligen Jägertypen jemals die 10 000-m-Region erreichten, konnten sie sich dort weder halten noch manövrieren. Deutschlands Industrie hatte dafür gesorgt, dass das "Auge des Oberst Nikolai" nicht länger blind bleiben musste.
Was, wenn ein Motor aussetzt?
Eine Viertelstunde ist verstrichen. Canaris hat Kaffee kommen lassen. Er hat aufmerksam zugehört, doch kaum ein Wort geäußert. Die Herren lehnen sich zurück. Spannung liegt in der Luft. Dr. v. Solm reicht Importzigarren herum und sagt, während er die Spitze kappt: "Darf ich Ihnen die technischen Daten unserer W-34 nennen?"
Canaris schweigt, seine buschigen Brauen zucken. "Ich kann mir nicht denken", bemerkt er nach einer Weile, "dass Aufnahmen, die man aus derartigen Höhen macht, genügend Einzelheiten erbringen."
Willberg zieht einen Stoß großformatiger Fotos aus der Aktentasche, breitet sie über den Tisch. "Skodawerke Pilsen", erläutert er knapp. "Da erkennen Sie die Panzermontagehalle, Tagesausstoß drei Stück, hier sehen Sie sie stehen... Das" – er tippt auf das nächste Luftbild – "sind die polnischen Herbstmanöver im Korridor. Tucheler Heide. Kavallerie, ausgeschwärmt nach französischem Reglement. Man sieht jeden Gaul; da oben ein MG-Trupp der Gegenpartei..."
"Und das alles aus elf Kilometer Höhe?" – "Unsere Optikindustrie schläft nicht", sagt der Oberst. "Da hat sich seit 1918 manches getan. Wir arbeiten mit extrem langen Brennweiten."