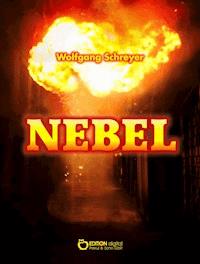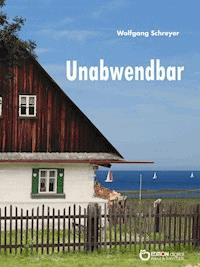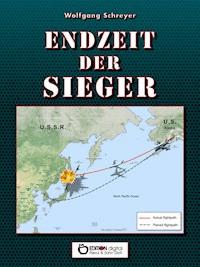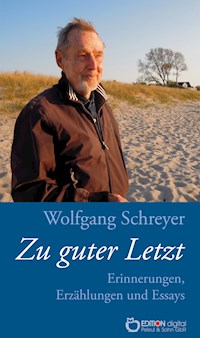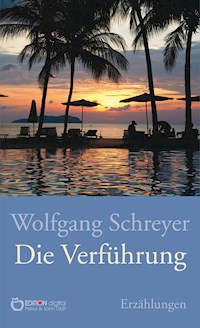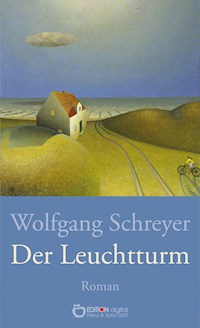8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Karibisches Meer, Juni 1954: Ein junger Deutscher gerät in Not und schließt sich Männern an, deren Geschäfte er nicht kennt. Schmuggeln sie Rauschgift, plündern sie Schiffe aus, sind es Kidnapper? Die Bande fürchtet keinen Richter, sie hat einen langen Arm - und Flugzeuge, Schnellboote, Sendestationen. Er kann nicht mehr zurück. Von jener Insel auf der Mosquitobank, die ein Piratennest ist, gelangt er in die Hauptstadt einer kleinen Republik zum Haus eines kaffeepflanzenden Greises, durch Urwälder, Tropenflüsse und über Kaktussteppen. Er lebt zwischen Gangstern und Landsknechten, trifft aufrechte Männer und Laffen, dient einem windigen General, dann einem frommen Obersten. Ihm begegnen Hafenpolizei, Indios, Mädchen, Papageien, Spitzel. Er trifft eine glutäugige Schönheit, die ihm die Haut ritzt und seine Spottlust weckt, bevor er sie liebgewinnt. Sie lehrt ihn ihre Heimat sehen; und im Lichte aufdämmernder Erkenntnis findet er sein Gewissen wieder. Wolfgang Schreyer gibt in diesem abenteuerlichen Roman dem Helden selbst das Wort. Darin liegt der besondere Reiz seiner Geschichte. Halb zeitgeschichtliche Reportage, halb Abenteuerroman, entstand dieses Buch zu einer Zeit, in der die cubanische Revolution noch nicht gesiegt hatte und niemand die Ereignisse in Chile voraussehen konnte. Der gesellschaftliche Hintergrund dagegen, den der Text auch da veranschaulicht, wo Figuren und Handlungen kühn erfunden sind, entspricht überall den Tatsachen. Der Wert des Romans liegt bei aller Unterhaltung, die er dem Leser bietet, in der Information über ein fernes kleines Land (Guatemala) und einen Vorgang scheinbar am Rande des Weltgeschehens, der nicht länger als zwölf Tage Schlagzeilen machte (der von der CIA organisierte Sturz von Jacobo Arbenz Guzmán). Heute erscheint uns dieser Vorgang in schärferem Licht; er gewinnt an Bedeutung, wenn man an die Verbrechen der chilenischen Konterrevolution denkt und an den Überfall der USA auf die friedliche Antilleninsel Grenada im Oktober 1983, der den Putsch der Bananengesellschaft in Guatemala auf erschreckende Weise wieder aktuell werden ließ. Das Buch wurde erstmals 1959 beim Verlag Das Neue Berlin unter dem Titel "Das grüne Ungeheuer" veröffentlicht. Beim Deutschen Militärverlag (DDR) erschienen mehrere überarbeitete Fassungen unter dem geänderten Titel "Der grüne Papst". Das Buch war die Vorlage zu dem mehrteiligen Fernsehfilm "Das grüne Ungeheuer" von Rudi Kurz (1962).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Das grüne Ungeheuer (Der grüne Papst)
Roman
ISBN 978-3-86394-090-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1959 unter dem Titel "Das grüne Ungeheuer" und 1961 als überarbeitete Ausgabe unter dem Titel "Der grüne Papst" bei VEB Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin
Dem E-Book liegt die überarbeitete Fassung von 1965 zugrunde.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2011 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: verlag@edition-digital.com Internet: http://www.edition-digital.com
The Boulevard of Broken Dreams
Savannah ist ein trauriges Nest für den, der die wirklich großen Städte liebt, und die Gefahren sind nicht geringer. Ich war ein Narr, dorthin zu gehen. Achtzehn Meilen hinter der Atlantikküste liegt es, an einem trüben Fluss, der Georgia von South Carolina trennt; man sagt, das Klima sei ungesund. Immerhin gibt es dort, besonders im Hafenviertel, ein paar der üblichen Kinos, schmale Handtücher, in denen man für fünfundzwanzig Cents hübsche Filme sehen kann - die tollsten nach Mitternacht. An jenem Juniabend 1954 hatte ich mich, nachdem mir in der Pension "Charleston" die fatale Geschichte passiert war, in einen dieser lärmenden Käfige geflüchtet. Den Vierteldollar besaß ich noch, und ich hoffte, dort würde die Polizei nicht nach mir suchen.
Die achtzig Plätze waren fast alle besetzt. Als ich mich im flimmernden Licht durch den Gang tastete, plärrte der Lautsprecher vorn: "I walk along a street of sorrow, the boulevard of broken dreams." Wenn etwas imstande war, meine Stimmung wiederzugeben, so war es dieses Lied. Zu seinen schwermütigen Akkorden zog sich auf der Leinwand ein Mädchen aus, geschäftsmäßig langsam und sehr methodisch. Während ich mich in eine der Platzreihen quetschte, schimpften die Leute hinter mir. Ich kam neben einen Mann zu sitzen, der nach teurem Whisky roch. Wie überall in den Staaten, wurden auch in Savannah die Mitternachtsvorstellungen oft von Betrunkenen besucht. Das Mädchen vorn war nun halbnackt, es erinnerte mich an die junge Dame, derentwegen ich aus der Pension hatte fliehen müssen. Plötzlich wurde mir übel; ich schloss die Augen. Seit dem schrecklichen Vorfall am Spätnachmittag hatte ich nicht mehr gewagt, ein Lokal zu betreten. Mein Magen war leer.
Als ich wieder zur Leinwand sah, klapperten Pferdehufe. Ein farbiger Kulturfilm lief, er pries die wilde Schönheit des Yellowstone-Nationalparks. Beim Anblick buntschillernder Springquellen, brodelnder Schwefelsümpfe und der sattbraunen, im Abendrot glühenden Felsen äußerte mein Nachbar höhnisch: "Ah, wie reizend!" Mir war, als hätte ich diesen Ausruf schon einmal gehört. Er erinnerte mich an einen Mann, mit dem ich mich damals in der amerikanischen Zone Deutschlands oft über Zigaretten unterhalten hatte. Er konnte sie besorgen, ich setzte sie en gros ab, für drei Reichsmark das Stück; en détail kosteten sie fünf. Ein ganzes Jahr lang flutschte der Handel. "Ah, wie reizend!", pflegte Steve zu krähen, wenn ich ihm zuweilen von einer Razzia und gewissen Verlusten berichten musste. Meist aber blätterte ich einen hübschen Haufen Geld vor ihn hin, er schob es wortlos in die Gesäßtasche und kam mit einer neuen Stange "Lucky Strike". Ach, lang war's her.
Kein Zweifel, der Film missfiel, im Kino wurde es laut. Auf den hinteren Sitzplätzen randalierten sie. Jemand hatte seine Schuhe ausgezogen, man schleuderte sie unter den Sitzen hindurch nach vorn. Ein Kaugummiklümpchen traf mich am Ohr. "Will mein Geld zurück", schrie von der Aborttür her ein Mann; er fing an, auf einer Kindertrompete zu blasen. Wäre ich nicht in der Klemme gewesen, hätte ich jetzt diesen Affenstall verlassen. Der Leinwand-Cowboy vorn fuhr unbeirrt fort, den Yellowstone-Park zu loben. In der sinkenden Purpursonne zügelte er sein Pferd, zog ein Fläschchen aus der Satteltasche, hielt es ins Publikum und sagte: "Wenn Sie nicht wollen, Ladies und Gentlemen, Sie brauchen nicht unbedingt nach Wyoming zu reisen, seit es dies hier gibt. Auch Cinzano dry Vermouth wird Ihnen zum inneren Erlebnis. Man rafft sich nicht gleich zu 'ner Reise auf, Cinzano dry Vermouth jedoch können Sie täglich trinken, gleich um die Ecke, in jedem Drugstore..." Er schlürfte den Wein und wandte sich wieder der heroischen Landschaft zu. Durstig gemacht, setzte auch mein Nachbar eine Flasche an die Lippen. Etwas tropfte auf meinen Ärmel, und ich glaube kaum, dass es Cinzano dry Vermouth war, was er trank; eher purer Whisky, doch von der allerbesten Sorte.
Es folgte eine Trickfilm, die übliche Kette effektvoller Schlägereien. Menschen wurden zersägt, mit Keulen erschlagen, in Öfen verheizt; sie wanden sich jedoch, schlanker geworden, zum Schornstein wieder heraus, der Lautsprecher blubberte dazu, und es gab einen klatschenden Laut, wenn es sie gleich darauf von neuem traf. Jetzt ging das Publikum mit. Wurden die Filmfiguren geschunden, schrillten Beifallspfiffe; mein Nachbar schlug sich aufs Knie, er rief: "Give him hell! Zeig's ihm! Gib ihm Saures!" ...Mein Gott, die Stimme kannte ich doch.
Ich lehnte mich zurück, musterte ihn verstohlen von der Seite. Diese wulstigen Brauen, dieses breite Gesicht! Meine Augen hatten sich an das Dämmerlicht gewöhnt, und nun erkannte ich ihn. Acht Jahre war es her, damals hatte ich ihn immer nur in Uniform gesehen, heute trug er einen hellen Maßanzug - dennoch, er war es: Steve Baxter, und niemand sonst... Da wusste ich, dass ich so gut wie gerettet war. Steve würde mir beistehen, so wie ich ihm beigestanden hatte, damals, als er noch Küchen-Corporal bei der 7. US-Armee in Augsburg gewesen war.
Die Hexe im Cadillac
Wenig später saßen wir in einem Espresso. Steve bestellte schwarzen Kaffee, den er nötiger hatte als ich. "Wieso", fragte er und legte seine riesige Hand auf mein Knie, "steckst du denn in der Klemme, Oberleutnant?"
So hatte er mich damals immer genannt, obwohl ich nie Offizier gewesen bin. Er wusste aber, dass ich bei der Luftwaffe war, und hatte oft seinen Spaß damit getrieben, wenn auch ohne jede Gehässigkeit. In der ersten Zeit fiel es den Siegern schwer, solche Anspielungen zu unterlassen, besonders wenn sie ein Kindergemüt hatten wie Steve. Es war eine sonderbare Sache, nach so vielen Jahren meinen alten Spitznamen wiederzuhören. Mir wurde traurig zumute, als ich hier im Hafen von Savannah um zwei Uhr morgens an die Heimat dachte.
"Dieses Drecknest", sagte ich, "ist mit Abstand der mieseste Fleck in den ganzen Vereinigten Staaten. Jeder Halunke hier hat einen Elektrorasierer, ist damit zufrieden, braucht keinen neuen, und das Klima soll auch nicht gesund sein. Die ganze Stadt stinkt nach toten Fischen, schon gemerkt?"
"Du kommst vom Thema ab", antwortete Steve.
"Mir geht's langsam über die Hutschnur", sagte ich. "Das sollte man mit den Leuten nicht machen. Da spaziere ich heute Nachmittag die General Green Avenue entlang, immer auf dem Bordstein, und denke über den schlechten Geschäftsgang nach - ich verkaufe Rasierapparate, Steve, das heißt, ich versuche es -, plötzlich merke ich, wie ein cremefarbenes Sportcoupé leise neben mir herfährt. Am Steuer sitzt ein Mädchen, Steve, sieht mich an und lächelt, verstehst du, nur mit den Augen. Himmel, war die süß! Ein Traum, alter Junge. Der Cadillac schnurrt immer so neben mir her, stell dir das vor..."
Er sagte nichts, sondern pfiff durch die Zähne.
"Ich stieg dann ein; wir waren uns beide kolossal sympathisch. Sie hieße Joan, wäre achtzehn und ginge noch aufs College, erklärte sie mir, heute hätten die Sommerferien angefangen, sie sei zu jedem Blödsinn aufgelegt. Als wir in meinem Zimmer ankamen, warf sie sich ohne Umstände aufs Bett, strampelte in der Luft herum und bat mich, schnell noch was zu trinken zu holen. Ich lief über die Straße, denn die Pension ist völlig trocken, und als ich wiederkam, war's passiert."
Ich drehte mich um, denn eben traten zwei Männer ein; doch sie kümmerten sich nicht um uns. "Joan stand am Telefon", fuhr ich leise fort. "Mit zerrauftem Haar, fast nackt, rote Kratzer auf Schultern und Hals; die Bluse war zerrissen, das Bett zerwühlt, eine Vase lag in Scherben. Sie schrie, ich hätte sie mit Gewalt hierher geschleppt, aber das ließe sie nicht mit sich machen, sie würde die Polizei anrufen. Ich begriff überhaupt nichts, sah, wie sie eine Nummer wählte, und hörte, dass sie das Überfallkommando alarmierte. Da hab' ich mich aus dem Staube gemacht, ohne Geld, ohne Gepäck; der Schlüssel steckte noch außen, ich sperrte sie einfach ein. Mit hysterischen Weibern werd' ich nicht fertig... Vermute, jetzt fahndet die Stadtpolizei nach mir."
"Worauf du Gift nehmen kannst", sagte Baxter. "Nur, wenn du meinst, sie war hysterisch, irrst du dich, Sohn. Das ist bloß ihr Geschäft. Die Gesetze sind hart in Georgia; auf Vergewaltigung stehen zehn bis dreißig Jahre Kerker. Da hättest du sie lieber geheiratet, glaube ich, damit sie ihre Aussage ändert. Und bei der Scheidung würde sie 'ne hübsche Abfindung von dir bekommen haben, oder 'ne nette Lebensrente, das hättest du dir aussuchen dürfen. Was glaubst du denn, wovon sie den Cadillac bezahlt?"
Er legte Geld auf die Theke, ich aber blieb sitzen. Ich wagte mich nicht mehr auf die Straße hinaus.
"War 'ne schlechte Idee, in dieses lausige Nest zu gehen", sagte ich und behielt dabei die Tür im Auge. "Hatte vorher 'nen feinen Job bei der Compañía Dominicana de Aviación. Leider kündigten sie mir im April, weil der Chefpilot Rauschgift geschmuggelt hatte, und sie meinten, ich hinge mit drin. Hätte sonst nie dieses widerliche Pflaster betreten."
"Du bist geflogen?", fragte Steve leise, und ich konnte bemerken, dass seine Augen sich weiteten. "Du fliegst noch?" Er wurde plötzlich ganz munter.
"Als Copilot", antwortete ich. "Die dominicanische Gesellschaft nahm es mit den Papieren nicht so genau; man konnte was."
Baxter betrachtete mich zärtlich. "Möchtest hier weg, was?"
"Muss verschwinden, Steve."
"Lässt sich machen, Oberleutnant."
Mit einem Ruck stand er auf; ich folgte ihm. Wir gingen in zwei benachbarte Kabinen, über die Trennwand hinweg tauschten wir unsere Jacken, Hüte und Hosen aus. Er gab mir zehn Dollar, auch eine Übernachtungsadresse. Hastig vereinbarten wir, uns am nächsten Mittag vorm Denkmal des Generals Pulaski zu treffen; dann verabschiedeten wir uns und verließen unauffällig das Espresso.
Die Hafenstraßen lagen in tiefer Finsternis, nur an den Fassaden der Amüsierlokale geisterte Neonlicht. Steves elegantes Jackett schlotterte mir um die Schultern, und die Hosen waren zu kurz; immerhin, der Hut passte. Jedes Mal wenn ich Schritte hinter mir hörte, bog ich ab. Doch ich erreichte das neue Quartier, ohne dass man versucht hätte, mich festzunehmen. Savannah ist, wie schon vermerkt, ein erbärmliches Nest. Nicht mal auf die Polizei dort ist Verlass.
Marihuana-Schmuggel und Notzucht
Zur verabredeten Zeit fand ich mich in der prallen Sonne unterm Denkmal des Generals Pulaski ein, einer dorischen Säule mit Freiheitsstatue. Inmitten der schachbrettartig gebauten City ragt sie am Rande einer kleinen Parkanlage empor, die mit ihren Agaven und Orangenbäumen die Straßenkreuzung einfasst. Es gab im Stadtkern Savannahs vierundzwanzig solcher Kreuzungen, und ich sagte mir, dass sie nicht überall einen Policeman hingestellt haben konnten.
Steve Baxter war unpünktlich. Immer wieder sah ich zur Uhr. Umspült vom Konzert der Autohupen, begann ich die Inschrift der Säule zu lesen. General Pulaski, stand dort, war Pole. An der Spitze der vereinigten amerikanischen und französischen Truppen hatte er 1779 versucht, die Stadt den Engländern zu entreißen, wobei ihn eine Kugel vom Pferde warf. Ich ging um die Säule herum, dreimal, sechsmal.
Dann endlich sah ich Steve aus einem hechtgrauen Studebaker klettern; schwitzend lief er auf mich zu. Etwas an seinem Gehabe gefiel mir nicht. Gewöhnlich bewegte sich Steve langsam und selbstsicher, jetzt haftete ihm etwas Gehetztes, Unterwürfiges an.
Im Fond saß ein schwarzhaariger, fülliger, in makelloses Weiß gekleideter Herr, der an einem Zigarillo sog. "Don Miguel", meldete ihm Steve, "hier bringe ich Ihnen meinen Freund." Der Fremde nickte kurz, stieß blassblauen aromatischen Rauch aus und lud mich mit einer Handbewegung ein, neben ihm Platz zu nehmen. Steve setzte sich hinters Lenkrad, unmerklich fuhr der Wagen an. Im Innern war es warm, es roch nach Juchten und nach Jasmin; draußen glitten Schaufenster, Verkehrsampeln, Springbrunnen vorbei. Ich stellte keine Frage. Man tut in solchen Fällen gut, Gelassenheit vorzutäuschen. Mir musste es genügen, zu wissen, dass es kein Polizeiflitzer war, in den sie mich genötigt hatten. Ab und zu hupte Steve sanft, damit sich der Autostrom vor ihm zerteile. Ich lag in dem leise schwingenden olivgrünen Schaumgummipolster und wartete ab.
Nach einer Weile warf Don Miguel sein Zigarillo hinaus und kehrte sich mir zu. "Señor Morena", sagte er. "Sie sind uns empfohlen worden. Wir haben viel Gutes von Ihnen gehört."
"Sie machen mich verlegen", entgegnete ich, und ich ging darüber hinweg, dass er meinen Namen verwechselte. In unklaren Situationen soll man eher zuhören als selber viel reden.
"Sehr viel Gutes", wiederholte er zerstreut wie ein älterer Herr, obschon er höchstens fünfzig sein konnte. "Marihuana-Schmuggel und Notzucht. Ihr Steckbrief klebt an allen Polizeirevieren. Das sind so die kleinen Betriebsunfälle."
Ich hatte plötzlich das peinliche Gefühl, für einen Gangster gehalten zu werden. "Fürchte sehr", antwortete ich, "Sie haben das missverstanden, Señor."
"Erzählen Sie das der Polizei", sagte Don Miguel. "Sie bemüht sich ohnehin, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Ein Dutzend Leute sind Ihretwegen heute auf den Beinen. Einer wartet im 'Charleston' auf Sie, zwei bewachen den Bahnhof, drei den Hafen, zwei den Flugplatz, die übrigen liegen an den Ausfallstraßen. Ohne uns kämen Sie kaum aus der Stadt heraus."
"Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet", erwiderte ich - doch in diesem Augenblick huschte draußen ein Schild vorbei, auf dem in leuchtenden Lettern stand: AIRPORT SAVANNAH - zum Flugplatz dreieinhalb Meilen... Die Häuser links und rechts wichen zurück, sie standen jetzt einzeln im Grünen, wir rasten durch eine Vorstadt. Mein Mund wurde trocken. Wenn Steve das Tempo beibehielt, würde er in fünf Minuten am Flugplatz stoppen, vor der Passkontrolle... Und meine Papiere lagen, mitsamt der übrigen Habe, in jener Unglückspension oder im Tresor der Kriminalpolizei.
"Setzen Sie diese Brille auf", sagte Don Miguel. "Übrigens, hier ist Ihr Pass." Er schob mir eine schmierige Lederhülle zu, mit spürbarem Widerwillen klappte er sie auf. Wenn ich die Brille trug, stimmte das Lichtbild. Auch das Alter schien ganz in Ordnung. Ich hieß Antonio Vasquez Morena und war, laut Pass, am 4. Oktober 1925 in Saltillo (Coahuila, Nord-Mexiko) geboren. Im Innern des Heftes fand sich ein Dauervisum für die Vereinigten Staaten und eine Einreisegenehmigung nach Honduras, vom Konsul selbst unterfertigt.
"Allerdings", äußerte ich, "mein Spanisch ist schlecht."
"Die Flugplatzpolente spricht's noch schlechter", sagte Steve Baxter über die Schulter hinweg.
Eine Viertelstunde später standen wir am Ende des Rollfelds vor den Privathangars. "Sehen Sie diese Maschine?", fragte Don Miguel und deutete auf ein zweimotoriges Sportflugzeug vom Typ Bonanza. "Können Sie damit umgehen?"
"Das ist kein Problem, Señor", antwortete ich korrekt; denn seine Höflichkeit hatte mich angesteckt.
"Es war mir ein Vergnügen", sagte er, lüftete mit Grandezza den federleichten elfenbeinfarbenen Panamahut und entfernte sich. Ein Hauch von Juchten und von Jasmin blieb, bis ein Windstoß ihn forttrug, bei uns zurück.
"Don Antonio", sagte Steve zu mir, "wie gefällt dir der Boss?"
Ich zuckte die Schultern und sah mir das Flugzeug an.
Er hat zuviel gewusst
Gewiss, die Geschichte kam mir von Anfang an spanisch vor. Ich glaubte an einen internationalen Schmugglerring geraten zu sein, der sich mit Rauschgift befasste. Am Heroin-, Koks- und Marihuana-Handel wurde und wird auch heute noch in den Staaten märchenhaft verdient. Vermutlich war der Pilot dieser Bande gefasst worden oder sonst wie abhanden gekommen; Steve Baxter hatte meinen Bericht vom Hinauswurf bei der Compañia Dominicana de Aviación falsch aufgefasst und mich seinem Boss als branchekundigen Ersatzmann empfohlen. Kein Zweifel, ich war unter die Gangster gefallen! ... Aber es sollte viel schlimmer kommen.
Die Maschine fand ich in gutem Zustand. Ich wackelte ein paar Mal mit dem Leitwerk und machte mich fertig zum Start. Steve ließ die Tanks bis zum Rand füllen, sogar in die beiden Rücksitze pfropfte er Benzinkanister; doch war er nicht zu bewegen, mir das Flugziel zu nennen. Stattdessen erzählte er eine Unmenge netter Witze und entwickelte dabei viel Charme. Seitdem Don Miguel uns verlassen hatte, war er sichtlich aufgelebt. Erst mit der Zeit kam ich dahinter, dass seine Geschichten alle dieselbe Pointe hatten. Auf eine, die von drei Texasreitern handelte, besinne ich mich noch. Diese drei wortkargen Burschen trabten über die kahle Steppe, und gleich nach dem Frühstück fragte ihr Anführer: "Jungs, wie viel ist siebzehn und neun?" "Dreiundzwanzig, Boss", antwortete ein paar Stunden später der zweite. Gegen Mittag sagte der dritte: "Ich meine sechsundzwanzig." Der Anführer drehte sich nach ihm um, zog seufzend den Colt und schoss ihn vom Gaul. Die übrigen beiden erreichten gegen Abend ein Blockhaus, und als sie die Pferde festbanden, fragte der zweite: "Boss, warum hast du'n weggepustet?" Und der Boss antwortete: "Der hat zuviel gewusst."
Mir entging nicht, dass Steve mich durch solche Geschichten auf taktvolle Art warnen und davon abbringen wollte, Fragen zu stellen. Um vierzehn Uhr bekamen wir Starterlaubnis, ich ließ die Motoren an und drückte drauf. "Höhe zwölfhundert Fuß", sagte Steve, "Kurs eins-neun-drei." Das Wetter war prachtvoll, ganz wie erwartet ging es nach Süden. Blindlings befolgte ich die Kursvorschrift, und es stellte sich bald heraus, dass wir parallel zur Strandlinie flogen. Links unter uns kräuselte sich endlos und blau der Atlantik, Schaumketten säumten die Ostufer der Inseln Sapelo, St. Simon, Jekyl und Cumberland, die wir nacheinander passierten. Gelb leuchtete der Sand, vor Brunswick wimmelte es von Sportbooten und Badegästen, wir konnten die Wimpel am Strand flattern sehen. Nach einer halben Stunde blieb die Küste auf Backbord zurück; wir näherten uns einer Stadt.
"Jacksonville", sagte Steve, "Kurs eins-acht-acht." Er schien die Ziffern im Kopf zu haben; ich wette, er flog die Route nicht zum ersten Mal. Wir befanden uns schon über Florida. Von Navigation verstand er freilich nichts. Er ließ mich niedrig fliegen, damit er sich nach Landmarken richten konnte: Gleise, Ortschaften, Seen, auch die große Autobahn nach Miami dienten ihm abwechselnd zur Orientierung. Mir grauste bei dem Gedanken, der Himmel könnte sich beziehen oder ein Seitenwind uns versetzen. Aber Florida ist für beständiges Wetter bekannt. Mit zweihundert Meilen pro Stunde surrte die Bonanza quer über die Halbinsel hinweg, und ich war erstaunt, als wir gegen vier Uhr nachmittags bereits ihren Südwestrand an jenem Punkt erreichten, wo der Caloosahatchee-River in den Golf von Mexiko mündet. Wir zogen eine Schleife über dem verlassenen Territorium zwischen den Everglades-Sümpfen, dem Häfen Puntarasa und dem Big Cypress Swamp; Steve befahl mir, auf einer einsamen Wiese zu landen.
"Wenn sie feucht ist", sagte ich, "sitzen wir fest."
"Sie ist so trocken wie meine Kehle", antwortete er.
Und wir kamen glatt hinunter.
Auch jetzt machte Steve nicht viel Worte. Er zerrte die Kanister aus dem Heck, füllte daraus den Haupttank nach und warf sie ins Gebüsch. Die Fondsitze wischte er mit einem sauberen Lappen ab; sein Reinlichkeitssinn machte mich stutzig. Ich beschloss, ihn hintenherum zu fassen. Wenn er mir schon Zweck und Ziel dieser Reise verheimlichte, so hielt ich es doch für angebracht, bestimmte arbeitsrechtliche Fragen zu erörtern, die sich aus meinem Anstellungsverhältnis ergaben.
"Die dominikanische Gesellschaft", begann ich behutsam, "hat mir für so was hundertsechzig die Woche gezahlt. Verstehe natürlich, Steve, dass ich erst die feinen Papiere abarbeiten muss, 'n Wochenlohn werden sie wohl wert sein. Ich frag' auch nur deshalb, weil ich dir deine zehn Dollar zurückgeben will, so schnell wie es geht."
Er war gerührt. "Lass uns die zehn vergessen, Oberleutnant", sagte er. "So dreckig geht's uns nicht. Green Pope sorgt für uns, besser als du denkst!" Und damit verriet er mir immerhin, wie die Gesellschaft hieß, für die ich neuerdings flog: Green Pope - der Grüne Papst.
Der dritte Mann
Kurz vor vier trafen statt der erwarteten Schmuggelfracht in einer orangefarbenen Limousine, einem Mietwagen offenbar, zwei Passagiere ein, deren Namen ich erst später erfuhr: Dr. Luis Guerra, ein hochgewachsener vierzigjähriger Mann, und seine Tochter, die er Chabelita nannte - Klein Isabel. Mit flinkem Pilotenblick schätzte ich die Zusatzlast ab; er mochte neunzig Kilo wiegen, das Mädchen sicher kaum fünfzig. Sie war ein knabenhaft schlankes Wesen von höchstens siebzehn Jahren, mit schwach gebogener Nase, brennenden Augen, indianisch getönter Haut und blauschwarzem Haar. An jenem Tage bemerkte ich von alldem wenig, obwohl ihre Hand einen Augenblick auf meiner Schulter lag, als sie ins Flugzeug kletterte. Mochte sie noch so zauberhaft sein - nach dem fatalen Vorfall im "Charleston" hatte ich von hübschen Mädchen genug.
Kaum angeschnallt, zog Dr. Guerra aus seinem Proviantkoffer eine Sodabombe hervor, gab jedem zu trinken und verteilte Apfelsinen, belegte Brote, Pfefferminzdrops und Kaugummi. Er war ein Mensch von angenehmen Umgangsformen, nicht ohne Scharfblick. "Sie sind Deutschamerikaner", sagte er zu mir. "Ich kenne die Deutschen: sympathisches Volk, tüchtige Pflanzer und gute Soldaten, in Politik nicht sehr begabt."
"Mit Politik, Señor", entgegnete ich, "haben wir hier nichts zu tun."
"Gott ist Zeuge", antwortete er mit verhaltenem Lächeln. "Adelante! Caballeros, wir dürfen nicht zögern." Er sah er sich mehrmals nach der Limousine um, die, in eine Staubwolke gehüllt, nach Puntarasa zurückrumpelte, ganz als fürchte er, es könnten hinter den dürren Zedern- und Palmetosgruppen Verfolger auftauchen. Es war eine stille, eigentümlich tote Landschaft. Der Boden bestand aus Schwemmsand und Trümmern, die der Golfstrom in Jahrtausenden zwischen die Klippen geworfen hatte; Riedgras bedeckte ihn, von der Sonne gebleicht. Abseits überm Big Cypress Swamp tanzten Mückenschwärme in glasigem Dunst. Mir wurde unheimlich an diesem Ort; erst als das Fahrwerk abhob, atmete ich freier.
"Kurs eins-acht-null", sagte Steve, und so steuerte ich genau nach Süden, aufs offene Meer hinaus. Nach vierzig Minuten sichteten wir die Perlenkette der Florida- Riffe mit der Marinebasis Key West an der Spitze; auch die imposante Eisenbahnbrücke, die vom Festland herüberführt. Es ist niemals ratsam, Militärstützpunkte zu überfliegen; wir wichen nach Westen aus, und eine halbe Stunde später schnitten wir die Küste Cubas nahe der Hauptstadt Habana. An dieser Stelle ist Cuba kaum dreißig Meilen breit. - "Wie soll's weitergehen?", fragte ich. Steve antwortete: "Immer der Nase nach."
Wir passierten die Ostflanke der Isla de Pinos, einer von Sumpfniederungen gesäumten Verbannungsinsel, auf der Cubas Diktatoren ihre Feinde zu verwahren pflegten. Dort wurde damals auch ein sechsundzwanzigjähriger Mann namens Fidel Castro in einem Zuchthaus gefangengehalten. Er hatte knapp ein Jahr zuvor, am 26. Juli 1953, mit 160 Gleichgesinnten vergebens versucht, die Moncada-Festung in Santiago de Cuba zu stürmen, die von 1000 Söldnern verteidigt wurde... Einige Zeit, nachdem wir den Verbannungsort überflogen hatten, ist Castro auf Grund einer allgemeinen Amnestie für politische Gefangene, die ein Wahlmanöver war, entlassen worden. Wie man weiß, ging er nach Mexico und bereitete sich dort von neuem darauf vor, seine
Heimat von einem entsetzlichen Joch zu befreien.
Hinter der Fichteninsel, die trotz ihres Namens ziemlich kahl ist, kamen mir Bedenken. Blau dehnte sich das Karibische Meer, rosa und braun blinkten am Horizont ein paar Fischersegel, winzige Fetzen im Ozean. Jetzt war es sechs Uhr abends, die Sonne stach schräg zum Steuerbordfenster herein, unser Sprit reichte nur noch für zwei Stunden, mit etwas Glück hätten wir den Strand von Honduras oder Jamaica eben noch erreichen können. Die britische Zuckerinsel lag im Südosten, die Bananenrepublik in Richtung Südsüdwest. Steve Baxter aber, dieser merkwürdige Aeronaut, ließ mich unentwegt Südkurs halten. Ich machte ihn mehrmals darauf aufmerksam.
"Das Wasser wird badewarm sein", sagte ich, "hier soll's auch 'ne Masse leckerer Haie geben."
"Macht nichts", sagte er, "auf dich, Don Antonio, haben sie keinen Appetit."
"Bist du ganz sicher?", fragte ich wütend.
"Du giltst seit Savannah als Mädchenschänder" sagte er So was spricht sich auch unter den Fischen 'rum."
Gegen acht Uhr wurde unsere Lage ernst. Laut Seekarte befanden wir uns hinter der Misteriosa-Bank, im Nordwesten rollte der Sonnenball herab, nach Cuba konnten wir nicht mehr zurück, Honduras war auch nicht zu erreichen; die Katastrophe bahnte sich an. Um zu verhindern, dass ich notfalls die britische Insel Grand Cayman anflog - die einzige, die, wie mir schien, noch in unserem Aktionsbereich lag -, schnallte Steve die Karte von seinem Knie los. Von nun an studierte er sie allein, bestimmte den Kurs, ohne dass ich ihm zusehen durfte. Mir lief ein Schauer über den Rücken. - Er hatte es damals in Augsburg nicht einmal fertiggebracht, den Lagervorrat an Grapefruit, Milchpulver und Kartoffelflocken fehlerlos zu addieren. Sobald es dunkel wurde, war es mit seiner Navigationskunst sowieso aus.
Plötzlich stieß er mich an und flüsterte: "Sag denen hinten, wir schaffen Honduras nicht mehr."
Betroffen schüttelte ich den Kopf. Was sollte das bedeuten? Wir hatten Honduras nie angesteuert! Ich begriff nicht, was da gespielt wurde. Nun sah ich, wie er sich umdrehte, und hörte ihn sagen: "Mister Guerra" - sonderbar, er bediente sich nicht der spanischen Anrede -, "Mister Guerra, wir stellen fest, dass wir Gegenwind haben. Wir können Honduras nicht mehr erreichen!"
In dieser Sekunde begann der Backbordmotor zu spucken, ich schaltete auf Reservetank um und konnte nicht verstehen, was unsere Passagiere antworteten. Die Sonne tauchte ins Meer; wie überall in den Tropen wurde es fast augenblicklich finster. Während der folgenden Minuten schwitzte ich mein Hemd durch, sie zählen zu den scheußlichsten meines Lebens. Steve gab mir munter Kursziffern an, er verstand nichts vom Fliegen und fürchtete sich nicht - ich wünschte ihm die Pest an den Hals. Heute besinne ich mich nur noch auf ein zuckendes, giftgrünes Lichtsignal, das ganz zuletzt, als wir kaum noch Treibstoff hatten, am Horizont über Wellenkämme geisterte. "Halt darauf zu", befahl Steve, und dann glitt es unter uns heran: die phosphoreszierende Brandung, das schwarze Felsenufer, Palmenwipfel hinter einer spärlich beleuchteten Landebahn, ein burgähnlich düsteres Bauwerk. Mehr war nicht zu erkennen, auch als die Maschine stand.
Ich kletterte als erster aus der Kabine, lehnte mich gegen das Fahrwerk und würgte alles heraus, was mir Dr. Guerra offeriert hatte - die Apfelsinen, Sandwiches, Drops und Schokoladenriegel. Ich spuckte es in den Sand und schwor mir, einen anderen Job zu suchen. Wir waren dem Tod von der Schaufel gesprungen, aber es hatte wirklich nicht viel gefehlt... "Hör auf zu opfern", sagte Steve hinter mir, "hast dich wacker gehalten." Und leiser, als sollte es außer mir niemand hören: "Wir sind am Ziel."
Dolch-Insel: Traumvilla und MPis
Aus den Interviews, die ich später einigen Zeitungskorrespondenten gab, hat man herauslesen wollen, der Landungsort müsse Swan-Island gewesen sein, eine Doppelinsel hundertzehn Meilen vor der Küste von Honduras. Ein Blatt behauptete sogar, es habe sich um eine der Corn-Inseln gehandelt, die ebenfalls amerikanisches Hoheitsgebiet sind und auf der Höhe von Bluefields liegen. Als vor Jahrzehnten das Projekt des Nicaragua-Kanals aufkam, hatten die USA dort einen Marinestützpunkt errichtet. Nichts dergleichen fand ich vor. Es ist auch keineswegs ein Punkt im columbianischen S.-Andrés-y-Providencia-Archipel gewesen. Das Felseneiland, über das die Bonanza mit Dr. Luis Guerra, seiner Tochter und Steve an Bord am 10 Abend des 13. Juni rollte, lag weiter nordwestlich auf der Mosquito-Bank, in der Nähe der Halbmond-Riffe. Es unterstand damals formell der Jurisdiktion Nicaraguas und hatte, soviel ich weiß, entweder keinen authentischen Namen, oder man hielt ihn vor uns geheim. Von den zeitweiligen Bewohnern wurde es Isla de Pufial, Dolch- Insel, genannt; ob das aus Tarnungsgründen geschah, wegen der eigentümlichen Gestalt des Eilands, oder ob es sich auf den Charakter seiner Herren bezog, möchte ich nicht entscheiden.
Am späten Vormittag des folgenden Tages weckte mich ein wandernder Sonnenstrahl. Ich richtete mich auf, schlürfte heißen Kaffee, der, wie von Gespensterhand gereicht, vor meinem Lager dampfte, und streifte durchs Haus. Es war leer. Außerhalb des Gemäuers keiften spanische Stimmen, ich verstand weder, um was es ging, noch konnte ich die Streitenden entdecken. Im lindgrün gekachelten Bad duschte ich mich und zog ein frisches Hawaiihemd über, das Steve mir geschenkt hatte. In die Wanne wagte ich mich nicht. Sie war in den Fliesenboden eingelassen, ihre Wände bestanden aus Glas, dahinter erblickte ich ein matt beleuchtetes Aquarium mit Schlingpflanzen, Schnecken und schleimigem Gestein, durch das Dutzende von Zierfischen huschten, so dass man glauben mochte, auf dem Meeresgrund zu schweben; eine nicht unbedingt erquickende Vorstellung. In solch einem Gefäß zu baden entsprach einem Lebensstil, der mir fremd und zuwider war.
So absonderlich wie diese gläserne Wanne war das ganze Haus. Es war eine festungsartig hergerichtete Villa; ihre glatten Außenmauern leuchteten kanariengelb, zimtbraun, himbeerrot. Auf Fenster hatte der Architekt verzichtet. Die Räume erhielten ihr Licht vom durchbrochenen Mauerwerk der Wände - bizarr geformten Löchern, auch als Schießscharten trefflich zu gebrauchen. Sie dämpften die tropische Helligkeit zu einem Dämmerlicht, das von buntem Glas oder farbigem Gemäuer sanft koloriert wurde. Ein milder Lufthauch strich hindurch, spielte mit den Moskitoschleiern. Erst später sollte ich erfahren, dass ein Kaffeemillionär aus Managua in den zwanziger Jahren seinem idiotischen Sohn dieses Heim geschaffen hatte. Im Becken des Karibischen Meers verträumte der Geisteskranke weltabgeschieden seine Tage, und damit er sich nicht hinabstürzen konnte, hielt man die Lichtöffnungen so klein. Er war zu jener Zeit schon lange tot.
Draußen rauschte die Brandung. Mächtige Corozopalmen reckten, von Lianen und Orchideen umrankt, die Fächer ihres Blattwerks steil in den Himmel. Dreißig Fuß lang, neun breit waren diese immergrünen Blätter, man hatte nahe dem Ufer aus ihnen regensichere Hütten errichtet; Kistenstapel lagen darin. Ein Mestize mit fettglänzendem Haar, breitem messingbeschlagenem Leibgurt, schwerer Machete und zwei riesigen Trommelrevolvern hielt davor Wache. Um den linken Oberarm trug er eine blaue Binde, in die ein silbernes Schwert hineingestickt war. Ein Totenschädel über gekreuzten Knochen wäre, so sagte ich mir, womöglich passender gewesen. Jedoch man durfte wohl nicht erwarten, dass die westindischen Piraten drei Jahrhunderte lang ihren Emblemen treu blieben. Als ich mich dem Posten näherte, salutierte er und fragte: "Primer-teniente?"
Dies bedeutete: Oberleutnant. Mich durchzuckte es heiß. Vermutlich hatte Steve Baxter meinen alten Spitznamen für einen echten Dienstrang ausgegeben, genau wie er mich gestern seinem Chef als abgefeimten Schurken empfohlen hatte. Von solcher Hochstapelei schien er sich viel zu versprechen, daher antwortete ich: "Si!" - militärisch knapp. Ich war selbst noch verblüfft und begann die Kisten zu kontrollieren.
In verschiedenen Sprachen lief die Aufschrift VORSICHT GLAS! NICHT STÜRZEN! Quer über die Bretter; als Absendehafen konnte ich Hamburg entziffern, Empfangsort war Cartagena, Columbien. Immerhin, nun lagerten sie sechshundert Meilen nordwestlich von Cartagena. Ich ließ mir vom Posten das Haumesser geben und brach einen der Deckel los. Die Kiste enthielt, in Öllappen sauber verpackt, nagelneue Maschinenpistolen, ohne Patronen und Magazine, die sich wahrscheinlich in den Nachbarbehältern befanden. Eins der Schießeisen hob ich ans Tageslicht und erkannte, dass es eine alte deutsche MPi Modell 40 war, seltsames Wiedersehen nach langer Zeit. - "Bien arreglado", sagte ich, "in Ordnung! Machen Sie wieder zu."
Die Hände in den Taschen, spazierte ich an der Inselküste entlang, unter Kriechpflanzen und hängenden Goldamselnestern hindurch. Wie waren die Kisten hierhergekommen? Über mir kreischte ein Papagei. Ich hätte Steve fragen können, doch er war nirgends zu finden. Offenbar hatten die Banditen einen Frachter geplündert, der ordnungsgemäß in Hamburg verladene Waffen nach Columbien beförderte. Sie hatten sich vielleicht des ganzen Schiffes bemächtigt - aber wie war die Ladung gelöscht worden? Es gab keine Mole und keine Landungsbrücke, von einem Hafenbecken ganz zu schweigen. Fest stand, Frachtschiffe konnten Isla de Puñal nicht anlaufen. Das Ufer war schroff, und dort, wo es sich zur Dolchspitze senkte, einer langgekrümmten schlammigen Sandbank, wucherten Mangroven; ihre knotigen Äste schufen ein undurchdringliches Dickicht, die Luftwurzeln bespülte das Meer.
Bald jedoch entdeckte ich im Südwesten eine Bucht, zu der ein eiserner Aufzug fünfzig Fuß tief hinunterführte. Bei den Nordostpassaten, die hier von November bis Juni bliesen, mochte sie für Schiffe ohne nennenswerten Tiefgang einen ruhigen Ankergrund bilden. Ich spähte hinab. Ein schlankes Motorboot von vielleicht achtzig Tonnen schaukelte auf den Wellen, zwischen Bordwand und Anlegepfahl rieb sich ein Fender. Stimmengewirr drang zu mir herauf. Nach einer Weile stieg aus der Kajüte ein Mann, den die Matrosen, wie deutlich zu hören war, mit "Comandante" anredeten; er stiefelte übers Vorderdeck. Viel konnte ich aus der Vogelschau von ihm nicht erkennen. Mir fiel nur auf, dass der Comandante blitzende Sporen trug, mit tassengroßen gezackten Rädern, obwohl es weder auf der Insel noch auf dem Schiff ein Pferd für ihn gab.
"Señor Morena", sagte da jemand hinter mir, "darf ich Sie einen Augenblick sprechen?" Ich fuhr herum. Es war Dr. Guerra; seine Tochter stand neben ihm.
Menschenraub: Für einen Pass zuviel
Er zog mich vom Ufer weg, hinter ein Dornengestrüpp, und sah sich nach allen Seiten um, wie er es schon am Big Cypress Swamp getan hatte, doch war nichts Ängstliches in seinem Gebaren, er glich eher einem stolzen, kampfeslustigen Mann. "Caballero ", fragte er, "wissen Sie, wo wir uns hier befinden?"
"Sowenig wie Sie", gab ich verdrossen zurück.
Er beobachtete mich scharf. "Bitte, sprechen Sie die Wahrheit: Ihr Benzinvorrat war wirklich aufgebraucht?"
"Zum Teufel, ja", antwortete ich. "Mit dem letzten Tropfen sind wir hier gelandet!"
"Sie hatten Gegenwind?", fragte er schnell.
Ich legte die Hände auf den Rücken - und schwieg. Etwas hinderte mich daran, diesen Mann zu belügen. Sein Blick hing an meinen Lippen, mir wurde unbehaglich. "Wenn man fliegt", sagte ich, "ist immer Gegenwind."
Einen Augenblick lang schien er nachzudenken; seine Hände schlossen sich, die Augen wurden schmal, er nickte kurz. "Ich danke für Ihre Offenheit", sagte er. "Man hat Sie genauso getäuscht wie mich. Sie sind noch nicht lange dabei?"
"Seit gestern", antwortete ich. "Gefiel mir nämlich nicht mehr in den Staaten, und 'n Job als Pilot wird einem nicht alle Tage geboten." - Ich wusste wirklich nicht, warum ich ihm das erklärte. Ohne den mindesten Beweis zu haben, hielt ich ihn für einen ehrlichen Menschen. Zwanzig Stunden im Dienst von Gaunern hatten genügt, um in mir den Wunsch zu wecken, mit friedlichen Leuten zu reden.
"Ich muss mich Ihnen anvertrauen", sagte Dr. Guerra leise. "Ich bin Journalist und wollte nach Honduras. Dort wurde vorgestern der Generalstreik ausgerufen, seitdem sind die normalen Verkehrswege unterbrochen. Ich charterte also ein Taxiflugzeug... Aber ich glaube, man hat mich in eine Falle gelockt." Dies ist ein Räubernest, scheint mir."
Ich konnte dem schwer widersprechen; die Waffen, das Motorboot, dieses seltsame Haus - Dr. Guerra übertrieb nicht. "Haben Sie einen Verdacht?"
Ich sah, wie er zögerte. Das dunkelhäutige Mädchen mischte sich plötzlich ein. "Vamos Claros - sprechen wir offen", flüsterte sie. "EI Verde Papa..." Und noch ein paar spanische Worte, die ich nicht verstand.
"Still, Chabelita", bat Dr. Guerra.
Ich sagte: "Die Küste von Honduras dürfte kaum weiter entfernt sein als siebzig Meilen."
Er legte den Arm um die Schulter seiner Tochter; eine unwillkürliche Geste, die mich ahnen ließ, wie er sich um sie sorgte. "Fliegen Sie uns hinüber, Señor Morena, ich bin nicht reich - doch ich würde Ihnen fünfhundert Dollar zahlen, wenn Sie sich dazu entschließen. Das ist beinahe alles, was ich besitze."
Er log nicht, das war ihm anzusehen. Ich überlegte fieberhaft. Ihm schien sehr viel daran zu liegen, von dieser Insel herunterzukommen. EI Verde Papa, wie seine Tochter den Gaunerring nannte, hatte ihn entführt - aus welchen Gründen auch immer -, soviel stand fest. Denn Verde Papa bedeutete nichts als Grüner Papst... Green Pope, wie Steve gestern auf der Wiese vor Puntarasa gesagt hatte.
Mich überlief es kalt. Wenn ich bis dahin geglaubt hatte, unter Schmuggler geraten zu sein, in eine Gesellschaft von Rauschgifthändlern, so wurde mir in dieser Minute klar, dass es Kidnapper waren, denen ich mich angeschlossen hatte. Menschenräuber, das war zuviel, auch für einen hartgesottenen Tramp wie mich. Auf Menschenraub stand lebenslänglich Zuchthaus, mitunter sogar die Todesstrafe, und das war mehr, als ich für einen falschen Pass riskieren wollte.
"Sie können auf mich zählen", sagte ich, "nur - ich muss vorher meinen Copiloten sprechen."
Wieder sah er mich aufmerksam an; dann schüttelte er mir die Hand, offenbar überzeugt, ich würde ihn nicht verraten. Wir trennten uns sogleich, ich musste mich um die Maschine kümmern; es konnte unseren Plänen nicht dienlich sein, wenn man uns beisammen sah. Zunächst wollte ich Steve suchen, der sicherlich wusste, wo hier Benzin lagerte. Im Stillen beschloss ich, die fünfhundert Dollar redlich mit ihm zu teilen. Einmal in Honduras, würde uns dieses Geld zu einem neuen Start verhelfen. Ich musste ihn davon überzeugen, dass es besser war, sich beizeiten von der Bande zu trennen! Verdammt, warum sollte ich ihn nicht herumkriegen? So dumm war Steve nun wieder nicht: Er musste einsehen, dass dies hier nicht ewig gut ging. Eines Tages würden vor Isla de Puñal Polizeiboote aufkreuzen, den Schlupfwinkel ausräuchern, die Piraten an den Galgen bringen. Wir lebten ja nicht mehr im siebzehnten Jahrhundert, wo Seeräuberei im Karibischen Meer noch ein lohnendes Handwerk war.
In solche Gedanken verstrickt, durchquerte ich den Palmenhain, pirschte mich am Waffenlager, dann an der Villa vorbei. Zimtbraun, kanariengelb und himbeerrot schimmerte die glatte, fensterlose Fassade, sie schmorte in mörderischer Tropenglut. Kein Laut drang heraus. Haus und Insel schienen verlassen. Nur bunte Vögel schrien in den Zweigen. Unter meinen Füßen knackte es, und das Meer rauschte dumpf... Gleich hinterm Haus begann der Landeplatz. Doch als ich ihn erreichte, stand kein Flugzeug mehr da. Die Bonanza war verschwunden.
Chronik des Verbrechens
Ich sah ihre Spuren im Gras. Jemand hatte die Maschine gewendet und war mit ihr aufgestiegen; es musste in der Frühe geschehen sein, während ich noch schlief. Was nun?
Mir blieb nichts übrig, als auf Steve zu warten. Am Ende der Landebahn, im Schatten eines Sapotillbaumes, ließ ich mich nieder, tupfte den Schweiß von meiner Stirn, schaute mich um. Das Rollfeld nahm die Nordhälfte der Insel ein, den Dolchgriff. Man hatte sie planiert und gerodet, was eine grausame Arbeit gewesen sein musste; beiderseits der Einflugschneise wuchs weder Baum noch Strauch. Doch war die Rollstrecke kurz und konnte, namentlich wenn der Passatwind blies, nur von leichten Maschinen benutzt werden. Es war unglaublich heiß, der leise Zug vom Meer brachte wenig Linderung. Die Sonne stand jetzt im Zenit, hinter mir klatschte die Brandung. Eine Viertelstunde verstrich, dann noch eine und noch eine. Ich wartete, der Uhrzeiger kroch, die Wellen zischten gleichmäßig; niemand kam.
Gegen halb zwei geriet mein Magen in Aufruhr. Ein knurrender Schmerz durchlief die Speiseröhre, zerrte und nagte in mir. Ich lugte zum Haus hinüber; keine Rauchsäule kräuselte dort auf. Offenbar dachte niemand daran, den Angestellten dieser ehrenwerten Gesellschaft ein Essen zu bereiten. Eine solche Behandlung erbitterte mich. Es war mir oft schlecht gegangen in den letzten Jahren, aber ein Mittagsmahl hatte ich mir noch immer leisten können.
Die Hitze machte mich bösartig und schlapp. Mir wurde zeitweilig schwarz vor den Augen. Ein Moskito stach mich am Handgelenk. Ich hätte versuchen sollen, im Haus etwas Essbares aufzuspüren, stattdessen blieb ich liegen und starrte hinauf zu den dicken glänzenden Sapotillblättern; sie ähneln denen des Feigenbaums. Rotbraune apfelgroße Früchte wiegten sich im Wind, ein paar waren abgefallen, ich kostete davon. Sie schmeckten süß, wie Birnen etwa, die man mit jenem braunen, leicht bitteren Rohrzucker versetzt hat, den die armen Leute in Mittelamerika essen; das Fruchtfleisch war gelbbraun und saftig. Nach dem vierten Sapotillapfel wurde ich schläfrig, der Hunger ließ nach, ich glitt hinüber in sanftes Dämmern.
Dabei beschäftigte mich unaufhörlich meine verzwickte Lage. Mir ging, während ich unter dem Baume ruhte, all das durch den Kopf, was ich über Amerikas Gangster gehört hatte. Wann die Verbrecher in den Staaten angefangen hatten, sich zusammenzuschließen, was überhaupt die Wurzel des Verbrechens war, wusste ich damals noch nicht. Aber ich dachte daran, dass es schon im Jahre 1912 in gewissen Vierteln New Yorks zu Straßenschlachten gekommen sein sollte, wobei die Polizei aus Maschinengewehren schoss.
Mir fiel ein dass auf dem Heck des Motorbootes in der Sudwestbucht auch ein Maschinengewehr gestanden hatte. Die trüben Gedanken ließen mich nicht los. Damals also hatte es begonnen. Vielen Männern, die aus dem ersten Weltkrieg heimkehrten, hatte man das Töten wohl zu genau beigebracht; sie hatten den Kopf hingehalten für andere, warum nun nicht einmal für sich? Es kam das Jahr 1920 mit Depression und Alkoholverbot. In den Slums amerikanischer Großstädte bildeten sich neue Banden, schossen wie Pilze hervor, und ihr Nährboden war die Prohibition. Denn Alkoholschmuggel wurde nur rentabel, wenn eine Organisation ihn besorgte, wenn bewaffnete Gangster den Transport der Schnapsfässer vom Landungsplatz bis in den Keller der Speakeasies - der verbotenen Destillen - deckten, mehr gegen die Konkurrenz als gegen die Polizei. Damals in den zwanziger Jahren entstanden Verbrechertrusts, die für jeden Geschäftszweig ihre Spezialisten hatten, vom routinierten Mörder bis zum Verbindungsmann zur Polizei...
Aber das war lange her. Ich biss in einen Sapotillapfel und sah zur Uhr. Es war vier, und von Steve keine Spur.
Ich lag tatenlos da und grübelte weiter. Namen wie Dillinger, Dutch Schultz, Jack Diamond und Al Capone waren damals in aller Munde gewesen. Doch es kam das Jahr 1933, Roosevelt hob das Alkoholverbot auf, die Geldquelle der Gangster versiegte.
Jeder weiß, worauf sie sich zu diesem Zeitpunkt verlegten: auf Menschenraub. Sie entführten Männer und Frauen, besonders die Kinder von Millionären, und pressten Lösegeld aus den Eltern heraus. Die reichen Leute wurden unruhig. Hinzu kamen Bankeinbrüche und Eigentumsdelikte in steigender Zahl. Schießereien um Sprittransporte hatten die Reichen nicht so gestört, jetzt ging es um Geld, um ihre Kinder. Man verstärkte die Bundeskriminalpolizei und schuf das berühmte G-Men-Korps, das mit List und Gewalt, Dollars, Fausthieben, Flugzeugen und Kleinkalibergeschützen einen blutigen Feldzug gegen die Kidnapper führte. Bestimmte Bandenchefs wurden zu "öffentlichen Staatsfeinden" erklärt und nach dem Grad ihrer Gefährlichkeit mit laufenden Nummern versehen; man jagte sie durchs ganze Land. Ich hatte in Magazinen allerhand darüber gelesen, nun fiel mir manches wieder ein. Es gab viele Schauergeschichten aus den mageren dreißiger Jahren, und leider waren die meisten wahr.
Als der zweite Weltkrieg ausbrach, stand der Kampf noch unentschieden. Womöglich fanden viele der Burschen während des Krieges Gelegenheit, ihre Raub- und Mordinstinkte auf gesetzliche Weise auszutoben. Was auch immer die Ursache war, jedenfalls kehrte die Ära des Kidnapping danach nicht wieder. Statt dessen stiegen die großen Haie, allen voran "Lucky" Luciano, gegen Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre schwer ins internationale Rauschgiftgeschäft ein; sofern sie nicht, wie Frank Costello, von Spielhöllen und Glücksautomaten lebten oder, wie Joe Adonis, sich zu Mordexperten entwickelten. Alle änderten sie ihre Lebensweise, trugen keine Pistole mehr unter der Achsel und machten sich nicht mehr die Finger schmutzig. Sie legten die rauen Sitten der Vorkriegszeit ab, verzichteten auf ihre Leibgarde, fuhren im Cadillac, kauften verrückte Villen - wie diese hier vor meinen Augen -, engagierten sich ganze Stäbe von Rechtsberatern, heirateten sogar und wurden nach außen zu respektablen Bürgern. Wie jeder amerikanische Zeitungsleser hatte ich allerhand über Gangster erfahren und über die Art, auf die sie Polizei und Gerichte narrten. Viele von ihnen verbanden sich mit korrupten Politikern und bestachen auch öfter die Polizeibeamten. Sie wurden recht selten verurteilt. Ich kannte die Namen mancher besonders berüchtigter Banden; sosehr ich mir aber den Kopf zerbrach - vom Grünen Papst hatte ich noch nie gehört.
Eins stand für mich fest: Wenn Green Pope vom Menschenraub lebte, so bedeutete dies einen Rückfall in die Praktiken der dreißiger Jahre. Die amerikanische Kriminalgeschichte kannte bisher keinen solchen Fall. Kidnapping galt wegen des hohen Risikos als veraltete Methode, wirklich dicke Fische befassten sich nicht mehr damit. Green Pope aber war so ein dicker Fisch, nach allem, was ich bisher gesehen hatte. Einen eigenen Stützpunkt mit Flugzeug, Waffenlager und Achtzigtonnenboot konnten sich kleinere Banden nicht leisten. Darin steckte ein Widerspruch! Und es gab noch andere: Wieso entführte man Dr. Guerra, der nach seinen eigenen Worten kein vermögender Mann war? Und falls er dennoch mehr besaß - seine Tochter zu verschleppen hätte genügt. Hier riss mein Gedankenfaden ab, denn ich sah Steve Baxter um die Ecke der Villa schlendern. Ich stand viel zu schnell auf, und wieder wurde mir schwarz vor Augen.
Der lange Arm verdorrte
"Hola, Don Antonio", rief er mir entgegen; "cómo está Usted? How do you do? Ostra! Muy mucho." Und er schwenkte ein Netz, in dem es von Austern wimmelte. Steve hatte, wie er mir in dem ihm eigenen Gemisch von Englisch, Deutsch und fehlerhaftem Spanisch erzählte, den ganzen Tag über Austern gefischt. Sie saßen massenhaft an den Luftwurzeln des Mangrovenurwalds, der die Ostspitze unserer Insel versperrte, und ich konnte mir vorstellen, wie er sich damit geplagt hatte.
"Hör mal", sagte ich, "unser Flugzeug ist weg."
"Dieser Bursche Kennard ist damit los", antwortete er. "Holt den Boss, glaube ich... Sieh dir das an, frische Austern! Manche bestreuen sie mit Pfeffer oder träufeln Zitrone drauf, aber die verstehen's nicht. Am besten, man schlürft sie roh, trinkt dazu weißen Burgunder." Steve war schon immer ein Feinschmecker gewesen. Er schnalzte mit der Zunge und ging vor mir her ins Haus. Dort leerte er das Netz in die Badewanne, in der es schon von Austern wimmelte. Offenbar hatte er mehrere Fänge eingebracht. Die Tiere lebten noch, es sah aus, als fühlten sie sich wohl unter den Schlingpflanzen, Schnecken und Zierfischen, von denen das Wannenglas sie schied.
"Hör mal", wiederholte ich, "Steve, muss 'n ernstes Wort mit dir reden."
"Ich weiß", sagte er und grapschte in die Wanne, "die Verpflegung ist mies. Sie legen neuerdings ihr ganzes Geld in Waffen an, was willst du machen?" Seine Rechte langte aus einem Wandschrank den Wein. "Man muss sich selber helfen... Da, koste mal." Solange er Austern aß, war nicht mit ihm zu reden.
Später, auf unserem Zimmer, schlug Steve Eier in die Pfanne, schnitt eine Büchse Grapefruit auf; wir verzehrten den Nachtisch, tranken darauf Rum. Nun bot sich mir Gelegenheit, meine Bedenken darzutun. Er hörte sich alles ruhig an, in seinem breiten Gesicht regte sich kein Muskel, auch nicht, als ich ihn bat, mit mir Isla de Puñal heimlich zu verlassen. - "Du weißt ziemlich gut Bescheid", äußerte er, während er über seinen Magen strich. "Nun will ich dir mal was über 'n paar Jungs erzählen, von denen du anscheinend noch nichts gehört hast."
Er goss den Rum in zwei Zahnputzgläser und sagte: "Lang lebe Don Miguel, unser Boss...! Also, was ich meine, sind die Burschen der Mord-AG. Schon mal von Albert Anastasia gehört?"
Ich schüttelte den Kopf. Den Namen kannte ich natürlich. Soweit ich mich erinnerte, leitete Anastasia in New York einen Club besonderer Art. Sein Geschäft war es, Gangster zu beseitigen, die im Begriff standen, Verrat zu üben. Jeder Bandenchef, der glaubte, dass einer seiner Leute drauf und dran sei, zur Polizei zu gehen und Lampe zu machen, konnte bei Albert Anastasia einen Mord bestellen; der treulose Bandit wurde rasch, meist auch unauffällig, liquidiert. Anastasia wollte auf diese Weise die amerikanische Unterwelt vor der Selbstvernichtung bewahren, und da er seinen Kollegen pro Mord fünftausend Dollar berechnete, fuhr er nicht schlecht dabei. Seine Killertruppe schoss aus dem Hinterhalt, stach zu, schlug mit Eispicken, blies Giftgas in Klosetts und beschwerte die Leichen ihrer Opfer, die im Hudson- River versenkt wurden, mit Betonklötzen. Und die Mord-AG hatte Erfolg. Seit Kriegsende mussten Dutzende prominenter Gangster von den Gerichten freigesprochen werden, weil Anastasias Garde die Belastungszeugen rechtzeitig abgeknallt hatte, ob sie sich in den Staaten aufhielten oder im Ausland.
"In seinem Haufen", sagte Steve, "gab's mal 'nen Mann namens Abe Reles. Gehörte sogar zur Leibwache, der Junge. Eines schönen Tages schnappte er über und ging zum Staatsanwalt. Seine Aussagen füllten fünfundzwanzig Stenoblöcke, stell dir das vor, Don Antonio. Reles belastete seinen alten Chef mit der Schuld an einunddreißig Morden, was bestimmt nicht sehr anständig von ihm war."
Steve trank sein Glas aus, verzog das Gesicht und knurrte: "Ein Sauzeug ist das! Himbeersaft, kein Rum... Da haben sie wieder gepanscht. Also, die New-Yorker Kripo wusste natürlich, was fällig war; sie traf fantastische Maßnahmen, um diesen Reles vor der Mord-AG zu schützen. Zusammen mit anderen Singvögeln sperrte sie ihn bei erstklassigem Essen und guter Behandlung in ein Hotel, das sie extra gemietet hatte; 'Zum Halbmond' hieß es, lag ziemlich abseits. Die Blauen bestückten das Haus mit MGs, pfropften es mit G-Men voll, verteilten draußen Detektive, und den Zugang zum Kronzeugen sperrten sie durch 'ne besondere Stahltür. Doch ein paar Tage vor Prozessbeginn stürzte Abe Reles aus'm sechsten Stock seiner Hotelfestung böse aufs Pflaster. In den Armen der G-Men hauchte er seine Seele aus... Das war im Jahre neunzehnhundertvierzig. Und wie Anastasia das gedreht hat, ist der Polente heute noch 'n Rätsel."
Ich leerte mein Glas und schwieg. Da war auch nichts mehr zu sagen. Steve hatte einfach Angst. Er wusste viel mehr über Green Pope als ich und fürchtete beseitigt zu werden, falls er ausstieg; so wie Abe Reles beseitigt worden war. Mir wurde in diesem Augenblick klar: Man geriet leicht hinein in einen Gangsterring, besonders wenn ein alter Freund für einen bürgte; aber man kam verteufelt schwer wieder heraus. Das war wohl ein Gesetz der Unterwelt. Flog Steve wirklich mit mir davon, so bestellte Don Miguel bei Albert Anastasia einen netten kleinen Doppelmord, falls ihm unser Tod zehntausend Dollar wert war... Vielleicht gewährte der Vorstand der Mord-AG in solchen Fällen auch Rabatt.
Wenn ich mich heute dieses Abends auf Isla de Puñal erinnere, da wir zwei stumm beieinander hockten und an den langen Arm Anastasias dachten, wird es mir leicht, hier zu vermerken, wie jenen Mann dreieinhalb Jahre später sein Schicksal ereilte. Nach amerikanischen Presseberichten durchquerte am Freitag, dem 1. November 1957, ein Herr in kleinkariertem braunem Anzug das Portal des Park Sheraton Hotels in der 55. Straße New Yorks, passierte die Glastür des Frisiersalons und ließ sich in einen der hübschen Zahnarztstühle fallen. "Haarschneiden", grunzte er, und man beeilte sich, ihn in den duftenden schneeweißen Umhang zu hüllen. In dieser Sekunde erschienen zwei Maskierte mit vorgehaltenen Pistolen im Salon. Sie scheuchten die erschreckten Friseure beiseite, und bevor der Mann im weißen Tuch eine Abwehrbewegung machen konnte, hatten ihn acht Revolverkugeln durchbohrt. Lautlos glitt er vom Sessel, die Mörder entkamen. Wenig später notierten Polizisten die Personalien des Toten. Sein Name war Albert Anastasia.
Es würde zu weit führen, hier darzulegen, weshalb Anastasia von Leuten ermordet wurde, die nach allem, was man darüber weiß, seine Komplizen gewesen sind. Weil dieser Vorgang jedoch eine Parallele bietet zu gewissen Erlebnissen, über die ich noch berichten muss, sei folgendes dazu mitgeteilt: Zu jener Zeit stand Cubas Diktator, ein korrupter Politiker namens Fulgencio Batista, in erbittertem Kampf gegen freiheitsliebende Rebellen, die, vom Volk unterstützt, auf der Ostseite der Zuckerinsel in der unwegsamen Sierra Maestra den Regierungstruppen trotzten. Ihr Führer, der Emigrant Fidel Castro, war am 2. Dezember 1956 - mit 82 Kämpfern auf einer Dieseljacht von Mexico herkommend - am Kap de Cruz gelandet. Das Unternehmen war verraten worden: ein ganzes Regiment erwartete die weiße Jacht Granma. Während des ersten Gefechts fielen 70 Mann. Nur 12 Patrioten erreichten die Berge der Sierra Maestra. Durch Terror behielt Batista anfangs die Oberhand, doch der Brand griff um sich, nach einem Jahr war die ganze Provincia Oriente Aufstandsgebiet, riesige Zuckerrohrfelder gingen in Flammen auf, und dem Diktator fehlte es bald an Geld, um seine auf fünfundzwanzigtausend Mann verstärkte Armee zu besolden, Benzin und Bomben für seine Tiefflieger zu kaufen, mit denen er verdächtige Ortschaften verwüsten ließ.
In dieser Lage sah sich der Regierungschef nach neuen Einnahmequellen um. Aus der Bevölkerung war nicht mehr herauszupressen, als schon herausgequetscht wurde. Hätte er die Steuerschraube angezogen, wären noch mehr Menschen ins Lager der Rebellen desertiert. Zwar steckten ihm die Amerikaner einiges zu, die das Inselreich nach dem spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 ursprünglich annektiert hatten und sich seitdem als sein Vormund fühlen. US-Firmen gehörten die größten Plantagen, Batistas Sturz hätte ihr Eigentum gefährdet. Doch dem Diktator reichte das nicht.
Nun flossen außerdem eine Menge Dollars freiwillig ins Land. Amerikanische Feriengäste brachten sie mit, und diesen Zustrom wünschte Batista zu steigern. Cuba war ohnehin schon zum Traumreiseziel wohlhabender US-Bürger geworden: Junge Ehepaare verbrachten hier ihre Flitterwochen. Millionärswitwen und reiche Nichtstuer promenierten am Strand. Zwischen den Palmen Habanas schossen moderne Hotelbauten empor. Und während wenige hundert Meter entfernt in der Avenida Theodore Roosevelt Rebellionsverdächtige gefoltert und zu zehn oder zwanzig Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurden, tanzten die nordamerikanischen Urlauber auf den Hotelterrassen Mambo.
In jenen Tagen war Cuba Schauplatz bestialischer Grausamkeit. In Santiago, der zweitgrößten Stadt, ließ der Polizeichef einer Rebellin beide Augäpfel ihres Bruders auf einem Tablett überbringen, um ihren Widerstand zu brechen. Erschossene Staatsfeinde blieben zur allgemeinen Warnung tagelang auf den Straßen liegen. In Habana zwang man Gefangene, mit anzusehen, wie ihre Frauen von Polizisten vergewaltigt wurden. Batista ließ seinen Gegnern die Fingernägel ausreißen und ihre Füße in Säure baden. - Obschon das in ihren Zeitungen stand, nahmen die Amerikaner von alldem kaum Notiz. Nur wenn ihnen aus den Musikautomaten der Cha-Cha-Cha "Fidelito" entgegenhämmerte, der Fidel Castro als Räuberhauptmann besang, rann den Touristen ein angenehmer Schauer über den Rücken.
Um nun Wohlbefinden und Spenderlaune der Yankees noch zu heben, rief Batista im Herbst 1957 die US-Unterwelt zu Hilfe. Für sein Projekt, aus Habana die größte Spielhölle der westlichen Halbkugel zu machen, gewann der Diktator - indem er ihm zehnjährige Steuerfreiheit bot - einen Mann, den der amerikanische Senat kurz zuvor als "einen der sechs mächtigsten Gangster" bezeichnet hatte. Dieser Mann hieß Meyer-Lansky. Er gehörte seit Jahren der Mord-AG Anastasias an; genau wie sein Chef hatte er begonnen, mit seinen Murder-Incorporated-Gewinnen ins Spielhöllengeschäft einzusteigen. Als Meyer-Lansky erfuhr, dass Albert Anastasia hinterrücks versuchte, ihm den Job abzujagen und die Spielkasinokonzession für Hiltons neues 25-Millionen-Dollar-Hotel in Habana auf eigene Rechnung zu erwerben, wurde er böse. Die beiden alten Freunde stürzten sich mit solcher Wucht auf die eben erschlossene Goldgrube, dass einer dabei auf der Strecke blieb.
So rutschte Albert Anastasia, dem die Gerichte keinen einzigen seiner Morde hatten beweisen können, an jenem Novembertag mit acht hässlichen Löchern im Anzug vom chromblinkenden Frisierstuhl und verschied. Mir bestätigte die Geschichte nur, was ich seit langem schon erkannt hatte: Gangster haben keinen Lebensabend. Steve Baxter das zu erklären, war ich damals fest entschlossen.
"Es wird dir schon bei uns gefallen", sagte Steve. "Überhaupt, du irrst dich, wenn du uns für Gangster hältst. Wir sind eine kleine Privatarmee, und du hast es darin immerhin zum Primer-teniente gebracht. Du bist höher gestiegen als damals unter Göring."
"Ich scheiß' drauf", antwortete ich.
"Es ist hauptsächlich wegen der Gage", bemerkte er. "Pass auf, wenn's Geld gibt: Sie zahlen meist in Nicaragua-Währung, ein Cordoba hat hundert Centavos, und hundert Centavos sind vierzehn Cents. Der Wechselkurs steht eins zu sieben. Manchmal kommen sie auch mit mexikanischen Pesos, die lass dir nicht andrehen, sie sind bloß acht Cents wert. Halt dich am Zahltag nur immer an mich."
Unvermittelt stand Steve auf, wühlte in einer Truhe und warf mir Stiefel, Ölzeug und einen Südwester zu. "Wir machen heut Nacht 'ne kleine Seereise", sagte er. "Wird dir schon bei uns gefallen! Green Pope sorgt für Unterhaltung, Sohn."
Kein Trost für Anastasia
Eines ist sicher und heute allen Beteiligten klar: Hätten Mr. Bilton, Meyer-Lansky und Albert Anastasia gewusst, wie es weiterging auf Cuba, sie würden weder das Hotelhochhaus erbaut noch wegen einer Spielbankkonzession die Gesundheit riskiert haben. Ihre Lizenzgelder nützten nämlich dem Diktator wenig. Vergebens durchkämmten Regierungstruppen die Berge. Nachts, wenn Batistas Söldner schliefen, kam Fidel Castro mit seinen Gefährten in die Lehmhütten der Bauern, Tagelöhner und Landarbeiter, um ihnen das Kampfziel zu verkünden.
Von den sechs Millionen Menschen, die auf der Zuckerinsel lebten, war zu jener Zeit eine Million stets arbeitslos. Die Bauern hausten noch immer in Hütten, wie sie Columbus im Jahre 1492 auf Cuba gesehen hatte. Ein Drittel der Ernte gaben sie den Großgrundbesitzern ab, von denen sie das Land pachten mussten. Wer gegen Missstände protestierte, wurde ins Gefängnis geworfen, wo Batista im Laufe seiner letzten Amtszeit 20 000 Menschen ermorden ließ.
Immer neue Rebellen sickerten durch die Postenketten; aus allen Provinzen strömten sie in der Sierra Maestra zusammen. In die Befreiungsarmee aufgenommen wurde nur, wer ein Gewehr mitbrachte. Nach einem Jahr Partisanenkrieg konnten Castros Leute heimlich Steuern erheben und zuweilen auch im Ausland Waffen kaufen. Costaricas Präsident Figueres schickte eine zweimotorige Beechcraft voller Maschinenpistolen. Im Herbst 1958 wurde der Nordteil von Oriente befreit, kurz darauf weite Gebiete im Zentrum der Insel.
Zum Entsetzen der amerikanischen Militärberater kontrollierte das Batista-Heer bald nur noch Städte und Straßen. Ein Jahr nach Anastasias Ende, am 3. November 1958, ließ der Diktator Präsidentschaftswahlen abhalten, womit er den Eindruck erwecken wollte, er ziehe sich von der Macht zurück. Doch für solche Tricks war es zu spät. Schon rückte die Befreiungsarmee unaufhaltsam auf Habana vor. Mit seiner engsten Clique floh Batista vor ihr am Neujahrstag 1959 in die Dominikanische Republik des Nachbardiktators Trujillo. Er ließ eine Militärjunta zurück, die ihm den Sessel warmhalten und nach Möglichkeit seine Politik weiterführen sollte.
Fidel Castro erklärte daraufhin, er werde keine Regierung anerkennen, die nicht aus den Reihen des bewaffneten Volkes hervorgehe. In den ersten Januartagen fegte ein Generalstreik in Habana die Junta hinweg. Auf den Armen der Menge wurde Castro in die Hauptstadt getragen. Zu den ersten Maßnahmen der revolutionären Macht gehörte die Ausweisung der US-Militärmission. Alle Sonderrechte der Amerikaner wurden aufgehoben. Die Hotels und Spielhöllen sahen sich ruiniert. Auch Meyer-Lansky packte die Koffer... Aber das ist ein schlechter Trost für Anastasia und auch ein anderes Kapitel.
Sternschnuppe aus Überplanbeständen
In der Abenddämmerung stapften wir zur Bucht, ließen uns am Eisengerüst hinab und kletterten an Bord. Der Dieselmotor puckerte schon, das ganze Schiff vibrierte. Es war, wie ich von Steve erfuhr, einst ein Schnellboot der amerikanischen Kriegsmarine gewesen, die Gesellschaft hatte es beim Verkauf überschüssigen Kriegsmaterials billig erstanden. Aus unerfindlichen Gründen hatte das US-Militäramt zwar die Torpedorohre abmontiert, das Fla-MG im Heck jedoch dem Käufer belassen. Es konnte Halbzollgeschosse verfeuern, und wie wir später sahen, standen im Zwischendeck genügend Munitionskästen herum. Die Kugelspritze steckte in einer Segeltuchhülle. Mich beschlich ein Grauen, als ich sie berührte.
Kaum standen wir auf den Planken, da legte das Boot schon ab. Es umrundete die flache Dolchspitze und nahm Kurs Nordwest. Wir lehnten an der Reling - mehr als Taue waren es nicht - und spuckten unseren Kaugummi in die brodelnde Hecksee. Achteraus versank Isla de Puñal im Meer. Was taten Dr. Guerra und seine Tochter jetzt? Sie mussten glauben, ich hätte sie verraten. Noch reckte am Horizont das Mangrovendickicht seine Wurzelarme über die Wellen, noch glühte der Felsen im Abendrot. Dann fiel die Dunkelheit ein, und wir sahen nur noch ein grünes flackerndes Licht.
Ich bin kein Seemann, das Schiff fuhr für meine Begriffe sehr schnell. Trotz ruhiger See war es unmöglich, auf Backbord oder Steuerbord oder gar auf dem Vorderdeck zu stehen, ohne von Spritzern überschüttet zu werden. Nur Comandante und Kapitän auf der Brücke und wir hinterm MG hatten leidlich trockene Plätze. Das Boot hieß "Estrella fugaz", "Sternschnuppe", ein schöner Name. Doch Steve Baxter mäkelte, die Sternschnuppe sei lahm. Unter amerikanischer Flagge hätte sie siebenundvierzig Knoten gemacht, während sie heute kaum mehr die Hälfte liefe, und dies, weil die Motoren nicht gepflegt würden und ausgeleiert seien. Achtzehn Stunden würden wir brauchen, ehe wir ans Ziel kämen.
"Feine Gegend dort?", fragte ich.
"Famos", antwortete er, "gibt da 'n flottes Bordell."
Mehr war von ihm nicht zu erfahren; wie gewöhnlich durfte ich mir allein den Kopf zerbrechen, wohin es ging, und mir ausmalen, was uns an dem fremden Gestade erwartete. Wohin wir fuhren, ließ sich vielleicht erraten. Sofern die "Estrella fugaz" Kurs und Geschwindigkeit beibehielt, mussten wir gegen Mittag des folgenden Tages die Ostküste der Halbinsel Yucatán sichten; doch sie konnte ebenso ihre Fahrtrichtung ändern und an Stelle Südmexikos Britisch-Honduras anlaufen. Ich hing in den Stricken, dachte über mein verpfuschtes Leben nach. Jetzt wurde es Nacht, man setzte ein weißes Hecklicht zu unseren Füßen, rote und grüne Seitenlampen, vorn am Mast flammte die Toplaterne auf. O ja, man achtete die Gesetze. Da das Schiff weniger als fünfzig Yards lang war, brauchte es nach der Seestraßenordnung nur ein Toplicht zu führen.
Die Finsternis in den Tropen kommt nicht nur schnell, sie ist auch undurchdringlich. Ohne den Widerschein der bunten Lampen hätten wir nicht mehr die Hand vor Augen gesehen. Hinter uns knarrte die Treppe, wir drehten uns um... "Buenos noches, Caballeros", sagte in unserem Rücken der Kapitän. Er hieß Molinero, ein stolzer, kleiner, verschlossener Mann. "Señor Comandante Tempestad", fuhr er fort, "lässt sich vielmals entschuldigen. Es ist ihm leider nicht möglich, sich mit Ihnen zu unterhalten. Er möchte persönlich auf die Riffe achten. Die Mosquito-Bank ist ein gefährliches Fahrwasser, und Ihre Sicherheit, Primer-teniente, liegt dem Comandante am Herzen. Wenn die beiden Herren ausruhen wollen - meine Kajüte steht ganz zu Ihrer Verfügung."
"Gracias", antwortete Steve.
Der Kapitän neigte ein wenig den Kopf, berührte den Schirm seiner Mütze und kehrte auf die Kommandobrücke zurück.
"Wieso", fragte ich leise, "liegt ihm meine Sicherheit so am Herzen?"
"Du bist ehemaliger Nazioffizier", flüsterte Steve zurück. "Das zieht hier gewaltig, und sie sind froh, dass sie dich haben... Vergiss aber nicht, wer dich dazu gemacht hat."
"Ich war immer nett zu meinen Leuten", antwortete ich.
Eine leichte Brise kam auf, sie fasste uns von rechts, die "Sternschnuppe" begann zu schlingern. Von Steuerbord her blies es Schaumfetzen herüber, die Planken wurden überspült, der Fahrtwind setzte uns zu, wir froren in unserem Ölzeug auch noch, als wir hinter die Aufbauten krochen. Jetzt gingen wir gern auf des Kapitäns nobles Angebot ein. Bevor ich unten auf dem Lederkissen der Koje einschlief, fragte ich ihn: "Was hat der Boss eigentlich mit diesem Doktor Guerra zu schaffen?"
"Seine Sache", antwortete Steve; ich hörte, wie er sich ausstreckte.
Ich sagte: "Wir haben ihn entführt."
"Das sieht nur so aus", brummelte er. "Dieser Guerra steckt seine Nase in alles..., das ist niemals gut, Don Antonio."
Und er fing an zu schnarchen.
Die Lucky Strike-Piraten
Es war finster. Die Bugwelle rauschte. Der Umriss des fremden Schiffes wuchs auf uns zu. Wir hörten seine Maschine stampfen und sahen Funkengarben aus den Schloten fliegen; gelbe Striche am Nachthimmel. Ich starrte auf die blasige Hecksee des Fremden - gleich würde es passieren! Jetzt glitt unsere Motorjacht mit silbern sprühender Gischt heran, kreuzte seinen Kurs, drosselte das Tempo und ging längsseits. Die Männer neben mir stülpten ihre Gesichtsmasken über, griffen zu den Maschinenpistolen, schleuderten die Enterleitern hoch. Dann hingen sie an der Bordwand des anderen, auch ich hing dort im Mondschatten, wir kletterten lautlos, zogen uns über die Reling... Die Bordwache döste wie immer, wir wurden schnell mit ihr fertig. Es fiel kein Schuss. Nur eine Tränengas-Handgranate verzischte in der Kapitänskajüte. Forrest, unser Boss, schaltete den Maschinentelegrafen auf "Stopp". Es wurde still. Unter uns gurgelte das Wasser. Wir tauchten in die Laderäume. Ich bekam eine Kiste mit Zigaretten zu fassen, stolperte, trat in Watte und stürzte, stürzte, stürzte.
Ich schreckte hoch, richtete mich auf - und schlug mit der Stirn gegen den Wellentunnel. Unmittelbar über meiner Koje verlief das Mantelrohr, in dem die Schraubenwelle rotierte. Natürlich, ich hatte geträumt; unser Schiff wiegte sich friedlich in den Fluten. Es war kurz nach Mitternacht. Die "Estrella fugaz" schlingerte leicht. Wir hatten niemanden überfallen; ich streckte mich wieder aus, suchte die Sache zu vergessen. Das waren Hirngespinste, mich peinigte wohl das schlechte Gewissen.
Schon schlossen sich meine Augen, schon dämmerte ich in Halbschlaf hinüber, da bekam ich, wie man das Ende eines abspulenden Taues erwischt, den Faden der Geschichte eben noch zu fassen. Mir fiel der ganze Vorfall ein. Jene Affäre nämlich, nach der ich fünfzehn Stunden lang mein Gedächtnis durchforscht hatte. Denn seit ich am Vormittag in der Südwestbucht das Motorboot entdeckt hatte, wusste ich, es gab da etwas, auf das ich mich nur besinnen musste. Eine Kette gerichtsnotorischer Verbrechen, ein Vorgang, über den die Presse berichtet hatte und der mir jetzt helfen würde, das Rätsel des Grünen Papsts zu lösen. Mein Erinnerungsvermögen hatte versagt - bis zu dieser Minute! Der Traum erst förderte die Geschichte zutage.
Sie hatte drei Jahre zuvor im westlichen Mittelmeer begonnen. Damals, in einer schwülen Sommernacht des Jahres 1951, kaperte ein wendiges Piratenschnellboot die "Riff Rock", ein Schiff des italienischen Kaufmanns und Schmugglers Alfredo Verano. Maskierte Seeräuber enterten den Dampfer, raubten ihn aus und gaben ihn dann der schreckensstarren Besatzung zurück. Kaum hatten sie ihre Beute auf der längsseits schaukelnden Jacht "Esme" verstaut, da machten sie die Leinen los, wirbelten herum und rauschten in wilder Fahrt davon.
Derartige Überfälle wiederholten sich in bestimmten Abständen Stets tauchte die "Esme" dort auf, wo kein Kapitän sie vermutete. Ihr Aktionsfeld lag zwischen Korsika, Palermo, Tunis, den Balearen und Casablanca. Frachter, die mit Maschinengewehren bestückt waren, wurden von den Gangstern gemieden. Jahrelang blieb ihr Treiben der Obrigkeit verborgen: sie plünderten nur Schiffe, deren Besitzer selbst Grund hatten, jeder Berührung mit der Polizei auszuweichen. Kein Reeder erstattete Anzeige. Die beraubten Dampfer waren ausnahmslos Schmuggelschiffe, die vom internationalen Freihafen Tanger Zigaretten nach Frankreich oder Italien bringen sollten.
Da auch ich einmal im Zigarettenhandel tätig war, hatte ich die Entwicklung des Falles in den Tageszeitungen verfolgt. Seit mir Steve damals in Augsburg die "Lucky Strike"-, "Philipp Morris"- und "Camel"-Stäbchen so preisgünstig beschafft hatte, dass ich zuweilen befürchten musste, er habe sie gestohlen, ist mir genau bekannt, was man an unverzollten Zigaretten - nicht nur in Notzeiten - verdienen kann. Veröffentlichungen über die Manipulationen weltweiter Schieberringe habe ich immer mit solchem Interesse studiert, als wäre ich selbst noch im Geschäft. Heute noch kaufen Tangers Schmuggelkönige, wie ich aus den Gerichtsprotokollen weiß, die amerikanische Zwanzigerpackung für vierzig bis siebzig französische Francs auf, was achtundvierzig bis vierundachtzig Pfennig entspricht. Der Preis für verzollte Schachteln liegt in Frankreich bei hundertneunzig Francs - zwei Mark achtundzwanzig also; und man muss zugeben, dass dieses Preisgefälle ein gewisses Risiko rechtfertigt.
Elliot Forrest jedoch, der junge amerikanische Piratenchef, konnte nicht auf die Schmuggeltour reisen. Da ihm das nötige Anfangskapital fehlte, um ein eigenes Geschäft zu gründen, beschloss der pfiffige New Yorker, den schon bestehenden Zigarettenhandel anzuzapfen. Er bediente sich hierbei eines Tricks, der von malaiischen Seeräubern, deutschen Ringvereinen, französischen Zuhältern, den nordamerikanischen Rackets und englischen Gangstern, die mit derartigen Erpressungen besonders die Buchmacher der britischen Insel plagen, seit eh und je erfolgreich angewendet wird: er bot den Kaufleuten Tangers gegen Gewinnbeteiligung seinen bewaffneten "Schutz" vor der Konkurrenz an.
Nachdem die Schmugglerkönige diesen Vorschlag indigniert zurückgewiesen hatten, mobilisierte Forrest seine Piratenschar. Er kaperte die Schiffe seiner künftigen Geschäftspartner und brachte ihnen bei, was es hieß, seine Ratschläge zu missachten. Binnen eines Jahres erlangte er so die Kontrolle über den gesamten von Tanger aus betriebenen Zigarettenschmuggel. Der "Esme"-Bande brachte ihre Sammlertätigkeit auf hoher See märchenhaften Reichtum ein. Denn Elliot Forrest hatte den Absatz nicht vergessen: er verband sich mit dem Marseiller Bandenchef Antoine Paolini, der die Ware in Frankreich an den Mann brachte. Was Steve und ich 1946 im Kleinen getan hatten, das spielte sich zwischen Forrest und Paolini nun im Großen ab. Hinzu kamen die "Schutzgelder", welche die bekehrte tangersche Kaufmannschaft zähneknirschend zahlte; alles in allem ein Arrangement, vor dem selbst ein Al Capone den Hut gezogen hätte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: