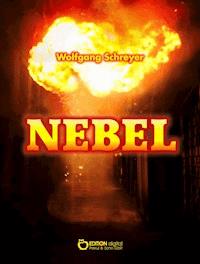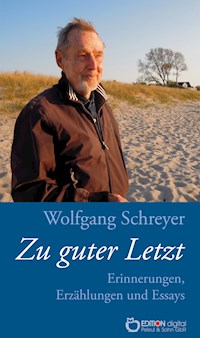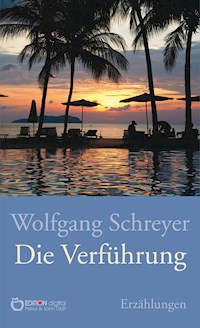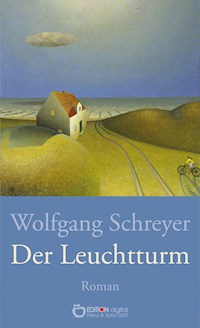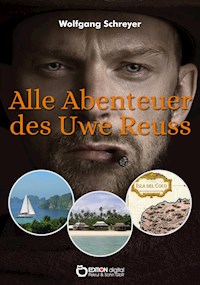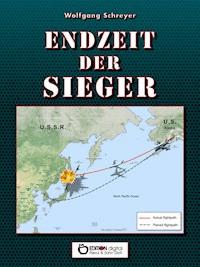
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Am 20. September 1946 druckt eine New-Yorker Zeitschrift Albert Einsteins Satz: »Während wir Russlands Geheimnissen und die Russen unseren Geheimnissen misstrauen, gehen wir zusammen dem Untergang entgegen.« Am 1. September 1983 schießt Major Wassilij Kasmin nachts über der Insel Sachalin einen Jumbo der südkoreanischen Fluglinie KAL ab. Die sowjetische Luftabwehr glaubt, ein amerikanisches Spionageflugzeug dringe bei ihr ein, doch Unbeteiligte finden den Tod. Vorgriff auf die Katastrophe eines Krieges aus Versehen? Ein doppeltes Rätsel zumindest: Irrtum der einen und mysteriöser Irrflug der anderen Seite! Wolfgang Schreyer spürt den Ursachen nach, er schildert auch Folgen, sieht die Schockwirkung des Falls auf Menschen in Kalifornien und anderswo. Dazu hat er die Schauplätze des Romans besucht; man schmeckt das Fluidum von Los Angeles, San Francisco und Las Vegas, die Luft von Florida oder New York, hört das Knistern im Cockpit einer Boeing 747 nahe dem Polarkreis. Wie ein Film rollt die Handlung ab, dramatisch, grandios, bis zum bitteren Ende. Dem Autor geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern um Erkenntnis: um Einsicht in Psycho-Mechanismen, Denkweisen und jene harten Fakten, die es uns erschweren, eine Welt ohne Kernwaffen, ja dermaleinst ohne Militär zu schaffen. »Unter dem Zwang, Gewinn zu machen«, sagt US-Präsident Eisenhower 1959 voraus, »werden mächtige Lobbys auftreten und immer größere Rüstungsausgaben fordern; das Netz der Sonderinteressen wächst von Tag zu Tag.« Der Roman zeigt auch das. Ein Konzern der US-Rüstungsindustrie ringt ums Überleben. Schreyer führt den Titanenkampf vor, den Griff nach der Macht und das menschliche Streben nach Glück, Geld, Liebe, Karriere - in der Verkettung von allem mit jedem. Der spannende Roman erschien erstmals 1989 im Mitteldeutschen Verlag Halle – Leipzig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 861
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Endzeit der Sieger
Roman
ISBN 978-3-86394-115-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1989 beim Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Für meinen Freund Hubert von Blücher, ohne den dieses Buch nicht entstanden wäre; es ist voller Ideen und Fragmente aus dem Speicher seines Lebens, zumal der Jahre in Nordamerika, das selbst zu bereisen er mich hilfreich angespornt hat.
W.S.
Das Thema der Kunst ist, dass die Welt aus den Fugen ist.
Bertolt Brecht
DER NACHTFLUG
Eine Philosophie, in der man zwischen den Seiten nicht die Tränen, das Heulen und Zähneklappern und das furchtbare Getöse des gegenseitigen Mordens hört, ist keine Philosophie.
Arthur Schopenhauer
I
De Luca spürte den Druck im Rücken, er sah die Lichter der Startbahn wegflitzen und den Wasserfilm am Außenglas des Fensters. Tröpfchen, vom Luftstrom in vibrierende Muster gepresst. Im Singen der Triebwerke versank Los Angeles International Airport hinter Güssen. Das Wasser schien dazu bestimmt, die Stadt von ihren Sünden reinzuwaschen oder sie noch vor Sonnenaufgang ins Meer zu spülen. Aber den Flugplan halten sie ein, dachte er auf seinem Fensterplatz in Reihe dreizehn. Vorbei die schönen Tage von Nevada, jetzt ging es wieder nach der Uhr.
Als das Flugzeug dem Unwetter entronnen war, machte De Luca es sich bequem. Der freie Nachbarsitz half ihm, die Beine zu platzieren. Fünf Minuten nach zwölf, keine glückliche Stunde, er flog lieber bei Tageslicht. Das hatte nichts mit dem Blick auf die Wolken, den Ozean oder das wenige Land zu tun, das man auf dieser Route zu sehen bekam. Nur war die Aussicht auf ein Gespräch nachts doch viel geringer. Fremde Menschen öffneten sich ihm sonst auf Reisen. Weil man einander gewiss nie wieder sah, teilten sie sich auch ohne Ermunterung mit. Er hörte bloß höflich zu, das genügte ihnen; und ihm half es manchmal, die Welt ein bisschen besser zu verstehen.
In diesem Jumbo aber würde er nur lesen und etwas trinken, dann leicht alkoholisiert dösen, wobei die Zeit ja auch verstrich. Selber hätte er den Flug – Korean Airlines 015 – nie gebucht. Zwar würde er, so hieß es in der Einladung, schon kurz nach sechs in Seoul sein und den ganzen Tag vor sich haben. Das klang vorteilhaft, tatsächlich jedoch war man, über sieben Zeitzonen hinweg, mit der Zwischenlandung in Alaska bis dahin vierzehn Stunden gereist, durch die künstlich verlängerte Nacht; die Abfertigungs- und Fahrtzeiten von und zu den Flughäfen gar nicht gerechnet. Da aber das Arrangement zum Vorzugspreis an diese Billiglinie gebunden war, hatte er keine Wahl gehabt. Die KAL flog dreimal wöchentlich, immer nachts.
Ringsum gähnende Müdigkeit auf allen Polstern. Im Mittelfeld Leute aus Fernost, Familien, die Kinder zugedeckt, fötal gekrümmt auf freien Plätzen. Die economy class hinter ihm auch voller Asiaten, zappelig wie zu Beginn einer Vorlesung daheim. In Berkeley hielten sie Disziplin, hingen an seinem Mund, schrieben meistens mit. Gewöhnlich eignete sich nur jeder achte Abiturient für eine Top-Universität, bei den asiatisch-amerikanischen Schülern aber fast jeder zweite. Sie waren halt wendiger und fleißiger als der Rest. Ihr Lernverhalten ähnelte dem der europäischen Juden, die von der Jahrhundertwende an nach Amerika geströmt waren – bis in die dreißiger Jahre, wie sein eigener Vater. Ganz klein fing man an, nähte, bügelte, reinigte: die Bekleidungsbranche als Sprungbrett. "Du musst in der Schule besser sein und bei der Arbeit geschickter", das hatte er zu Hause oft gehört.
Genauso die Asiaten. Sie stachen hervor, als Absolventen der High School drängten sie ins Physik-, Elektronik- oder Ingenieurfach und brachten die Statistik der Fakultäten durcheinander. Für ihn, De Luca, kein Problem, sein Fach war weniger gefragt. Es gab nur zwölf Prozent asiatischer Studenten an seinem Institut, exakt der Chinesenanteil der Bevölkerung San Franciscos. Aber die meisten Universitäten fühlten sich doch überschwemmt, bauten Hürden. Ihre Zulassungsbestimmungen waren sowieso auf weiße Bewerber zugeschnitten, und Kinder von Yale-, Havard- oder Princeton-Absolventen hatten stets bessere Chancen gehabt. Nur bei Hochbegabten spielte die Hautfarbe keine Rolle mehr.
Vorn, beiderseits der Kinoleinwand, erklärten zierliche Damen synchron zu einer Tonbandstimme den Gebrauch der Schwimmwesten, ein Lächeln aus Marzipan um die Lippen. Sie trugen den weiß-rot-grün-blauen Traditionsdress der Koreanerin. Nach dem Begrüßungsschluck schoben sie Servierwagen zwischen die Reihen und gaben Kopfhörer aus. Ein paar Fluggäste stellten die Lehnen hoch in Erwartung des Dinners, andere stöpselten die Hörer ein... De Luca stand auf, weder hungrig noch interessiert an dem Film "Kramer gegen Kramer", wahlweise in vier Sprachen zu hören. Eheleute im Streit um das Kind, geschieden, diese Art Filme nervte ihn. Er war, mit fünfunddreißig, unverheiratet und wollte sein Leben in der Hand behalten. Mit etwas Glück sich in Fachkreisen einen Namen machen. Trotz des Gefühls für Jill Lasky, eines ganz ernsthaften Gefühls, das sich gegen schwere Hemmungen in ihm entwickelt hatte. Es würde nicht gut gehen, nach jeder Erfahrung. Jill war lieb und reizend, sie sah zu ihm auf. Doch auch dies, so sagte er sich, brannte eines Tages herunter bei einer Frau von knapp fünfundzwanzig, aus derart selbstbewusstem Haus. Hatte es sie nicht geprägt, ein Elternhaus, das ihre Wahl deutlich missbilligte?
Sie war einfach zu reich. Dass sie seine Assistentin war und in der Arbeit aufging, ihre Familie nicht brauchte und schon gar nicht deren Geld – sie hatte eigenes –, machte es kaum besser. Vermutlich hatten ihre Leute die Macht, ihn aus Berkeley zu vertreiben. Während er nach vorn ging, vorbei an der Leinwand, fiel ihm der Brief Howard Laskys ein, Jills älterem Bruder. Zufällig hatte er den entdeckt, gestern in Las Vegas, als sie im Tropicana die Koffer packten. "Sandro de Luca", stand da sarkastisch, "zugegeben, das klingt! Dem Namen nach Italiener mit einem Schuss jüdischen und auch afrikanischen Blutes, das wirkt doch reichlich gemischt."
Vielleicht hatte Lasky junior mit seinem Naserümpfen sogar recht vom Standpunkt einer Familie, die seit drei Generationen im Lande saß und seit dem Zweiten Weltkrieg die Universität finanziell unterstützte. Womöglich war an dieser Bewertung wahrhaftig etwas dran, De Luca verschloss davor die Augen nicht. An manchen Tagen hatte er das Gefühl, ein lebender Widerspruch zu sein. Wie oft lenkten ihn Stimmungen, seinem analytischen Talent und jeder Logik zum Trotz. War er nicht aus einer Laune heraus mit Jill nach Las Vegas geflogen: Flucht in die Wüste, Hochzeitsreise ohne Eheschließung? Und ebenso intuitiv hatte er gebilligt, dass Jill ihn bis L. A. begleitete, obschon sie dadurch eine Vorlesung schmiss. Nach dem Abendessen wäre sie ihm in ihrer Begeisterung noch bis an den Flugschalter gefolgt, hätte nicht das Unwetter getobt... Abschiedsszenen in der Öffentlichkeit waren ihm zuwider, die überließ er gern dem Film.
Rotlicht an beiden Waschräumen der business class. Dort stand schon jemand, ein wuchtiger Herr, dessen Profil ihn an irgendwen erinnerte. Dezent gekleidet wie ein Bankier oder Beamter, in dunkles Tuch, zu kostbar, um zu knittern. Stirnglatze und Brille über solider Eleganz, jetzt glaubte De Luca, das Gesicht zu kennen, vom Fernsehen oder aus der Presse. Dann würde dies ein First-class-Passagier sein. "O weh", hörte er ihn da sagen, "das dauert."
"Kein Waschraum in der ersten Klasse?"
Der Mann wies mit dem Kinn auf die Wendeltreppe zum Oberdeck. "Den haben sie eingespart, wegen ihrer Bar, diese Brüder." In seiner Stimme lag Freundlichkeit, der Hauch von Schicksalsgemeinschaft über dem nachtschwarzen Meer.
"Man zahlt doch dort nicht für die Drinks?"
"Für die meisten schon, ihre so genannten Spitzenweine. Champagner ist gratis, Pol Pot heißt die Marke und schmeckt danach. Die Weine kann man auch vergessen, egal ob sie sich St. Emilion oder Château Talbot nennen."
"Mir genügt ein schlichter Rosé."
"Ja, da kann Ihnen nichts passieren."
"Falls man bei einer Flasche bleibt."
"Kein Jahrhundertwein verträgt das Geschüttel, und das wissen die genau; Schlitzohren sind sie."
"Sie mögen Koreaner nicht so sehr?"
"Ich hab überhaupt nichts gegen Asiaten. Es sind bloß zuviel davon an Bord."
"In Seoul trifft man vermutlich noch mehr."
"Ist zu befürchten. Sie meinen, ich will da hin?"
"Es soll immerhin das Flugziel sein."
"Also auch meines?", fragte der Erster-Klasse-Mann. "Ich kann ja in Anchorage umsteigen."
"Schon, nur würden Sie dann die Konferenz verpassen."
"Von welcher Konferenz reden Sie denn?"
"Von der des 'Asiatischen Forschungszentrums'."
"Wer sagt Ihnen, dass ich daran teilnehme?"
"Es steht in der Zeitung, Sir. Ich spreche doch mit Senator Jesse Helms?"
"Sind Sie von der Presse? Auch nach Seoul geladen?"
"Nicht als Journalist."
"Wen vertreten Sie, bitte?"
"Die Universität von Kalifornien, Senator. Das Institut für Konfliktforschung."
Helms verzog den Mund, als befremde ihn dies. Er sah geradezu unwirsch aus; vielleicht aber nur, weil der Pol Pot auf seine Blase drückte. Wie der schwere eiserne Vorhang eines Theaters senkte sich Schweigen auf sie herab. Ein mächtiger Mann, unter der dicken Haut des Südstaatlers empfindlich. In Washington, das wusste De Luca, stand der Senator ganz weit rechts. Gegner schlug er oft mit Bibelsprüchen nieder, daheim in North Carolina wie im Capitol. Sein Denken lief in der alten Spur des amerikanischen Geistes, wie zur Pionierzeit teilte sich ihm die Welt in Weiß und Schwarz, in wir und sie. Ein Holzschnitt, in dem das Gute gut und das Böse böse war und man leicht zwischen beiden unterscheiden konnte.
Helms fragte: "Leiten Sie das Institut?"
"Allenfalls ersatzweise. Der Direktor hat zwei Stellvertreter."
"So, aha... Und einer davon sind Sie?"
De Luca nickte, er sah dem Senator das Bemühen an, sich zu erinnern – ihn entweder den politischen Freunden oder seinen Widersachern zuzuordnen. Gewiss war etwas nach Washington gedrungen von der Linie, die er am Institut vertrat; doch solange er seinen Namen verschwieg, würde sich Helms nicht über ihn klar werden.
"Und wie verkraftet Berkeley den Ansturm Asiens? Besser als dieses Flugzeug?"
Für einen Moment war De Luca sprachlos. Ein ziemlicher Gedankensprung. Die Leute um Helms wünschten im Fernen Osten ein perfektes Militärbündnis gegen die Russen, wie passte dazu der Ansturm Asiens? – "Ach, es geht schon. Zwölf Prozent Chinesen bei mir, das tut doch keinem weh."
"Denken alle so in Kalifornien?"
"Nein. Mancher Rektor blockt ab, mit Quoten."
"Und das gefällt Ihnen nicht."
"Es ist ebenso ungerecht wie dumm, auf lange Sicht."
"Wissen Sie was? Die Gelben sollten mehr Sport treiben."
"Mehr Sport, Senator?"
"Eben. Wer da etwas zeigt, dem öffnen sich die Tore jeder Universität. Champions sind überall willkommen, nicht wahr? Geben Sie denen doch mal das Rezept."
De Luca begriff, er hatte sich wider Willen als Gegner des Senators enttarnt. "Sport ist kaum deren Stärke, Sir."
"Man muss trainieren; ohne Fleiß kein Preis."
"Aber der Körperbau. Die sind ja leicht und klein, kaum athletisch, mehr geistig begabt. Und das nützt ihnen bei der Aufnahme wenig."
Helms fasste ihn ins Auge, als gewahre er erst jetzt De Lucas krauses Haar und die braune Haut – wohl infolge der Beleuchtung. "Ich bin kein Rassist", bemerkte er nach einem Atemzug, wie um eine lästige Konversation zu beenden.
"Danke, Senator. Es freut mich, dass Sie das sagen."
"Ich sage Ihnen noch mehr. Ein gelber Mitbürger, der hier seinen Weg macht, ist mir lieber als jene Schwarzen, die in unseren Städten herumlungern, um zu betteln."
"Ist das einzig ihre Schuld?"
"Nein. Ich gebe zu, deren Vorfahren wurden aus Afrika verschleppt. Nur, seit gut hundert Jahren sind sie frei, und wie haben sie die Zeit genutzt? Ein Vietnamese, der auch aus dem Dreck kommt, fasst in hundert Wochen bei uns Fuß."
De Luca spürte, es stieg gallig in ihm hoch. Doch bevor er antworten konnte, klappte die Tür, das Licht wurde grün und Helms verschwand im WC. Jähes Ende einer absurden Unterhaltung. Zurück blieb der Eindruck von Schlagkraft und Streitlust dieses führenden Parlamentariers. Ein starker Mann und gefährlicher Feind in Seoul! Hätte Helms geahnt, was er, De Luca, dort äußern würde, er hätte kaum das Wort an ihn gerichtet. Mehr noch, er würde versucht haben, ihn von der Konferenz fernzuhalten. Die Seilschaft des Senators hätte De Lucas Teilnahme zu verhindern gewusst. Es hätte genügt, ihn zur selben Zeit nach Washington zu zitieren... Aber – so sagte er sich – ein Historiker sollte nicht spekulieren, sondern nur das prüfen, was tatsächlich geschehen war.
Nach der halben Flasche Wein dämmerte De Luca vor sich hin. War nichts Besseres zu tun, gehörte es zu seiner Reisetechnik, zu entschweben, durch das Haus seiner Jugend zu streifen und bei den Lichtpunkten zu verweilen. Er schloss die Augen und sah sich auf dem illuminierten Wohnschiff am Kai von Sausalito im Bannkreis eines Mädchens, das ihn sofort verhext hatte. Lange Zeit war sie für ihn der Gipfel strahlender Weiblichkeit gewesen, lockend und unzugänglich. Er hatte sich endlos mit ihr beschäftigt, sie niemals ganz vergessen.
Damals, im dritten Semester, war er bitter arm gewesen, abhängig vom Zufall und dem Erbarmen einer kirchlichen Stiftung, die mittellosen Studenten unter die Arme griff. Sein Vater nämlich, ein dünner Mann mit dem argwöhnischen Blick eines gescheiterten Ladenpächters, schlug sich als Reiseführer italienischer Touristen durch. Trotz der Trinkgelder, bis zu vier Dollar pro Person in der Woche, brachte er nie die achttausend Dollar Studiengebühr für Berkeley zusammen. Gelegenheitsjobs hielten De Luca über Wasser.
Es geschah zu Beginn der Party, als er Drinks servierte, auf einer der schwimmenden Villen des Künstlerstädtchens am Golden Gate. Jemand gab Vietnam-Heimkehrern der Universität Stanford ein Dinner. Und im Musiksalon sah er jene Schönheit – groß, dominierend, atemberaubend, von jungen Männern umringt, die ihr applaudierten. Ihr straff hochgekämmtes Haar ließ die Nackenlinie frei, sie hatte türkisfarbenen Stoff (sein ungeschultes Auge hielt ihn für Gaze oder Tüll) teils verschwenderisch, teils sparsam um sich drapiert und genoss die Blicke, die ihren halbentblößten Brüsten galten. Ein mexikanischer Goldschmuck hielt das Kleid zusammen. De Luca blieb geblendet stehen, unfähig, sich loszureißen. Ein bezauberndes Weib! Aufreizend leise führte sie das große Wort. Er hörte kaum hin, starrte weltvergessen, krank vor Bewunderung auf die glatte Haut einer Schulter, von der langsam das Trägerband glitt.
Ein Lachen nach dem anderen stieg von der Gruppe auf. Den Bourbon in der Hand, bogen sich die Veteranen vor Begeisterung. Sie hatten dem Land gedient, es hinter sich gebracht, dankbar tauchten sie wieder ein in den Zauber der Zivilisation. Nach einer Pointe blickte die Erzählerin im Kreis umher, war sie verstanden worden? Da entdeckte sie De Luca, sah ihn prüfend an. Ihm zog sich die Gurgel zusammen, er fühlte sich bei etwas ertappt, das ihm keineswegs zukam. Ein Wandel ging mit ihr vor, sie verschloss sich wie eine Blume, die bei Frost ihre Blütenblätter einrollt. Hatte sie an ihm das Tablett bemerkt? Ihre Augen verengten sich, und während ihr klar war, im Zentrum aller Aufmerksamkeit zu sein, schob sie geringschätzig das Trägerband hoch und wandte sich von ihm weg.
De Luca rutschten beinah die Gläser aus der Hand. Galt die Abfuhr seiner Hautfarbe oder dem Kellner, der es gewagt hatte, zu starren wie die anderen auch? Einerlei, es hinderte ihn nicht, sich nach ihr zu erkundigen. Sie hieß Tanja Cory und studierte in Stanford, dem teuersten Platz in Kalifornien. Ohne staatlichen Zuschuss erhielt sich Stanford durch die sagenhafte Gebühr von 17 000 Dollar pro Student und Jahr. Tanja war der Star dieser Party, jeder verzehrte sich nach ihr. Sie fuhr einen weißen Porsche; als weiteres Zeichen ihres Ranges lag ein Bündel Golfschläger darin. Ihre Eltern scheuten sichtlich keinen Aufwand, um sie zu verwöhnen.
Ein prägendes Erlebnis. Es bestimmte das Bild, das er von solchen Mädchen hatte. Da lag wohl der Ursprung seiner Hemmung gegenüber Jill... Tanja war nie aus seinem Kopf verschwunden. Den Klatschspalten nach hatte sie einen Filmschauspieler geheiratet, der voller Anekdoten steckte, jedoch kein ernsthaftes Gespräch führen konnte. Und kürzlich war De Luca ihr nach fünfzehn Jahren in Jills Umgebung wiederbegegnet. Tanja war seriös geworden, womöglich noch anziehender mit ihrem damenhaften Charme und dem vollen Mund. Der ließ ihn das Wort Niederlage denken, wenn sie die Lippen verzog – stets bereit, die schönen Zähne zu zeigen. Aus ihr war eine Karrierefrau geworden, ein As in Sachen Vertragsrecht. Angeblich beriet sie kleinere Firmen, die juristischen Beistand brauchten, ohne sich eigene Rechtsabteilungen zu leisten.
Seit einiger Zeit geschieden. Ihm fielen ein paar von den Sätzen ein, die ihrem Exmann entschlüpft waren, dem Leinwandhelden aus Frankreich. Hatte es der Schwachkopf doch fertig gebracht, Privatdinge auszubreiten, als bewegte sein Leben die ganze Nation. Nun, Tanja hatte das verdient. Da ihr das Äußere über alles ging, fiel sie auf einen Schönling herein. De Luca lernte sie unter ihrem alten Namen bei Jerome Lasky kennen, Jills anderem Bruder, einem Charmeur, der vorgab, Wirtschaftsjournalist zu sein. Tanja erinnerte sich nicht, wie denn auch, sie hatten ja nie miteinander gesprochen. Sie war mit Jerome liiert. Ein rauchiger Ton schwang in ihrer Stimme, manchmal zeigte ein Lächeln den harten Schmelz ihrer Zähne – wie damals.
Der Jet verließ seine Gipfelhöhe, De Luca spürte es in den Ohren. Matt säuselten die Triebwerke, schluckte man, wurden sie lauter. Halb fünf Uhr früh, 31. August, ein Mittwoch, der pechschwarz begann. Müsste nicht auf Nordwestkurs an Steuerbord schon eine Spur Morgenröte sein? Nein, halb drei erst war es nach der Alaska-Hawaii-Zeit; die einzige Gemeinsamkeit zwischen dem 49. und dem 50. Bundesstaat der USA.
Er stellte die Uhr um zwei Stunden zurück. Längst lief kein Film mehr, das Licht war gedämpft, die Kabine glich in ihrer Unordnung dem Zwischendeck eines Auswandererschiffs. Achtzig Minuten Aufenthalt in Anchorage, dem Ankerplatz von James Cook. Anno 1778 hatte der Weltumsegler dort verzweifelt nach dem Heimweg gesucht, der Nordwestpassage, 20 000 Pfund Sterling waren ihm vom Londoner Parlament dafür versprochen worden. Doch er fand nur Sackgassen wie Cook Inlet, den tiefen Einschnitt in Südalaska, an dessen Ende jetzt der Flugplatz lag. Zur Umkehr genötigt, war Cook auf Hawaii von Eingeborenen erschlagen worden; denen hatten seine Leute ein Boot geraubt... Für Konfliktforscher ein fesselnder Stoff.
Hinten im Touristenpferch stieg eine Stewardess über Beine, weit in den Gang gereckt. Ihre Zwitscherstimme weckte Menschen mit der Mahnung, sich anzuschnallen. Der Jumbo schien zu bremsen, fiel durch Luftlöcher, die Köpfe der Passagiere nickten simultan. Ein Quietschen, die Räder setzten auf, es war, als rumpele ein Bus über Bahngleise. Dann pfeifendes Rollen, Manövrieren zum Flugsteig.
Ringsum nervöse Erlösung. Gegen das Flehen des Personals drängte man vorzeitig zum Ausstieg, in immer gleicher Unvernunft. Mit einem Schwall von Asiaten spülte es De Luca durch den Gang, den der Airport ihnen rüsselhaft entgegenschob. Gutgekleidete Männer, vielleicht das Orchester der chinesischen Oper. Oder Mitglieder der Mun-Sekte, die weltweit zwei Millionen Jünger hatte? Ihr Oberhaupt, ein Mann der äußersten Rechten nutzte die Steuerfreiheit, die Amerika jedem Kirchenführer bot. Reverend Mun – so nannte er sich – steckte im Ginseng-Geschäft, mischte im Waffenhandel und in der Bauindustrie mit.
Auch hinter dem Asiatischen Forschungszentrum sollte Mun stehen. Gemeinsam mit dem Institut für politische Studien in Tokio lud das Forschungszentrum zu der Konferenz ein, die das fernöstliche Bündnis stärken sollte... Noch mehr Widersacher! De Luca glaubte sich plötzlich von Leuten umringt, die ihn in Seoul befehden würden, wenn er seine Thesen vortrug. Falls man ihn überhaupt reden ließ. Und dann? Alles war offen. Viel hing ab von seiner Taktik. Er wusste zwar, was er sagen wollte – aber nicht, wie. Noch fehlte ihm die passende Eröffnung. Da hoffte er auf Inspiration. Oft kam ihm der beste Einfall erst unterwegs.
II
Die endlosen Transithallen amerikanischer Flughäfen, selbst hier am Rande der Welt. Wie eine Geisterbahn erwacht zu neonfahlem Leben. Man wär verloren darin, dachte De Luca, hätten nicht die Fluggesellschaften sie in Scheiben zerlegt. Der Flugsteig N-3 führte in den Sektor der Korean Airlines. Und dort, über den Andenkenshops, zollfreien Läden, Wechselschaltern und Imbissbars, hob sich aus Schmusemusik – geeignet, einen zu besänftigen – manchmal eine Frauenstimme, die Namen nannte und Passagiere zur Abfertigung rief. Gewimmel in den Sitzreihen aus Plastik; Hunderte von Nachtwandlern füllten den Raum mit Handgepäck und Rastlosigkeit.
Anchorage Airport, Drehscheibe im Irgendwo zwischen den Kontinenten. Das chinesische Orchester oder die Truppe von Hochwürden Mun stieß zu dem Heer der Schlaf- und Mondsüchtigen. Angeblich hatte dieser Mun einst eine Christusvision gehabt, seitdem fühlte er sich berufen zum Messias. Sein Sprachrohr, die Washington Times, warb für den Zusammenschluss der alten Feinde Japan und Südkorea unter amerikanischer Führung. Ein Militärpakt gegen die Sowjetunion schwebte ihm vor. Denn seine religiöse Lehre gipfelte in heftigem Antikommunismus, beflügelt durch Größenwahn. "In der geistigen Welt gilt San Myun Mun als Sieger des Universums und Herr der Schöpfung", hieß es in einer Schrift der Sekte – eher komisch als bedrohlich, hätte der Machtanspruch sich auf die geistige Welt beschränkt, was auch immer das sein mochte.
Die Hände auf dem Rücken, ging De Luca umher, in Gedanken schon am Ziel. Wie seine Rede eröffnen, mit dem Mann in Las Vegas, der einen orientalisch roten Fes getragen und ihn belästigt hatte mit seinem Rededrang und der bizarren Idee, ähnlich dem Autoverleih von Hertz ein Geschäft zu gründen, das Waffen und Söldner an alle Welt auslieh? So dass künftige Kriege nicht mehr von schwach motivierten, flüchtig gedrillten Zivilisten ausgefochten würden, die stümperhaft und widerwillig ihre Heimat oder das Nachbarland verwüsteten, sondern von Vollprofis in der Sahara. Hochspezialisierte Söldner an modernsten Leihwaffen auf dem gemieteten Schlachtfeld!
Die unvermeidliche Anekdote. Ein witziger Anfang, der aufhorchen ließ, den Boden lockerte für die Saat. Den Mann im Fes und seinen Vorschlag gab es wirklich, doch das nahm ihm ja kein Mensch ab in Seoul. Hinter denen, die dort zusammenkamen, vermutete De Luca in erster Linie konservative Wirtschaftskreise der USA, Kanadas und von Fernost, gewiss auch aus Westeuropa, das Rüstungsgeschäft im Blick. Vertreter solcher Interessen würde die Story bloß verprellen. Er musste seriös sein, von A bis Z, glaubwürdig noch im Scherz. Und jene andere Gruppierung aus Japan, Südkorea und Taiwan erreichen, die ein Stück weiterdachte und nicht auf Rüstung setzte. Zwar lenkten diese Leute genauso gern Verteidigungsgelder auf ihre Konten; aber eher, um unter militärischem Vorwand eine Grundlagenforschung zu treiben, der dann, staatlich finanziert, neue Konsumgüter entsprossen... Diese Gruppe galt es anzusprechen, ihr wollte er Argumente liefern.
Das hatte er übrigens schon einmal versucht, auf der Konferenz in Los Angeles, und war gleich eingangs gescheitert durch einen dummen Fehler. Bereits seine ersten Sätze waren von den japanischen Managern missdeutet worden. In Los Angeles hatte er gesagt, Amerikas Betriebsleiter und Arbeiter könnten getrost etwas lernen von der Firmentreue und Disziplin fernöstlicher Arbeitnehmer, die bekanntlich zu Beginn jedes Werktags vereint ein fröhliches Lied sangen: Ausdruck sozialer Hygiene, des Leistungswillens und Friedens in der Gesellschaft, der Abwendung vom Klassenkampf. In seinen Augen ein Kompliment an die Adresse der japanischen Zuhörer. Die freilich hatten Hohn gewittert, sie glaubten sich bloßgestellt, standen wie ein Mann auf und verließen gekränkt den Saal! Peinlicher Abgang im Silentium.
Ein Eklat, er hatte abbrechen müssen; das durfte ihm nicht noch mal passieren. Wie aber, wenn er nun in Seoul freimütig von dem Vorfall sprach und klarstellte, was er eigentlich hatte sagen wollen? dass es nämlich entschieden besser sei für die Belegschaft, gemeinsam ein Morgenlied zu singen, als in Uniform, unter der Aufsicht kriegerisch gesinnter Offiziere, Soldatenlieder und patriotische Hymnen zu schmettern – was seltsamerweise in demokratischen, zivilisierten Ländern noch allgemein gebilligt werde. Obgleich es doch dazu diene, friedfertige Menschen auf militärischen Drill, Waffengebrauch und Völkermord einzustimmen. Das könne man weiß Gott von den Fabrikliedern nicht behaupten! Manch einer im Westen, der die komisch finde, sie arrogant belächele, habe gar nichts gegen nationalistische Marsch- und Hassgesänge, aus Gründen der Tradition. Heute aber sei zu fragen, von welchen Traditionen man Abschied nehmen müsse im Zeichen der Atombombe und des drohenden Weltuntergangs. Womit er schon beim Thema war. Ein hübscher Eröffnungszug. Glückte ihm der, kam auch das übrige an.
De Luca merkte auf, fiel da eben nicht sein Name im Lautsprecher? Einen Augenblick war er im Zweifel. In drei Sprachen hallte es über ihn weg, erst die Wiederholung verstand er: "Wir bitten Herrn De Luca vom Flug null-eins-fünf zum Informationsschalter der Korean Airlines." Wer wusste denn, dass er um diese Zeit hier sein würde? Am Stand hieß es, ein Gespräch für ihn aus Los Angeles. Er nahm den Hörer und hatte Jills Stimme im Ohr, über 2500 Meilen so klar, als wäre sie im selben Raum. – "Schläfst du noch immer nicht?", fragte er sie.
"Nicht mehr. Ich hab mich eben wecken lassen, um das Frühflugzeug zu erwischen. Damit die Vorlesung nicht ausfällt."
Ihm zuliebe! Sie flirtete nie, doch auch am Telefon hatte ihre Stimme etwas, das ihn sexuell ansprach. "Jill, du willst mir doch was sagen?"
"Sicher. Du, ich liebe dich."
"Ich dich auch. Ist das alles?"
"Ist das nicht genug?"
Er stellte sich ihr Gesicht vor, fein, blütenzart, so war es ihm schon vor Jahren in Berkeley aufgefallen. Sie war dunkelblond, einen Kopf kleiner als er und hatte manchmal die braunen, hoffnungslosen Augen eines italienischen Waisenkinds (oder eines polnischen, das lag bei ihr näher). "Du hast wirklich nichts weiter auf dem Herzen?"
"Nein. Ich fliege gleich nach San Francisco, ohne dich."
"Regnet es noch bei dir?"
"Nein, warum fragst du?"
"Dann wird es ein netter Flug. Knapp eine Stunde über dem Meer und den rotgrauen Bergen."
"Es wird mir keinen Spaß machen. Ich werde den oder die, wer immer da zufällig neben mir sitzt, gehörig hassen, weil du es nicht bist. Ich hatte mir so gewünscht, das Semester gemeinsam mit dir zu beginnen. Und nun bist du weit weg, zu einer albernen Tagung."
"So unnütz ist sie gar nicht. Ich halte die Fahne von Berkeley hoch."
"Vor zweitrangigen, belanglosen Narren!"
"Die sind weder zweitrangig noch harmlos."
"Eben, das kommt noch hinzu. Sei vorsichtig, hörst du?"
"Aber ja. Danach sehe ich mir nur noch ein Archiv an."
"Sandro, wenn's irgend geht, kürz es doch ab!"
"Das will ich gern versuchen."
"Du bist also nicht erst in einer Woche zurück?"
"Vielleicht schon in vier Tagen, Jill."
Er hörte sie aufatmen und beschloss das Gespräch mit zärtlichen Worten. Ihre Besorgnis rührte und ärgerte ihn. Nie mehr würde er in seinen Schritten so frei wie vorher sein. Dafür nun der Gewinn an Intensität und Lebendigkeit. Sein starkes Gefühl überstrahlte die Schatten der Partnerschaft; ein Amtssiegel darauf aber hätte es wohl erstickt.
De Luca fing an, die Umgebung wieder wahrzunehmen. Das Getümmel ringsum entstand dadurch, dass in dichter Folge weitere Jets einschwebten, Jumbos auf dem Weg nach Japan, Taiwan, Stockholm oder Paris; die Leuchtschrift dort zeigte es an. Sie gaben sich draußen ein Stelldichein, er sah es durch das Glas, Schwinge an Schwinge umdrängten sie den Terminal und spien Menschen aus. Zwischenstopp zum Auftanken und Wechsel der Crew, Pause vor dem zweiten großen Sprung. Auch war dies ein Knoten im Flugnetz des Staates Alaska. Vierzehn Inlandsrouten trafen sich hier, eine Wandkarte zeigte es.
In diesem Moment glaubte er Tanja Cory zu sehen. Wirklich, sie war es! Sie hat ihn eher entdeckt, vermutlich dank des Aufrufs, von ihrem Platz aus blickte sie in seine Richtung. Er winkte ihr zu, sie lächelte nicht zurück, sondern lud ihn mit einer knappen Geste zu sich ein. Sie nahm ihr Gepäck vom Nebenplatz, damit er sich setzen konnte... "Welch ein Zufall", sagte er.
"Ich bin genauso überrascht."
In dem vagen Gefühl, ihre Überraschung sei nicht echt, sah er sie aufmerksam an. Ein kaum geschminkter Mund, samtiger Hauch auf der Oberlippe, kunstvoll frisiertes Haar, Modeschmuck von Ciro; wenn sie die lange Zigarette hob, klirrten Armbänder. Sie rauchte, ohne zu inhalieren. Trotz ihrer lässigen Haltung wirkte sie sehr damenhaft – brünett, reserviert, eingeweiht. Das Flanellkostüm und die weißen Handschuhe schienen das zu unterstreichen. Den kalifornischen Akzent, ihm von damals noch im Ohr, hatte sie abgelegt und sich dem Sprachklang Neuenglands genähert. Ihre Figur war ideal, durch Diät getrimmt, zweifellos. Er war überzeugt, dass sie zweimal die Woche zur Hautpflege ging und Gymnastik trieb, um die Waffen blankzuhalten. Würde sie heute noch auf einer Party das große Wort führen? Schwerlich. Soviel Schick und Schliff... Doch er durchschaute das. Komödiantin! Gewechselt hatte bloß das Stück. Sie inszenierte ihren Aufstieg, nicht mehr nur die Unwiderstehlichkeit ihrer Person.
Tanja Cory war mit dem Flug KAL 007 aus New York gekommen. Ihr Jumbo hatte, auch im Regen, nach Ostküstenzeit kurz vor Mitternacht vom Kennedy-Airport abgehoben, war sieben Stunden unterwegs gewesen, ehe er hier niederging; zwanzig Minuten vor De Lucas Jet. Da saßen sie nun beide mit demselben Ziel, Seoul, in zwei Maschinen, deren Kurs sich schnitt. Von der Dreiviertelstunde gemeinsamen Aufenthalts war die Hälfte schon herum. Wozu Tanja nach Korea flog – sie behielt es für sich. Mühelos wich sie seinen Fragen aus, das machte ihr sogar Spaß.
"Stimmt es", fragte er, "Sie sind unter anderem auch für die Malcolm Aircraft tätig?"
"Wer hat Ihnen denn das erzählt?"
"Na, die Tochter des Präsidenten."
"Sie meinen Jill, Ihre Verlobte?"
"Verlobt? Ich hab noch nie wem die Ehe versprochen."
"Manche Leute behaupten das Gegenteil, Sandro."
"Manche Leute behaupten auch, die Erde wäre flach." Dass sie sich seinen Vornamen gemerkt hatte, berührte ihn angenehm, trotzdem gab es keinen Grund, ihr zu erklären, wie er zu Jill stand. Fing sie doch jeden Versuch, von ihr selber etwas zu erfahren, leicht amüsiert mit einer Gegenfrage auf. Mehr hören als sagen, eine der Regeln auf dem Weg nach oben. Dennoch saß De Luca gern bei ihr. Welch schöne Stimme, schwingend im unteren Bereich; etwa das, was Literaten verheißungsvoll nannten. Freilich nahm er auch Spuren von Hochmut wahr; wem bekam es schon, so begünstigt und begabt zu sein?
Während das Gespräch ihm dennoch die Zeit vertrieb, sah er sich wieder auf dem Wohnschiff ihr gegenüber: sein ehrliches Entflammtsein und ihre instinktsichere Abwendung. Zwar war der Abstand kleiner geworden, er hatte inzwischen aufgeholt, doch sie lag immer noch vorn und ließ es ihn fühlen. Falls ihr Umgang mit Jerome Lasky so eng war wie seiner mit Jill, waren sie beide Anhängsel der Familie; kein sympathischer Gedanke.
"Sehen Sie den Senator Helms?", hörte er sie da fragen. "Neben dem Kahlkopf mit der Hornbrille! Das ist Symms, sein Amtsbruder aus Idaho."
"Helms fliegt bei mir mit. Zufällig haben wir ein paar Worte gewechselt."
"Das würde ich auch gern einmal tun."
"Ist mir klar, Tanja. Ein charismatischer Mann."
"Sie wissen doch gar nicht, worum es mir geht."
"Na, bestimmt um ein Denkmal für knorrige Männlichkeit und Vaterlandsliebe."
"Machen Sie sich nur lustig, Sandro. Sie haben doch auch sehr ausgeprägte Überzeugungen."
"Nicht so feste wie er. Ich bin kein Kreuzfahrer, wissen Sie, weder für Gott noch für Marx."
"Jill Lasky ist da anderer Meinung."
"Hat sie Ihnen das gesagt?"
"Allerdings. Ihre Worte waren: 'Ohne ein Bild von der Welt und davon, wie sie eigentlich sein sollte, kann man gar nicht richtig leben'."
"Das ist nicht von mir. Sie macht sich manchmal eigene Gedanken." Er merkte, Tanja hörte ihm nicht zu, sie sah dem Senator nach. Der verschwand im VIP-Raum, dem Salon der Privilegierten.
"Sandro, darf ich Sie um einen Gefallen bitten?"
"Was immer es auch sei."
"Wenn Ihnen an Helms nichts liegt, hätten Sie wohl Lust, in meinen Jet zu steigen? Wir müssten nur die Bordkarten tauschen."
"Dazu sollten Sie wissen, ich sitze in Reihe dreizehn."
"Aberglauben kann ich mir nicht leisten. Sie kämen hinauf aufs Oberdeck: bequemer reisen und eher am Ziel."
"Wer säße da neben mir, ein schnarchender Greis?"
"Lawrence McDonald, Kongressmann aus Georgia."
"Ich hoffe doch, er hat Sie nicht belästigt?"
"Können wir mal ernsthaft reden?"
"Sie wollen mich also zu einem Südstaatler setzen."
"Ach Gott, das ist wohl eine Zumutung für Sie."
De Luca ließ sie ein bisschen zappeln, im Stillen schon bereit, ihr den Wunsch zu erfüllen. Obgleich Tanja es unterließ, die Tauschabsicht zu erläutern. Er vermutete ihr Motiv auf dem weiten, verschwiegenen Feld des Lobbyismus. Eine der Firmen, die sie beriet, erwartete offenbar von ihr, dass sie Kontakte zu Männern von Rang und Einfluss knüpfte... Durch das Glas schimmerte der Umriss ihres Jets, den roten Fantasievogel der Korean Airlines am Leitwerk. – "Geht in Ordnung, Tanja."
"Wie dankbar ich Ihnen bin." Zu ihrer Bordkarte reichte sie ihm eine gelbe Marke des Airports. Die hatte ihr ein Angestellter gegeben, damit sie vom Warteraum des Fluges 015 unbehindert zu den Passagieren der KAL 007 zurückkehren konnte.
Er sagte: "Es ist ein Genuss, Ihnen behilflich zu sein."
III
Um zehn vor vier betrat De Luca den Jumbo, die Stewardess strahlte ihn an, wie beschenkt durch sein Kommen. Nach einem Blick auf die Bordkarte bat sie ihn mit tänzerischer Anmut aufs Oberdeck. Dort war nur die Hälfte der Plätze belegt, breite cremefarbene Sessel mit viel Beinfreiheit und Fußstütze. Der Fenstersitz in Schlafposition, darauf lag wie ein gefällter Baum Lawrence Patton McDonald, ein schwerer Mann von Ende Vierzig, leicht schniefend, gepflegtes üppiges Haar, das Gesicht in den Polstern verkantet.
De Luca berücksichtigte sein Vorurteil. Er wusste, McDonald galt im Repräsentantenhaus als Eisenfaust, als fast so einflussreich wie Jesse Helms im Senat. Seine Freunde nannten ihn Larry. Kürzlich erst hatte er den Satz geprägt: Es geht darum, ob diese Zivilisation bereit ist, gegen die rote Pest zu kämpfen oder zerstört zu werden. Er stand der John Birch Society vor und hatte in Vietnam kleine Atomwaffen einsetzen wollen. Aber politische Absichten hatten mit persönlichen Umgangsformen wenig zu tun. Nicht jeder Recke war ein düsterer Charakter. Im Gegenteil, solche Leute konnten gewinnend und sogar amüsant sein. McDonald schlief so fest, als sei er gar nicht ausgestiegen. Das Vorrecht des Staatsmanns! Er musste nicht von Bord, wenn aufgetankt wurde. Man achtete seinen Schlaf wie seinen Beitrag zum Überleben der Zivilisation.
Jetzt, gegen vier Uhr Ortszeit, raste der Jumbo über die Startbahn und hob ab. Im Steigflug hielt er nordwärts auf das Hufeisen der Alaska Range zu, wo bei Tageslicht das Eis des Mount McKinley aus dem Dunst trat, mit 20 400 Fuß der höchste Gipfel Nordamerikas. Dies entnahm De Luca dem Prospekt der KAL, das er aus der Sesseltasche zog. Über den Wolken an Steuerbord ein Lichthauch, erste Blässe der Morgendämmerung. Doch ehe der Streif sich rosa färbte, glitt er schon weg. Das Flugzeug ging in die Kurve, schwenkte auf Kurs Westsüdwest und holte die Dunkelheit wieder ein. So hoch im Norden flog eine Boeing 747 schneller, als die Welt sich unter ihr drehte. Der Jet blieb im Erdschatten, Nacht genannt, die Zeit blieb stehen, ja sie lief zurück. Erst nach Stunden, wenn man den 180. Längengrad überflog, würde sie vorwärtsspringen. An der Datumsgrenze wurde der Mittwoch ruckartig zum Donnerstag; aus dem 31. August, der gerade anbrach, wurden die ersten Nachtstunden des 1. September! Man verlor einen Tag, kriegte ihn beim Rückflug freilich wieder... Das Heft erweckte den Anschein, dies sei der KAL zu danken.
Die Wunder des Luftverkehrs. De Luca blätterte um, belustigt vom Stil der Broschüre, ihrem Ton, der einem das Gefühl von Sicherheit und Perfektion gab. "Wie alle Direktflüge von New York nach Ostasien überqueren wir ganz Kanada bis hinauf zum Yukon-Territorium und nach Südalaska", las er. "Exakt die Route, die der berühmte Charles Lindbergh und seine Frau Anne wählten. Vor 52 Jahren brachen sie mit ihrem einmotorigen Wasserflugzeug auf, um einen Flugpfad nach Fernost zu suchen. Der konnte nur im Norden abkürzend um den Pazifik laufen, das zeigte dem Bezwinger des Atlantiks der Blick auf den Globus. Dies hatte schon der Weltumsegler Cook geahnt, dem das Abkürzen misslang. Was zur See an Fels und Eis scheitern musste, das glückte durch die Luft. Das bloß zweisitzige Wasserflugzeug der Lindberghs hatte Schwimmer, verwendbar auch als Kufen, es hüpfte von einem kanadischen See zum nächsten, schließlich von Insel zu Insel. So schlug sich das mutige Ehepaar auf seiner Nordwest-Passage bis nach Japan durch. Aus dem Hochdecker steigend, sagte es der Route eine große Zukunft voraus. Heute ist sie zur Tatsache, zur Gegenwart geworden; jeden Tag und jede Nacht."
De Luca drehte am Leselicht, sein Blick fiel auf die Streckenkarte. Ein Teil der historischen Route streifte den Rand der Sowjetunion. Das Wort Sibirien hatte die zwei Flugpioniere noch nicht erschreckt, ihre Hoffnung, Kontinente auf neuen Wegen zu verbinden, nicht trüben können. Und wirklich, als sie an einem Augustabend 1931 im Hafen von Petropawlowsk auf Kamtschatka wasserten, wurden sie vom Marinekommandanten, dem Ortssowjet und von der Bevölkerung so warm begrüßt wie zuvor auf heimatlichem Boden. Kaum machten sie fest, da sahen sie sich von Arbeitern umringt. "Die schwangen keine Vorschlaghämmer", hatte Anne Lindbergh notiert, im Hinblick auf ein Klischee der Presse jener Tage. "Sie drängten an den Kai, neugierig auf uns..."
Kaum denkbar heute, dies hatte sich zum schlechteren gewandelt, die Broschüre verschwieg es. Damals war Kamtschatka ein Stück Ödland gewesen, so weit entfernt von strategischer Bedeutung wie Alaska. Heute stand man sich an beiden Ufern der Beringsee nervös gegenüber, im atomaren Patt der zwei Giganten. Nirgends kamen sie einander so nahe wie dort. Der Preis des Fortschritts war zu hoch, wenn er diesen Aufmarsch einschloss.
Von New York bis Anchorage hatten die Lindberghs elf Tage und Nächte gebraucht. Die Boeing 747 schaffte das in sieben Stunden, kursgenau und ohne Pannen, wie sie die zwei Pioniere erdulden mussten. Dafür aber hatten die ein enormes Stück Natur unter sich gesehen – Wälder, Gebirge und Seen, Elchherden, Eskimos und Bären, die nach Lachs fischten. Den Reisenden im Jumbo war stattdessen das Melodram "Mann, Frau und Kind" gezeigt worden. Laut Programmheft entdeckte der Ehemann, von einer früheren Affäre her Vater eines Sohnes zu sein... Ein Gespinst aus Hollywood für die fliegende Isolierstation.
De Luca fragte die Stewardess: "Wo sind wir jetzt?"
Sie sah auf die Uhr. "Vierzig Minuten nach dem Start, also schon hinter Bethel, Sir! Haben Sie einen Wunsch, darf ich Ihnen etwas bringen?"
"Bethel, was ist das?"
"Der letzte Festlandspunkt auf unserem Weg. Ein Funkfeuer, wonach wir den Kurs korrigieren, wenn nötig... Es gibt gleich das Frühstück."
"Frühstück?"
"In New York geht's auf zehn, da hat man doch Appetit."
Sie merkt nichts, dachte er. Sie hält mich für einen Fluggast aus New York. Mit der Cockpit-Crew hat wohl das Kabinenpersonal in Anchorage gewechselt. "Wie weit liegt das Schwesterflugzeug zurück?"
"Gut hundert Meilen, Sir."
"So genau wissen Sie dies?"
"Es hat zwölf Minuten nach uns abgehoben, und wir fliegen fünfhundert Knoten – achteinhalb Meilen in der Minute."
"Sind aber zwanzig Minuten früher in Seoul?"
"Ja, nach dem Flugplan. Sehen Sie, uns hat man 'Romeo zwanzig' gegeben, die kürzeste der parallelen Routen überm Nordpazifik. Es sind im Ganzen fünf, wegen der Sicherheitsabstände. Der Flug null-eins-fünf verläuft etwas südlich, das verlängert die Strecke."
De Luca dankte für die Auskunft. Der Vorsprung nützte ihm nichts, er musste die Ankunft von 015 abwarten, mit dem sein Koffer kam. Doch es gefiel ihm, dass Tanja hinterdrein schwebte, im Abstand von zwölf Minuten, aus denen im Laufe der Nacht zwanzig wurden. Obwohl ihn das nicht hätte kümmern sollen. Frauen – nun ja! Das Rätsel der Ausstrahlung, ihrer geheimen Macht, sofern ihr Bild einem folgte. Für ihn war Sex, wie jede Art Verführung, weitgehend fauler Zauber. Unwägbares wie ein Duft, ein Schwingen der Stimmbänder, ein Lächeln oder ein Blick schienen Genuss zu versprechen, das Glück einer Partnerschaft. Das gaukelten die Sinne vor, es wurde selten wahr. Denn der Reiz einer Frau hatte mit ihrem Wert so wenig zu tun wie die Vortragskunst eines Dozenten mit dem Ernst seines Forschens, der Gültigkeit der Erkenntnis, die er verkaufte.
Er fand, Sex ist Erfolg und umgekehrt, die Fassade dessen, was wir sind oder tun. Wenn ein Text ihm geglückt erschien, wenn er im Hörsaal damit glänzte, argwöhnte er, das Hochgefühl, das in ihm aufstieg, sei dem Triumph einer Frau ähnlich, die Bewunderung erregt. Beides hieß ja bloß, zu wirken, aller Beifall galt der Außenseite, kaum je dem verborgenen Kern, dem Charakter oder einer Leistung, deren Wert oder Unwert sich erst später zeigte. Gewiss, dies hing zusammen. Tausend Fäden führten vom Kern zur Oberfläche und zurück. Ob wir reich oder arm, schön oder hässlich, mächtig oder machtlos waren, das formte uns auch innerlich. Nur Moralprediger konnten dies leugnen. Ehrgeiz war gut, nur sollte man davon nicht besessen sein. Er hatte Jill zugestimmt, als sie in Las Vegas deshalb mit ihm stritt. Ihr leuchtete nicht ein, weshalb er nach Seoul musste. Für sie beide war Erfolg kein Ziel, das jedes Opfer rechtfertigte.
Irgendwo war die Grenze. De Luca liebte sein Fach, hoffte immer auf den großen Wurf, und doch, das bedeutete ihm nicht alles. Sonst hätte er neben seinem Nachbarn in Respekt versinken müssen. Larry McDonald verkörperte ihn beispielhaft, den Erfolg, das Parfüm des Mannes: sein Aufstieg in den Streitkräfteausschuss, mit Ende Vierzig Liebling des Pentagon im Kongress, dessen Stütze in allen parlamentarischen Fragen der Landesverteidigung... So groß kam eine Tanja Cory nie heraus. Und seine eigene Karriere blieb im akademischen Umfeld vergleichsweise unbeachtet. Nie reichte der Glanz einer Buchveröffentlichung auch nur entfernt an den eines Politstars heran, hinter dem Gönner standen.
Neidete er ihnen den Triumph? Nicht ernsthaft. Aus der Einladung ging hervor, dass McDonalds Beitrag Republik Korea – Alliierter der freien Welt an vorderster Front hieß. Der waffenklirrende Titel sprach für sich. Die Politiker sonnten sich in dem Glauben, sie retteten das Land oder die Menschheit mitsamt den heiligsten Gütern. Eher aber war es nötig, die Welt vor ihnen zu retten – vor ihren Doktrinen, Ambitionen und dem, was sich daraus ergab. Das Thema der Konferenz lautete unverblümt: Nordpazifische Sicherheitsstrategie. Dieser Gegenstand würde die Köpfe beherrschen, zweieinhalb Tage lang im alten Stil, wenn niemand sich fand, der das Schema sprengte.
Eben das hatte er Jill erklären wollen; es war ihm missglückt. Sie räumte ein, jemand sollte dies versuchen, doch wieso gerade er? Der wissenschaftliche Wert der Tagung sei gleich Null, keine neue Erkenntnis stehe ins Haus, er reibe sich sinnlos auf, niemand werde auf ihn hören: Profit sei das stärkste Argument. Maßvoll hatte er entgegnet, Berkeley schicke einen Vertreter, wenn nicht ihn, dann Baldwin – ein weicher Mensch, mit dem habe die Konferenz den Segen des Instituts, was sie auch beschließe, das jedenfalls müsse er verhindern. Worauf sie ihm den Drang vorwarf, in die Öffentlichkeit zu gehen, sich für die Medien aufzubauen, ein Publikumsheld zu sein.
De Luca schloss die Augen, er dachte zurück an den Moment der ersten Berührung vor anderthalb Jahren; da war sie Studentin im letzten Semester gewesen. Sie saßen mit anderen am runden Tisch eines Lokals nahe North Waterfront, Jill zufällig neben ihm, still, blütenzart, in ihrem Jeansanzug, der mögliche Formen verbarg. Irgendetwas wurde gefeiert, er wusste nicht mehr, was. Seine Studenten luden ihn zu manchem Anlass ein. Im Wirrwarr der Gespräche, quer über den Tisch geführt, wandte er sich allmählich Jill zu, weil ihn das nicht zwang, die Stimme zu heben. Unter dem fragwürdigen Eindruck, sie sehe zu seinem gehäuften Wissen auf, sprach er bald nur noch für sie. Wegstrebend von Privatem, versicherte er ihr ernstlich, die deutsch-britische Flottenrivalität der Jahrhundertwende sei die klassische Vorform des heutigen Wettrüstens gewesen, ein Muster für die Vielfalt der Ursachen, die in der Neuzeit zum Kriege führten. Der beiderseitige Flottenbau habe, anstatt abzuschrecken, den Ausbruch des Ersten Weltkrieges gefördert. Das erste industriell beschwingte Wettrüsten in der Geschichte verdiene wegen seines Modellcharakters mehr Aufmerksamkeit.
De Luca war müde gewesen nach einem harten Tag, er hatte zur Entspannung Budweiser getrunken und sich kaum sehr klar geäußert über die Risiken des Großmachtstrebens. Jill aber lauschte ihm ganz verzaubert, bis ihm aufging, was er da zusammenschwatzte, bloß ihretwegen! Einzig durch stummes Zuhören entlockte sie ihm derart Dürftiges, dass er abrupt aufstand, mit einer knappen Entschuldigung. Sie erhob sich, um ihn durchzulassen, für einen Atemzug standen sie voreinander, und da geschah es ihm, dass er aus einer Laune, einem Reflex heraus die Hände seitlich an sie legte und sich mit dieser kumpelhaften Geste von ihr trennte.
Um Verständnis bittend. An einem Winterabend zu Beginn des Falklandkriegs. Über den Ghirardelli Square blies der Wind ein bisschen Schnee, der nicht liegen blieb, durch die Jefferson Street zum Maritime Museum San Franciscos, das in Gestalt eines Dampfers gebaut worden war; vielleicht hatte überhaupt erst der Schiffsrumpf ihn dazu gebracht, die Seerüstung zu streifen? Vor Ripley's Believe It or Not Museum, dem Haus der Kuriositäten, stand sein Wagen. Und es war wirklich kurios, kaum zu glauben, die kurze Berührung hatte ihn elektrisiert. Seine Hände hatten nicht mehr ertastet als Jills Oberarme, ein Griff, der ihn schmale Schultern ahnen ließ, einen eher knabenhaften Körper. Und doch sprang dabei ein Funke über, der unbemerkt zum Schwelbrand wurde.
Er hatte ehrlich versucht, den Abend zu vergessen. Die Magie ihres Blicks, das Lockende der langwimprigen, grünblauen Augen (es ging auf eine leichte Achsenverschiebung zurück). All das holte ihn erst ein, als Jill eines Tages schüchtern anfragte, ob er ihr Mentor sein wolle beim fälligen Schritt zum Master of Arts. Dabei ruhte ihr Blick glänzend auf ihm, asymmetrisch, mit einem Ausdruck flehender Beharrlichkeit, vertieft durch das mangelnde Ebenmaß der Augen. Verdutzt fand er den Entwurf ihrer Diplomarbeit betitelt: Der Anteil des deutsch-britischen Wettrüstens zur See 1898/1914 am Ausbruch des Weltkriegs I... Das, schwor er sich, würde ihm eine Lehre sein. Man streute keinem etwas hin, ohne zu riskieren, dass die Saat aufging.
So nahm die Sache ihren Lauf. Was den Schwelbrand entfachte, das trug sich in einem der hübschen Neuengland-Häuser seiner Studenten zu, nach der Feier am 4. Juli. Da hatte Jill mehr getrunken als er, sie tanzte mit einer Freundin "Hernandos Hide-a-way" und schmachtete die Gefährtin tragisch an. Ein Bärtchen auf die Oberlippe getuscht, parodierte sie das Lied der Leidenschaft mit starrer Miene, verruchten Gebärden und ausgreifenden Tangoschritten, düster wie das Schicksal selbst. De Luca war baff, soviel Spiellust und Fantasie! Jill trug ein langes, hochgeschlossenes, ärmelloses Batikkleid mit Stehbundkragen, frech geschlitzt, wie eine zweite Haut lag es ihr schillernd an.
Die Flamme züngelte hoch, als nun der Popstar Michael Jackson "Beat It" sang. Die zwei Mädchen ließen sich los, sie brauchten einander nicht mehr. Keinen Partner, nur noch die Musik gab es für Jill, den harten Discosound. Ihr ganzer Körper war ein Schwingen, bis ihr plötzlich einfiel, allein dem Rhythmus zu folgen, roboterhaft exakt. Der Wechsel vom gelösten Gleiten in den zuckenden Tanz war atemberaubend. Es schien De Luca, als stehe nicht nur Jill unter Strom, sondern auch er selbst. Ihm wurde klar, ganz hingerissen zu sein, heillos verliebt. Seit dieser Nacht waren sie ein Paar. Wobei der Gedanke ihn nie verließ, es könne bei ihrem Hintergrund unmöglich von Dauer sein.
Die Kluft war tief, Las Vegas hatte sie aufgedeckt. De Luca setzte dort keinen Dollar. Er lief bloß durch die wirre, verspiegelte Purpurpracht der Kasinos, um das preiswerte Essen zu finden, mit dem die Hotels nach Spielern fischten. Wo jeder am Spieltisch sein Glück versuchte, zumindest am Einarmigen Banditen, da genügte es ihm, mit Jill auf der Rutschbahn des Tropicana in den Pool zu sausen, unter den prasselnden Wasserfall zu schwimmen, abends über den flimmernden Strip zu strolchen oder im Tiffany Theatre das Getingel der Folies Bergere zu sehen.
Gar zu bescheiden und gesittet für Jill. Geiz hatte sie ihm vorgeworfen, die Fadheit eines Biedermanns, und sich ihm im Zimmer Nr. 1406 des Paradise Tower schließlich als "Hauptgewinn" präsentiert, gestiftet vom Haus für den bravsten Gast: in jenem Kleid, an dem sich acht Wochen zuvor sein Verlangen erst entzündet hatte. Darunter trug sie nichts... Von der Deutung des deutsch-britischen Wettrüstens zum Verzicht auf weibliche Rüstung. Die perfekte Überraschung. Das Beste an ihr, fand er, war die Bereitschaft, sich zu verwandeln. Jills Metamorphosen verwirrten ihn, wurden ein Teil seines Lebens, und neben Verwirrung brachten sie Antrieb, vitalen Reiz, die unwiderstehliche Lust, möglichst viel Zeit mit ihr zu verbringen. Manchmal fragte er sich, wie all das einmal enden werde, wer von ihnen wohl ging und den anderen verließ.
Sie? Nun, das wusste er nicht. Schwer vorstellbar aber, selber derjenige zu sein. Nein, das brachte er niemals fertig.
IV
Das Flugzeug der Pacific & Southwest Airways landete um acht Uhr fünfzehn in San Francisco, als die Sonne über den Diablo-Bergen stand, über der glitzernden Bucht. Jill Lasky bedauerte, nicht gleich auf dem Ostufer zu sein. Vom Metropolitan Oakland Airport wäre sie über den Nimitz Freeway im Nu heimgehuscht. Doch ihr Flitzer parkte beim North Terminal des San Francisco International Airport, weil dort der Flug nach Nevada begonnen hatte. Ihr Vortrag war erst um zehn, sie würde es schon noch schaffen.
Aber ihr Koffer tauchte nicht auf. Nervös starrte sie auf das Fließband, fremdes Gepäck glitt vorbei und rieb sich, sooft das Band in die Kurve ging, ohne ihren Koffer! Ähnlich wie bei der Ankunft in Las Vegas, da hatte Sandro erklärt: "Wenn du sicher sein willst, dass man einen Sprengkopf nie findet, dann checke ihn bei dieser Luftlinie ein." Geschah ihm etwas Unangenehmes, pflegte er zu sagen: "Das Crash-Management ist in Kraft; der Krisenstab beschließt..." Jill Lasky sah auf die Uhr – Sandros Uhr, zu groß für ihr Handgelenk –, ihr Krisenstab beschloss, nicht mehr auf den Koffer zu warten. Sie reklamierte ihn, hinterließ ihre Telefonnummer und lief zum Parkplatz. Ihr Vortrag steckte in der Reisetasche, die ihr von der Schulter hing, sie hatte das Manuskript nicht dem Koffer anvertraut.
Den Sportzweisitzer fand sie rasch. Das Stoffdach war feucht, auf dem Lack perlten Tropfen. Doch als sie den Zündschlüssel drehte, sprang der Motor nicht an. Ein paar Umdrehungen, dann war die Batterie leer. Sie musste Hilfe erbitten, das war ihr peinlich. Ein freundlicher Herr schob ihr Auto mit der Stoßstange seines eigenen vor sich her, bis der Motor kam. Jill Lasky ließ ihn aufheulen, sie bedankte sich. Der Herr schien von ihr angetan, er gab ihr auch noch seine Visitenkarte, falls sie mal wieder Hilfe brauche... In dem flüchtigen Gefühl, ihm schon begegnet zu sein, nahm sie die Karte, ohne einen Blick darauf zu werfen.
Das Blechgetümmel war vorbei, problemlos glitt sie in den Verkehr. Auf einen Knopfdruck hin summte das Verdeck zurück, Seewind griff ihr ins Haar. Der Freeway streifte die San Francisco Bay, Segel schwammen im Dunst. Wie üblich zog bleicher Sommernebel vom Ozean her, verhüllte die halbe Stadt, um sich erst über der Bucht aufzulösen. Unrast befiel Jill Lasky, Vorgeschmack des Lampenfiebers, das sie bei jedem Auftritt vor der Seminargruppe beschlich. Sandro dort keine Schande machen! Ein paar Studenten waren mit ihnen am Grand Canyon gewesen, würden Klatsch verbreitet haben. Ein lästiges Thema, der Falkland-Krieg, für gründliches Erörtern viel zu frisch. Die USA hatten Großbritannien wirksam unterstützt, auch mit Satellitenfotos von der argentinischen Flotte, doch dazu gab es nur Pressestimmen, keine Dokumente; die kamen erst später ans Licht. Gab es sowjetische Hilfe für Buenos Aires? Moskaus Archive öffnen sich in hundert Jahren oder nach der nächsten Revolution, hatte Sandro gesagt.
Das wollte sie ihrem Text noch anfügen. Er schüttelte so etwas aus dem Ärmel, sie aber hing von ihren Notizen ab. Am Kreisel beim Showplace Design Center nun ein Stau. Sie trommelte auf das Lenkrad, trieb den Motor im Leerlauf hoch aus Furcht, er könne wegsterben. Hinter ihr wurde gehupt, es ging weiter, in sanfter Krümmung stieg der Freeway auf Stelzen und wurde zum Skyway. Links fielen die City zurück mit ihren Türmen, rechts die Piers und Lagerhäuser, vorn stieß die Oakland Bay Bridge im Schwung der stahlblauen Träger durch den Dunst ins Gegenlicht.
Bei der Küstenwacht inmitten der Bucht, auf Yerba Buena Island, begriff Jill, das Manuskript war gar nicht in ihrer Reisetasche. Sie hatte es zuletzt noch Sandro gezeigt und nicht wieder eingepackt! Am Ostufer bog sie mechanisch nach links, ihr Kopf war wie mit Gas gefüllt, das Gesicht spannte, als sei die Haut aus Papier. Entweder war der Text im Koffer oder Sandro hatte ihn irrtümlich eingesteckt... Sie glitt in einen krankhaften Zustand von Übermüdung. Es fiel ihr schwer, den Weg über das Kleeblatt zur Shattuck Avenue zu nehmen, der geradlinig zum Campus führt. Alles war aus, sie würde mit Falkland einbrechen, sich jämmerlich blamieren.
Daran änderte auch nichts, dass von Sandro eine bunte Postkarte in ihrem Briefkasten lag, verblüffend und rührend, aus Nevada. Er hatte sie heimlich im Tropicana geschrieben, um ihr die Heimkehr zu versüßen. Las Vegas bei Nacht, schon so weit weg, ein Bild vom Lichtertanz der Hotelfassaden. Weiße Fontänen, die gelben Kuppeln des Westward Ho, die Neonpalmen vorm Oasis Casino. Es war ihr unmöglich, Sandros Gekritzel zu lesen, seine Ermunterung, nutzlos und liebevoll.
Den Tränen nahe, stülpte Jill ihre Tasche um, durchwühlte den Inhalt – kein Manuskript. Im Außenfach bloß das Kärtchen des Herrn vom Flughafen. Goldenes Hufeisen, stand da: Touristik, Besichtigungen, Reisebegleitung. Der Helfer hieß Maxwell, es war seine Geschäftskarte, er verteilte ständig, um für seinen Reisedienst zu werben. Ihre langen Finger, ohne jeden Schmuck, gruben in dem, was sich auf dem Schreibtisch stapelte. Da lugte unter einem Ordner die Zweitschrift hervor! Sie war gerettet. Sie hatte die Kopie noch in Sandros Wohnung geglaubt. Aber er hatte sie ihr beim Aufbruch mit ein paar Korrekturen zurückgereicht.
Erlöst stieß sie das Fenster auf, Harzgeruch drang herein, der Duft von Rosen und Koniferen, die milde Spätsommersonne. Das ansteigende Hochschulgelände mit den quellenden Platanen, Eukalypten, Pinien und Wacholderbüschen. Die Villen des Wohnviertels und der venezianisch strenge Glockenturm, der Kampanile mitten im Campus, dort schlug es gerade halb. Ihr Blick ging bergan, wo sich über dem Griechischen Theater (ein Geschenk des Zeitungskönigs Hearst) das Cyclotron, die Lawrence Hall of Science, das Silver Space Laboratory und weitere Stiftungen im Dickicht verbargen. Treppen und Serpentinen führten hinauf in die botanischen Gärten hoch über der Stadt, die den Namen des irischen Philosophen und Bischofs trug; passend zur grauen Gotik manches Lehrgebäudes und zum Neuenglandstil der Quartiere.
Sie atmete tief, auf das Fensterbrett gestützt. Der Krisenstab gab Entwarnung. Bischof Berkeley hatte recht, die Dinge waren bloß ihr trügerisches Abbild, alles fügte sich erst im Kopf zur vermeintlichen Realität. Dies war Jills Heimat seit sieben Jahren, noch nie hatte sie so stark gespürt, ganz bei sich selbst zu sein, im Zentrum ihres Lebens. Sandro, ihr Idol, war jetzt auch ihr Beschützer. Betrat er einen Raum, verblassten alle neben ihm. Nie würde sie ihre Entscheidung für ihn und die Welt von Berkeley bereuen.
Noch immer ein Hauch von Unruhe, ein Schleier von Schweiß auf der Haut, der Drang nach Reinigung. Jill Lasky ging ins Bad und zog sich aus. Ihr Mund glich einer platzenden Frucht, oft sog sie die Lippen leicht nach innen in dem unbewussten Wunsch, das Sinnliche zu drosseln. Blickte sie so in den Spiegel, fragte sie sich, was Sandro eigentlich an ihr fand. Sie war überzeugt, er könne jede Frau auf dem Campus haben.
Mit dem Badetuch rieb sie den Spiegel blank und nahm die Duschhaube ab. Wie immer kräuselte die feuchte Luft ihr Haar, machte es dem Sandros ähnlich. Ein Kopfschütteln und schon saß die Frisur. Das bisschen Fleisch unter der überperlten Haut, wie gut, dass es genug war, ihn zu reizen. Beim Abfrottieren hielt sie sich vor: Ich muss über den Dingen stehen, spielend damit fertig werden, mit meiner Schüchternheit, den Zweifeln und Ängsten. Nicht mehr in Panik geraten durch ein fehlendes Papier, keine Debatte fürchten, auch nicht mit Kontrahenten wie dem aufsässigen O'Brien, der nachher das Koreferat hielt. Die Forschung kam, wie Sandro fand, nur in ständiger Reibung der Geister voran; Harmonie war Stillstand.
Sandro De Luca. Unbegreiflich lange hatte er sie übersehen, viel Zeit ging so verloren. Wie hatte sie sich noch im Frühsommer nach ihm gesehnt! Seine Berührung damals am runden Tisch schien ein Versprechen zu sein. Benommen war sie umhergeirrt, hatte Bücher verlegt, Schlüssel verloren, Termine vergessen, manchmal falsche Vorlesungen besucht und angestrengt auf Texte gestarrt, während sein Gesicht sich beharrlich zwischen ihre Augen und die gleichgültigen Buchseiten schob. Bis er sie dann plötzlich als Frau entdeckte, dank des Tangos, einfach durch ihren Tanz! Und ohne viel Worte die Party mit ihr verließ; sie selbst schwieg schon aus Furcht, ihre Stimme könne verraten, wie ihr zumute war. An seiner Seite gab sie sich den Schauern der Erwartung hin. So bog man verschwörerhaft in die La Loma Avenue, bergan, auf dem Weg zu ihm.
Der folgende Morgen fand sie beide verwandelt. Hand in Hand gingen sie durch stille krumme Straßen hinauf zum Park über der Stadt. Sie hatten alle Scheu vor der Macht ihrer Gefühle verloren. Undenkbar, sich jemals zu belügen. Oft hatte Jill das Wort "vor Freude weinen" gehört und nie daran geglaubt. Aber beim Abschied hatte sie Tränen in den Augen, obwohl sie sich von da an nur noch für Stunden trennten und es als ausgemacht galt, dass es so gut wie für immer war.
Ja, für immer, denn auch körperlich kam er ihrem Wunschbild nahe. Zu große und schwere Männer flößten ihr Furcht ein. Kein Verrenken, wenn sie Sandro küsste, keine Angst, erdrückt zu werden. Ihn zu berühren war äußerst angenehm, sie mochte seine glatte braune Haut. Und wenn er anfing, sie zu streicheln, überlief es sie heiß. Erst wohlige Entspannung, dann die hypnotische Lust, nach der sie süchtig war; wie Morphium breitete sie sich in den Adern aus. Für den Rest ihres Lebens begehrte sie keinen anderen Mann. Bald würden sie heiraten und all ihre Zeit gemeinsam verbringen; außer wenn er auf Reisen war. Über dem nächtlichen Ozean.
Auf Reisen, um Leute zu bekehren, deren Beschränktheit aus ihren Schlagworten sprach, Slogans wie Nordpazifisches Sicherheitsdenken und Fenster der Verwundbarkeit. Das Odeur von Waffenöl und Scheiterhaufen. Unverbesserliche Narren... Seufzend griff Jill nach ihrem Jeansanzug. Zehn vor zehn, sie musste sich sputen, dort hinter der Moffitt-Bibliothek zu bestehen – im Namen der Konfliktforschung die Kämpfe austragen, von denen die Wissenschaft angeblich lebt. Der akademische Meinungsstreit war Spiegelfechterei. Wozu das, waren die Menschen nicht schon verschieden genug? Die wirklichen Unterschiede reichten doch aus.
Und während die Sonne hereinfloss und den Globus auf der Ecke des Schreibtischs schimmern ließ, drehte Jill den Nordpazifik zu sich hin, das Fenster der Verwundbarkeit. Ihr Finger glitt von den Aleuten zur Datumsgrenze und weiter zu den Kurilen. Über die Hälfte der Strecke Anchorage-Seoul lag hinter Sandro. Bei ihm dort südlich von Kamtschatka, auf dem 160. Längengrad, war es fünf Stunden früher als hier, ging also erst auf fünf. Er schob die Nacht vor sich her, ein Forscher und Mann von Wichtigkeit, der durch tiefe Finsternis das Licht seines Wissens trägt, zu den Unbelehrbaren, und Klarheit in die Menschheitsfragen bringt.
Wenn sein Flugzeug um Viertel nach sechs in Seoul landete und es hier längst Mittag war, Viertel nach eins, wurde es für ihn da drüben wieder hell. Erst wenn sein Anruf kam, würde sie beruhigt sein; ein dreifaches Läuten, das ihn nichts kostete. Wünschte er doch von ihr die Selbstbeherrschung, den Hörer gar nicht abzuheben.
V
"Bitte, Sir", lispelte es an De Lucas Ohr, "würden Sie so gut sein, wieder Ihren Platz einzunehmen?"
Schlaftrunken sah er auf. Das Mädchen trug ein rotblaues taeguk am Revers, koreanisches Sinnbild von Himmel und Erde in Gestalt einer Doppelsichel; die Chefstewardess offenbar.
"Darf ich Ihre Bordkarte sehen?"
Er fischte danach. Die Dame schien unfähig, ihre Stimme zu modulieren, so dass sie mehr plärrte als sprach. Unüberhörbar war ihr Drang, ihn zu vertreiben. Was ließ sie unter dem Lack der Höflichkeit derart gegen ihn wüten? Ach, er sah schon, wer sie ihm auf den Hals geschickt hatte. Der Fensterplatz war leer, Lawrence McDonald thronte an der Bar – dort, wo laut Jesse Helms der Waschraum des Oberdecks sein sollte. Ein kräftiger Mann, zur Fülle neigend. Eine Zigarette hing ihm von den Lippen und eins seiner Augen war des aufkräuselnden Rauchs wegen geschlossen wie bei einem Detektiv der schwarzen Serie Hollywoods. McDonald hatte über ihn hinwegsteigen müssen, sich geärgert und beschwert wie in Washington, wenn ihm jemand den Parkplatz wegnahm.
Die Stewardess – zäh in ihrer Bereitschaft, der Prominenz zu dienen – ließ ratlos von ihm ab, mit einer Geste der Resignation in Richtung Bar. "Tut mir leid", sagte der Abgeordnete über den Gang hinweg. "Ich nahm an, Sie hätten sich im Platz geirrt. Darf ich Sie zu einem Drink einladen?"
Guter Stil. Ein Staatsmann verschanzt sich nicht, er übernimmt die Verantwortung. De Luca trat an die Bar und stellte sich vor.
Auf McDonalds Gesicht lag amüsierte Wachsamkeit. "Sie wissen sicher, wer ich bin."
"Sollte ich das, Sir?"
"Beim Tausch der Bordkarten hat Frau Cory Ihnen das wohl kaum verheimlicht. Haben Sie auch mit der MAC zu tun?"
De Luca überlegte zwei Sekunden. MAC war das Kürzel für Malcolm Aircraft Corporation, die Firma der Laskys. "Ja, so könnte man es sehen."
"Und auf welchem Sektor arbeiten Sie?"
"In der Forschung..."
"Schön. Ich rede am liebsten mit Fachleuten. Man kommt schneller auf den Punkt."
"Was wäre hier der Punkt?"
"Bei Ihnen passiert zuviel. Keine Entwicklung ohne Pannen, das hab ich auch Frau Cory schon gesagt. Die hat Sie wohl ersucht, das Gespräch an ihrer Stelle fortzuführen."
"Ganz so war es nicht, Mr. McDonald."
"Ach, gehen Sie! Ich bin schon dafür, die Forschung zu streuen. Nicht jeder Auftrag muss nach Kent oder San Diego gehen. Die Großen können nicht alles machen, sonst werden sie zu teuer. Jeder muss eine Chance haben, gerade bei einem System, das verzwickt ist wie 'Tomahawk'."
"Auch bei den anderen geht eine Menge schief, Sir."
"Sicher, aber doch in Grenzen. Ich sage jetzt bloß: Santa Catalina."
De Luca nippte an seinem Drink. Verdammt schwer, so zu tun, als sei man eingeweiht. Dem Namen nach eine Insel bei Los Angeles, ein Paradies für Glücksspieler und Sportfischer 25 Meilen vor der Küste, im Besitz der Wrigleys. Doch mit Glücksspiel oder Kaugummi hatte der Hinweis bestimmt nichts zu tun.
"Schon vergessen oder, sagen wir mal, verdrängt?"
Das Spiel war aus, er wusste zu wenig von der Malcolm Aircraft.
"Ich gebe Ihnen noch ein Stichwort: La Jolla. Dämmert es nun?"
La Jolla war der Badevorort von San Diego, und dann gab es noch ein nuklear getriebenes Unterseeboot, das so hieß. Dunkel erinnerte De Luca sich eines Vorfalls mit dem Boot. Offenbar spielte McDonald auf die Panne vom Frühsommer an. Aus einer Tauchposition hatte "La Jolla" bei der Insel Santa Catalina ein Cruise Missile vom Typ Tomahawk abgefeuert, ein Testgeschoss der MAC. Wie üblich durchbrach es die See wie ein hochschießender Tümmler, fuhr seine Flügel aus und zog tief über dem Ozean eine Kurve, um ostwärts Santa Barbara die Küste zu schneiden und über kalifornisches Ödland sein Testgebiet in Nevada zu finden, ein kleines Zielquadrat. Das hatte oft funktioniert, diesmal aber war das Kriegsbeil abgeirrt, auf die Santa-Ynez-Berge mit dem Landsitz des Präsidenten. Die Sache wäre vertuscht worden, hätten nicht Reporter dort gelauert und den Einschlag fotografiert.
"Sir, der Groschen ist gefallen."
"Na gut. Das hat Ihnen und uns geschadet. Schließlich kann der Verteidigungsausschuss keine Waffe befürworten, von der ein Schlag gegen Reagans Ranch droht."
"Ja, das war ein Eigentor. Inzwischen aber ist das Navigationssystem verbessert worden. Und mit der Tarnkappen-Technologie liegt die MAC deutlich vor allem anderen."
"Die Gutachter bezweifeln das. Fest steht nur, die Testvorgaben werden bisher nicht erreicht. Ihr Produkt fliegt stets unter den besten klimatischen und geographischen Bedingungen."
"Die Marine will es so."
"Sie traut dem Gerät eben nicht mehr zu. Der Weg von Santa Catalina nach Nevada ist die reinste Milchmanntour, und trotzdem Irrläufer! Nicht umsonst schickt man Abfangjäger mit."
"Zur Beruhigung des Publikums. Die Gefechtsköpfe sind ja leer, da fliegt kein Krümel Sprengstoff."
"Ich bin im Bilde. Die Navy hilft Ihnen, Ihr Zeug zu retten. Sie ist ja ganz wild darauf, die Pazifikflotte mit Cruise Missiles zu bestücken."
"Schweift ein 'Tomahawk' so weit ab, dass er sich anhand des Bodenreliefs nicht mehr zurechtfindet, wird neuerdings die Fallschirmlandung ausgelöst." De Luca begann, sich in Tanjas Rolle einzufühlen. Was hatte es zwischen ihr und diesem Mann gegeben, dass sie in Anchorage von ihm abließ? Hatte sie sich um des Verkaufserfolgs willen an ihm festgesaugt? Unsinn, was half es ihr, mit dem einen ins Bett zu gehen – drei bis vier Dutzend Leute entschieden über Regierungsaufträge solchen Umfangs. "In Kürze werden die Probleme gemeistert sein", hörte er sich sagen.
"Möglich, bei markanten Profilen." McDonald drehte sich um, er bestellte kalifornischen Weißwein, ihm zuliebe. "Aber im Polareis und über den Ebenen Sibiriens erblindet Ihr Geschoss. Da sind noch nicht mal die Einflugschneisen vermessen worden."
Das Gespräch lief wie von selbst. Sandro der Zauberer, Priester des Waffenkults. Was er der Presse entnommen und längst vergessen hatte, stieg in ihm auf, wurde verfügbar. Wie glatt ihm das von der Zunge ging! Er konnte ohne weiteres über eine Waffe sprechen, die er nicht mehr beachtet hatte als andere Systeme. Lag das am Wein oder am Charme seines Partners? Es saß und sprach sich hier ganz angenehm... In einem Winkel seines Kopfes steckte ein Satz aus einem Jahrbuch, möglicherweise dem Almanac of American Politics, wo es über Lawrence P. McDonald hieß: "Er steht auf dem rechten Flügel der Demokratischen Partei ganz außen und vertritt zuweilen Verschwörungstheorien, die sogar viele seiner konservativen Freunde zusammenzucken lassen..."
Davon war wenig zu spüren. Wuchtig saß McDonald da, bekümmert, das dicke Haar gesträubt, als sei er der einzige auf der Welt, der sich ernstlich um sie sorge: vom Volk gewählt, zu verhüten, dass sie dem Feind in die Hände fiel. Schweigen senkte sich auf die winzige Bar. Es reicht, dachte De Luca. Er schwatzte Unsinn und traf auch nicht immer den Ton. Nur, wie es stoppen, ohne den Mann gegen sich aufzubringen? Stets war es leichter, etwas anzufangen, als es zu beenden.
Eine halbe Stunde später sagte McDonald: "Ich ahne, wie Ihnen zumute ist, Sandro. Soviel Promotion für 'Tomahawk' und alles umsonst."
De Luca tauchte aus seinen Meditationen auf. Das klang, als zeige sich ihm ein Ausweg. Sie hatten das Thema erschöpft.
"Tut mir leid, mein Freund, es plaudert sich wirklich nett mit Ihnen. Aber Ihr Produkt überzeugt nicht so wie Sie persönlich."
"Ich hab Sie gar nicht überzeugt."
"Durchaus – von der Güte Ihres kalifornischen Weins."
"Mehr war's für heute eben nicht."
McDonald strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn, seine dunklen Augen leuchteten kühl. "Das ist sympathisch an Ihnen, Sie spüren es, wenn ein Produkt noch unreif und das Ja nicht zu kriegen ist."
"Man kann 'Tomahawks' nicht mit Hauruck an den Mann bringen. Es sind keine Sportwagen oder Kühlschränke."