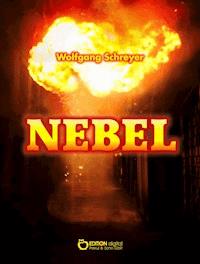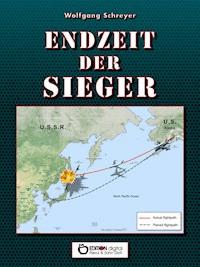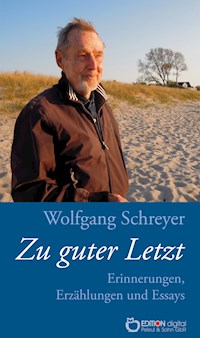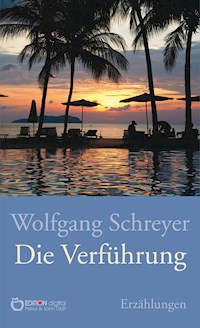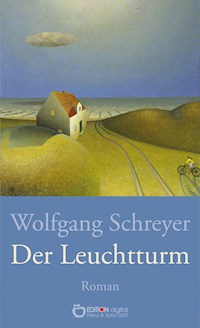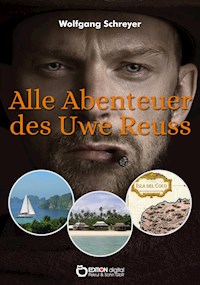5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Ahrenshooper Kurhaus, Baujahr 1970, war einst begehrtes Urlaubsziel. Seit neun Jahren verfällt es zur gespenstischen Ruine. Die will der Eigner durch ein Grand Hotel ersetzen, wie es das Dorf noch niemals kannte. Wird es jetzt zum Modebad, zum Sylt des Ostens werden? Wolfgang Schreyer, seit langem hier ansässig, blickt zurück auf die Künstlerkolonie, auf das alte Kurhaus, seine Gäste und deren skurrile Geschichten. Der heutige Streit (2002), genau erzählt, füllt diesen packenden Bericht mit Zeitgeist: Wie meistert man das Leben und findet auch sein Glück? Eine besinnlich-amüsante Story mit offenem Schluss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Das Kurhaus
Erzählung
ISBN 978-3-96521-462-0 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 2002 im BS-Verlag Rostock Angelika Bruhn.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
2021 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Obwohl, dem Sprichwort entgegen,
das Geld nicht auf der Straße liegt,
gibt es Menschen, die’s finden.
Erich Kästner
Bereichert euch!
Louis-Philippe
Der Reichtum gleicht dem Seewasser:
je mehr man davon trinkt,
desto durstiger wird man.
Arthur Schopenhauer
1
Das Theater in Anklam, eine GmbH mit mehreren Spielstätten, hatte mich für zwei Abende verpflichtet. Der Chefdramaturg schrieb mir, er schätze mein letztes Buch. Mich wiederum hatte sein Schneid bei den Vineta-Festspielen des Städtchens Barth verblüfft: ein Auftritt, der fast vergessen ließ, dass Vineta früher nie im Barther Bodden, sondern vor Usedom oder auch vor Wollin vermutet worden war. Übrigens hieß er Piet Oltmanns, recht passend zur Legende; in Maske und Gestik, ja selbst vom Wuchs her gab er den Recken im Lederwams mit Bravour.
Ich fuhr also hin und las dort aus meinen Erinnerungen, schon diesem Haus zuliebe. Von einem Hamburger Magazin nämlich war es übel beschmutzt worden. Dessen Mann hatte sich nicht einmal geschämt, den Namen des rührigen Intendanten – Bördel – billig zu bewitzeln. Dass der Reporter für sein Zeug auch noch den 91er Egon-Erwin-Kisch-Preis zweiter Klasse bekommen hatte, war wirklich die Krone. All das lag zwar schon elf Jahre zurück, doch wir Ostdeutschen, vor derlei Arroganz solidarisch, vergessen so bald keine Kränkung.
Am Ende des Abends galt es wie immer, ein paar Bücher zu signieren. Auch war der übliche Eintrag im Gästebuch fällig – ein Zwang, der mich an Tucholskys Seufzer denken ließ: Er fühle sich, so gedrängt, stets wie jemand, der ins WC gesperrt wird, ohne zu müssen. Da kein würdiger Satz mir einfiel, schrieb ich: „Einen Autor mögen und ihn persönlich kennenzulernen ist wie Gänseleber mögen und die Gans persönlich kennenzulernen“. Der Chefdramaturg, zuständig für den Ablauf, blieb so gefasst wie beim Untergang Vinetas, der sündigen Stadt.
An seinen Platz rückte eine junge Dame, sehr adrett und mir wohlgesinnt. Sie hatte ganz vorn gesessen, mehrfach zustimmend genickt und mit hilfreichen Fragen die Diskussion belebt. Ihr folgte als Letzter ein junger Mann, hellblond, unruhig wippend und ein Büchlein in der Hand, das keins der meinen war. Und während die Dame, von der ein zarter Duft ausging, sich als angehende Historikerin zu erkennen gab, argwöhnte ich, ihr Hintermann werde mir gleich ein eigenes Werk aufdrängen. Womöglich seine Memoiren, die dann zu lesen sich kaum verweigern ließ.
Die Memoiren? Nein, dazu war er zu jung; ich schätzte ihn auf höchstens dreißig. Eher wohl Lyrik, es schien ja ein dünner Band zu sein. – Seit man bei uns Bücher selbst edieren, wenn auch nicht in nennenswerter Zahl verkaufen kann, mehren sich solche Wünsche. Natürlich lese ich die Texte, oft sind sie voller Lebensmaterial. Verdrießlich aber bleibt es, sie zu begutachten oder dem Verfasser gar Ratschläge zu geben, die ihm schwerlich nützen; hat er doch meist anderes im Sinn. Er sucht Ermutigung, Anerkennung – darin unterscheidet er sich von den Profis nicht.
Mein Denken irrte ab, infolge der ganzen Belastung. Mich beschlich das Gefühl, die Übersicht zu verlieren. Anstatt der Studentin zuzuhören, schielte ich zu dem Büchlein in ihres Nebenmanns Hand. Eine Broschüre eigentlich, in warmem gelbbräunlichem Einband – Chamois, so hieß der Farbton in der Fotokunst früherer Jahre. Da sagte die Historikerin: „An Ihrer Autobiografie, Herr Woelk, hat mir imponiert, dass Sie zugeben, für manches offen gewesen zu sein: bereit zur Anpassung, damals vor fünfzig Jahren. ,Leitet einen, der Schriftsteller sein, also nach oben will, noch der Charakter, die Überzeugung, oder einzig die Situation?‘ So steht’s bei Ihnen, und man liest das nicht alle Tage. Wir sind hierzulande im Verdrängen recht geübt, uns der eigenen Neigung zum Mitläufertum kaum noch halbwegs bewusst.“
„Nun, was meinen Opportunismus betrifft“, sagte ich in dem Empfinden, ihr Charme dämpfe das akademisch Präzise ihrer Rede, „als Neuling im Beruf will man doch Fuß fassen, und das heißt zunächst mal, sich zu arrangieren.“
„Weil das ganze Leben Arrangement ist und Einordnung fordert?“
„Schon, doch in Maßen. Auf das Maß kommt es an. Schließlich muss man sich selber treu bleiben. –“ Wie mich bloß ihrem Zugriff entziehen? „Später, wenn da Erfolg kam, hat man sich freigeschrieben. Da lockte es mehr, den eigenen Kopf durchzusetzen und abzuweichen vom Parteikurs – oder vom Mainstream des politisch Korrekten, wie das heute heißt.“
„Sie meinen, die Kunst lebt von Tabuverletzung?“
„Von Unabhängigkeit. Zensur, und ebenso der Drang nach Verkäuflichkeit, beides sind Fesseln, die sie abstreifen muss.“
„Das heißt, sie geht nicht mehr nach Brot?“
Etwas in mir verspannte sich. Das wurde uferlos, jede Frage zog bei ihr die nächste nach. Zwar war sie so fair gewesen, mir erst jetzt damit zu kommen; dennoch schien sie dabei, mich mattzusetzen. Bisher war ich ganz gut über die Runden gekommen, alles Weitere ging über meine Kraft. – Immerhin, sie merkte es wohl und ließ nach ein paar Floskeln taktvoll von mir ab.
Der Jüngling rückte nach, und zwar mit dem merkwürdigen Eifer, ja der Aufdringlichkeit des eigentlich schüchternen Menschen. Er gab mir ein Kärtchen, das ihn als Partner der Firma Hinrichs + Labusch auswies, ein Consulting-Büro. Es hatte etwas mit Firmenberatung und Werbung zu tun, die Sache war zu verzwickt für den Moment des Aufbruchs. Dabei zögerte Hinrichs, mir sein Werk zu unterbreiten, obgleich ihn ein Schulterzucken plagte, als Spannungssignal. Es war beklemmend; all sein Gerede diente nur der Anbahnung dieses unvermeidlichen Aktes.
Endlich schob er mir das Büchlein zu. „Unser letztes Produkt“, sagte er bescheiden, gar nicht forsch wie ein Werbemann. „Der Versuch, die Story eines altehrwürdigen Hotels in Wort und Bild zu fassen. – Würden Sie wohl, morgen in Zinnowitz, mal einen Blick hineintun? Und mir eventuell später, vor oder nach Ihrem Vortrag in der ,Blechbüchse‘ dort, unverblümt Ihre Meinung sagen?“
Auch Hinrichs sah mir das Erschlaffen durch Reizüberflutung an. Also drang er nicht weiter in mich, sondern ging mit einer knappen Verbeugung, die immerhin Respekt spüren ließ.
2
Zinnowitz galt als Kaiserbad. Ein paar Kurorte auf Usedom und Rügen nennt man wieder so, obschon Wilhelm II. kaum dort abgestiegen war. Der zog Kreuzfahrten ins Nordmeer oder zur georgischen Schwarzmeerküste vor. Deutschlands Zukunft freilich lag für ihn „auf dem Wasser“, auch den Spruch vom „Platz an der Sonne“ hatten Majestät geprägt (oder Ihr Reichskanzler v. Bülow). Nein, da schien bloß die Belle Epoque, die Glanzzeit der Reichen und Hochgestellten gemeint.
Mein erster Besuch in Zinnowitz, ach, das war 51 Jahre her. Damals hatte uns der Vermieter erzählt, dies sei mal das Seebad der Deutschnationalen gewesen. In Bansin habe der Kleinadel vorgeherrscht, in Heringsdorf die Juden und in Ahlbeck das restliche Bürgertum Berlins. – Man war offenbar gern unter sich gewesen.
Nach Morgenbad und Strandbummel bis zu den Türmen von Schwabes Hotel, das einst den Peenemünder Stab um Wernher von Braun beherbergt hatte, legte ich in meiner Pension die Füße hoch und vertiefte mich in das Büchlein. Hinrichs Partner Labusch zeichnete als Autor, er hatte es schlicht „Eine Chronik“ genannt. Schon das hob sich wohltuend ab vom üblichen Tamtam der Tourismuswerbung. Labusch schien Akademiker zu sein, begann er doch damit, den Begriff Kurhaus zu deuten. Dies nämlich sei „das zentrale Bauwerk in einem Kurort, in dem Veranstaltungen und etliche Anwendungen stattfinden“. Letztere beschrieb er als „therapeutische Maßnahmen wie Heilbäder, Massagen und anderes den Kurerfolg Sicherndes im Wellness-Bereich des Hauses“.
Perfekt. Inzwischen ging mir auf, die Rede war von einem Hotel, in dem wir – meine erste Frau und ich – zur Ulbrichtzeit zwar nicht hatten wohnen, aber doch speisen dürfen, für die zwei Wochen Gewerkschaftsurlaub. Einmal hatte ich Anlass gehabt, das Beschwerdebuch zu verlangen, und war beschieden worden, es sei voll. Der Geschäftsführer stehe gleichfalls nicht zur Verfügung: „Der ist auch voll!“
Solch lockerem Ton des Personals entsprechend, dem die Idee der Gleichheit und Brüderlichkeit aller Menschen zugrundelag, hieß das Haus „Weltfrieden“ oder „Völkerfreundschaft“. Das Porzellan indes war hier und da noch beschriftet mit „Kurhaus Parkhotel Kaiserhof Atlantik“. Durch närrische Sinnverknüpfung erinnerte mich das an ein Führerwort; in seinem Wälzer „Mein Kampf“ hatte Hitler die Sowjetunion zum „osteuropäisch-innerasiatisch- jüdisch-bolschewistischen Koloss“ erklärt. Derlei Bombast würzte seine Reden, der war von wundersamer Wirkung im Wahlkampf gewesen.
Schwulst und Pomp schienen Labusch fremd, nur leicht klang so was in historischen Zitaten an. Da stand etwa bei ihm: „Am 21. Juli 1890 trafen Ihre Majestät die Kaiserin mittags mit den Prinzen ein und wurden von Sr. Durchlaucht dem Fürsten zu Putbus empfangen.
Die Prinzen spielten in der ungezwungensten Weise an dem herrlichen Strande. Ihre Majestät geruhten im Kurhause den Thee einzunehmen und verließen den Ort gegen 51/2 Uhr, anscheinend von dem Aufenthalte recht befriedigt.“
Zur Eröffnung der nächsten Saison brach die Lokalpresse in Jubel aus, vermerkte das erste Konzert der Kurkapelle vor dem Kurhaus und schrieb: „Die Flaniermeile nahm wieder Konturen und Gestalt an.“ Trotzdem, die Aktiengesellschaft der Investoren ging im selben Jahr schon pleite. Erst zur Jahrhundertwende lebte das Haus in hochadliger Hand wieder auf, gestützt auf eine Dampferanlegebrücke, die, vom Sturm zerstört, erst 1905 weit stabiler neu errichtet wurde.
All das war durch Texte von Zeitzeugen und Fotos sorgsam belegt. Alten Glanz brachte der Chronist dem Leser nahe, auch indem er „die Speisefolge an der prachtvoll dekorierten Festtafel“ wiedergab: Ochsenschwanzsuppe, Steinbutte in Caperntunke, Hammelrücken garniert, Englische Sellerie, Französische Poularde, Salate, Compot, Eisbombe à la Victoria, Feines Gebäck, Butter, Käse.
Ähnlich scharf skizziert: die trüben Zeiten von Weltkrieg, Zusammenbruch und Niedergang. Das Kurhaus verwahrloste und wechselte den Besitzer, bis ein rumänischer Jude es 1923 für 170 Millionen Reichsmark erwarb. (Hier fehlte das Datum! Im Januar des Inflationsjahrs wären das gut 15.000 US-Dollar gewesen, Ende November bloß noch sieben Dollar; in jedem Fall ein günstiger Kauf.)
Der quirlige Geldmann fügte dem Haus ein Spielcasino, ein Kabarett und die Kakadu-Bar hinzu.
Und das hieß, er nahm „keinerlei Rücksicht auf die sittlichen Belange der guten deutschen Volksgenossen“, wie der Bürgermeister rückblickend 1936 der Geheimen Staatspolizei in Berlins Prinz-Albrecht-Straße denunziatorisch schrieb. Immerhin, die rumänische Gesandtschaft schützte ihren Landsmann noch im Herbst 1938 vor Enteignung, die damals „Arisierung“ hieß. Es gab dazu ein formloses, nicht unterzeichnetes Papier, von Diplomaten „Verbalnote“ genannt. Erst bei Kriegsausbruch floh der Besitzer nach Bukarest, kehrte aber 1946 zurück, focht die „Entjudung“ des Hauses an, und das Landgericht in Greifswald gab ihm Recht.
Was nun kam, klang bekannt, war Schicksal vieler Hoteliers hierzulande: Anklage und Haft wegen sogenannter Wirtschaftsverbrechen; erneute Wegnahme um 1953. Das Kurhaus, nun volkseigen, fiel für fast vier Jahrzehnte dem DDR-Reisebüro zu. „Mittags wurden fünf Wahlgerichte, eine Suppe und ein Dessert gereicht“, hatte der Autor vermerkt, ohne sich über das doppelte Unrecht der Aktion „Rose“ in diesem speziellen Fall sonderlich zu erregen. „Halbpension kostete in den Siebzigerjahren 9,50 Mark, Vollpension 12,50 Mark pro Tag.“
Ich blätterte um. Die 89er Wende zog Unsicherheit und Stellenabbau nach sich. Dutzendfach kamen Kauflustige zur Besichtigung, scharf auf ein Schnäppchen. „Im Rahmen der Privatisierung durch die Treuhand-Anstalt stand das Haus zum Verkauf. Anfang 1993 übernahm die Baltic Flair Hotel GmbH mit Sitz in Köln, die das beste Nutzungskonzept und einen Sanierungsplan vorgelegt hatte, das prestigeträchtige Objekt.“
Zu welchem Preis? Da schwieg des Sängers Höflichkeit. Ein üppiger Bildteil folgte, vom Festsaal bis zur „ägyptischen Bäder- und Sauna-Landschaft“. Durchweg schwelgte das Haus in einer Farbsymphonie von königsblau bis orange. Der Schluss galt prominenten Gästen. Max Schmeling, Lilian Harvey und Prinz Friedrich zu Schleswig-Holstein-Glücksburg führten die Liste an; sie endete nach 60 weiteren Namen mit Angela Merkel, Bernd Seite und Franz Fürst zu Putbus. Mir war, als schließe sich da ein Kreis.
3
Hinrichs fing mich vor dem skurrilen Bau der „Blechbüchse“ ab, begierig auf mein Urteil. „Ihre ,Chronik‘ ist prächtig, sehr solide, ein Genuss“, sagte ich nicht ganz wahrheitsgemäß, um ihn rasch loszuwerden. Mein Vortrag fing gleich an, und wie immer war ich grundlos nervös.
„Finden Sie?“, fragte er lauernd. „Ein Schriftsteller Ihres Formats, Herr Woelk, hätte weit mehr daraus gemacht.“
„Unsinn! Die Arbeit Ihres Partners ist nicht zu toppen.“
„Da war der Auftraggeber leider anderer Meinung.“
„Dann muss er ja ein ziemlich strenger Mensch sein.“
„Streng, das drückt es noch vornehm aus. Er kann sehr gewinnend, aber auch verdammt direkt sein. Neulich hat er zu mir gesagt: ,Es gibt eine Menge Leute, die netter sind als ich; man nennt sie auch Verlierer.‘ Wie finden Sie das?“
Der Satz gefiel mir, ich wollte ihn notieren. Selten bringt ein Mann seine Haltung so auf den Punkt.
„Also, der Geschäftsführer lässt Sie herzlich bitten, nach Ihrem Vortrag nicht etwa heimzufahren, drei Stunden durch die Nacht. Sondern in eben dem Hotel zu rasten, das unsere ‚Chronik‘ Ihnen geschildert hat. Natürlich auf Rechnung des Hauses. Es ist gar nicht so weit weg.“
„Was verschafft mir denn die Ehre?“
Hinrichs rückte näher, er senkte die Stimme. „Ja, Herr Dr. Garcón hofft, Ihre Feder für Ähnliches, also für solche Schriften zu gewinnen. Das Unternehmen betreibt gut ein Dutzend Nobelhotels dieses Typs.“
„Wie kommt er auf die Idee, das wäre was für mich?“
„Er wird Ihnen ein Angebot machen, das Sie kaum ausschlagen werden.“
Das klang bekannt; wie aus einem Mafia-Film geschöpft. So etwa hatte Marlon Brando sich als Pate, Don Corleone, im Ernstfall ausgedrückt. Ich war baff, und um das zu bemänteln, fragte ich: „Dr. Garcón ist Franzose?“
„Eigentlich Baske. – Das lässt Sie vielleicht an die ETA denken, aber Bombenlegen ist bestimmt nicht sein Ding.“
Er lachte zu seinem Scherz. Doch nicht die ferne Untergrundarmee kam mir in den Sinn, sondern Ignacio López, jener GM- oder Opel-Manager, der unter obskuren Umständen zu Volkswagen gewechselt war und dort die Preise der Zulieferer gedrückt hatte, bis weit unter die Schmerzgrenze. Vielleicht steckte in jedem Basken solch ein Kern, anders hätte das Restvolk, an den Rand Europas gedrängt, wohl kaum überlebt. – „Und wie stellt er sich das vor?“
„Natürlich darf ich dem Gespräch, zu dem er sie morgen um elf erwartet, nicht vorgreifen“, sagte der junge Mann gedämpft. Beim Ellbogen nahm er mich beiseite, mit einer augenfälligen Verstohlenheit, die seine Worte noch unterstrich. „Nur soviel: neben Lesungs- und Vortragsreisen durch all seine Objekte denkt Dr. Garcóon an ein Honorar im mittleren fünfstelligen Bereich.“
Es war Acht, der Abend begann. Mein Verstummen richtig deutend, raunte Hinrichs mir zu: „Für Ihre prinzipielle Bereitschaft, das in Erwägung zu ziehen, bedanke ich mich, Herr Woelk! Wenn Sie die Güte haben, mir zu folgen, fahre ich nach dem Vortrag einfach vor Ihnen her.“
4
Im Saal verließ mich bald der Mut. Ich hatte das Gefühl, nicht bei der Sache zu sein, so dass die Lesung mir missriet. Meine Stimme trug nicht, sie klang blechern und belegt – so flach wie das, was ich da von mir gab. Das Kapitel meiner USA-Reise von 1987, darum gab’s öfter Streit. Das Amerikabild manches Zuhörers ist halt heller. Ein Westberliner hatte mir vorgeworfen, ich schildere die Reise wie einen Horrortrip; kein Wunder, hatte ihn doch der ferne Alliierte jahrzehntelang vor der roten Flut ringsum beschützt.
Bloß heute – nicht mal Widerspruch! Erst als ich in der fünften Reihe die Studentin von gestern zu erkennen glaubte, munterte mich das auf. Mir fiel ein, dass Vera, meine zweite Frau, früher jedes Mädchen beargwöhnt hatte, das ein weiteres Mal in meine Lesung kam. Damals, vor 30 Jahren, hätte das auch mir geschmeichelt; doch vor 30 Jahren war jenes Mädchen dort, die angehende Historikerin, noch gar nicht auf der Welt gewesen ... Sie saß allerdings auch jetzt nicht da. Als ich die Fernbrille aufsetzte, alterte die Dame jäh: eine Sinnestäuschung! So brach mir die letzte Stütze weg.
Die einzige Frage galt dem Titel meiner Memoiren. Die hießen „Der zweite Mann“ – weshalb denn nur Zweiter?
„Ja, das ist eben oft meine Rolle gewesen, vorn stand meist wer anders“, bekannte ich. „Unter den Gaben, mir unverdient in die Wiege gelegt, hat eine leider gefehlt, ohne die man schwer Karriere macht: Autorität oder Führungsstärke. Es ist mir nie geglückt, Kraft auszustrahlen, Wünsche zu bündeln, also Frontmann zu sein, Macht auszuüben und irgendeine Art von Gefolgschaft zu bilden. Kein brauchbarer Chef, Offizier oder Politiker wäre je aus mir geworden. Dazu muss man ein Alpha-Typ sein. Selbst in der Liebe ...“
Leicht widerstrebend fuhr ich fort, in dem Gefühl, dies werde zu persönlich und ich sei dabei, mich den Leuten anzubiedem, um ihnen doch noch einen Laut, ein Quäntchen Beifall zu entlocken. „Zwei Ehen, und in keiner bin ich gleich der Erste, also der Wunschpartner gewesen. Na, da hab ich mir gesagt: Besser zweite Wahl als ganz verschmäht. In der Ruhe liegt die Kraft, es siegt oft die Beharrlichkeit. Auch wenn sich im Rückblick vielleicht mehr Niederlagen zeigen. – Denn im Übrigen scheint mir, meine Damen und Herren, ein bloß halb geglücktes Leben ist im Grunde ganz geglückt; mehr darf man nämlich nicht erwarten.“
Gestammel, dachte ich. Mit wehender Flagge sinken! O Gott, hatte ich das nötig? Winkte mir nicht ein Honorar im mittleren fünfstelligen Bereich – soviel, wie das Privatfernsehen für manch hirnrissig hingeschludertes Drehbuch zahlt? Ich spürte, wie da Endorphine sich schmerzstillend in mir verteilten. Da kam auch schon der Chefdramaturg mit den Blumen herbei, und Schlussapplaus deckte gnädig meinen Abgang zu.
„Sie waren Spitze, Herr Woelk“, sagte Hinrichs draußen, euphorisch wie ein Lobhudler. „Diese Aufrichtigkeit selbst noch im Privaten. – Hängen Sie sich einfach an, jetzt sind die Straßen leer, wir sind im Handumdrehen da.“
5
Die Juniorsuite des Strandhotels roch aromatisch nach Zedernholz, sie umfing mich gelb-blau, mit gediegenem Luxus. Das Marmorbad prunkte mit riesigen Tüchern im Vanilleton der Fliesen, das Zahnputzglas war luftdicht verpackt, königsblau, der Hygiene zuliebe. Dies war ein Fünf-Sterne-Haus: keine Spur mehr von „Weltfrieden“ oder „Völkerfreundschaft“, gewiss gab es kein Beschwerdebuch; zumindest würde kein Kellner jemals sagen, es sei voll und der Geschäftsführer auch. Die Suite kostete 286 Euro (etwas mehr, als mir laut VS-Tarif für den Vortragsabend zustand); freilich den Begrüßungs-Cocktail, das reiche Frühstücksbüffet und die Nutzung der Wellness-Landschaft inbegriffen.
Dennoch, mein Schlaf war flatterhaft. Mir träumte, der Dr. Garcón wünsche mich im Ägyptischen Bäder- und Saunabereich zu empfangen. Dahindämmernd stellte ich ihn mir wie einen Sultan vor, umringt von seinem Harem. Die hübsche Historikerin führte mich hin, vorbei an duftenden Planschbecken und Schalen voller Orangen. Selber nur sparsam verhüllt, reichte sie mir ein kostbar gebundenes Buch, auf dessen Seiten sich Personen von Rang und Stand geäußert hatten. Der Zwang, Geistvolles abzusondern, bis hierhin verfolgte er mich!
Ich bildete mir ein, zurückblätternd, schlicht datiert auf 1828, von Goethe den Satz zu finden: „Ein paradiesisch Plätzchen zum Ruhen, Sinnen und Trachten.“ Danach konnte Heinrich Heine ja vermerkt haben: „Wellen, fast so schön wie an der Nordsee.“ Theodor Storm ließ sich das Wort zuschreiben: „Was wäre unser Werk ohne das Meer?“ – „Gleichen Sinnes“, konnte Gerhart Hauptmann oder Henrik Ibsen angefügt haben. So wortkarg durften nur Genies sein, mir hätte man’s verübelt.
Kurhaus Parkhotel Kaiserhof Atlantik. „Auf einer Durchreise geruhten Majestät dies Kurhaus nett zu finden und zeichneten sich zum Ausdruck Höchsteigenen Wohlgefallens hier namentlich ein ...“ Den Faden im Halbschlaf fortspinnend, ließ ich Thomas Mann notieren: „Manchmal war es dort still und sommerlich. Die See ruhte träge und glatt, in blauen, flaschengrünen und rötlichen Streifen, von silbrig glitzernden Lichtreflexen überspielt, und Quallen lagen da und verdunsteten. Aber des Meeres leiser Atem strich rein und beglückend über alles hin.“
Um dieser Narretei zu entfliehen, nahm ich eine dämpfende Tablette, wälzte mich und spürte das Unklare meiner Lage. Irgendetwas stimmte nicht. Aufwand und Nutzen für den, der mich engagieren wollte, standen in keinem rechten Verhältnis. – Langsam sackte ich ab, glitt dicht unter der Oberfläche dahin und fragte mich: Wo ist der Haken? Ich trieb durch Blasen, die Wände glichen Zerrspiegeln. Da es mir so an Machtinstinkt fehlte, beherrschte Dr. Garcón stets die Szene, er trug eine Baskenmütze und sagte: „Nicht dem Fischer muss der Köder schmecken, nur dem Fisch.“ Hinrichs blickte hündisch zu ihm auf, während aus dem schwimmenden Sessel, der ihn trug, zischend Luft entwich.
Tatsächlich – und das war mir auch im Traum bewusst – hatte er zwar den Schmeichler gespielt, und selber hatte ich Blech geredet in der „Blechbüchse“, doch war aus keinem Sessel dort Luft entwichen. Bevor der Sitz mit ihm versank, erklärte er nachdrücklich: „Wir denken an ein Honorar im mittleren fünfstelligen Bereich!“