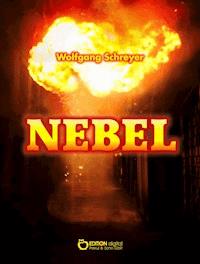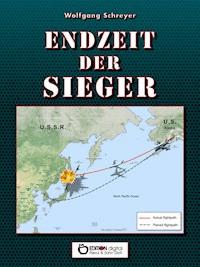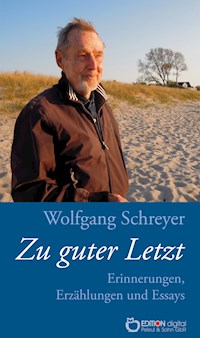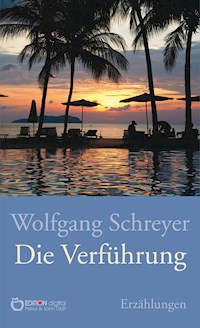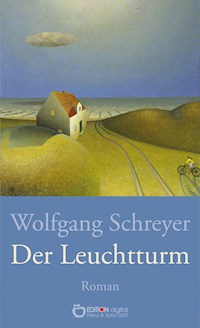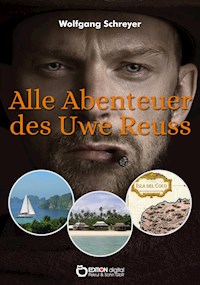5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Das eBook schildert Stauffenbergs heldenhaftes Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944. Spannend und atemberaubend wird die kurze Zeitspanne vom Attentat bis zur Erschießung von Stauffenberg, Haeften, Olbricht und Merz geschildert. Rückblenden zeigen die Haltung und Ziele der in den Putsch verwickelten Offiziere. Im Mittelpunkt steht der verzweifelte, unermüdliche und mutige Kampf Stauffenbergs um das Gelingen des Putsches. Die zweite Erzählung "Tod eines Kanoniers" spielt am 6. März 1945 in einer Flakbatterie in Frankreich weit hinter der Frontlinie. Hätte der erfolgreiche Putsch am 20. Juli den sinnlosen Tod des jungen Kanoniers verhindern können? Beide Erzählungen wurden erstmals 1959 im Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung der DDR veröffentlicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Das Attentat
ISBN 978-3-86394-087-4 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 1959 beim Verlag des Ministeriums für Nationale Verteidigung, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
DAS ATTENTAT
1. Kapitel
An einem strahlenden, blaugoldenen Sommermorgen rollte ein kleiner Mercedes durch die südlichen Vororte von Berlin; er fuhr in Richtung Rangsdorf. Im Fond saßen zwei Offiziere: der Generalstabs-Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg und seine Ordonnanz, Oberleutnant der Reserve Werner von Haeften. Die beiden schwiegen, da der Fahrer sie hören konnte; sie sahen hinaus. Zu ihren Füßen stand eine Aktentasche aus hellem weichem Leder. Es war Donnerstag, der 20. Juli 1944, acht Uhr.
Ruinen säumten den Weg. Die meisten Straßen waren zerbombt. Im grellen Sonnenlicht sah man Spuren der vernichtenden Bombenwürfe, die seit einem Dreivierteljahr auf Berlin heruntergingen. Mauerwerk lag auf dem Pflaster, Glassplitter, verkohlte Balken; die Ladenschaufenster waren mit rohen Brettern vernagelt. Stellenweise war die Fahrbahn aufgerissen, so dass der Wagen einen Umweg nehmen musste. An einer einsam ragenden Giebelwand stand: "Unsere Mauern brechen, doch unsere Herzen nie!"
Stauffenberg trieb zur Eile. Er kannte dieses Bild. Die Straßen schienen jetzt verödet; nur in den späten Nachmittagsstunden überfluteten wirre Menschenmassen die S- und U-Bahnhöfe und alle Wege, die zum Stadtrand führten; man wollte fern vom gefährdeten Zentrum eine ruhige Nacht verbringen. Beklemmend war es, diese Menschen zu sehen. Sie murrten, doch sie arbeiteten weiter in den Rüstungsbetrieben – zehn, zwölf Stunden am Tag, unausgeschlafen, bei Hungerrationen. Viele hatten ihr Heim verloren, ihre nächsten Angehörigen. Doch sie taten ihre Pflicht wie der Soldat an der Front. Hofften sie noch auf den Sieg? Vielleicht. Eine wahnwitzige Führung täuschte sie über die Erfolgschancen des Krieges, verbarg ihnen die wirkliche Lage, missbrauchte ihren Fleiß, ihre Tapferkeit, forderte sinnlose Opfer. Fünf- bis sechstausend Deutsche verbluteten täglich, hier und draußen vorm Feind... Aber das sollte nicht mehr lange dauern. Heute Abend noch – und der schlimmste Spuk war vorbei.
"Neunzehnhundertachtzehn", sagte Haeften, "haben sie hier in Berlin gestreikt."
"Da war die Verpflegung schlechter", antwortete Stauffenberg. "Und Wilhelms Pickelhauben waren nicht dasselbe wie die Gestapo."
Der kleine Mercedes stoppte am Rande des Militärflugplatzes Rangsdorf. Der Oberst stieg aus. Er war ein sechsunddreißigjähriger, hünenhaft gebauter Mann mit dichtem dunklem Haar, kräftigem Kinn und hartem Mund; über dem linken Auge trug er eine schwarze Klappe. Siebzehn Monate zuvor hatte ihn in Tunesien die MG-Garbe eines Tieffliegers erfasst und schwer verwundet. Sein rechter Arm war zerschossen, er trug eine Kunsthand; an der Linken fehlten zwei Finger. Dennoch hatte er es auf sich genommen, Adolf Hitler zu töten.
Oberleutnant von Haeften folgte ihm. Sie gingen auf das wartende Kurierflugzeug zu. Haeften trug Stauffenbergs Aktentasche, und er wusste, was sie enthielt. Er war ein Freund und Vertrauter des Obersten. Obwohl schon fünfunddreißig Jahre alt, wirkte er durch sein frisches, heiteres Wesen und das hellblonde lockige Haar viel jünger. An der Front durch einen Beckenschuss verletzt, war er zum Stab des Heimatheeres in die Bendlerstraße versetzt worden und tat bei Stauffenberg Dienst, der ihn in die Umsturzpläne eingeweiht hatte. Er war, wie die anderen Verschwörer, entschlossen, sein Leben zu wagen, um durch einen Militärputsch den Faschisten die Macht zu entreißen.
Sie kletterten in die Maschine. "Na, wie ist die Luftlage?", fragte Haeften den Piloten. – "Ganz Deutschland feindfrei", antwortete der. Stauffenberg sah mit dem gesunden Auge zweifelnd hinauf in den klaren Julihimmel.
"Bei dem Wetter?", fragte er.
"Was nicht ist, kann noch werden, Herr Oberst."
Stauffenberg nickte. Die "fliegenden Festungen" der Amerikaner würden gegen Mittag wiederkommen, und dieses eine Mal wünschte er sie selbst herbei. Ein Bombardement der Reichshauptstadt musste Verwirrung stiften, die SS in die Keller bannen und sein großes Vorhaben erleichtern... Da sprang der Motor an, das Flugzeug rollte zur Piste, hob sich vom Boden ab. Es nahm Nordostkurs.
"Die Kiste ist ziemlich schnell", sagte Haeften. "Macht die sechshundert Kilometer in knapp zweieinhalb Stunden."
Der Oberst war an diesem Tage zu Hitler befohlen worden, um über die Aufstellung neuer Divisionen zu berichten. Als Stabschef beim Befehlshabers des Ersatzheeres, dem Generalobersten Fromm, gehörte es zu seinen Aufgaben, die Bereitstellung und den Abtransport frischen Kanonenfutters zu organisieren. Das Flugzeug sollte ihn ins Führerhauptquartier bringen, das sich in Ostpreußen befand. Er war in dieser Zeit der einzige unter den Verschwörern, der zu den Lagebesprechungen bei Hitler gelegentlich Zutritt hatte. Er allein kam an Hitler heran. Schon zweimal, am 11. und 15. Juli, als er zum Vortrag auf dem Obersalzberg war, hatte er eine Bombe in Hitlers Nähe zünden wollen. Beide Male jedoch fehlten Himmler und Göring, die mit getötet werden sollten. Heute aber war es gleich – heute würde er auf jeden Fall handeln.
"Beck scheint's noch nicht ganz zu glauben", hörte er Haeften sagen. "Weißt du, Claus, was er gestern geäußert hat? 'Ein Pferd, das zweimal scheute, springt auch beim dritten Mal nicht.'"
Stauffenberg lachte dunkel. Das sah ihm ähnlich! Generaloberst a. D. Ludwig Beck, das geistige Haupt der Verschwörung, mochte ein hochgebildeter Mensch, ein kluger Offizier, ein großer Planer sein; aber er war auch ein Zauderer, er sah oft zu schwarz. "Ob wir wollen oder nicht, Werner", antwortete er leise, "heute müssen wir springen."
Eintönig brummte der Motor. "Ja", sagte Haeften nach einer Weile. "Wir müssen. Das ist ein Wettlauf. Die Fronten ringsum zerbrechen. Höchstens zehn Tage hält von Kluge die Westalliierten noch im Normandie-Landekopf fest. Dann löst sich die Front in Frankreich auf. Die Ostfront ist schon kaputt. Siebenundzwanzig Divisionen haben wir in Weißrussland verloren. Die Heeresgruppe Mitte besteht nicht mehr. Wenn der Russe in dieses Loch stößt... Das ist ein Wettlauf. Wenn die totale Niederlage Hitlers eher käme als der Aufstand gegen Hitler, welchen Sinn hätte dann der Aufstand noch?"
Der Oberst nickte. Er sagte nichts. Er dachte, dass es auch in anderer Hinsicht ein Wettlauf sei. Die Gestapo war ihnen auf der Spur. Sie hatte am 4. Juli die sozialdemokratischen Führer Leber und Reichwein, als diese auf sein Drängen hin mit den Widerstandskämpfern um Saefkow zusammengekommen waren, überraschend verhaftet. Weitere Schläge folgten. Die Gestapo rollte die Widerstandsfront jetzt auf, sie begann mit dem linken Flügel. Und es ging weiter. Vorgestern, am 18. Juli, war ein Haftbefehl gegen Dr. Goerdeler ergangen. Goerdeler gehörte dem innersten Kreis der Beck-Gruppe an! Es wurde Zeit. Heute musste gehandelt werden, oder es war für immer zu spät.
Gegen elf Uhr ging die Kuriermaschine bei Rastenburg nieder. Stauffenberg wies den Flugzeugführer an, sich in zwei Stunden wieder bereit zu halten. Ein Wagen des Lagerkommandanten brachte ihn und seinen Begleiter über düstere Waldwege in Hitlers "Wolfsschanze".
Das Hauptquartier lag im Schatten mächtiger masurischer Kiefern. Es war durch einen Tretminengürtel gesichert, dessen Durchmesser sechs Kilometer betrug. Unablässig umschlichen ihn Posten. Innerhalb dieses Ringes gab es zwei weitere Sperrzonen: ein von SS besetztes Grabensystem mit elektrisch geladenem Stacheldraht und einen durch Geheimpolizisten bewachten, drei Meter hohen Maschendrahtzaun, der den innersten Bezirk umschloss – den Sperrkreis I –, in dem Hitler hauste. Neben Hitlers Wohnbunker stand nichts als ein Zwinger für seine Hündin und die "Lagebaracke", in der er Kriegsrat zu halten pflegte. Nur wenige hohe Naziführer wie Himmler und Bormann durften ihn dort besuchen. Den Offizieren, die zur Lagebesprechung befohlen wurden, verschaffte ein handgeschriebener Sonderausweis des Hitlerschen Leibwächters, des SS-Oberführers Rattenhuber, Einlass.
Wie üblich, meldete sich Stauffenberg beim Lagerkommandanten, erhielt den Sonderausweis und fuhr zum Teehaus; dort ließ er sich und Haeften ein Frühstück reichen. Rittmeister von Möllendorf, der Adjutant des Kommandanten, leistete ihnen Gesellschaft. Er war ein großer, lebensfroher, zum Sarkasmus neigender Mann, der über die Sicherheitsmaßnahmen spöttelte und das Hauptquartier im Scherz ein "freiwilliges KZ" nannte.
"Der Führer erwartet heute Mussolini", sagte er und spießte ein Stück Rührei mit Schinken auf seine Gabel. "Der Besuch des Duce ist für vierzehn Uhr dreißig angesetzt. Die Mittagslage ist deshalb auf zwölf Uhr dreißig vorverlegt, der Teilnehmerkreis beschränkt worden. Man will nur rasch das Allernötigste besprechen." Er schob das Ei in den Mund, kaute, schluckte, brummelte: "Nicht einmal Göring und Himmler werden kommen."
Stauffenberg ließ die Gabel sinken; seine Backenmuskeln traten plötzlich hervor. Der Teilnehmerkreis beschränkt? Vielleicht kam er gar nicht an Hitler heran? Und bis man ihn wieder einmal rief, konnten Wochen vergehen...
In die jähe Stille hinein drang aus dem Radio die Stimme des Nachrichtensprechers: "... zwischen Dnjestr und Bug warfen unsere Panzerdivisionen den Feind in erbitterten Abwehrkämpfen zurück. Beiderseits Wlodawa wurden alle Übersetzversuche bis auf einen Einbruch, um den noch gekämpft wird, vereitelt. Im Raum Brest-Bialystok vernichteten Sturmgeschütze achtundzwanzig bolschewistische Panzer. Westlich Grodno kam es zu schweren wechselvollen Kämpfen. Schlachtflieger versenkten auf der Memel sechzehn vollbeladene Fähren der Sowjets. In Kauen toben erbitterte Straßenkämpfe..."
Kauen? Stauffenberg rief sich das Kartenbild ins Gedächtnis. Kauen, das war etwa hundertachtzig Kilometer von hier. Und Grodno? Hundertsechzig! Wenn man ihn heute nicht vorließ, brach die Ostfront inzwischen zusammen. In Berlin warteten die Kameraden auf seine befreiende Tat!
"Aber soviel ich vorhin gehört habe", fuhr Möllendorf arglos fort, "wurde Ihr Vortrag, Herr Oberst, nicht abgesetzt. Die Ersatzlage gilt ja als dringender Punkt."
"Und ob", sagte Haeften.
"Nein, Sie sind nicht umsonst gekommen, meine Herren", sagte der Rittmeister liebenswürdig. Er betupfte die Lippen mit der Serviette, schob den Teller zurück und winkte eine Ordonnanz heran, der er auftrug, Eiskaffee zu bringen. Es war elf Uhr fünfundvierzig geworden; die Hitze war unerträglich.
Bald darauf trennten sie sich. Dem Teehaus schräg gegenüber wartete der Wagen am Rande des Parkplatzes; der Oberst ließ Haeften hier zurück. "Dass wir jederzeit losrollen können...", flüsterte er und stapfte quer durch den Wald. Es roch nach Harz und nach den Auspuffgasen der Fahrzeuge. Ein trockener Kienapfel zerknackte unter seinem Stiefel. Sonnenlicht durchstieß das zitternde Nadelmeer, spielte grünlich auf dem warmen, knisternden Boden.
Stauffenberg kannte sich aus. Er war noch nicht oft hier gewesen, hatte aber einen guten Orientierungssinn. Da rechts standen die Bildzentrale und das Lagerkino, links sah man die Wohnung des Hitlerschen Leibarztes, eines Quacksalbers namens Dr. Morell, durch die Stämme. Stauffenberg schritt auf Fellgiebels Nachrichtenbunker zu.
General Erich Fellgiebel begrüßte ihn herzlich. Er war ein Nachrichtenfachmann, dem Hitler seit langem misstraute, ohne ihn entbehren zu können. Das komplizierte Befehlgebungssystem in dem riesigen, von der faschistischen Wehrmacht besetzten Kriegsraum war sein Werk. Er hatte Stauffenberg versprochen, im Augenblick des Attentats die Telefon-, Fernschreib- und Funkverbindungen des Hauptquartiers lahm zu legen, damit die Naziführer nicht erfuhren, was in Berlin vorging, und keine Maßnahmen gegen den dort anlaufenden Militärputsch treffen konnten. Sein Beitrag war von entscheidender Bedeutung. Der Oberst suchte ihn auf, um ihn in letzter Minute noch einmal an seine Zusage zu erinnern.
Er fand den Nachrichtenchef bereit. Fellgiebel war entschlossen zu handeln, doch er beklagte sich auch. "In der Bendlerstraße besteht Unklarheit über das, was ich tun kann", sagte er und rückte unwillig an seiner Brille. "Mir wurde eine Botschaft Becks übermittelt, aus der hervorgeht, dass er damit rechnet, ich würde den Nachrichtenbunker sprengen. Das ist Unsinn."
"Es wäre das sicherste", sagte Stauffenberg. Wenn es ihm möglich war, Hitler in die Luft zu sprengen, musste es Fellgiebel doch schaffen, den Nachrichtenbunker zu zerstören.
"Aber das ist Unsinn!", wiederholte der General schwer atmend. Er neigte in solchen Situationen zu heftigem Aufbrausen; nur mühsam beherrschte er sich. Vielleicht waren Lauscher in der Nähe. Er war ein mutiger Mann, körperlich kräftig, ein guter Reiter und Fechter – aber was man da von ihm erwartete, ging zu weit.
"Es handelt sich nicht um ein, sondern um fünf Gebäude, die ich in die Luft jagen müsste, Oberst! Dazu brauchte ich ein paar Wagenladungen Sprengstoff. Das sind doch Bunker mit sechs Meter dicker Betondecke, genau wie der Führerbunker."
"Können Sie nicht einige wichtige Apparaturen zerstören?"
"Mein lieber Oberst, wir haben eine SS-Besatzung im Hauptquartier. Nur zwei oder drei meiner Leute sind eingeweiht. Die übrigen würden sofort nach der Wache rufen. Zerstören – da käme ich nicht weit."
"Ich verstehe."
"Was ich wirklich machen kann, ist, den Befehl erteilen, alles zu blockieren..., sobald es irgendwo hier im Gelände knallt."
"Wie lange können Sie die Sperre aufrechterhalten?"
"Drei Stunden", antwortete der General.
"Das genügt", sagte Stauffenberg. "In vierzig Minuten ist es soweit."
Er schüttelte Fellgiebel die Hand und ging, die schweinslederne Aktentasche unterm linken Arm, in derselben Richtung zweihundert Schritte weiter, auf Feldmarschall Keitels Unterkunft zu.
OKW-Chef Keitel, den Stauffenbergs Freunde "Lakaitel" oder "Nickesel" nannten, war ein Hitler völlig ergebener Offizier; er pflegte den unsinnigsten Befehlen beizupflichten. Diesen von ihm tief verachteten Mann suchte der Oberst auf, um einige Punkte zu erörtern, die er in der Lagebesprechung angeblich vorbringen wollte. Wenn er lange genug bei Keitel blieb, würde der ihn selbst bei Hitler einführen, was günstig war. Er sprach lebhaft und eindringlich mit dem Feldmarschall, scherzte, heuchelte Siegeszuversicht, tat alles, um keinen Verdacht zu erwecken. Keitel lobte einige seiner Vorschläge.
"Unter den zweieinhalb Millionen Mann, die das Ersatzheer hat", sagte Stauffenberg, "sind zur Zeit vierhunderttausend Rekruten bereit zur Frontabsendung, fünfhunderttausend noch in der Ausbildung. Bei diesen könnte man den letzten Teil der Ausbildung weitgehend in den frontnahen Raum verlegen, so dass im Falle eines plötzlichen Durchbruchs wenigstens Sperrverbände zur Stelle sind."
"Keine schlechte Idee", antwortete Keitel. "Das können Sie ja dem Führer nachher selbst vortragen. Mir scheint es ein, äh, ganz konstruktiver Vorschlag zu sein. Müssen sehen, dass ihn die anderen Herren unterstützen."
Gegen zwölf Uhr dreißig wurde der OKW-Chef unruhig, sah mehrmals auf die Uhr, räusperte sich und versuchte, Stauffenbergs Redefluss zu unterbrechen. Der aber sprach und sprach; er wollte und musste einen vorzeitigen Aufbruch verhindern. Schließlich fiel ihm Keitel ins Wort: "Herr Oberst, die Lage! Ich darf bitten. Der Führer ist stets pünktlich!"
Sie standen auf. Während der Feldmarschall, sein Adjutant und ein hinzugekommener Generalmajor ihre Mützen griffbereit hatten und das Gebäude verließen, ging Stauffenberg in den Garderobenraum. Dort öffnete er in fliegender Hast seine Aktentasche, schob Papiere beiseite, die über der Sprengladung lagen, griff eine kleine Kombizange, die er mit seinen drei Fingern betätigen konnte, machte sich am Zünder zu schaffen. Doch die Zange rutschte ab. Er biss sich auf die Lippe; seine verstümmelte Hand bebte. Draußen rief jemand: "Dalli, dalli, wir kommen zu spät!" – Er fluchte, setzte die Zange wieder an. Seine Backenmuskeln traten hervor. Diesmal gelang es; er drückte den Zünder ein.
Der Oberst trat ins Freie, tief atmend, die Mütze schräg auf dem Ohr, umgeschnallt, die lederne Tasche unterm Arm. Sie enthielt ein Kilogramm Hexit, einen englischen Sprengstoff von großer Brisanz, und der Zünder lief. Es war ein chemischer Zünder: Eine Säure zerfraß den Sperrdraht, der den Schlagbolzen noch zurückhielt. Genau zehn Minuten brauchte sie dazu – dann würde der Bolzen, von einer Feder getrieben, auf das Zündhütchen schlagen... Jetzt war die Bombe scharf.
"Herr Oberst, darf ich Ihnen die Tasche abnehmen?", fragte Keitels Adjutant den Einarmigen höflich. "Lassen Sie nur", wehrte Stauffenberg leichthin ab. Er sah zur Uhr; es war zwölf Uhr zweiunddreißig. Jetzt begann die Führerbesprechung. Sie schritten rasch aus. Bis zur Lagebaracke waren es drei Minuten Weg. Über seiner Nasenwurzel erschienen Schweißtröpfchen. Wenn sie nun aufgehalten würden, wenn Hitler nicht rechtzeitig käme... Aber nein, Hitlers pedantische Pünktlichkeit war ja bekannt.
Sie passierten die SD-Wache des Sperrkreises I. "Meine Herren, meine Herren", klagte Keitel, "ich fürchte, wir verspäten uns." Im Vorraum der Lagebaracke schnallten sie die Koppel mit Pistolentaschen ab; es war verboten, in Hitlers Gegenwart Handwaffen zu tragen. Stauffenberg sah sich um. Bis hierher war er noch nie gekommen. Die große Baracke, an deren Kopfseite sich das Konferenzzimmer befand, war mit weißer Strohpappe ausgeschlagen. Die Pappe würde gut brennen. Ein halbmeterdicker Betonmantel umgab als Splitterschutz die Holzwände und die Decke; er würde den Explosionsdruck stauen. Leider waren Fenster und Türen in dem Betonpanzer ausgespart, und die Fenster standen wegen der Hitze offen.
Aus dem Lageraum drang die Stimme des Generalleutnants Heusinger; der Operationschef referierte über die Situation an der Ostfront. Stauffenberg sah sofort: Zwei Dutzend hohe Offiziere umstanden den sechs Meter langen Kartentisch, dessen dicke Eichentafel auf zwei massiven Sockeln ruhte. Hitler, in braunem Rock und schwarzer Hose, nur wenige Schritte entfernt an der Breitseite des Tisches stehend, wandte ihm den Rücken zu, flankiert von seinen ergebensten Beratern – rechts der schmächtige, farblose Heusinger, links der rotgesichtige Generaloberst Jodl. An einem der zehn Fenster rekelte sich SS-Obergruppenführer Fegelein, der Schwager Eva Brauns. Im Hintergrund stand der drei Meter breite Radioschrank des Diktators.
Bei ihrem Eintritt unterbricht Heusinger seinen Vortrag, Hitler dreht sich um, und Keitel meldet: "Mein Führer, darf ich Ihnen Herrn Oberst Graf von Stauffenberg vorstellen, der nachher zur Lage des Ersatzheeres vortragen wird." – Hitler reicht Stauffenberg die Hand, der, um sie zu nehmen, die Mappe abstellen muss. Er lehnt sie vorn an den rechten Sockel des Tisches, nur drei Schritte von Hitler entfernt. Ein Generalstabs-Oberst, der dort auf einem Hocker sitzt und den die Tasche stört, schiebt sie mit dem Fuß etwas von sich weg. Stauffenberg tritt nach dem Händedruck bescheiden zurück. Heusinger spricht weiter.
Stauffenberg sieht verstohlen zur Uhr. Er hat die Bombe placiert, jetzt drängt die Zeit. Sechs Minuten sind vergangen, seit er in Keitels Quartier den Zünder eingedrückt hat... Er steht unbeweglich. Nur seine Augen huschen umher. Niemand achtet darauf, dass er zwei-, dreimal zur Uhr geschaut hat. Plötzlich beugt er sich zu dem Obersten, vor dessen Füßen die Tasche steht, und sagt: "Ich erwarte dringend ein Berliner Gespräch. Ich brauche die Angaben zum Vortrag. Das Gespräch ist noch nicht da, ich will schnell erinnern."
Der Stabsoffizier nickt, Stauffenberg verlässt – von den anderen unbemerkt – den Raum. In der Garderobe setzt er seine Mütze auf, greift nach dem Koppel und hastet aus der Baracke. Ein Feldwebel vom Fernsprechdienst sieht ihm verwundert nach. Noch drei Minuten! Nach hundert Schritten erreicht er den Sperrkreis I, zeigt seinen Sonderausweis mit der Unterschrift des Leibwächters Rattenhuber und darf das Tor im Maschendraht passieren. Noch zwei Minuten!