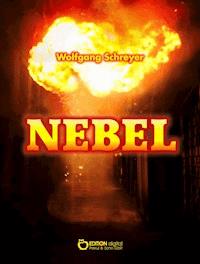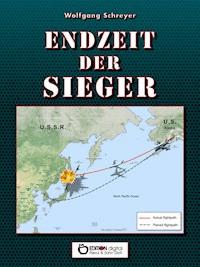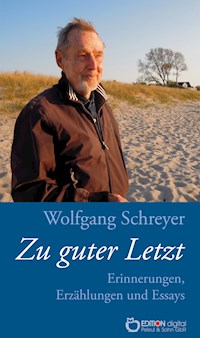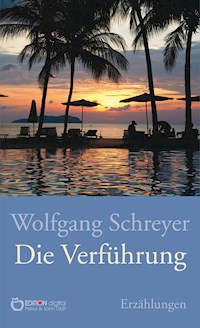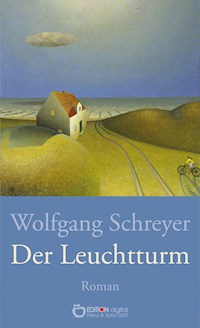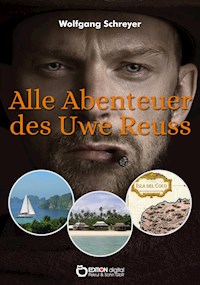8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
KARIBIK, 1984 und 1986: Schwungvoll beginnt Uwe Reuss mit Linda, seiner nächsten Partnerin, ein neues Leben. Sie fassen Fuß auf Navassa und betreiben dort ein Feriendorf. Bis es ihnen dämmert, dass dies nur fremde Interessen deckt: US-Rauschgift-Bekämpfer, internationale Drogenhändler, übermächtige Finanzjongleure oder Waffenschieber? Da bleibt nur rascher Rückzug auf die friedliche Insel Grand Turk. Doch dem Spiel der Gewalten hält auch diese Ausweich-Existenz am Ende nicht stand. Wieder zieht die tragische Gestalt des Kubaners Sergio Figueras das Paar in den Strudel bitterer Ereignisse. Nach seiner „Suche“ und dem „Fund“ setzt Wolfgang Schreyer mit „Der Verlust“ den Abenteuern des Uwe Reuss, dieses Helden wider Willen, ein verblüffendes Ende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der Verlust oder Die Abenteuer des Uwe Reuss
ISBN 978-3-96521-447-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 2001 im BS-Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
2021 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Für Paul Markus Daniel
Wir liegen alle in der Gosse, aber einige von uns blicken nach den Sternen.
Oscar Wilde
NAVASSA ISLAND
Verdecktes Feuer brennt mit größerer Kraft
William Shakespeare
1
Uwe Reuss spürte den Morgenwind im Gesicht. Frischer Vorgeschmack, noch mal in Panama, nach all der Zeit, welch ein Wiedersehen! Die City mit ihrer Geschäftigkeit, den Schuhputzern, Losverkäufern und Denkmälern, dem quirlenden Verkehr um die Hoteltürme, die Firmen- und Bankfilialen oberhalb der mürben Mauern von Altstadt und Hafen (ein flacher historischer Pfuhl, bloß noch für Fischer gut). Es roch ganz wie damals; die Prise aus Seeluft und Auspuff, Kaffeerösterei und Parfüm – wenn man Damen nahekam –, all das rief in Reuss einen Strom von Gedanken und Bildern wach: Gespeichertes, vergessen Geglaubtes, die Erinnerung an die Tage im Juni 1979, als Ginas Vater, Professor Dahlmann, sein Freund gewesen war und es weidlich ausgenutzt hatte … Erfahrung macht reich, man ist gewappnet. Im Hinblick auf Sergio Figueras scheint das auch nötig. Der war jetzt neben ihm wie einstmals Dahlmann, aber wortkarg, schwer durchschaubar, offenkundig etwas planend. Sergio, den es nie wirklich erwischt. Der Macho, von Gina blind geliebt, damals und inzwischen wieder.
Längst Vergangenes umwehte Reuss und stimmte ihn weich, sehnsüchtig, auf angenehme Art melancholisch. Ach, die Zeit auf den Bahamas, als man sich noch nicht wehren musste! Inseln der Sinnenlust in kaum lädierter Ursprünglichkeit. Der Wellenschlag, das Knistern der Palmen, das Boot – ihre „Fantasy“, und die Zärtlichkeiten atemloser Liebe, womöglich – von ihm noch mehr geschätzt – schon nachmittags. Nichts in seiner Erinnerung kam den Tagen auf Rum Cay gleich. Die Sonnenaufgänge, der schimmernde Ozean, das Fehlen beinah jeder Obrigkeit! Weißer Sand unter grünen Wedeln, biblisches Land der Verheißung; und dann das, wonach er sich ein Leben lang gesehnt hatte, jäh versunken. Sein Traum, wer gab ihm den zurück? Sergio doch nicht, mit dem fing ja die Austreibung an. Bleib entspannt, redete er sich zu, schließlich hast du durch ihn Linda Prout gefunden, dein neues Glück … Sie wartet auf dich im Hotel. Und keineswegs erwartet sie, dass du ihr ein Paradies zu Füßen legst. Sie will nur wissen, wie es mit uns weitergeht.
Über Nacht hatte es geregnet, die Luft war ziemlich klar. Bald würde sie in Staub und Hitze flirren, noch aber fühlte er sich von ihr erfrischt. Ihm wurde bewusst, dass es diese Stadt doppelt gab: in seinem Gedächtnis und in Wirklichkeit. Beides schien deckungsgleich, rührte daher seine Stimmung? Die Gewissheit, es müsse das gut werden, was er hier unternahm? Kann sein; war es doch bequem und erfreulich, einen Ort so wiederzufinden, wie man ihn verlassen hatte. Andererseits zeigte es einem, das Leben ging weiter, als hätte man den Ort nie betreten. Man ging weg und alles blieb beim Alten, kein Mensch hinterließ eine Spur; bis auf die starken Männer, die Machthaber. Dem Land den Stempel ihrer Persönlichkeit aufdrücken, falls sie eine hatten, und so ihren Tod überleben – sollte es das sein, was diese Burschen trieb? Keiner stieg freiwillig vom Thron.
Vor der Glasfront der Banco Alemán Panameno stupste Figueras ihn an; der Gedankenfaden riss. Vor Sergio betrat Reuss den klimatisierten Schalterraum, er gab einem Clerk den Scheck der Chase Manhattan Bank, ihrer Filiale in David, gleich hinter der Grenze von Costarica.
„Sie haben 100.400 Dollar bei uns gut“, sagte der Mann. „Möchten Sie ein Konto eröffnen, Sir, oder es sonst wie verwenden?“
„Ja, sonst wie.“
„Gut, wir könnten es in Wertpapieren anlegen, für Sie arbeiten lassen. Zum Beispiel Kanalaktien – kein Risiko, Rendite etwa acht Prozent …“
„Lieber Cash, wenn’s Ihnen nichts ausmacht. Kanäle sind mir zu finster.“ Reuss sprach gedämpft, sehr selbstsicher. Immer, wenn er etwas tat, das ihm kaum vertraut und nicht ganz geheuer war, suchte er instinktiv den Eindruck von Gleichmut zu erwecken.
Der Clerk wich hinter ein Drahtgeflecht zurück, er verzog den Mund, als belustige ihn der Gedanke, die Auszahlung einer so lächerlichen Summe könne sein Haus überfordern. Er gab die Gutschrift dem Kassierer, der grüngraue Geldbündel in seine Zählmaschine schob.
„Das ist leider alles, Sergio“, sagte Reuss. „Mehr ist von euren 89 Prozent nicht übrig geblieben. Dein Anwalt in San José, dieser Bandit, unter einer halben Million wollte der keinen Finger rühren.“
„Du weinst doch dem Geld nicht etwa nach?“
„Nicht mal verteidigen musste dich der Kerl.“
„Er hat etwas Besseres getan – die richtigen Leute geschmiert. Ich war nicht scharf auf den Prozess.“
„Irgendwo tut’s doch weh, wie einem das zerrinnt. Da ziehst du unter Blut, Schweiß und Tränen drei Millionen an Land, und dann nehmen sie dich aus wie eine Weihnachtsgans. Auch die Yankees in David haben abgesahnt, dort fing das schon an. Mindestens 800.000 ist das Platin wert gewesen, fünf Prozent zogen sie gleich ab.“
„Dein Anteil ist hoffentlich unversehrt?“
„Davon ist schon noch was übrig.“
„Das Fünffache deiner Investition, damit bist du doch gut bedient. Und ein paar Große gibt’s für dich noch dazu.“
„Wieso das, Sergio?“
„Unser Präsident ist tot. Ja, den armen Burns musste ich von der Liste streichen. Der Jamaica-Clan hat ihn erledigt, keine Ahnung, warum. Wir teilen seine drei Prozent jetzt auf; durch drei teilt sich das leicht.“
Während Reuss an Burns dachte – kein sympathischer Mensch, die feuchten Hände, der umherhuschende Blick –, blätterte man an der Kasse das Geld vor ihn hin. Er quittierte und schob es dem Partner zu. Der zählte 7.600 Dollar ab und gab ihm die zurück. „Was ist mit den Hinterbliebenen?“, fragte Reuss.
„Für uns hat Burns keine gehabt. Nicht im Sinne der Satzung. Laut Ziffer neun fällt beim Tod eines Gesellschafters sein Anteil den Überlebenden zu … Steck es weg, es gehört dir.“
Unter solchen Reden traten sie hinaus auf die Avenida Arosomena. Burns, der glatzköpfige Advokat! Es war Reuss, als höre er ihn sagen: Sie können Ihre Satzung jederzeit durch Mehrheitsbeschluss ändern, ohne Behinderung von Amts wegen. Sie unterliegen keiner Kontrolle auf Grand Cayman. Nur Vorstand und Aufsichtsrat, also wir vier, sollten uns einmal im Jahr zusammensetzen. Das ist alles, die Geschäftsgrundlage … Und Reuss erinnerte sich auch des Nachtrags im Gesellschaftsvertrag der Offshore Treasure Salvage Company, des makabren Punktes neun. Den hatte Sergio ihm vor acht Wochen in Puntarenas erläutert, als das Wagnis noch vor ihnen lag und sie im Motel Orlando darüber stritten, ob Linda mitfahren dürfe oder nicht.
Den Wagen hatte Figueras um die Ecke geparkt, neben der Bank of London and Montreal. Dort zahlte er, immer auf der Hut, das meiste Geld wieder ein. „Das beste an dem Haus ist die Kabelanschrift“, bemerkte er. „Lonmont, das merkt sich. Immer fächern! Nie alle Eier in einen Korb.“
Dies hatte man von ihm schon gehört. Sergio spielt den Geschäftsmann, er gibt vor, das zu sein, was er gar nicht ist: seriös, für Linda akzeptabel … Während der sechs Wochen, die er in Costarica eingesessen hatte, war seine Schatztaucherfirma versunken. Unfähig, Löhne und Rechnungen zu bezahlen, ging die Cayman Marine Recoveries unter in der Pleite. Die Gläubiger hielten sich schadlos an der Villa bei Mount Pleasant, Sergio begann mit Gina fast bei Null – doch einen Spieler stört das nicht.
Sie fuhren los. Um die elegante Via Espana drängten sich Dutzende von ausländischen Geldinstituten und ein paar hundert Briefkastenfirmen. Steueroase Panama. „Was nun?“, fragte Reuss. „Löst du die Offshore Treasure gleichfalls auf?“
„Nicht, bevor der Rest verteilt ist.“
„Auf Cocos kann keiner zurück, Costarica hat ein Schiff hingeschickt.“
„Hast du das Gold vergessen, in der Bahia Piedra Bianca?“
„Lass Gras darüber wachsen. Wer anders findet es nicht.“
„Noch ist das eine Dreiviertelmillion, Uwe, aber der Goldpreis sinkt.“
„Ich bin heilfroh, rauszusein aus dem verdammten Land.“
„Dann hole ich’s eben allein. Ein Zentner Gold, das ist kein Problem.“
Weshalb eigentlich nicht? Er, Reuss, hatte das Platin über die Grenze gebracht, sollte der Partner das Gold doch holen. Vor den zwei Hotels, wo ihre Frauen warteten (Linda im Panama Hilton, Gina im El Continental), bog Sergio plötzlich ab. „Ich will dir etwas zeigen.“ Er fädelte sich in den Verkehr der Avenida de los Mártires und begann, von einer Insel zu reden, die es wert sei, besucht zu werden. Angeblich stieg sie grün-weiß aus dem Meer, gut 600 Seemeilen nördlich von Panama, in der Windward Passage zwischen Jamaica und Haiti, dem sie einstmals auch gehört habe. Ein Klotz aus porösem Kalkstein, durchsetzt von einem Labyrinth endloser Höhlen, bedeckt mit Zwergpalmen und Bambus; bis auf die Seevögel und das Personal des Leuchtturms unbewohnt, seit langem. „Dort wäre dein Geld bestens angelegt, Uwe. Erstklassiger Standort! Bis 76 Meter über dem Meer, keine Quadratmeile groß … Das wäre dein Königreich.“
Sergio, der Pläneschmied. Reuss fühlte sich versucht, nach dem Quadratmeterpreis und den Erschließungskosten zu fragen. Am Vorabend, auf der Terrasse des Hilton, hatte er von seinem Wunsch erzählt, ein kleines Feriendorf zu gründen, zum Urlaub à la Robinson, vielleicht mit einer Surf- und Segelschule, um abseits der Tourismusströme sein Auskommen zu finden, im Einklang mit sich und der Natur. Nur die Bahamas musste er meiden, seit die Mafia in der Person des Polizeioffiziers Hindmarsh ihn dort verjagt und enteignet hatte.
„Und da liegt noch ein ungehobener Schatz? Vermutlich hast du wieder eine Karte?“
„Nein. Bloß Guano liegt da herum, Vogelmist. Den hat man früher abgebaut.“ Figueras rauchte eine seiner dünnen schwärzlichen Zigarren an. „Der wahre Reichtum ist die Natur. Müssen es immer Schätze sein? Ein stiller Fleck, ganz wie von dir erträumt. Einsam in der Karibik und trotzdem nicht aus der Welt.“
Er sprach wie ein Grundstücksmakler, der einen Alterssitz empfiehlt. „Und wie heißt das Paradies?“
„Navassa Island.“
„Weshalb wohnt da so gut wie keiner?“
„Weil künstlicher Dünger inzwischen billiger ist.“
„Sergio, wo ist der Haken?“
„Nirgends. Zwar ist Navassa US-Besitz, pro forma, aber ohne jegliche Behörde. Der Leuchtturmwärter kommt aus Puerto Rico, von da wird die Insel auch verwaltet. Die Yankees sind völlig desinteressiert.“
„Trotzdem! Das kann ich nicht riskieren.“
„Und ob du’s kannst. Das Amt in San Juan wird jauchzen, wenn endlich einer kommt, der für den Felsen etwas tut.“
„Lieber nicht. Die haben mich im Computer. Deren Drogenfahndung glaubt doch, ich hätte was mit dem Tod von Alec Bentley zu tun, den sie nach Rum Cay geschickt hatten.“
„Nun halt erst mal die Luft an und hör mir ein bisschen zu. Es ist ganz einfach. Wir pachten den Südwestteil, ohne dass du nach außen in Erscheinung trittst.“
„Willst du das etwa machen?“
„Ich denke, Linda wird es für dich tun. Lass alles auf ihren guten britischen Namen gehen; wen sie dann beschäftigt, kümmert keinen Schwanz. Nimm sie als Firmenschild.“
„Den Südwestteil pachten, weshalb?“
„Na, irgendwo müsst ihr ja bauen. Der Südwesten hat Sandstrand und liegt in Lee. Die kleine Bucht heißt Lulu Bay, der einzige Ort, wo man von See herankommt. Von dort aus wird auch der Leuchtturm versorgt, per Dampfkran oben auf dem Hang.“
„Du kennst dich aus, wie?“
„Kunststück, jeder Seemann kennt das Inselchen in der Passage. Der Weg von der US-Ostküste nach Panama führt direkt daran vorbei. Das Ding sieht mit all den Löchern von weitem aus wie ein versteinerter Schwamm. Nachts hast du den im Radar, das Echo kommt auf 20 Meilen, noch ehe am Horizont der Leuchtturm blitzt.“
„Und worum geht’s dir dabei?“
„Darum, dass du glücklich wirst. Ich hab dich von Rum Cay weggelockt, dein Boot verbrannt, immerhin, dein Mädchen läuft weg, zu mir; da scheine ich dir noch was zu schulden. Zumindest einen guten Rat.“
„Sehr nobel gedacht.“ Ein Freundschaftsdienst. Aber stimmte das denn, war es glaubhaft bei einem wie ihm? Sergio im Heiligenschein der Nächstenliebe und Freundestreue – nicht sehr plausibel. Selbstlosigkeit passte zu ihm wie die Pille zum Papst.
„Na schön, ich denke dabei auch an mich“, sagte Figueras, als spüre er die Zweifel. „An ein Plätzchen zum Untertauchen, notfalls, bei Bedarf, wenn’s mal ganz dick kommen sollte. Der kluge Mann baut vor.“
Das also war es. Fluchtburg Navassa. Das karibische Asyl. Halbvergessenes fiel Reuss ein, Bemerkungen Sergios zum Wert solcher Inseln. Ihre Verwendbarkeit als Zuflucht und Versteck. Das hatte ja Tradition, schon die Piraten hatten gewusst … In seinem Kopf spulte ein Faden ab, mit huschenden Bildern, verwischten Sätzen. Das Wunder der Erinnerung! Das Hirn verknüpft Dinge, es zieht ans Licht, was es gespeichert hat – ob gestern erst oder vor langer Zeit.
Jetzt durchfuhr man Quarry Heights, einen Vorort, der schon Kanalzone war. Ein Schwall heißer Luft drang ein, als Reuss die Scheibe wegdrehte. Es roch nach Hafen und verbranntem Kaffee; den rösten sie hier zu stark … Was führt Sergio im Schilde? Nun passierte man den Kanal auf der Puente de las Americas. Am Südufer schwang sich die Straße zu dem Ort Farfán empor. Schilder wiesen nach Fort Knobbe, dem Fliegerhorst Howard und einer Marinebasis. In diesem Moment erkannte Reuss den Weg. Bald vier Jahre war das her! Damals war er Sergio im Taxi gefolgt, bis zum Pier 4 am Zaun des Marinehafens. Dort hatte die „Port of Spain“ gelegen, auf der er dann Gina fand. Der rostige Frachter, vor seinen Augen war er beladen worden: Kisten voller Waffen. Navassa als Drehscheibe, als Waffendepot? Ein Arsenal im Meer, das passte besser zu Sergio als ein Asyl; über Fluchtwege zerbrach der sich nie vorher den Kopf, immer erst, wenn es soweit war.
Am Pier 4 lag jetzt ein schnittiger Viermaster, eine Hochseejacht, hinreißend gebaut. Reuss schätzte das Schiff auf 3.000 Tonnen. Weiß glänzte es im Sonnenlicht, und der Hauptmast ragte ungefähr 50 Meter vom Deck an himmelwärts; bei Sturm eine Herausforderung an den schlanken Rumpf … „Hat die Jacht etwas mit Navassa zu tun?“
„Nein. Höchstens indirekt.“
„Worin liegt die Verbindung?“
„Im Geistigen. Ich schätze die Jacht so wie du stille Inseln.“ Figueras hielt vor der Schiffstreppe und stieg aus „Ein Ding für Milliardäre“, sagte er über die Schulter. „Lass uns entern, das muss man gesehen haben.“
Das Schiff hieß Sea Ghost. „Du darfst an Bord?“
„Na sicher. Und jeder in meiner Begleitung.“
„Wieso bist du dort willkommen?“
„Man ist gern gesehen, wo man keine Fragen stellt.“
Reuss fühlte sich gehemmt, dem Mann zu folgen, der da ein Loblied auf die Sea Ghost sang. Präsident Roosevelt sei einst an Bord gewesen, auch einem karibischen Diktator habe sie gehört, und so weiter. „Einer der sechs größten Segler, die es überhaupt noch gibt; der einzige mit dem Pomp der Vorkriegszeit …“
Etwas Unerklärliches hielt Reuss zurück, er kam nicht dagegen an. Dieses Schiff oder ein anderes – er würde am Pier 4 keinen Fuß mehr auf ein Fallreep setzen.
2
„Sergio konnte es kaum fassen, dass ich sein Schiff nicht sehen wollte“, sagte Reuss zu Linda Prout.
„Und, weshalb hast du verzichtet?“
„Ehrlich, ich weiß es nicht. Vermutlich wäre ich vor Neid erstickt. Schon der Rumpf lässt das Tempo ahnen, die Angriffslust, mit seinen Linien, die zum Bugspriet ansteigen. Wie der Kopf eines Schwertfischs, weißt du?“
„Das klingt aber recht schwärmerisch.“
„Nein, mir lag nichts daran“, fuhr Reuss über einer Karte der Windward Passage fort, die er mitgebracht hatte. „Wozu Wasserhähne aus purem Gold bestaunen, versenkbare Wände und Betten, die sich auf Knopfdruck soweit unter dir heben, dass du nicht aufstehen musst, um das Meer zu sehen. Barbarisch! Sündhafter Überfluss …“ Er tippte auf das winzige Oval bei Haiti. „Dort bauen wir dazu den Gegenpol, unser Robinson-Dorf.“ Das Kontrastmilieu.
Das muss ihr doch eingehen? Er entwickelte den Plan und skizzierte die Finanzierung.
Nach einer Welle fragte sie: „All das ist deine Idee?“
„O ja; aufgrund bestimmter Informationen.“
„Ich ahne, von welcher Seite.“
„Gut, von ihm, aber es ist okay.“ Reuss sah die Falte auf ihrer Stirn. „Er selbst ist kaum daran interessiert. Er hat für uns nachgedacht, dankbar, dass wir ihn herausgeholt haben. Es liegt kein Schatz dort, bloß Vogelmist. Linda, was hast du gegen Vogelmist?“
„Das habt ihr einfach so beschlossen, ohne mich. Aber auf meinen Namen soll es gehen.“
„Für die Yankees bist du ein unbeschriebenes Blatt.“
„Na fein. Du versteckst dich hinter mir, und er versteckt sich hinter uns. Aber zu welchem Zweck?“
„Ihm geht es um ein Refugium, falls er mal schnell verduften muss.“
„Ich hab’s ja geahnt! Dieser Mann zieht dich ständig in etwas hinein. Er ist und bleibt ein Filou.“
„Nicht uns gegenüber, da war er immer fair. Hätte er mir sonst heute früh die Summe ausgezahlt?“
„Wer weiß, warum er das tat. Leute wie er leben nur für sich. Diese Jacht wird auch einem gehören, der durch dunkle Geschäfte reich geworden ist.“
„Wie kommst du darauf?“
„Wenn er an Bord darf, muss es ein Komplize von ihm sein.“
„Linda, wir sind auch seine Freunde.“
„Du vielleicht, ich nicht.“
Das ging zu weit, irgendwie musste er sie bremsen. Trotz ihres zarten Wesens, in dem Punkt trat sie ihm störrisch entgegen. Er durfte nicht zulassen, dass sie sich zwischen ihn und Sergio schob. – „Wenn du der Ansicht bist, hinter jedem großen Vermögen steht ein Verbrechen irgendwelcher Art, okay, in diesem Sinne hast du natürlich recht.“
„Weich mir nicht aus“, bat sie. „Sei nicht so glatt und philosophisch. Ich bin überzeugt, er hat mit dieser Insel etwas vor. Und wir geben mit dem Feriendorf die Tarnung für ihn ab.“
„Was soll er denn dort vorhaben?“
„Das eben möchte ich gern wissen, bevor ich mich darauf einlasse, Uwe.“
„Gut, gehen wir also hinüber, und du fühlst ihm auf den Zahn …"
Draußen war es schrecklich heiß. Auf dem Weg zum El Continental schätzte Reuss die Chance ab, von Sergio mehr zu erfahren, als der ihm hatte sagen wollen. Linda an seiner Seite schwieg … Er seufzte, und die gehobene Stimmung vom Vormittag schlüpfte aus seiner Brust wie ein Atemzug. Das Leben war verworren, die Zukunft lag im Dunst, immer schon; übrigens für jeden. Immer würde etwas da sein, das sich beim besten Willen nicht voraussehen oder durchschauen ließ. Leben hieß ja, den nächsten Schritt zu tun, ohne den übernächsten zu kennen. Dass es so war, folgte aus all den Erfahrungen, die hinter ihm lagen, ob in Europa, Afrika oder hier. Und das erst machte es spannend. Neugier regte an, Überraschung war das Salz an der Suppe – für Linda freilich nicht. Sie wünschte kein weiteres Abenteuer, ihr musste stets alles klar oder doch gut überschaubar sein, das hatte er begriffen. Es war der Punkt, in dem sie nicht harmonierten … Keine Partnerschaft ohne solch einen Punkt.
Navassa Island, löchrig wie Schweizer Käse. Welche Möglichkeiten bot das, was fing ein Mann wie Sergio mit einer derart unterminierten Insel an? Gewiss lag es nahe, an ein Versteck zu denken: für Rauschgift, Waffen oder einfach für ihn selbst. Letzteres hatte er schon zugegeben, es musste aber noch nicht alles sein. Seine Aufrichtigkeit wirkte nicht ganz echt, etwas schien faul an der Sache, irgendein Detail – das sich dem Zugriff entzog – stimmte offenbar nicht. Was kam denn noch infrage, womit ließen sich die Poren des „versteinerten Schwammes“ wohl außerdem füllen? Nun, zum Beispiel mit Giftmüll oder mit Fässern voll radioaktiven Drecks. Wohin mit dem Zeug, das fragte man sich auf der ganzen Welt, viel Geld hing daran … Nein, das strapazierte die Fantasie. Die Insel hatte keinen Hafen, es gab also ein Transportproblem. Auch war sie amerikanisch, zumindest formell; Kontrollen blieben denkbar. Navassa lag an einer stark befahrenen Route, wenn dort ein Schiff ankerte, fiel es unweigerlich auf; und ein amtlicher Verdacht würde zu Inspektionen führen, durch die US-Küstenwacht. Reuss schüttelte den Kopf. Arsenal oder Müllplatz – alles Humbug. So dumm kann Sergio nicht sein, der kennt andere Wege zum schnellen Geld. Aber was dann, worum geht es ihm wirklich?
In der Hotelhalle war es wunderbar kühl. Der Lift trug sie hinauf zu dem Apartment im obersten Stock. Es öffnete ihnen Gina Dahlmann. Sergio schlafe, sagte sie verhalten, er habe sich, von der „Sea Ghost“ zurück, gleich hingelegt.
Linda fragte: „Ein anstrengender Tag für ihn?“
„Es sieht so aus. Auf der Jacht wird halt gepokert und getrunken, die gehört Geschäftsfreunden von ihm … Kann sein, sie nehmen uns mal mit. Dich nicht, Uwe, du hast dich ja nicht hochgetraut; warum eigentlich?“
„Keine Ahnung. Ein Instinkt – gefühlsmäßige Aversion. Ich nehme an, der Schornstein war schuld.“
„Der Schornstein?“
„Der verdirbt die Silhouette. Hat mich ans vorige Jahrhundert erinnert: die Dampfer mit Segeln. Ein Stilbruch, Gina. Der Schlot passt nicht ins stolze Bild.“
„Das soll ich dir glauben?“ Sie lud zum Sitzen ein und begann, Cocktails zu servieren. „So ein Segelfan bist du doch gar nicht, dass ein Schornstein dir ein Schiff vermiest.“
„Segelfan und Inselnarr …“ Reuss beobachtete sie. Ginas Mund und Augen waren ausdruckslos, in ihrer Haltung lag etwas Gebieterisches, Konspiratives. Als die Drinks fertig waren, legte sie den Finger an die Lippen, wies auf die Schlafzimmertür und stieß leise mit ihnen an. Sie weiß mehr, dachte er. Sie wirkt eingeweiht; ich kenne mich mit ihr aus. Und sie scheint Linda noch immer nicht zu mögen, meist richtet sie das Wort an mich. Ob ihr etwas zu entlocken ist? Gegen Sergios Willen schwerlich.
Um Sergio nicht zu stören, ging man auf den schattigen Balkon. Im Seewind war es dort erträglich. Fern über dem Pazifik trübte sich der Himmel. Zwei Staffeln driftender Wolken rückten aufeinander los. Reuss vertiefte sich in den Anblick, es kam ihm so vor, als zögen die Wolkenbänke trotz der verschiedenen Höhe in den Kampf. Darunter duckte sich bleigrau das Meer, schrumpften die Felsen des Perlen-Archipels weg bis auf ein Eiland, das seltsam kantig über dem Horizont schwebte; eine Luftspiegelung gewiss. Ohne dass er einen Grund dafür sah, berührte ihn dieses Bild. Es schlug ihn in Bann, als werde ihm dort ein Wunsch erfüllt, eine lang gehegte Sehnsucht, gelänge es nur, das Gebilde zu betreten. Und dabei überkam ihn ein Vorgefühl, streifte ihn der Eishauch einer Ahnung von Gefahr … Dann aber, wie durch Zauber, verschwamm die Silhouette, löste sich im Nebel auf. Weggewischt die Fata Morgana, zerbrechlich und vergänglich wie alles auf der Welt.
„Wisst ihr übrigens“, hörte er Gina fragen, „dass es noch Gold auf den Antillen geben soll? Man hat es jetzt erst entdeckt, und zwar auf Fotos aus dem Weltraum.“ Sie schlug eine Zeitung auf und reichte sie ihm – nicht etwa Linda.
Der Passus lautete: „Bekanntlich gelten die Goldvorkommen in Venezuela, mit Fortsetzung auf westindischen Inseln, als erschöpft, Sie erlauben keinen sinnvollen Abbau mehr. Doch hat ein Team japanischer Forscher beim Auswerten der Bilder des Fernerkundungs-Satelliten ,Spot‘ in Gesteinsschichten des westlichen Inselbogens überraschend Anzeichen für das begehrte Metall erspürt. Inzwischen schwitzen die Geologen im Labor so wie früher in der Wildnis. Künftig wird noch mancher Rohstoff am Schreibtisch entdeckt werden, und teure Probebohrungen nach Erdöl oder Edelmetallen dürften größtenteils entfallen.“ So stand es auf dem augenschonend getönten Papier der „Financial Times“. Während Reuss dies vorlas, behielt er Gina im Blick.
„Kann sein, das betrifft sogar Navassa“, sagte sie.
„Das glaubst du doch nicht im Ernst.“
„Ja, weshalb denn nicht?“
„Weil du’s sonst für dich behalten hättest.“
„Ach! Wo ich immer so lieb und hilfreich bin.“
„Hör zu, die Insel besteht aus Kalkstein, nicht wahr? Sie ist erdgeschichtlich viel zu jung, um ein Metall zu enthalten. Wie es auf der Kokosinsel kein Erdöl gab, weil sie vulkanischen Ursprungs ist, so liegt auf Navassa kein Gold – nur versteinerte Pflanzen und Tiere: Fossilien, umhüllt von Kalk …“
Es tat ihm gut, sein Fachwissen vorzuweisen, den kümmerlichen Rest. Doch mittendrin ging ihm auf, dass er sich vielleicht irrte. Der Kalksteinklotz Navassa, einst ein Stück Meeresboden, war mit ziemlicher Sicherheit vulkanisch hochgedrückt worden, bis auf 76 Meter überm Meer. Folglich saß darunter Eruptivgestein, und das konnte alle möglichen Erze bergen, selbst Gold. In der Theorie. Praktisch war es derart unwahrscheinlich, dass es ihm überflüssig erschien, diese Feinheit zu erwähnen.
„Vergiss es, Gina“, sagte er in dem Gefühl, von ihr nichts Brauchbares zu erfahren. Da kam nicht der kleinste Fingerzeig. Gina und ihr großer Sergio! Denen lag bloß daran, ihn hinzuhalten, mit allerhand Schnickschnack zu täuschen. Wenn überhaupt, legten die zwei eine kalte Spur, um ihn zu beschäftigen, bis seine Neugier erlahmen und er zu dem Schluss kommen würde, Navassa sei harmlos; eines der tausend karibischen Inselchen – ein Ort, an dem es kein Geheimnis gab.
3
Vier Monate später, eines Nachmittags im Juli 1983, kehrte Reuss in der „Fantasy II“ mit ein paar zahlenden Gästen von dem üblichen Törn heim nach Navassa. So von weitem, wie eine Platte im Meer, oben flach, leicht nach Norden gekippt, wirkte der Felsen erträglich. Von Steilhängen gesäumt, über dem Brandungsschaum, bot er wenig vom sanften Zauber der Karibik. Sicher, der Ort konnte ihm sein Rum Cay nicht ersetzen. Aber ein Tourist, auf Einsamkeit und Abenteuer aus, mochte es sich ja so wünschen. Und immerhin, sie hatten Fuß gefasst, Linda und er. Man hat sich eingelebt, ist etabliert, kommt geschäftlich fast so gut zurecht wie miteinander. Da muss man wohl zufrieden sein.
Nur fehlt es der Insel an Fluidum. Dreimal so groß wie Helgoland, ist sie doch menschenleer, unheroisch, geschichtslos, ohne Legende. Bar jeder Romantik, leider. Es sei denn, man findet die Wildnis schön, das Buschwerk oben auf der Tafel. Die verkrüppelten Zwergpalmen und Kakteen, die mit dem roten Oleander im Schutz der Westhänge wachsen. Der Leuchtturm ist reizlos, ein runder Schaft aus hellgrauem Beton. Anfangs locken noch die Höhlen mit ihrem Gewirr von Muscheln und toten Korallen, all den Fossilien – versteinerte Urzeittiere im Kalk. Bald aber bleibt man ihnen fern. Die Gänge fuhren nirgendwo hin, sie schrumpfen im Eingeweide der Platte, auch sind sie voller Fledermäuse. Die hängen in jedem Winkel, ihr Guano ist dunkel und stinkt, anders als der weiße, geruchlose Möwenmist im Freien. Da kehren selbst mutige Urlauber um.
Und das Gold? Das kannst du vergessen, hatte Reuss zu Gina gesagt. Ihn freilich ließ der Gedanke nicht los. Er war durch ein Dutzend Kavernen gekrochen … Noch in Panama hatte er mit Lindas Hilfe über den Büchern der Katholischen Universität (Universidad Santa Maria La Antigua) seine Kenntnisse aufgefrischt. Danach kam Gold meist gediegen vor, wenn auch fast immer legiert mit Silber, Kupfer oder sonst einem Metall. Es trat in Kristallen, Blättchen oder Körnern auf, den sogenannten Nuggets, und war ziemlich leicht zu erkennen. Es sollte nächst dem Eisen und dem Aluminium das in der Erdkruste am weitesten verbreitete Metall sein, kam jedoch nur in geringen Mengen vor, oft als Ader, als kilometerlanger Gang. Regelrechte Lager, Bonanzas wie einst in Nevada, waren die große Ausnahme.
Jedes jüngere Eruptivgestein konnte prinzipiell goldhaltig sein. Der berühmteste Fund, ein Klumpen von 6 1/2 Litern, war in Australien gemacht worden, 124 Kilo schwer, nach heutigem Geld 1,6 Millionen Dollar, da der Goldpreis in letzter Zeit ein wenig fiel. Diese Einzelheiten hatten sich ihm eingeprägt. Aber die Höhlen, die er durchforscht hatte, bestanden auch weiter unten, nahe dem Meeresspiegel, durchweg aus Kalkstein. In der Sedimentschicht war die Chance gleich Null.
Und da im Übrigen nichts geschah, das seinen Verdacht erhärtete, hatte er beschlossen, hinter der Sache nicht mehr zu sehen, als es wirklich zu sehen gab – nämlich nichts. Denn Tatsache war, Sergio und Gina tauchten hier überhaupt nicht auf. Nachdem die zwei mit der Sea Ghost losgesegelt waren, kam keine Nachricht mehr. Ihre Spur verlor sich in den Weiten des Stillen Ozeans, zu Lindas heimlicher Freude … Es sah so aus, als hätte das Paar sich mit dem Schatz, von Reuss verscharrt an der Bahia Piedra Bianca, einfach aus dem Staube gemacht.
„Navassa gehörte mal Haiti, aber das hat sich nie darum gekümmert“, sagte Reuss in der Backstagbrise, die beide Segel blähte. „Weder die Spanier noch die Franzosen dort haben es besiedelt; die Schwarzen schon gar nicht. Erst um 1856 landeten Nordamerikaner, sie gründeten die Navassa Phosphate Company zum Abbau des Guanos. Dieser Mist war ein geschätzter Dünger. Die Ruinen der Firma auf dem Oberland sind Ihnen ja vertraut.“
Jemand fragte: „Es ist kein Piratennest gewesen?“
„Ich fürchte nein. Denen ist Navassa zu poplig gewesen, so ohne Hafen. Die saßen einen Segeltag nordostwärts auf Tortuga.“ Reuss korrigierte den Kurs, das Boot neigte dazu, in den Wind zu drehen. „Um die Jahrhundertwende zog man das Sternenbanner hoch, die Insel wurde amerikanisch, ein Kohlenlager für die Navy, der Leuchtturm entstand … Nach dem zweiten Weltkrieg hat es noch eine Radarstation gegeben. In den Schuppen der Guano-Gesellschaft lagen Wasserbomben, für deutsche U-Boote bestimmt. Mehr weiß auch der Leuchtturmwärter nicht.“
Ziemlich dürftig. Immer derselbe Text zur Erbauung der Leute. Fertige Sprüche, alles Routine, da kam Langweile auf. Weil das Boot knapp acht Knoten lief, blieb es meistens bei Cap Tiburon, dem Westzipfel Haitis. Jamaicas Blaue Berge und die cubanische Sierra Maestra stiegen nur bei bester Sicht über die Kimm, wenn man westwärts oder nordwärts lief, um zwischen haushohen Frachtern und Tankern zu kreuzen.
Und nun die Piratennummer. Reuss pflanzte den Jolly Roger auf – schwarz mit weißem Totenkopf über gekreuzten Knochen. „Im 17. Jahrhundert“, hörte er sich sagen, „lag die Beute eines Kaperschiffs jährlich bei zwei Millionen Dukaten, das wären heute rund hundert Millionen Dollar. Es hat sich demnach gelohnt.“ Die hübsche Miss Taylor hing wieder an seinen Lippen, als sei er selbst einer der Seeräuber, die das Karibische Meer ernährt hatte und die sich noch heute da tummelten, wenn auch ohne Holzbein und Augenklappe.
„Holländische oder russische Dukaten?“, fragte Miss Taylors Vater, ein Bankbeamter mit der lästigen Neigung, sich alles zu merken und es nachzuprüfen.
„Holländische, nehme ich an. Die Russen hielten sich damals hier heraus.“
„Dann ist Ihr Vergleich ungenau, es dürfte weniger gewesen sein. Der Holland-Dukaten wog kaum dreieinhalb Gramm …“
Reuss antwortete zerstreut, von Taylor aus dem Konzept gebracht. Seine Gedanken schweiften. Bei einem Goldpreis von knapp 13.000 Dollar waren die 50 Kilo an der Bahia Piedra Bianca gerade noch 640.000 Dollar wert. Zog die Bank davon fünf Prozent ab, lag sein Anteil bei 130.000 Dollar. Damit ließen sich weitere vier oder fünf Bungalows oberhalb von Lulu Bay hinstellen. Es wurde Zeit, dass Sergio mit dem Geld rüberkam.
„Spanien reagierte auf die Piraten schwerfällig, defensiv.“ Er nahm den Faden wieder auf. „Statt zurückzuschlagen, band es seine Schiffsbewegungen an Routen und Termine. Nur einmal im Jahr versorgte es sein Weltreich durch zwei Flotten, je eine für Mittel- und Südamerika. Zur Rückfahrt sammelten sich beide in Habana, beladen mit Gold und Silber. Dann lief der Konvoi auf die Bahamas zu. Ihn anzugreifen war riskant, manchmal aber half den Angreifern ein Sturm, der den Geleitzug zerstreute …“
„Silber ist früher beinah so wertvoll wie Gold gewesen“, bemerkte Mr. Taylor, der Besserwisser vom Dienst. „Nach der Entdeckung Amerikas verzehnfachte sich die Produktion, der Preis verfiel …“
„Lass ihn doch ausreden“, sagte Miss Taylor.
„Vor drei Jahren“, fuhr Taylor fort, „war die Unze Gold siebzehnmal teurer als die Unze Silber. Dann brach über Nacht der Silbermarkt zusammen, und heute bekommt man fünfzig Unzen Silber für eine Unze Gold.“
Eine Zeit lang redeten sie beide, dann gelang es Reuss, die Lage der Spanier zu schildern.
„Mitten in ihrem Imperium entstand ein Piratenstaat, verstärkt durch Auswanderer aus Frankreich. Auf Tortuga wurde es eng, sie setzten sich an Haitis Westküste fest, bis dahin, wo wir gewesen sind, gingen auf die Jagd oder pflanzten Mais, Bohnen und Tabak an. Gegen Tabak gaben ihnen holländische Händler das, was auf den gekaperten Schiffen fehlte. Nebeneinander Raub und friedliches Tun! Eine Mischwirtschaft ähnlich wie heutzutage die Symbiose zwischen der Mafia und dem normalen Erwerbsleben.“
Jetzt lag die Insel drei Meilen voraus, an der felsigen Ostküste stand die Brandung. Wie üblich verglich er Navassa mit einem versteinerten Schwamm (Sergios Bild), und reichte das Fernglas herum. In diesem Moment sah man die Hubschrauber. Es waren zwei, sie flogen von Steuerbord an wie Libellen, die keine Spur hinterlassen, und senkten sich auf den porösen Fels. Nahe der Nordhuk, die mit 40 Metern überm Meer nur halb so hoch war wie das Südende des Oberlands, setzten sie auf. Ihr Surren ging im Plätschern des Kielwassers unter.
Was bedeutete dies? Im Dickicht musste, von ihm nie entdeckt, ein Landeplatz sein! Er bat um sein Fernglas. In dem Kreis, den es ihm zeigte, traten aus dem Hitzegeflirr die Rümpfe hervor, deren Oberteil mit dem Rotor das Buschwerk überragten. Dicke Transportmaschinen, gelbrot ihr Anstrich, kein Militär also, trotzdem störend fürs Geschäft … Reuss merkte, er hatte angefangen, die Insel als sein Eigentum anzusehen. Aber nur 60 Hektar waren gepachtet worden, und nicht einmal von ihm. Nur ein Achtel des Bodens – ja, das vergaß man leicht.
*
Linda empfing ihn mit der Frage, ob Miss Taylor wieder mitgesegelt sei. „Und noch drei andere“, sagte Reuss. „Wir waren keinen Moment allein.“
„Pass auf, dass sie dir nicht den Kopf verdreht.“
„Das hast du doch längst besorgt.“
„Sie hat sich vom Tauchkursus abgemeldet, nur weil Jimmy den leitet, nicht du.“
Das übliche Geplänkel; er war zu nervös, um darauf einzugehen. „Wer ist da eigentlich gelandet?“
„Sicher ein Bohrtrupp, wie im Mai. Noch ein Versuch, einen Brunnen zu bauen. Hoffentlich geht das wieder schief, sonst graben sie uns noch das Wasser ab.“
Reuss stieg hangaufwärts, er fühlte sich alarmiert. Tony Musto, der Leuchtturmwärter, war als Vertreter der Behörde fraglos unterrichtet. Er bewohnte mit seinem Anhang ein zweistöckiges Steinhaus am Fuße des Turms, gegenüber der Kraftstation. Das Haus war stabil genug für einen Hurrikan. Man hatte es Stück für Stück aus den Staaten herbeigeschafft, es von Leichtern in Lulu Bay an Land gesetzt und mit dem Dampfkran emporgehievt. Der Transportweg war es, der das Leben hier verteuerte.
„He, Tony“, sagte Reuss, „wer sind diese Leute?“
„Techniker …“ Musto war ein stämmiger Puertoricaner, das Haar wuchs ihm tief in die Stirn. „Im Auftrag der Marine.“
„Wird wieder nach Wasser gebohrt?“
„Weiß ich’s? Mich geht das nichts an.“
„Ich werfe mal von oben einen Blick darauf.“
Doch Musto vertrat ihm den Weg. „Der Turm ist gesperrt, ab sofort.“
„Auch für deine Freunde?“
„Du gibst keine Ruhe, was? Aber hoch kommst du nicht.“
Reuss ließ ihn stehen. Auf dem Trampelpfad, der zur Nordwesthuk führte, lief er durch Gras und Bambusgestrüpp, in dem Gefühl, das, was dort geschah, könne lästig, ja bedrohlich werden. War es wirklich geheim oder spielte Musto sich bloß auf? Er war eitel und obendrein scharf auf Linda, die seine Avancen lächerlich fand; sein tabakgetränkter Charme verfing nicht bei ihr.
Nach drei oder vier Minuten kreuzte ein Draht den Weg, ein gelbes Schild hing daran: Kein Zutritt für Unbefugte. Reuss tauchte unter dem Draht weg, das Verbot erschien ihm absurd. Unmöglich konnte er seinen Gästen sagen, dass sie sich auf dem Oberland kaum noch bewegen durften. In der Abendsonne lief er weiter, bis das Buschwerk sich linker Hand lichtete und den Blick freigab auf ein Korallenriff. Dort schäumte die See, das Riff panzerte das Nordkap der Insel, es zog sich ein Stück hinaus, deshalb lief er stets von Süden her in Lulu Bay ein.
Erst kurz vor den Hubschraubern hielt man ihn an. „Ich hab kein Schild gesehen“, sagte er und stellte sich vor. „Das ist ein Spazierweg meiner Kunden, wieso soll es hier nicht weitergehen?“
Die Leute, in olivgrünem Räuberzivil, gaben keine Auskunft. Sie wiederholten nur ihre Weisung, auf der Stelle umzukehren. Reuss merkte, ihr Wortschatz war beschränkt. Er hatte den Eindruck, sie würden ihm ohne Befehl von oben nicht einmal die Uhrzeit sagen.
Aus dem nächstgelegenen Zelt trat ein langer, etwa vierzigjähriger Mann, schwitzend, rothaarig, in kurzen Hosen. Er heiße Farrish und sei der Teamchef. „Uns ist bekannt“, fuhr er fort, „eine Mrs. Prout sitzt an der Lulu Bay. Keine Angst, ihr wird nicht gekündigt, aber dies ist ab heute Sperrgebiet. Wir erwarten Ihr Verständnis.“
„Das wird ein Marinestützpunkt – ohne Hafen?“
„Der Punkt liegt günstig, das gab den Ausschlag.“
„Was ist es denn, das Sie da bauen?“
„Ein Militärobjekt; das muss Ihnen genügen.“
Reuss sah sich um, die Pracht steckte noch in silbrigen Containern. Schwer zu sagen, was das werden sollte.
„Eine Wetterstation“, rief er, „oder ein Radar?“
„Ich sollte den Mund halten“, sagte Farrish, „aber Sie kriegen es ja doch heraus. Hier stand schon mal ein Radar, bis zur Kuba-Krise in den sechziger Jahren.“
„Und jetzt ist es wieder soweit?“
„Sieht ganz so aus …“ Farrish juckte sich unter der Achsel, wo Salzlinien sein Hemd verzierten. Zwischen Santiago de Kuba und der Insel Grenada, teilte er mit, pendelten Flugzeuge: Castro exportiere die Revolution bis in den Süden des Antillenbogens. Der Luftweg sei tausend nautische Meilen lang und führe an Navassa vorbei. Man habe sein erstes Drittel von hier aus elektronisch im Visier.
„Gott schütze euch“, sagte Reuss. „Und das auf meine alten Tage. Navassa ist ein Idyll, ein stiller Winkel, das hat man Mrs. Prout in San Juan versprochen. Aber gut, wenn’s denn sein muss, seien Sie fair, Sir, begnügen Sie sich mit der Hälfte! Wenn Sie den Zaun ein Stück zurücknehmen, bleibt Ihnen genug Platz und den Touristen auch.“
„Und was bieten Sie dafür?“
„Zum Beispiel gute Nachbarschaft. Ihre Leute können an unserem Strand baden und surfen; Sie wissen doch, es gibt nur den einen.“
„Baden? Ich glaube kaum, dass viel Zeit dazu bleibt – aber abgemacht. Für das Gefühl, willkommen zu sein, tut ein moderner Mensch manches.“
4
„Gefällt mir gar nicht, was dort vorgeht“, bemerkte Jimmy Croft beim Frühstück – ein handfester Mann von Mitte zwanzig, mit hartem Mund, kurzer gerader Nase, lustigen Augen und ausgebleichtem Haar. „Die Helikopter sind bunt bemalt, kein Tarnanstrich, niemand trägt Uniform und vor allem, sie hissen das Sternenbanner nicht.“
„Das gibt auch mir zu denken“, sagte Reuss.
„Man kennt doch die Brüder, ohne Flagge läuft bei denen nichts. Nach drei Tagen noch immer kein Fahnenmast! Der kommt bei ihnen gleich nach der Sorge um sauberes Trinkwasser, egal, wo sie sind: der Brunnen, die Fahne – in dieser Reihenfolge … Nein, das ganze riecht nach Geheimdienst oder noch was Schlimmerem.“
Linda fragte: „Was kann schlimmer sein als der?“
„Na, Gangster! Die Mafia, Freunde. Heute Abend ziehe ich mal los. Ich will wissen, was da gespielt wird. Die Reihe ist an mir.“
„Lass das lieber“, sagte Reuss, ein kleines Lächeln um den Mund. „Wenn Gangster merken, man guckt ihnen in die Karten, legen sie einen gewöhnlich um.“
„So blöd sind die nicht, das macht ihnen zu viel Lärm. Eher würden die versuchen, mich zu kaufen.“
„Dann nichts wie ran! Nimm die Kohle und verdufte.“
„Wie könnt ihr nur so reden“, sagte Linda; man sah, sie wurde daraus nicht recht schlau. Manchmal fehlte ihr der Nerv für die Art von Sarkasmus, an der die Männer Spaß hatten.
„Jimmy, mach ihr doch keine Angst.“ Reuss wandte sich an Linda.
„Wir zwei sind uns nämlich einig, man beehrt uns wegen Grenada, genau wie’s Farrish gesagt hat.“
„Tatsächlich?“, fragte Jimmy. „Du glaubst ihm also? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der lügt uns doch die Hucke voll! Dem traue ich nicht über den Weg.“
„Genug“, sagte Linda. „Fangt nicht schon wieder an, mir reicht es.“
Reuss stand auf, auch sein Bedarf an schwarzem Humor war gedeckt. Grenada – in seinen Ohren hatte das keinen schönen Klang. Die Insel, auf der man ihn inhaftiert hatte, zusammen mit Dattel, dem Drogenfahnder. Die näheren Umstände fielen ihm ein, der Kerker, die Verhöre, das Hochfahrende des schwarzen Offiziers, der ihn schließlich des Landes verwiesen hatte. Wie kam man als Weißer auf solchen Inseln mit der neuen, selbstbewussten Obrigkeit zurecht? Diese Zwergstaaten waren eigentlich kaum lebensfähig, bei all ihren Problemen in der sich wandelnden Welt.
Einiges davon ging ihm durch den Kopf, während er treppabwärts stieg. Zu viel Erfahrungen auf den Inseln! Ursprünglich schwer erreichbar – dadurch benachteiligt, doch auch geschützt –, riss das Flugzeug sie aus der Isolation; aber ein Flughafen war teuer. Rostige Frachter verbanden sie mit dem Weltmarkt. Und dort drückten die Stärkeren die Preise nieder, von Jahr zu Jahr gab es für Südfrüchte weniger Industriewaren. Manch eine Insel hielt sich mit Serien bunter Briefmarken über Wasser. Andere boten sich dem Auslandskapital als Steuerschlupfloch an. In Georgetown auf Grand Cayman saßen 18.000 Briefkastenfirmen, drei pro Kopf jedes Einwohners. Jamaica lieferte billig Bauxit, auf Barbados und Montserrat entstanden EDV-Zentren, auf den Bermudas ließen sich Versicherungsfirmen nieder, die Bahamas lebten halb vom Tourismus, halb vom Drogenhandel. In keinem Fall hatte so ein Kleinstaat die Kraft, multinationalen Konzernen ein gleichwertiger Partner zu sein. Er hielt immer das kürzere Ende des Stocks in der Hand. Unbedingt war solchem Gerangel die Ruhe der Einsamkeit vorzuziehen. Trotz der Schatten, die unvermeidlich auch diesen Fleck Erde streiften – man hatte gut daran getan, auf Sergios Rat hierher zu gehen.
*
Anfang Oktober hatte sich alles eingespielt, die Lage auf Navassa war beruhigend entspannt. Ein Maschendraht trennte beide Teile, mit dem Tor, das sich nur südwärts öffnete, zum Leuchtturm und zur Lulu Bay. Die Handvoll Touristen und das Dutzend Techniker im Norden respektierten einander. Den Teamchef Farrish hatte ein Ingenieur namens Rollins ersetzt; manchmal gab Linda ihm Unterricht im Zeichnen. Rollins ließ beiläufig wissen, man baue eine „Horchstation“, was auch immer das sein mochte. Offenbar kam sie ohne größere Antennen aus. Weder ragte ein Parabolspiegel aus dem Gestrüpp, noch krönte eine Kunststoffkuppel, das Antennengitter kapselnd, den Norden der Insel. Hätte derartiges nicht auch auf das höhere Südende gehört?
Das kubanische Flugzeug übrigens existierte, zweimal wöchentlich zog es stumm seine Bahn. An jedem Freitag flog die Maschine zwölf Meilen ostwärts vorbei nach Grenada, um den Geist Castros in den letzten Winkel der Karibik zu tragen; am Samstagnachmittag kehrte sie auf demselben Wege heim. Sie war zweimotorig, ziemlich langsam, vom sowjetischen Typ AN 26 … Kein sehr energischer Export der Revolution.
Trotzdem, der Leuchtturm blieb gesperrt. Das erinnerte Reuss an den Leuchtturm von Darßer Ort, den sie bestiegen hatten, er und seine Frau, so oft sie bei Prerow zelteten. Der war ungefähr so hoch wie dieser, 35 Meter, und damals schon, als Reuss sich scheiden ließ, hatte man nicht mehr hinaufgedurft: daneben saß die Volksmarine, mit dem Hang des Militärs zu vorspringenden Punkten. Die ganze Landzunge nebst der Bernsteininsel wurde unbetretbar, zum Verdruss der Zeltler. Um diese Zeit, nach dem Bau der Berliner Mauer, trieben bei Prerow kleine Gummibälle an, listig bedruckt mit: Den Urlaubern mehr Strand, der Volksarmee mehr Urlaub! Ein Nadelstich im psychologischen Krieg der Sechzigerjahre. Doch wenn er jetzt daran dachte, kam ihm das nicht mehr vor wie bloße Propaganda. Wer schützt uns vor unseren Beschützern? Die Frage schien weltweit offen zu sein.
Nur Linda durfte noch einmal hinauf, bei Sonnenuntergang. Tony Musto erlaubte es, um sich ihr zu nähern und seiner Werbung Nachdruck zu geben. Es kamen beide nicht auf ihre Kosten, Linda sah in der Dämmerung nur ein paar Baracken anstelle der Zelte. Der Versuch fand im September statt, er wurde nicht wiederholt.
Schon vorher, im Spätsommer, war eine Karte aus Reno gekommen (Nevada, USA). Sie zeigte im Neonlicht den Wasserfall eines Hotels und war von Gina; sie schrieb, es ginge ihnen glänzend. Dem folgte ein Luftpostbrief ohne Absender, gestempelt in Las Vegas. Der Handschrift nach verbarg sich dahinter Sergio Figueras. Er teilte mit, die Dinge ständen gut. Kein Wort über das Gold an der Bahia Piedra Bianca. Dafür Sprüche wie Du musst wissen, wann Du halten und wann du passen musst, aus dem Song „The Gambier“ von Kenny Rogers. Oder das Zweitbeste nach spielen und gewinnen ist spielen und verlieren. Vielleicht versuchte Sergio, bevor er ans Teilen ging, den Schatz auf riskante Art zu vermehren – jene 600.000 Dollar, die man ihm für die Münzen allenfalls gezahlt hatte.
Dabei wurde das Geld für die Wintersaison hier gebraucht. Linda führte die Bücher der Robinson Lulu Bay Ltd., unzufrieden mit dem Ertrag. Nicht nur das Startgeld war draufgegangen, Reuss’ Anteil an dem Platin, sie hatten sich auch verschuldet, um den Gästen mehr zu bieten als den Standard eines Robinson Crusoe. Das amerikanische Steuerrecht verlangte eine saubere Bilanz … Linda in ihrem Element.
„Wir sind Krämer geworden“, sagte er gern. „Unser Leben sinkt ab zum Geschäftsbetrieb. Weißt du, dass ich nur emigriert bin, um dem zu entgehen? Das Leben ist doch kein Geschäft!“
„Bestimmt ist es mehr“, sagte sie dann. „Aber nur auf solider Basis. Für den 40.000-Dollar-Kredit haben wir das Dorf verpfändet. Wird die Saison kein Erfolg, müssen wir Jimmy entlassen und die Köchin dazu. Kosten und Zinsen fressen uns von Mai bis November die Einnahmen auf.“
„Vielleicht sind wir zu groß eingestiegen. Damals auf Rum Cay haben mir zwei, drei Gäste schon genügt.“
„Auf Rum Cay, aha!“ Das traf einen Nerv in ihr. „Da habt ihr in der Sonne gelegen, Cocktails geschlürft und keine Köchin gebraucht. Wer Hunger hatte, der fuhr ins Lokal oder segelte zu einer Nachbarinsel, stimmt es?“
„Nein, gekocht hat Gina schon, wenn auch nicht täglich. Ente afrikanisch ist ihre Spezialität gewesen.“
„Gefüllt mit Bananen, ich weiß. Die brauchtet ihr bloß zu pflücken, hier wächst uns nichts in den Mund, alles wird teuer bezahlt. Aber es musste ja Navassa sein …“
Er liebte sie selbst im Streit und fügte sich ihren Normen. Linda, immer so proper und verlässlich. Letztlich hatte sie ja recht, auf Sergio zu schimpfen. Wann kam der endlich mit dem Geld? Warum hatte er ihnen diese Insel aufgeschwatzt, wo die Kilowattstunde 32 Cent kostete, weil das Dieselöl Fass für Fass an Land gehievt werden musste; wo dem Stubenmädchen der US-Mindestlohn von 3 1/2 Dollar zustand, abgesehen von dem Zuschlag für den abgelegenen Arbeitsplatz.
Und falls jemand krank wurde oder sich verletzte, was dann? Einen Arzt hatte es auch auf Rum Cay nicht gegeben, wohl aber den täglichen Flug nach Nassau. Hier waren es 100 Meilen über See zur Klinik in Guantanamo auf Kuba oder 120 Meilen bis Kingston. Falls Rollins nicht so freundlich war, den Hubschrauber anzufordern, wieder für viel Geld … All das nervte Linda, sie fand es bedrückend, und im Stillen gab er ihr recht.
*
Eines Abends – Reuss hatte das Boot vertäut und war auf halber Treppe – sah er am Rand des Oberlandes einen Mann, dessen modischer Pfiff ihm ins Auge sprang. Keiner der Robinson-Gäste putzte sich so heraus. Der Geck lehnte an einem Wagen der Schmalspurbahn, die den Leuchtturm mit dem Kran verband. Dessen Schatten fiel auf sein Gesicht, sodass Reuss erst spät begriff, wer da saß: Sergio Figueras.
Das Ganze geschah unter dicken Quellwolken an einem schwülen Oktobertag. Reuss kehrte vom Haiti-Törn heim, er hatte wieder beim Cap Tiburòn geankert, um den Gästen eines der Abenteuer zu bieten, auf das sie Anspruch hatten laut Vertrag (in diesem Fall den Schauer, unbefugt das Reich des verruchten Herrschers Baby Doc zu betreten, für ein Picknick). „Endlich“, rief er und zog sich an den Stahlseilen hoch, dem Geländer, das die Treppe trug. „Die Lulu Bay Limited heißt dich willkommen! Dich und die Dollars aus Las Vegas.“
„Kühler Empfang.“ Figueras nahm das Zigarillo aus dem Mund, und Reuss sah, ihm fehlte der Lippenbart. „Ganz wie deine Linda. Sei nicht so habgierig, Junge.“
„Wir hängen durch, das ist Fakt …“
„Nur Fledermäuse lassen sich hängen.“
„Sergio, die Firma braucht Zuschuss.“
„Und etwas Geduld. Ich kam nicht an das Zeug heran. Da war nämlich ein regelrechtes Camp, an unserer Bucht.“
„Was für ein Camp?“
„Wir haben nicht danach gefragt, vorsichtshalber. Die sahen wie Guerrilleros aus, vielleicht bestimmt für Nicaragua. Mit denen hätte ich ungern geteilt; es sind zu viele gewesen.“
Was redete er da? Reuss fand, es höre sich bescheuert an. Sergio war flott in Schale, sein Gesicht aber wirkte lädiert, zumal um die Augen. Und es war dieses Bild des Alterns – Mitte fünfzig musste er ja sein –, das Reuss daran hinderte, grob zu werden. Nein, er glaubte ihm nicht. Zum Glück sprach Sergio nicht weiter, offenbar gewillt, einen Rest von Würde zu wahren, anstatt die Begebenheit auszuschmücken.
Nach einer Pause fragte Reuss: „Da liegt das Gold jetzt noch?“
„Na sicher. Wenn du es gut verscharrt hast?“
Aus. Das war zu dem Thema alles. So wahrte ein Figueras sein Gesicht. Ganz bestimmt merkte er, ihm wurde nicht geglaubt; war er doch ebenso gerissen wie sensibel. Ein halbes Jahr ließ dieser Mann verstreichen, ohne noch einmal nach dem Schatz zu sehen? Höchst unwahrscheinlich … Seltsamerweise berührten Reuss die Spuren all der Strapazen in den Augen des Partners (die Monate hinter Gittern, im Busch und auf See); dieser Eindruck dämpfte den Ärger, der in ihm aufstieg. Wie auch immer, das Geld war futsch, so oder so, am Ende verspielt, in Reno und Las Vegas. Schwer zu verzeihen, und doch war dies nicht böswillig, eher schicksalhaft passiert. Der große Sergio hatte Pech gehabt. In seiner Haltung lag ein theatralisches Element, die Geste des Bedauerns. Er wäre als echter Lump doch einfach weggeblieben.
Und nun sagte er in festem Ton: „Du hast das Platin gebracht, Uwe, ich hole das Gold und damit basta. Zum Tageskurs schulde ich dir hundertzwanzigtausend Dollar. Die kriegst du, sobald es in meinen Händen ist.“
*
„Ich hab gewusst, er haut dich übers Ohr“, sagte Linda. „Das war mir in dem Moment klar, als er vor der Tür stand, in den gebügelten Hosen und seinem abstrakten Hemd, diesem Gemälde à la Kandinsky. So was kann man höchstens bis dreißig tragen.“
„Er will halt jung sein für Gina.“
„Du verzeihst ihm alles, wie? Er hat sie mitgebracht, und ich bot ihnen an, bei uns zu wohnen. Obwohl es mir schwer wird, die beiden zu ertragen. Aber nein, sie haben bei Rollins Quartier! Was mögen sie da wohl tun?“
„Ich weiß es nicht, Linda. Sie werden es uns noch erzählen. Für mich steht fest, Sergio ist abgebrannt und irgendwie in amerikanischen Dienst getreten. Das hat er schon früher gemacht, in den Sechzigerjahren; ich nahm an, das sei bei ihm vorbei. Er wollte nie mehr auf deren Rechnung reisen.“
„So? Wenn du mich fragst, er hat nie etwas anderes getan – nur auf fremde Kosten gelebt. Weshalb taucht er hier auf, und zwar in Rollins’ Hubschrauber? Um sich vor dir zu rechtfertigen? Da muss ich doch lachen! Nein, Uwe, ich sage dir, dahinter steckt mehr, als uns lieb sein kann und als gut ist fürs Geschäft.“
„Womit wir wieder beim Thema sind. Das Leben, Linda, ist kein Geschäft, nicht für mich; deshalb bleibt Sergio auch mein Partner, selbst wenn er mal pleite ist und genötigt, sich vor mir herauszureden … Vergiss doch nicht, ohne ihn hätten wir niemals den Schatz entdeckt.“
„Den hat er nach Flemings Karte entdeckt, bedenke das auch! Und wo ist Fleming geblieben?“
5
So begann ein stiller Wandel auf der Insel, von ihnen bald bemerkt. Der Helikopter setzte häufiger auf; er flog stets von Norden her an. Die Zahl der Leute hinter dem Zaun nahm zu. Kamen sie über das westliche Steilufer zum Baden in die Lulu Bay, sah man neuerdings, dass die Südländer überwogen. Ein paar waren Neger oder Mulatten. Linda sorgte sich ums Geschäft. Doch da sie abseits blieben, am Strand ganz manierlich, nahmen die Gäste es hin, als Farbtupfen im Robinson-Milieu.
Oder fielen Reuss all die kleinen Veränderungen jetzt erst auf? Mit Sergios Ankunft fragte er sich täglich, was hinter dem Zaun geschah. Man hörte dort Hühner gackern und Schafe blöken, wie auf einem Bauernhof. Axthiebe wurden laut, eine Motorsäge knatterte, als rode man das Buschwerk, mache das Oberland urbar. Gelegentlich fiel ein Schuss, und des Nachts brummte öfter ein Motorboot, das nicht in die Lulu Bay einlief; wohin aber sonst?
Am 20. Oktober, einem Donnerstag, lud Reuss das Paar zu einer Bootsfahrt ein, dem kleinen Törn um die Insel. Aber Gina blieb an Land, um Linda Gesellschaft zu leisten. „Was hecken die zwei bloß aus?“, fragte Reuss beim Verlassen der Bucht. „Das kann nur gegen uns gehen.“
„Gina will sich mit deiner Frau anfreunden.“
„Das wäre gar nicht so schlecht.“
„Für mich nicht. Du aber hättest sie dann beide auf dem Hals.“
Diesmal wirkte Figueras offen, wie ein Mensch, der in Gedanken versunken ist. Gina sei im Camp die einzige Frau, sagte er, das schwäche seine Stellung. Man beneide ihn, und das sei lästig. Auch Gina leide unter der Situation, sie habe die Männerblicke satt. „Sie hofft, dass Linda die Einladung erneuert, die sie bei der Ankunft ausgeschlagen hat.“
„Die gilt für euch beide. Es sind noch Zimmer frei.“
„Danke, aber mein Platz ist im Camp.“
Vor dem Leeufer blies der Passat mäßig, doch die Strömung lief nach Nordwest, das beschleunigte die Fahrt. Dicht unterhalb der Nordhuk, wo das Korallenriff ansetzte, sah Reuss ein Motorboot vor dem pergamentfarbenen Gestein einer Grotte, auf die er noch nie geachtet hatte. Im Takt der Dünung dümpelte es, elastisch verzurrt, vor der Öffnung am Fuße des Steilhangs. Wer außer Sergio schaffte es wohl, dort nachts einzulaufen, zwischen Küste und Riff?
Hinter der Nordspitze frischte es auf, Reuss ging über Stag und nahm das Vorsegel weg, damit das Boot friedlich blieb. „Was tut sich bei euch eigentlich?“, fragte er; die Gelegenheit schien günstig.
„Das gleiche wie überall.“ Figueras zeigte die Zähne, intakt und recht hell für einen Raucher – seine einleitende Grimasse. „Der Mensch wird geboren, um zu schuften, Kinder zu haben, elternlos zu werden und selbst Waisen zu hinterlassen“, sagte er mit einem Ausdruck von mürrisch verhaltener Kraft. „Ein paar gute Dinge gibt es – Geld, Frauen, Boote, Kämpfe; nicht unbedingt in der Reihenfolge … Reichtum. Nicht, dass ich dem mit hängender Zunge nachlaufe, das war er mir niemals wert. Aber es ist doch ein Unterschied, ob du reich bist oder arm.“
„Und, wirst du reich, dort in diesem Camp?“
„Dumme Frage, und das weißt du genau. Das Camp ist nur ein Sprungbrett, Junge, der Start ins Glück.“
„Es gibt kein Glück ohne Bescheidenheit.“
„Irrtum. Freiheit braucht der Mensch, und nur Geld macht dich frei. Jetzt fehlt’s mir, das bindet mich hier an. Doch ich hab da was in petto.“
Wie immer: Sergio, der Pläneschmied. Zwecklos, ihn zu fragen. Es lag in der Natur seiner Pläne, dass er sie geheimhielt. Sie saßen auf Backbord, die Luvseite der Insel im Blick – aber was war das? Reuss sah vier, fünf Männer im senkrechten Kalkstein turnen, wie Spinnen am rauen Putz einer Wand. Die Steilküste war an der Stelle reichlich zwölf Meter hoch. Und über dem Absatz, der um ganz Navassa lief, stiegen die Flanken des Oberlands wie zerknitterte Eierschalen auf dreifache Höhe an. Ein Seil verband die Kletterer. Unten rieb sich ihr Schlauchboot am Fels, es schwappte in der Brandung.
„Sie können’s nicht lassen! Dabei ist der Punkt gestrichen.“
„Wozu tun die das?“
„Überlebenstraining, nach Rollins’ Programm.“
„Und was ist damit bezweckt?“
„Existenzielle Selbsterfahrung. Man nennt das Grenzsituation. Die charakterstärkende Kraft der Seilschaft.“
„Aber ihr habt die Übung gestrichen?“
„Allerdings, gleich gestern, als die Meldung kam: Andere tun unseren Job. Die Burschen machen sich allein kaputt.“
Ein Satz, den Reuss nicht verstand. „Trainierst du da Exil-Kubaner?“
„Der Zirkus ist international, Rollins nimmt, was er kriegt. Untaugliche sieben wir aus. Wer versagt, fliegt heim.“
„Wie wählt ihr denn aus?“
„Auf die feine Art. Der Mann soll zum Beispiel in ein Loch springen, das eine Zeltbahn bedeckt. Keiner weiß da, wie tief er fällt. Oder man verlangt von ihm, in einer stockdunklen Hütte ein unbekanntes Tier zu fangen, zu erkennen, was es ist und das Gewicht zu schätzen.“
„Das würde mich überfordern.“
„Kein Problem für dich. Du bist schlau genug, zu wissen, wir sind nicht darauf aus, dass sich jemand den Knöchel bricht. Und wir sperren auch keinen Mungo in die Hütte oder sonst ein wildes Tier.“
„Sondern?“
„Na, ein Haustier. Trotzdem fiel neulich einer durch, der hatte noch nie ein Schaf gesehen.“
„Da habt ihr ihn also zurückgeschickt.“
„Nein. Er hatte sich ja hineingetraut und zugepackt; das hat uns genügt. Wir suchen keine Hirten, sondern Kerle mit Mumm.“
„Wie heißt das Camp, hat es einen Namen?“
„O ja, den hat es.“
„Aber du darfst mir den nicht sagen.“
„Doch. Immerhin hast du ihn selber ausgesucht.“
„Ich, wie käme ich dazu?“
„Dann ist es Linda gewesen. ,Robinson Lulu Bay Limited‘, so firmiert der Zoo. ,Erlebnisurlaub und Abenteuer‘ …“
*
Zur selben Zeit sagte Gina Dahlmann auf der Veranda: „Glauben Sie mir, Linda, es fällt schwer, davon zu sprechen, aber Sergio ist nicht fair, Ihnen und Uwe gegenüber.“
Linda Prout goss Kuba libre nach und gab Eiswürfel in den Drink. Gina warb um Vertrauen, ein ganz neuer Zug. Sie war hübsch und oberflächlich, wirkte eher amerikanisch … Vielleicht dank der schmetterlingsförmigen Sonnenbrille und des glitzernden Modeschmucks. Was will sie nur? Ist sie gekommen, um sich Luft zu machen, einfach mit jemandem zu reden, auch über Figueras? Oder hat der sie geschickt, zum Spionieren? „Ich kenne ihn ja kaum“, sagte sie, wie ihr schien, hinlänglich neutral. „Wir waren nur ein paar Tage zusammen.“
„Auf dieser Expedition. Dabei lernt man sich doch kennen.“
„Wissen Sie, ich war da plötzlich in etwas verwickelt und mit mir selbst beschäftigt. Figueras hat mich nicht so brennend interessiert.“
„Vermutlich haben Sie schnell gemerkt, woran Sie mit ihm sind. Bei Ihrer Lebenserfahrung. Bei mir hat es ewig gedauert. Ich bin schon vor reichlich vier Jahren einmal mit ihm liiert gewesen. Damals war ich gerade zwanzig, da wurde er mein Idol, und es war zu kurz, um mir die Augen zu öffnen.“
„Wofür?“
„Für seinen Charakter … Das moralische Defizit.“
Das klang nach Auflösung, dem Zerfall einer Partnerschaft; es konnte aber auch vorgetäuscht sein.
„Und jetzt?“
„Ach, ich finde ihn noch immer toll, bis auf diesen Punkt. Freunde belügt man nicht.“ Sie waren allein, dennoch senkte Gina die Stimme und beugte sich vor – der Korbsessel knackte. „Was ich Ihnen sage, das bleibt unter uns?“
„Wenn Sie es wünschen.“
„Also, das Gold hat er längst geholt. Ich war dabei, hab es mit ihm ausgebuddelt, an dem Teich hinter der Hütte. Es gab da kein Camp, die Bahia Piedra Blanca war völlig verlassen. Im Beiboot haben wir’s an Bord gebracht, für die ,Sea Ghost' war die Bucht zu flach … Aber Sergio hat teilen müssen, mit den Eignern der Jacht.“
„Wem gehört sie überhaupt?
„Reichen Leuten. Mit denen hatte Sergio zu tun, sie haben ihn unterstützt, aber nicht umsonst.“
„Er ist kein Mann, der gern teilt. Weshalb hat er das Gold nicht allein geholt, nur mit Ihnen?“
„Ihm lag daran, diese Leute zu beeindrucken. Der Fund sollte ihnen zeigen, dass auf Cocos Island noch mehr zu holen ist. Das klappte auch, aber dann haben die es sich anders überlegt. Sie hörten nämlich, dass man nicht mehr ohne Genehmigung auf die Insel darf und dass da ein Zollboot kreuzt. Jedenfalls, man nahm Kurs auf Kalifornien. Zu Pfingsten stiegen wir zwei in San Francisco ab.“
„Abschied im Guten?“
„Ja, nach außen hin. Sergio kann sehr diplomatisch sein. Tatsächlich war er grau und stumm vor Wut. Er hatte das halbe Gold an sie verloren und es nicht geschafft, ihnen beim Pokern mehr als fünf Große wieder abzunehmen.“
Linda nippte an dem Drink. „Und weiter?“
„Wir sind dann nach Reno, das hat ein wunderbares Klima, es liegt ziemlich hoch zwischen Bergen und Seen. Ich schwamm herum oder sah mir ,Harrah‘s Automobile Collection‘ an, all die Oldtimer, während Sergio in die Kasinos ging. Er wollte genug gewinnen, um Uwe das zu ersetzen, was auf der Jacht geblieben war.“
„Und das ging schief.“
„Nein, im Gegenteil, ihm gelingt fast alles. Er hatte soviel Glück, dass die Mafia es merkte und anfing, uns zu belästigen. Wir setzten uns nach Las Vegas ab, wechselten dort zweimal das Hotel, aber trotz des enormen Trubels blieb man an uns dran … Mein Gott, war das aufregend! Wussten Sie, Linda, dass Millionen Amerikaner leidenschaftlich pokern, und nur in Nevada darf man das, öffentlich, mit unbeschränktem Einsatz?“
Gina schweifte ab, so viele Erinnerungen! Sie beschrieb die breitkrempigen Stetsons und die Cowboyhemden der Spieler, mit Fransen und Goldknöpfen närrisch verziert. Und deren Texasstiefel aus Pfauenhaut und Antilopenleder, wie komisch. Ein Winkel im Horseshoe Saloon hatte es ihr angetan, dort zeigte man hinter kugelsicherem Glas eine Million Dollar in großen Scheinen, „damit die Leute auch wissen, wie soviel Geld aussieht.“ Dazu die überlangen Autos, Rolls Royce, Cadillac, Mercedes und Jaguar. Darin chauffieren kantige Leibwächter ihre Herren, die professionell card players, die Meister der Zockerzunft.
„Keine Verrückten“, erklärte Gina, „geniale Spieler, kalt unter Druck mit allen Wassern gewaschen. Eine Mixtur aus Stalin, John Wayne und Machiavelli; gegen die trat Sergio an und hat sie das Fürchten gelehrt.“
„Wie schaffte er das?“
„Spielend. Es hat ihn amüsiert, da lebte er richtig auf. Noch nie ist er auf Männer von solcher Intelligenz gestoßen. Die stecken jeden Minister oder Professor in die Tasche.“
„Schließlich auch ihn.“
„Eben nicht! Sergio blieb immer bis zum Lunch im Bett. Nur ausgeschlafen ist man gut, Aufputschmittel helfen da nichts. Er hat das echte Pokerface, den vollen Durchblick auch noch am Ende einer durchkämpften Nacht. Wer Nerven zeigt, den nimmt man aus wie eine Weihnachtsgans. Sergio war sagenhaft, der brauchte keine dieser entspiegelten Sonnenbrillen, die das Auge tarnen, ohne das Kartenbild zu reflektieren. Sie hätten ihn sehen sollen im poker room, ein paar Zigarillos im Golfhemd, total konzentriert, das Blatt in der Hand …“
Sie schwärmt noch immer für ihn, dachte Linda. Trotzdem, sie nahm ihr das nicht übel, eher erleichterte es sie. „Und dann schlug auch ihm die Stunde.“
„Weil man kein sauberes Blatt mehr spielte. Ein Typ hatte zweimal den Royal Flush: Zehn, Bube, Dame, König, As in gleicher Farbe, das gibt’s doch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist eins zu einer Million!“
„Und das war der Schluss?“
„Etwas hat er immer in Reserve. Diesmal den Draht nach Florida. In Miami wurden wir schon erwartet, man flog uns her – nur eben nahezu ohne Geld.“
„Trauern Sie dem doch nicht nach.“
„Aber es ist so wichtig für ihn! Wenn du reich bist, sagt er immer, kannst du jeden, der’s verdient, in den Arsch treten … Sein Credo! Nur, wozu belügt er euch?“
„Es war ihm wohl peinlich, mit leeren Händen zu kommen und obendrein als besiegt dazustehen.“
„So ist es bestimmt! Ich bin sicher, ihm schwebt vor, die Schuld zu begleichen. Und ich ahne auch schon, wie.“ Gina grub in ihrem Beutel, ohne zu finden, was sie suchte. „Ich hab’s nicht bei mir, zeige es Ihnen ein andermal.“
„Ist es so wichtig?“
„Es sind Grundstücksgeschäfte, davon verstehe ich ja was. Der erste, mit dem ich nach Übersee ging, war Grundstücksmakler.“
„Was tut Sergio auf Navassa?“
„Kein Kommentar. Ich bin geliefert, Linda, wenn ich rede. Bitte verlangen Sie das nicht von mir.“
*
Abends hörte Reuss im Radio von dem Chaos auf Grenada. Die Armee hatte tags zuvor ins Volk geschossen und den Premier Bishop sowie ein paar Minister exekutiert. War es das, was Sergio meinte mit den Worten: Andere tun unseren Job, die Burschen machen sich allein kaputt? „Es sind Söldner dort im Camp“, sagte er zu Linda. „Ranger. Eine Art Fremdenlegion.“
„Hat er dir das erzählt?“
„Andeutungsweise. Es ist ihm so entschlüpft.“
„Dem entschlüpft doch nichts. Anscheinend sollen wir denken, dass es Söldner sind.“
6
Die nächste Zeit war voll von Nachrichten und Mutmaßungen über das, was auf Grenada geschah, dort am Südrand des Antillenbogens. Laut Rollins scherte die Insel seit langem aus dem Kielwasser der freien Völker aus. Nachdem das Militär geputscht und die gemäßigte Führung um den Premier Bishop erledigt hatte, sprach Präsident Reagan von linken Strolchen. Und am 21. Oktober nahm ein Verband der US-Marine mit zwei Dutzend Schiffen, darunter dem Flugzeugträger „Independence“, Kurs auf das Ziel. Angeblich ging es Amerika um den Schutz seiner Bürger; der Zusammenbruch von Recht und Ordnung mache es nötig, notfalls militärisch einzuschreiten.
Die Sachlage blieb undurchsichtig. Reuss suchte widersprüchliche Mitteilungen in seinem Denken unterzubringen, bestärkt in dem Verdacht, das benachbarte Camp habe mit diesen Dingen etwas zu tun. Auch lebte in ihm die Erinnerung an zwei Wochen Untersuchungshaft neu auf, zuletzt verbracht in Gesellschaft des amerikanischen Drogenfahnders Johnny Dattel. Sie beide hatten damals Grenada unerlaubt betreten, auf der Suche nach Gina und Figueras. Und man warf ihnen vor, Teil eines Söldnertrupps zu sein, den ein früherer Diktator, gestützt von der CIA, auf einer nördlichen Insel bildete. Damit war Prune oder Palm Island gemeint – sollte es heute Navassa sein?
„Ihr Vergehen ist durch die Haft nicht verbüßt“, hatte ein kakaobrauner Leutnant ihn angeherrscht. „Schlimm, wie Sie unsere Souveränität missachten! Wir sind kein Fußabtreter für Ihresgleichen. Sie haben zwanzig Stunden Zeit, das Land zu verlassen.“
Letzteres übrigens, weil binnen dieser Frist das nächste Flugzeug ging. Greller Stolz, das war sein Eindruck von der winzigen Volksarmee Grenadas gewesen. Revolutionäre! Erst hatten sie ihren Diktator verjagt und sich nun, wie das so geht in der Politik, im Streit um den rechten Weg, das heißt um die Führung entzweit … Doch warum sich erinnern? Lästige Bilder. Wozu brauchen wir die Vergangenheit? Muss man denn alles und jedes begreifen? Die Karibik lehrt uns doch, nur für den Tag zu leben.