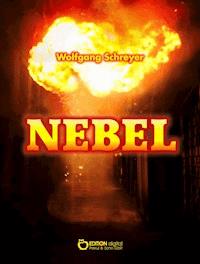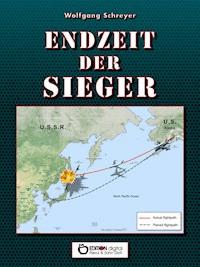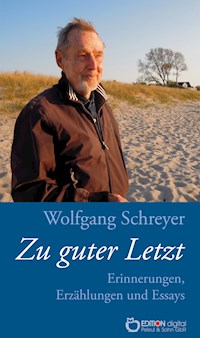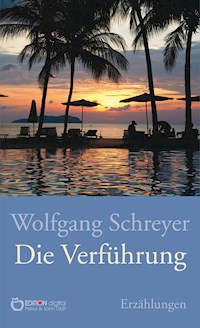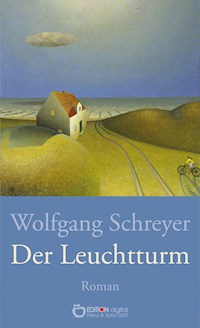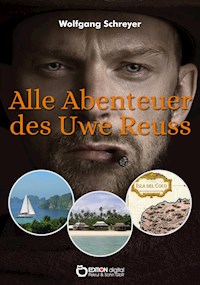8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Ein Traum hatte sich erfüllt, endlich war ich wieder unter Deutschen, Matrosen noch dazu. Diese Umgebung und das blaue Tuch im Spind 1 machten mich stolz. Stella hieß das Schiff übrigens nur, wenn es listig unter Hollands Flagge fuhr. Mit 2300 BRT war es der zweitkleinste Hilfskreuzer Seiner Majestät... Der Deckname war S. M. S. 17.« Südatlantik, Januar 1915. Der junge Richard Harms will als blinder Passagier auf einem neutralen Frachter Europa erreichen, will wie viele »heim ins Reich«. Als der Frachter von S. M. S. 17 aufgebracht wird, verbindet sich Harms' Schicksal mit dem des kaiserlichen Hilfskreuzers: Kampf, Raub, Versenkungen, Stürme, Flucht und Täuschung; eine Kette von Seeabenteuern in den Weiten zweier Ozeane. Nach Tatsachenberichten aus dem Ersten Weltkrieg schrieb Wolfgang Schreyer diese fiktive Odyssee, einen Roman über militärisches Piratentum, die reguläre Seeräuberei unseres Jahrhunderts. Das eBook gibt ein Zeitbild, es schildert die Welt von einst präzise in der Nussschale dieses Schiffs: Der Kriegsfreiwillige Harms steht im Mit-: und Gegeneinander an Bord »seinen Mahn« - im Bann eines verwegenen Offiziers, den er auch dann noch bewundert, als ihm das Fragwürdige des schier endlosen, alle Sinne aufpeitschenden Beutezugs rund um den Erdball aufgeht. DIE BEUTE ist der Roman einer Verführung. Er legt jene seelischen Abläufe bloß, die deutsche Matrosen zum Selbstopfer trieben, bis nach all dem Grauen ein neues Denken in ihnen keimte, das sie innehalten und aufbegehren ließ. Das spannende Buch erschien erstmals 1989 beim Hinstorff Verlag Rostock. Das eBook enthält einen bibliografischen Bericht über alle Werke des Autors bis 1989. Dazu schrieb er, in welcher Absicht, Stimmung oder Hoffnung er die Bücher schuf, wie er die einzelnen Arbeiten 1989 sah.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Die Beute
Erstes Buch: Schiff 17
ISBN 978-3-86394-114-7 (E-Book)
Für Paul zur Erinnerung an Simon
Die Druckausgabe erschien erstmals 1989 beim VEB Hinstorff Verlag Rostock
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Prolog
"Der ewige Friede ist ein Traum und nicht einmal ein schöner Traum. Der Krieg ist ein Element der von Gott eingesetzten Weltordnung. Die edelsten Tugenden des Menschen entfalten sich daselbst."
Helmuth von Moltke
"Nicht ein Werk Gottes, sondern des Teufels sind die Kriege."
François Marie Arouet de Voltaire
Mephistopheles:
"Das freie Meer befreit den Geist. Wer weiß da, was Besinnen heißt! Da fördert nur ein rascher Griff, Man fängt den Fisch, man fängt ein Schiff... Man hat Gewalt, so hat man Recht. Man fragt ums Was, und nicht ums Wie. Ich müsste keine Schifffahrt kennen: Krieg, Handel und Piraterie, Dreieinig sind sie, nicht zu trennen."
Johann Wolfgang Goethe, Faust II
Mit den Vätern haben es die Söhne schwer. Anfangs sind sie deren Stolz, ihr ganzes Glück. Später – wenn es so geht wie bei mir – der beste Freund. Dann aber ändert sich das, unmerklich oder mit einem Schlag, als ob da Wärme verfliegt. Die Zeit der Kameradschaft, des Vertrauens und Geborgenseins endet mit Enttäuschung. Das Band wird dünn, nichts steht mehr fest. Streit liegt in der Luft, Protest, vielleicht sogar Weggang und Trennung.
Eines Tages fängst du an, den Vater zu beobachten. Wer ist er eigentlich, was für ein Mensch? Und während du dich das fragst, spürst du seinen Blick und ahnst, dass auch er dir misstraut. Er beginnt, dich als Wesen wahrzunehmen, das unabhängig von seinem Willen, seinen Wünschen existiert. Seine Macht hat Grenzen. Irgendwann wirst du ihm nicht mehr folgen – spätestens dann, wenn dir aufgeht, dass er gar nicht der ist, für den du ihn hältst. Kein großes Vorbild, sondern ein schwacher und fehlerhafter Mensch... Jede Generation entdeckt das aufs Neue. Die schmerzlichen Erfahrungen wiederholen sich. Ich schreibe dies auf, um vor blindem Glauben an die Väter (und an deren Stellvertreter) zu warnen. Erkenntnis ist besser als Verehrung.
Das Goldstück
All das lag noch vor mir, damals, Pfingsten 1914. Ich war im Winter fünfzehn geworden und dabei, etwas anderes zu entdecken: die Welt der Mädchen und den verwirrenden Reiz, der von ihr ausgeht. Nicht der Vater beschäftigte mich, sondern die Tochter seines Geschäftsfreunds. Sie hieß Anni Greve und war schon sechzehn, gut ein Jahr älter, was ich recht störend fand. Sie war die Schwester von Manfred, dem Klassenbesten unserer Untersekunda; ihr Zeugnis sollte gleichfalls glänzend sein. Noch mehr als das schüchterte mich ihre Ruhe ein, diese Leichtigkeit, die anmutige Art zu lachen, sich zu bewegen und wie eine Erwachsene mit meinen Eltern zu plaudern. Sah sie mich an – unter dem mittelblonden, gescheitelten Haar, dessen dicke Zöpfe zu Schnecken aufgesteckt waren –, verschlug es mir manchmal die Sprache. Obwohl fast einen Kopf größer als sie, glaubte ich, in ihren Augen wie ein dummer Junge dazustehen.
Manfred Greve bemerkte es. Überschätz sie nicht, riet er mir, sie tut nur so gelassen und gescheit. Die Weiber machen dir was vor, sie schauspielern meistens. Es stimmt zwar, sie sind früher reif, unser Grips soll ja erst mit achtundzwanzig Jahren komplett beisammen sein, ihrer schon mit achtzehn, aber er ist dann auch danach, wie Schopenhauer schreibt... Manfred war sehr belesen. Er suchte meine Freundschaft, weil ich der Stärkste in der Klasse war.
Unsere Familien verbrachten ein paar Ferientage auf dem Greifswalder Bodden. Vaters kleine Jacht "Nordstern" hatte uns hingebracht. Zum Baden war es noch zu kalt, deshalb kreuzten wir Männer zwischen Mönchsgut und der Insel Vilm, wo die drei weiblichen Mitglieder an Land hausten. Für meinen Vater, den Rostocker Grundstücksmakler Albert Harms, zählte nämlich außerhalb des Büros nur zweierlei: das Segeln und das Münzsammeln. Von Anfang an versuchte er, mich für seine Passionen zu begeistern, und natürlich war es ihm geglückt. Ich schätzte ihn als Segler genauso wie als Münzkenner. Dass erst sein Geschäftserfolg ihm zu beidem verholfen hatte, darüber sprach man nicht, es war ja selbstverständlich.
Am Pfingstmontag lud er Anni Greve ein, mit uns an Stelle ihres Vaters, den ein Telegramm vorzeitig heimrief, an Bord zu gehen. Er zwinkerte mir dabei zu, als hätte er meinen heimlichen Wunsch erkannt, Anni mit meiner Segelei zu imponieren. "Aber nicht aufs offene Meer", bat ihre Mutter, und mein Vater versprach es ihr. Wir Jungs jedoch steckten die Köpfe zusammen, der Bodden hing uns zum Hals heraus, vom letzten Sommer her kannten wir jeden Winkel. Die "Nordstern" brauchte ein anständiges Ziel. Wenn schon nicht Saßnitz oder die Seebrücke von Binz – die Greifswalder Oie musste es wenigstens sein.
Als wir nach dem Mittagessen im Gasthaus von Vilm mit dem Beiboot zur Jacht übersetzen wollten, die draußen dümpelte, legte am Steg der Käpten Dippel mit seinem Kutter aus Lauterbach an. Von ihm erfragten wir, wie man den Hafen der Insel Oie anläuft, in der stillen Hoffnung, dass der Südostwind uns leichter dorthin als nach Peenemünde bringen würde. Lieber nicht, sagte mein Vater, da liegt ein Gewitter im Westen. "O wat"", winkte Dippel ab, "ehe dat rup kömmt, sünd ji lang door."
Die Frage blieb offen. Unter der Küste von Mönchgut kreuzten wir gegen den schlappen Südost an. In der Hagenschen Wiek lag ein kleines Kriegsschiff, der Artillerie-Tender "Fuchs" mit seinen vier Geschützen. Vater befahl zu grüßen, und ich zog die Flagge des Stralsunder Heimathafens hoch. "Seefahrt ist Not", rief er, worauf Manfred den Kaiser zitierte: "Deutschlands Zukunft liegt auf dem Wasser!" Das waren so unsere Scherze, respektlos, doch letzten Endes glaubten wir daran. Vater war Leutnant der Reserve und, wie jeder gute Deutsche, ein Patriot.
Aber diesmal sank ihm der Mut. Nahe dem Zicker See blieb der Wind weg, am Horizont kroch es dunkel hoch. Vater wollte in diesen Nothafen rudern, um das Gewitter abzuwarten. Wir jedoch murrten. Die "Nordstern" ist eine Segeljacht mit zwölf Zentnern Blei im Kiel. Was werden die Leute sagen, wenn wir rudern. Ja, wenn wir eine Maschine hätten wie der Stralsunder Oberfischmeister! Doch mein Alter nahm einen Riemen und fing an, das träge Wasser umzurühren. "Über allen Wimpeln ist Ruh', auf allen Segeln spürest du kaum einen Hauch", sagte er zu mir. "Der Albert rudert vernünftig, warte nur, künftig ruderst du auch." Wir fühlten uns vor Anni blamiert, machten das Beiboot klar und schleppten mühsam die Jacht – allerdings südwärts, bis unter Thiessow.
Auf dem Thiessower Haken kräuselte sich die See, Wind sprang auf, Nordwind. Jubelnd stiegen wir wieder ein, das Wasser rauschte am Bug, knapp acht Seemeilen vor uns lag die Oie, in einer Stunde würden wir dort sein, gefolgt von Donnergrollen. Ein Wagnis, ein Wettlauf mit dem Wetter. Anni schien stark beeindruckt. Vor ihren Augen hatte ich mich gegen Vaters Schwanken durchgesetzt. Ohne sie hätten wir uns wohl kaum in dieses Abenteuer gestürzt.
Bald türmten sich hinter uns, bis zu 45 Grad Höhe, prachtvolle Gewitterwolken, die Ränder von der Sonne vergoldet. Je näher wir dem Ziel kamen, desto flauer wurde mir. Das Wetter zog um ganz Rügen, es kreiste uns ein, denn auch über der pommerschen Küste stand eine schiefergraue Wand mit gelblichen, scharf hochgekämmten Fransen: ein Zeichen für Sturm.
Wir passierten die Signaltonne zwei Meilen vor der Oie. Verblüffend rasch kam der Abend. In dem Zwielicht blitzte der Leuchtturm auf und, ein Stück südlich, das Hafenfeuer. Gott sei Dank, es wies uns die Einfahrt. Schon lag sie dicht vor uns, da setzte der Wind aus. Wie ein Bündel Pfeile waren flockige Wölkchen, mir wohlbekannt, jetzt über uns. Wir hatten das Rennen verloren. Ohne dass ein Wort fiel, senkte ich die Gaffel, ließ das Großsegel herunter und zurrte es fest. Vater deckte das Cockpit ab, Manfred verteilte mit zitternden Fingern das Ölzeug.
Kaum hatten wir es angezogen, fuhr heulend ein Windstoß in das Vorsegel und drückte uns auf die Seite. Die Fock knallte und schlug, gleichzeitig klatschte der Regen so dicht nieder, dass die Insel samt Hafenfeuer und Leuchtturm verschwand. Solch ein Unwetter hatte ich noch nie erlebt. Aus allen Richtungen fielen Böen ein. Unser Versuch, zu ankern, misslang im Peitschen und Schmettern der Blitze. Jedes Aufzucken zerriss die Finsternis und warf auf die gepeinigte Netzhaut ein Momentbild vom Toben der Elemente: Wellen, starr wie Mauern, hinter Hagelkörnern, die in der Luft stillzustehen schienen.
Anni Greve kauerte in der Kajüte, so überreizt und geblendet, dass sie schwarze Blitze sah, wenn sie sich die Augen zuhielt. Vorbei der Spaß an unserem Sport! Die Angst vor dem Meer wurde sie nie mehr los. Auch mich packte das Grauen, doch ich hatte ja zu tun. Kentern würde die "Nordstern" nicht dank ihres Bleikiels, aber sie konnte stranden. Vater hielt sie vor dem Wind, ansonsten ließ er alles über sich ergehen. Der Schrecken machte ihn eigentümlich teilnahmslos. Ich hing unten über Karte und Kompass und gab ihm den Kurs. Manfred schöpfte stumpfsinnig das Cockpit aus.
Es ging auf die See hinaus, nördlich an der Oie vorbei. Als wir aus ihrem Schutz kamen, wurden die Wellen höher, die Kämme klatschten aufs Deck. Wir kehrten um, liefen am Wind wieder in den Bodden ein, das Thiessower Kliff an Steuerbord und den Großen Stubben, die Sandbank mit den drei Steinen, unsichtbar vor uns. Einziger fester Punkt in dem Chaos war das Leuchtfeuer der Oie. Hier und da geisterte die Ankerlaterne eines Schiffs oder eines Baggers durch die Nacht; in der Ferne Flammenschein wie von brennenden Gebäuden... Rechtzeitig wendeten wir, und nun lagen der Ruden oder das Steinriff der Oie bedrohlich in unserem Kurs.
Nach Mitternacht ebbte der Aufruhr ab, Vater rief mich ans Ruder. Er kroch mit nassen Sachen in die Koje, todmüde wie er war. Wie hatte auch ich es satt! Ich bebte vor Kälte und Furcht vor Strafe, all dies war meine Schuld, leichtfertig hatte ich uns in Gefahr gebracht. Später hörte der Regen auf, nur noch fern über Usedom blitzte es. Gegen vier Uhr, nach ungezählten Manövern, lag vor mir wieder die Oie, jetzt im Morgenrot, und das Heck der Jacht platschte in eine schon kraftlose See.
Anni erschien blass aus der Kajüte, mit einem Becher Kaffee. "Willst du, Richard?", fragte sie.
"Danke dir. Alles in Ordnung da unten?" Das kam mir recht mannhaft aus der Kehle; zum ersten Mal war ich ihr gegenüber unbefangen.
"Ich glaub schon. Du hast es geschafft."
"Wir sind noch mal davongekommen, meinst du."
"Nein, du hast es geschafft", beharrte sie. "Wer weiß, ohne dich..." Ihre Lippen streiften mich, das Wunder geschah, sie gab mir einen Kuss. Es war wie im Traum, ich stand nicht mehr als dummer Junge, sondern als Retter vor ihr da! Kälte und Mattheit fielen von mir ab. Wir waren allein an Deck, rot überhaucht vom Morgenlicht. Ich legte den Arm um sie und küsste ungeschickt zurück. Sie liebt mich also, verzeiht mir die schlimme Nacht, vielleicht musste der Schock sogar sein, damit sie nicht länger verbirgt, was ich für sie bin! Alles, alles würde nun gut werden... Nie zuvor und nie mehr danach habe ich die Sonne in solcher Pracht aufgehen sehen.
Was im Glanz des Maimorgens so glücklich begann, wurde der schönste Tag meines Lebens. Heute, ein Vierteljahrhundert später, lässt sich das wohl schon sagen. Seltsamerweise kam Vater, als gäbe es weit Wichtigeres für ihn, nicht mehr auf unsere Irrfahrt zurück; weder lobend noch tadelnd. Mein Leichtsinn schien vergessen, kein Mensch warf mir etwas vor. Auf Vilm hatte der Sturm Bäume entwurzelt, den Fischern Netze und Boote zerstört, man war heilfroh, uns unversehrt landen zu sehen. Spät abends, daheim in unserer Villa, schenkte Vater mir auch noch ein Goldstück: völlig unverdienter Lohn. Ich bin ihm nie so nahe gewesen wie in dem Augenblick, als er mich zu sich rief und die schwere Kassette aufschloss, die seinen Schatz enthielt.
Bis dahin waren es nur Silbermünzen gewesen, die er mir überlassen hatte, wenn auch schon mal seltene, wie der mexicanische Silberdollar, den ich zum Geburtstag bekam; geprägt im Jahre 1842. Jetzt nun beschämte er mich mit einem goldenen Dreirubelstück, dem sogenannten Imperialdukaten. Es wog zehn Gramm, zeigte vorn den Zaren Nikolaus II. im Profil und auf der Rückseite den gekrönten Doppeladler. Allein das Gewicht! Vater hatte mir gesagt, dass Gold fast sechzehnmal wertvoller als Silber war. Hinzu kamen für den Sammler der Erhaltungsgrad und der Seltenheitswert. (Sein bestes Stück war eine 25-Rubelmünze, von der es nur 475 Exemplare auf der ganzen Welt gab.)
Leicht zerstreut erklärte er mir, dieser Dukaten habe, was seinen Erhaltungsgrad betreffe, das Prädikat "sehr schön". Einer Gewohnheit folgend, wiederholte er die Note auf Englisch und Spanisch: very fine und muy bien conservada. Der Metallwert dieser Münze, so merkte er an, sei um drei Prozent höher als ihr Nennwert; das erst mache sie interessant.
"Meinst du wirklich, ich hab das verdient?", fragte ich etwas beklommen.
"Warum denn nicht?" Er lächelte matt. "Hör auf, an dir zu zweifeln. Übrigens, was heißt das schon – verdient... Meist geht es ungerecht zu auf Erden. Gut für dich, das zu wissen. Inzwischen betrachte die Münze als Unterpfand, als Garantie unserer Freundschaft."
"Die braucht keine Garantie."
"Wer weiß, was uns bevorsteht, mein Junge. Versprich, dass du zu mir hältst, komme was wolle."
"Komme, was wolle", sagte ich dumpf, wohltuend überschauert: ein Wort unter Männern, wie ein heiliger Schwur. Ich fiel ihm um den Hals. Was für ein Tag! Es würde mir nicht schwer fallen, zu diesem Wort zu stehen.
Die "Cap Trafalgar"
Das war ein Frühling wie noch keiner. Auf den Wallanlagen duftete süß der Flieder. Dem Unwetter war ein Schwall milder Luft gefolgt, sie ermunterte alle Verliebten zur Zärtlichkeit. Ich traf mich heimlich mit Anni, so oft sie aus der Klavierstunde kam. Wir schrieben uns Briefe, um Tage der Trennung zu verschmerzen. Ihr Bruder war der Bote, die Eltern sollten nichts wissen. Oft schlich ich abends an die Rückseite ihres Gartens in der Steintor-Vorstadt. Dort hörte ich Anni Chopin spielen, Schubertlieder oder die "Träumerei" von Schumann, sah ihren Umriss durch die Gardinen und wusste, jetzt denkt sie an mich. Das war mir Trost genug.
Die paar Wochen verflogen wie im Rausch. Mich kümmerten weder Schulzensuren noch das, was in der Zeitung stand über die große Politik. Zwar spürte ich im Elternhaus eine gewisse Nervosität. Gespräche brachen ab, wenn ich ins Zimmer trat. Mein Großvater kam, was selten geschah; er hatte ein Fuhrgeschäft in der Neustadt und verstand sich mit seinem Schwiegersohn, meinem Vater, nicht besonders gut. Wir sahen ihn sonst nur zu Weihnachten. Aus dem Herrenzimmer drangen Stimmen, Kurt Greve war auch da. Großvater ging als erster, türenschlagend – er war halt ein grober Klotz, für meinen eleganten Vater "ein Bauer". Am Abend brach meine Mutter plötzlich in Tränen aus, sie verließ den Raum. Mein Vater murmelte etwas von der Gewitterwolke, die über Europa hing: Mutter habe Angst vor einem Krieg. Das klang weit hergeholt, es überzeugte mich nicht, doch war mir mehr darum zu tun, rechtzeitig an Annis Gartenzaun zu sein, ihr Klavierspiel zu hören, die "Träumerei".
Niemand fragte nach meinen Klassenarbeiten oder den Hausaufgaben. Trotzdem erwarteten wir sehnlich die großen Ferien. Unsere Familien würden sie, wie im letzten Jahr, gemeinsam auf Rügen verbringen. Doch obwohl der große Kabinenkoffer, vorzeitig vom Boden geholt, schon im Schlafzimmer stand, war keine Rede mehr von Binz oder Sellin... Manfred brachte mir ein Briefchen zurück: Sein Vater habe es entdeckt und ihm verboten, noch länger den Postillon d'amour zu spielen. Das ist keine Kinderfreundschaft mehr, hatte er gesagt, für einen Flirt sei es bei uns beiden entschieden zu früh.
Und dann stieß ich daheim auf eine Kartenrolle, die Karte des Greifswalder Boddens, sah auch das Fernglas, das gleichfalls zur Ausrüstung der Jacht gehörte, und fand, misstrauisch forschend, in Vaters Schreibtisch die Kopie eines Kaufvertrags. Er hatte die "Nordstern" verkauft! Für 1700 Mark an den Stralsunder Rechtsanwalt Lehmann. Es war nicht zu fassen. Ich lief zu meiner Mutter – sie wusste schon Bescheid. "Glaub mir, Richard, es ist nur vernünftig von ihm", sagte sie. "Dein Vater kann sie diesen Sommer ja gar nicht nutzen. Er muss geschäftlich ins Ausland."
"Wohin denn?"
"Nach Übersee. Das muss dir vorläufig genügen."
"Aber unser Boot! Es ist doch mehr wert. Und überhaupt, hätte ich euch nicht segeln können?"
"Dazu wird kaum Gelegenheit sein. Ich hab mich entschlossen, ihn zu begleiten. Und natürlich nehmen wir dich mit."
"Für wie lange, Mutter?"
"Das steht noch nicht fest. Ein paar Monate schon." (Ein paar Monate! Der Sommer war verloren. Die Welt stürzte für mich ein.) "Du darfst zu keinem darüber sprechen; das ist sehr wichtig, mein Junge." Sie fügte matt hinzu: "Die Art von Geschäft, die er im Auge hat, verträgt nun mal kein Aufsehen."
Viel mehr enthüllte mir auch Vater nicht. Tiefernst erinnerte er mich an das Wort, das ich ihm am Tag nach Pfingsten gegeben hatte. All das wirkte feierlich, geheimnisvoll, ein Jahr früher, und es hätte mich riesig gefreut, der Schule fernzubleiben, und außerdem hätte es meine Fantasie beflügelt. Offenbar handelte es sich um Landkäufe großen Stils in Südamerika. Kam es heraus, würden die Bodenpreise steigen. Ein Abenteuer also, womöglich wurde man reich... Ich aber sah nur die Trennung von Anni. Was sollte aus uns und unserer Liebe werden?
Es wurde sorgsam verhindert, dass ich Abschied nahm. Der nächste Tag schon war mein letzter in der Schule. Ich hatte dem Ordinarius ein Schreiben zu geben. Er nahm es wohl für die Antwort auf den Mahnbrief, in dem er meine Leistungen speziell in Latein beklagt hatte, und öffnete es nicht in meinem Beisein. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Er soll ein halbes Jahr später in Frankreich gefallen sein.
Am selben Abend noch setzte mein Vater uns, Mutter und mich, in den D-Zug nach Hamburg. Sobald er "die laufenden Geschäfte abgewickelt" habe, hieß es, komme er schleunigst nach. Nun, da ich halbwegs eingeweiht war, hatten sie es eilig, mich aus Rostock wegzubringen. Während Mutter aber drei Plätze zweiter Klasse auf einem Schnelldampfer der Hamburg–Südamerika–Linie buchte, gelang es mir doch, einen Brief an Anni in den Kasten des Hotels zu werfen. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit schrieb ich ihr alles, was ich von dem jähen Aufbruch wusste, und bat sie, mir zu verzeihen. Auch wenn unsere Eltern dagegen wären, möge sie auf mich warten. Ich jedenfalls würde in der Fremde kein Mädchen anschauen, für mich gebe es nur sie.
Ende Juni, kurz bevor wir ausliefen, meldeten Extrablätter das dann so folgenschwere Attentat auf den Erzherzog Franz Ferdinand. Über den Tod des österreichisch-ungarischen Thronfolgers in der bosnischen Landeshauptstadt Sarajewo wurde an Bord unseres Luxusliners endlos spekuliert. Mich langweilte das Gerede im Speisesaal und auf dem Promenadendeck. Sonst hätte eine Seereise in so nobler Umgebung mir gewiss mehr imponiert. Jetzt nahm ich, mit meinem Blick für Schiffe, nur das Bild des schwarzweißen Ozeanriesen in mich auf. Er hieß "Cap Trafalgar", hatte drei mächtige Schornsteine, war 180 Meter lang, 18 Knoten schnell und galt als das beste Schiff der Hamburg–Südamerika–Linie. Vor zwei Jahren erst gebaut, verkürzte es mit seinen 19 000 Pferdestärken die Fahrt nach Buenos Aires glatt um acht Tage. 5 000 Tonnen Steinkohle konnte es laden. Solch ein Schnelldampfer brauchte durchschnittlich je Knoten Geschwindigkeit in der Stunde fast eine Tonne Kohle – unser Schiff weit über 300 Tonnen am Tag. (Schwach in Latein, war ich ganz gut in Mathematik.)
Wir fuhren durch den Ärmelkanal. Am zweiten Tag ragten auf Steuerbord die Kreidefelsen von Dover, später lag backbord der französische Kriegshafen Cherbourg, dann Brest, fern hinter all den Inseln und Klippen der Bretagne, an die der Atlantik schlägt. Auf halber Strecke, bei den Capverdischen Inseln, wurde es tropisch. In einer schwülen Nacht kam Vater mit dem Zweiten Offizier ins Gespräch. Dem hatte er einmal geholfen, ein ererbtes Haus in Warnemünde günstig zu verkaufen. Der Offizier erzählte ihm, vom deutschen Admiralstab seien 13 Handelsdampfer im Kriegsfall dazu bestimmt, in Hilfskreuzer verwandelt zu werden; nämlich alle, die mehr als 17 Knoten liefen. Die "Cap Trafalgar" stand entsprechend ihrer Größe auf Platz acht der Liste, die mit der "Vaterland" begann.
Anderntags zeigte er uns stählerne Unterbauten vorn und achtern im Zwischendeck. Sie dienten als Fundament von 15-Zentimeter-Decksgeschützen. Es gab auch Munitionsaufzüge für die zentnerschweren Granaten. Das war übrigens gar kein Geheimnis. Die Briten hatten seit Anfang des Jahres drei Dutzend ihrer Schnelldampfer sogar schon bewaffnet! – "Ein Krieg mit England käme zu früh", sagte der Zweite Offizier zu meinem Vater. "Unsere Hochseeflotte ist erst in drei Jahren soweit."
Nach gut zwei Wochen erreichten wir die berühmte Bucht von Rio de Janeiro. Ein Teil der Passagiere ging an Land – wir nicht. Den Zeitungen, die frisch an Bord kamen, entnahm mein Vater, dass die Balkankrise weiterschwelte. "Es spitzt sich zu, Elisabeth", sagte er, und meine Mutter seufzte: "Vielleicht ist's gut, da heraus zu sein." Es fiel mir auf, dass mein Vater dazu schwieg. Ich kannte doch seine Haltung, als Patriot hätte er dem widersprechen müssen. Er hielt es wohl für zwecklos, mit ihr über etwas zu streiten, wovon sie nichts verstand.
Bevor das Schiff in Buenos Aires am Ziel war, lief es noch Montevideo an, die Hauptstadt Uruguays an der Mündung des Rio de la Plata. Und obgleich unsere Kabine bis Buenos Aires bezahlt war, stiegen wir hier schon aus. Wieder ein Haken, den Vater schlug, zur Täuschung der Konkurrenz. Auch zog er mit uns in kein Hotel, sondern in ein bescheidenes, dünnwandiges Haus am südöstlichen Stadtrand, nahe dem Leuchtfeuer Punta Brava. Ein älteres Mulatten-Ehepaar bediente uns dort. Vater sprach mit ihnen ganz leidlich Spanisch, er riet auch mir, mich darin zu üben.
Unglücklicherweise gab es in Montevideo eine deutsche Schule. Kinder unserer Diplomaten und Firmenvertreter besuchten sie, auch die der zahlreichen Auslandsdeutschen. Und bestürzt merkte ich, hier war gar nicht Ferienzeit, wir kamen vom Frühsommer in den südamerikanischen Winter. So atmete ich auf, als Vater beschloss, mich wegen des langen Wegs ins Stadtzentrum nicht zur Schule zu schicken. Als Hauslehrer warb er einen Studenten an, der gerade genug Deutsch konnte, um den Anschein zu erwecken, er gebe mir Unterricht. Immerhin, mein bisschen Spanisch lernte ich von ihm. Zum Strandbad Playa Ramirez – um diese Jahreszeit schwach besucht – war es nicht weit. Ich hätte froh sein können, wäre nur Anni bei mir gewesen.
Am Silberfluss
Der Rio de la Plata, entstanden aus dem Zusammenfluss der Ströme Paraná und Uruguay, ist in Wirklichkeit ein Meer – an der Mündung in den Ozean hundert Meilen breit. Vom argentinischen Südufer war natürlich nichts zu sehen. Plata heißt Silber, so sagte mein Lehrer; argentum im Lateinischen. Auf diesen Wogen waren einst die spanischen Eroberer nach Argentinien gekommen. Das Wasser ist allerdings gelblich, der Silberfluss hat – außer gegen die Abendsonne – niemals silbrig geblinkt. Die Spanier nannten ihn so, weil er sie in gold- und silberhaltige Berge führen sollte; was jedoch nicht geschah.
An diesem Ufer wurde auch mein Vater offenbar nicht reich. Was er eigentlich tat, blieb mir ein Rätsel. Er bekam weder Briefe noch Telegramme und schrieb auch selbst nicht. Nie lud er einen Menschen zu uns ein. Mehrmals holte ihn eine Droschke ab, meist aber nahm er nur das Fernglas und verließ das Haus zu Fuß. Besichtigte er die Ländereien, die er in fremdem Auftrag kaufen sollte? Ich folgte ihm unbemerkt und sah ihn einen Hügel ersteigen; er spähte nordwestwärts zum Hafen und hinaus aufs Meer. Seltsam, wir lebten so zurückgezogen, dass es mich an die Einsamkeit des alten Seebären in meinem Lieblingsbuch erinnerte, der "Schatzinsel" von Stevenson. Auch dieser Mann zog, bewaffnet mit einem Messingfernrohr, tagtäglich ans Meer.
Vater war selber schuld, wenn ich ihn im Stillen mit Billy Bones verglich, jenem abgewrackten Piraten. Weshalb verschloss er sich vor mir? Sein Schweigen bedrückte mich fast so wie der Umstand, dass ich Anni nicht schreiben durfte und folglich von ihr nichts mehr hörte. Sie glaubte uns in Buenos Aires, hatte keine Adresse. Und was nun kam, das verstärkte noch mein Gefühl, heimatlos und von dem, was ich liebte, abgeschnitten zu sein: Österreich-Ungarn erklärte am 28. Juli Serbien den Krieg. Am 1. und 3. August zog Deutschland mit Kriegserklärungen an Russland und Frankreich nach. Als am 4. August unser Heer in das neutrale Belgien eindrang, um den linken Flügel der französischen Armee zu umgehen, antwortete England noch am gleichen Tag mit Krieg. Schließlich folgte am 5. August Österreichs Kriegserklärung an Russland. Damit stürzten sich die zwei mächtigsten Staatengruppen der Welt in einen Krieg von bis dahin unbekanntem Ausmaß.
Es war, als falle dröhnend ein Tor hinter uns zu. Der Heimweg schien versperrt, die Postverbindung zerschnitten. Würde die britische Flotte mit ihren Stützpunkten auf allen Meeren Deutschland nicht blockieren? Vater beruhigte mich: Durch neutrale Nachbarn wie die Schweiz, Holland oder Dänemark lief der Verkehr doch weiter. Auch werde ein Sieg über Frankreich, wie er am Monatsende uns schon winkte, das Problem rasch lösen. Nein, wir stünden nicht auf verlorenem Posten; unser Platz sei hier, mehr lasse sich noch nicht sagen.
Wie sehnte ich diesen Sieg herbei! Meine Gedanken schweiften heimwärts. Lieb Vaterland, dachte ich und sah die Rostocker Wallanlage vor mir – das Laub färbte sich, fiel herab, schon roch es herbstlich, während mich die immergrüne subtropische Natur, der träge Silberfluss und fremde Menschen umgaben. Unser tapferes Heer. Deutschland, Deutschland über alles... Doch der September verstrich, in Europa erstarrten die Fronten, Frankreich hielt stand, der erhoffte Blitzsieg blieb aus. Unglaublicherweise existierte dies zur selben Zeit: das heldenhaft kämpfende Vaterland und die Einsamkeit, das Schäbige dieser Vorstadt, in der überhaupt nichts geschah.
Mit Hilfe des Hauslehrers las ich in den Zeitungen. Mein Herz schlug für die Marine. Ein deutsches Schiff machte gleich von sich reden. Der Schlachtkreuzer "Goeben" hatte aus seinen 28-Zentimeter-Geschützen zwei französische Küstenstädte in Nordafrika beschossen und sich dann mit dem Kreuzer "Breslau" der Verfolgung entzogen, um am 10. August in die Dardanellen einzulaufen. Sein Erscheinen bestärkte die schwankende Türkei in dem Entschluss, an Deutschlands Seite zu treten. Ein Kriegsschiff machte Geschichte, wie mein Vater fand.
Aber die Sensationspresse von Montevideo feierte auch einen britischen Seesieg bei Helgoland. Dort waren am 28. August im Feuer einer Übermacht drei unserer Kreuzer gesunken, darunter die moderne "Mainz". Wir hatten sie im Jahr zuvor während der Kieler Woche besichtigt. Ihr Liegeplatz war gegenüber der Universität vor der Mole des Werfthafens. Ein schmuckes Schiff, 4350 Tonnen schwer und 27 Knoten schnell, mit fast 400 Matrosen. Nun lag es auf dem Grund der Nordsee! Die Flotte des Kaisers hatte, glaubte man den Schlagzeilen, über 1 200 Mann verloren. Großadmiral Tirpitz, der sie nicht führen durfte, sprach von einem dies ater, einem "schwarzen Tag".
Der Krieg kam uns näher, und das Glück blieb auch dem Feind nicht treu. Von der Südsee her glitt das Fernostgeschwader des Vizeadmirals Graf von Spee auf die Rückseite Südamerikas zu. Sein Kern waren die Panzerkreuzer "Scharnhorst" und "Gneisenau", bestückt mit je acht Kanonen vom Kaliber 21 Zentimeter, deren Geschosse zweieinhalb Zentner wogen. Mitte Oktober vereinigte es sich, dank der Führungskunst und Funktelegrafie, an einem der entlegensten Punkte des Erdballs mit drei kleineren Kreuzern und dampfte auf Chiles Küste los. Dort, nahe dem Hafen Coronel, traf das Geschwader am 1. November auf vier britische Schiffe und schlug sie nach Sonnenuntergang, als ihre Umrisse sich scharf gegen den roten Abendhimmel abhoben. Mit den großen Panzerkreuzern "Good Hope" und "Monmouth" versanken 1 500 Offiziere und Mannschaften im kalten Pazifik. Auch der englische Admiral kam ums Leben.
Übrigens schrieb mein Vater die Verluste an Kriegsschiffen immer gleich auf. Er hatte ein Buch mit den Flottenlisten aller Seemächte und hielt es auf dem letzten Stand. Vor jedes Schiff, das man als versenkt meldete, setzte er ein Kreuz; schwere Beschädigung markierte er durch ein Dreieck. Und ich ertappte mich dabei, die Verluste der Feinde viel öfter als die eigenen zu studieren: Am 9. September der britische Hilfskreuzer "Oceanic" vor Schottland gestrandet; am 20. September der Kreuzer "Pegasus" vor Sansibar von der "Königsberg" versenkt; zwei Tage später drei englische Panzerkreuzer bei Hoek van Holland von dem U-Boot U 9 in Grund gebohrt; am 27. Oktober das Linienschiff "Audacious" vor Irland durch Minentreffer gesunken; tags darauf der russische Kreuzer "Jemtschug" und der französische Zerstörer "Mousquet" im Hafen von Penang nordwestlich von Singapore vom Kreuzer "Emden" tödlich überrascht... Das las ich so oft, dass ich es noch heute auswendig weiß.
Vater aber wusste mehr. Zum Beispiel, was aus unserer stolzen "Cap Trafalgar" geworden war. Sie hatte Ende August Montevideo noch als Handelsschiff verlassen, randvoll mit Kohlen. Inmitten des Atlantik, vor der brasilianischen Felseninsel Trinidade, war sie dann von dem kleinen Kanonenboot "Eber" zum Hilfskreuzer aufgerüstet worden. Mühsam machte man die Fundamente passend, die für 15-Zentimeter-Geschütze gebohrt waren: Die "Eber" hatte nur zwei 10,5-Zentimeter-Kanonen abzugeben. Auch ihr Kommandant stieg über. Er ließ das Bild durch Neuanstrich verändern und den dritten Schornstein kappen, der blind war. "Das Dümmste, was man dem Gegner anbieten kann", sagte mein Vater dazu. "Da hilft kein Umschminken. Deutsche Passagierschiffe haben soviel bauliche Eigenheiten, dass der Fachmann sie auch erkennt, wenn ein Schornstein fehlt."
Nach seinen Worten spürte der englische Hilfskreuzer "Carmania" tatsächlich schon Mitte September die "Cap Trafalgar" am alten Ankerplatz vor Trinidade auf, beim Rendezvous mit einem Kohlendampfer. Sie hatte einen Streifzug nach Norden hinter sich und war, ohne auf Beute gestoßen zu sein, wieder dabei, ihren Brennstoff zu ergänzen. Es begann ein ungleicher Kampf: zwei 10,5-Zentimeter-Geschütze und ein paar 3,7-Zentimeter-Kanonen gegen fünf britische 12-Zentimeter-Geschütze in der Breitseite der "Carmania", die trotzdem 79 mal getroffen wurde und 35 Mann verlor. Ihr Vorschiff qualmte so stark, dass sie, vor dem Wind laufend, das Duell abbrechen musste. Die "Cap Trafalgar" hatte zwölf Volltreffer erhalten, auch in die ungepanzerte Wasserlinie, sie brannte gleichfalls und neigte sich derart nach Steuerbord, dass die Backbordschraube auftauchte. Das Schiff war nicht mehr auf Gefechtskurs zu halten, sein verletzter Kommandant ließ es sprengen. Beim Untergang fand er mit zwei Offizieren und zwölf Mann den Tod.
"Woher weißt du das?", forschte ich; all dies hatte in keiner Zeitung gestanden.
"Von einem Überlebenden", erwiderte er. "Der Kohlendampfer 'Eleonore Woermann' hat die gerettete Besatzung hergebracht..."
Er traf also doch, anders als ich, irgendwelche Leute. Mich hielt man von allem fern... Weitere Hilfskreuzer wie die "Kronprinz Wilhelm" (bewaffnet durch den Kreuzer "Karlsruhe") waren durchaus noch am Feind. Sie störten dessen Handel frech wie Piraten und wichen vor der alliierten Flotte unauffindbar in die Weite des Weltmeers aus. Meine Fantasie regte sich, wenn ich solche Meldungen las. Welche Abenteuer bestand dort eine Handvoll von Draufgängern! Was dagegen tat ich? Ich verfolgte ihren Weg auf Karten und dem Globus. Das sollte für mich alles sein?
Der springende Punkt bei den Auslandskreuzern, verriet mir Vater, war deren Versorgung. Stützpunkte gab es nicht; die letzten Häfen in den Kolonien, die sich noch hielten, waren längst von See her blockiert. Die Chance der Kreuzer im Handelskrieg stieg und fiel mit dem Kohlebestand an Bord. In jahrelanger verdeckter Arbeit hatte das Marineamt abgelegene Plätze für eine Kohlenübernahme erkundet und Tross-Schiffe verpflichtet, ein weltumspannendes Netz zur Versorgung mit Brennstoff, Nachschub und Nachrichten geknüpft. Aber der Feind schlief nicht, sein Geheimdienst deckte allmählich die Fäden auf. London übte so lange Druck auf die Neutralen aus, bis die "Marineetappen" – so nannte Vater das Netzwerk – Stück für Stück zerfetzt wurden. Dies erst besiegelte das Schicksal der deutschen Schnelldampfer. Sie fraßen einfach zuviel Kohle, als dass sie sich von dem Vorrat der feindlichen Handelsschiffe, die sie aufbrachten, hätten selbst versorgen können.
Bevor aber die erste Welle unserer Hilfskreuzer von den Meeren verschwand, scheiterte das Geschwader des Grafen Spee bei den Falklandinseln. Der Admiral stieß dort am 8. Dezember 1914 frühmorgens bei dem Versuch, die britische Funkstation und das Marinearsenal zu zerstören, verblüfft auf acht Feindschiffe. Sie lauerten hinter den Hügeln von Port Stanley, geführt von den zwei Schlachtkreuzern "Invincible" und "Inflexible". Diese waren Spees Panzerkreuzern von England entgegengeeilt: artilleristisch dreifach überlegen, durch stärkere Panzerung geschützt und außerdem schneller, also imstande, einen Gefechtsabstand zu wählen, der die größere Schussweite ihrer 16 Geschütze vom Kaliber 30,5 Zentimeter (mit den acht Zentner schweren Granaten) zur Geltung brachte.
Spees Geschwader focht sieben Stunden lang, bis zum grausigen Ende. Das Flaggschiff "Scharnhorst" sank im Geschosshagel mit dem Admiral und seinen 800 Mann. Die "Gneisenau" ging zwei Stunden später unter, wobei die Engländer kaum ein Viertel der Besatzung retteten – in ihrem Drang, den Rest des Geschwaders auch noch zu erwischen. Von den drei Kleinen Kreuzern entkam ihnen einzig das Turbinenschiff "Dresden", während die "Leipzig" und die "Nürnberg", durch bewachsenen Schiffsboden und Kesselrohrbrüche in ihrer Geschwindigkeit gebremst, von den Verfolgern ereilt wurden und sich nochmals heftig wehrten. Von den 650 Seeleuten überlebten nur 25.
Es ist schwer, nach so vielen Jahren meine Gefühle zu schildern. Damals erschien es mir besonders heldenhaft, dass alle Schiffe mit wehender Flagge sanken; also bis zuletzt den Feind nicht etwa baten, das vernichtende Feuer zu stoppen. Noch beim Sinken der gekenterten "Nürnberg" hielten vier Mann, auf dem Kiel schon im eisigen Wasser stehend, die Reichskriegsflagge hoch! Das vielfach kopierte Ölbild "Der letzte Mann" stellt eine ganz ähnliche Szene dar.
Mit vierzig ist man nüchterner und skeptischer als mit fünfzehn, auch was den Patriotismus betrifft. Heute weiß ich, dieser maßlose Stolz kostete nur noch mehr Menschenleben. Weit über zweitausend deutsche Matrosen waren tot; zerrissen, erstickt, ertrunken. Darunter auch jene 127 Reservisten und Kriegsfreiwilligen, die Graf Spee an Bord genommen hatte, als er nach dem Sieg von Coronel für 24 Stunden in Valparaiso eingelaufen war – unter dem Jubel der dortigen Auslandsdeutschen. Jetzt hörte man die Engländer in Montevideo ebenso feiern. Ihre Grand Fleet hatte die Scharte von Coronel ausgewetzt. Ja, es schien, als befänden sich sämtliche Handelswege nunmehr fest in britischer Hand.
Die bittere Wahrheit
Allmählich dehnte ich meine Streifzüge gegen das elterliche Verbot bis ins Stadtzentrum aus. Der Weg führte auf eine Anhöhe zum Rennplatz; von dort brachte mich die Straßenbahn für fünf Centavos über den palmengesäumten Boulevard "18. de Julio" zur Plaza de Independencia, wo mit der Markthalle und dem Theater die Altstadt begann. Montevideo hatte eine Viertelmillion Einwohner, fast viermal soviel wie damals Rostock, zur Hälfte übrigens Fremde: Basken, Italiener, Franzosen, Deutsche und Briten. Es gab einen Deutschen Klub, dem Vater fernblieb, und sieben verschiedene Zeitungen, darunter zwei englische... Mich aber zog es stets zum Postamt und zum Hafen.
Die Hauptpost, Central de Correos, lag zwischen der aus Backsteinen erbauten Kathedrale und dem Englischen Hospital. Schon Anfang Oktober hatte ich einen Brief an Anni geschickt, versehen mit dem Hinweis via Italia: die schnellste Verbindung lief über das damals noch neutrale Italien. Darin bat ich meine Freundin, mir auf demselben Weg an die Hauptpost von Montevideo zu schreiben, poste restante, was "postlagernd" heißt. Voller Ungeduld fragte ich ab Ende November jede Woche klopfenden Herzens am Schalter nach, ohne dass etwas für mich kam.
Vom Postamt schlenderte ich immer ans nahe Meer, um meinen Kummer zu vergessen. Beim Zollhaus, nördlich des Forts San José, begannen die Docks und die Schiffsliegeplätze. Die Bucht von Montevideo, anderthalb Seemeilen im Quadrat, war hier kaum vier Meter tief. Große Schiffe ankerten deshalb auf Reede inmitten der Bucht, täglich dampften an die drei ein oder liefen in den Silberfluss hinaus. Kohlen nahmen sie auf der Westseite, wo sich unterhalb des Monte Video (150 Meter hoch, von einem Fort und dem Leuchtturm gekrönt) auch die Schlachthäuser mit ihren Piers befanden. In der Bucht lag auf Isla de los Ratos, der Ratteninsel, das Zuchthaus für jugendliche Verbrecher. Dahinter, am Nordufer, erstreckten sich die prächtigen Gärten der ausländischen Kaufleute mit deren Villen.
Elf Schifffahrtsgesellschaften hatten den Hafen bedient, darunter die Hamburg-Südamerikanische und der Norddeutsche Lloyd. Jetzt waren es bloß noch acht, die deutschen Linien fehlten, ihre Büros waren verödet. Keines unserer Schiffe lief mehr ein: Die feindlichen Agenten, von denen es in der Stadt wimmeln sollte, hätten es ja sofort über Funk der Royal Navy mitgeteilt. Die Briten kreuzten im Südatlantik oder kamen sogar her, um Kohlen, Wasser und Proviant zu nehmen. Nur 24 Stunden durften Kriegsschiffe nach dem Seerecht in neutralen Häfen bleiben; doch für die mächtigen Briten galt das nicht... Sehnsüchtig sah ich den Frachtern nach, die nach Europa gingen, beladen mit Wolle, Häuten, Trockenfleisch und Büchsen voller Fleischextrakt. Was hätte ich für meine Überfahrt und Heimkehr, zum Beispiel via Italia, nicht alles hergegeben!
Kurz vor Weihnachten sah ich am Kai hinter dem Bahnhof einen Herrn, der durch die drückende Wärme eine Aktentasche trug. Ehe er mich wahrnahm, erkannte ich meinen Vater. Gedeckt von den Kistenstapeln der Ladestraße folgte ich ihm unbemerkt zur Plaza Flores. Dort betrat er ein Juweliergeschäft, in dem er sich längere Zeit aufhielt. Wählte er vielleicht ein Geschenk für Mutter aus? Zwar schämte ich mich, ihn so zu beobachten, konnte es aber auch nicht lassen, denn schließlich war klar, dass ein Geheimnis ihn umgab. Später sah ich ihn in eine Straßenbahn steigen, die um die ganze Bucht herum zu den besseren Vorstädten Paso Molino, Aguada und Pocitos fuhr. Wen besuchte er dort wohl?
Abends fand ich in seiner Aktentasche das Fernglas, in der Rocktasche ein Billett der Straßenbahn, gelöst bis zur Endstation am Monte Video. Von dem Berg aus blickte man weit übers Meer. Was bedeutete das? Spähte Vater auch bloß Schiffen nach, wehmütig wie ich? Anstatt unsere Rückkehr zu betreiben oder jene mysteriösen Landkäufe zu tätigen, an die zu glauben mir längst schwer fiel?
Am Heiligen Abend dämmerte mir etwas. Die englische Zeitung, die Vater hielt, berichtete mangels anderer Kriegserfolge groß von einem deutschen Spion. Er war in Scapa Flow, dem Haupthafen der Royal Navy auf den Orkney-Inseln, gefasst und vor ein Kriegsgericht gestellt worden. Als Geschäftsmann getarnt, hatte er Schiffsbewegungen der Home Fleet, der britischen Heimatflotte ausgespäht und über Funk der deutschen Seekriegsleitung gemeldet. Da er immerhin Offizier war, hieß es, habe man ihm nicht ganz den Respekt versagt und ihn zum Tode durch Erschießen verurteilt. So starb er halbwegs wie ein Soldat.
Es überlief mich heiß. Auch Vater war Offizier, Leutnant der Reserve, und mit der See vertraut. Das Handbuch der Kriegsflotten fiel mir ein, viele britische Schiffe waren darin abgebildet, und er hielt es peinlich auf dem Laufenden. Hinzu kam seine Kenntnis der "Marineetappen", des deutschen Unterstützungsnetzes, das er mir beschrieben hatte. Und all die verstreuten Bemerkungen zum Einsatz der Hilfskreuzer, die ihm entschlüpft waren! Konnte es sein, dass man ihn kurz vor Kriegsausbruch, eben noch rechtzeitig, hergeschickt hatte, damit er den feindlichen Schiffsverkehr auf dem Rio de la Plata beobachte? Warnte er eigene Schiffe im Südatlantik, die das Falklandunglück überlebt hatten, etwa vor britischen Kreuzern, wenn sie hier auftauchten, und signalisierte er auch das Auslaufen englischer Frachter, die so ein Opfer der deutschen Seekriegsführung wurden? Aber wo war sein Funkgerät? Womöglich saß ein Helfer dort oben am Monte Video.
Der Schatten verflog, der auf unserer Freundschaft lag. Vaters Schweigen wurde verständlich, er gewann meine Achtung zurück. Im Stillen hatte ich ihm nämlich schon vorgeworfen, er verstecke sich im warmen Süden, während andere wehrfähige Deutsche im Ausland alles daran setzten, auf Schleichwegen heimzukehren und ungeachtet der Briten, die jedes neutrale Schiff nach Deutschen durchsuchten, zur Fahne eilten. Dabei tat er offenbar hier nur seine Pflicht, so schwer es ihm auch sein mochte. Zwar stand er nicht in Feindesland wie der zum Tode verurteilte Offizier. Doch angesichts der feindlichen Geheimagenten war das englandfreundliche Uruguay für ihn gewiss ein heißes Pflaster.
Mir fiel ein Stein vom Herzen. All das erklärte unsere Einsamkeit – Vaters Vorsichtsmaßregeln ebenso wie Mutters Tränen. Er war also ein Held. Nur, weshalb weihte er mich nicht ein? Mutter, die ihm kaum helfen konnte, wusste doch auch Bescheid... Am Silvesterabend überraschte ich ihn über seinen Münzen. Ich hatte nicht geahnt, dass er sie mitgenommen hatte. Obwohl er den Deckel rasch schloss, sah ich, dass wertvolle Stücke fehlten – sogar die 25-Rubelmünze, von der es nur 475 Exemplare auf der ganzen Welt gab. Sechshundert Goldmark war sie wert, damals ein Vermögen. Die Kassette schien halb leer zu sein. Übrigens hatte Vater auch kein Geschenk beim Juwelier gekauft... "Was ist denn, Richard?", fragte er.
"Du hast Nikolaus II. nicht mehr", sagte ich.
"Ach, was soll mir noch der Zar", scherzte er. "Dessen Tage sind gezählt."
"Es ist dein bestes Stück gewesen!"
"Nein, das seid ihr – deine Mutter und du."
"Bankfrisch", bohrte ich, um ihn aus der Reserve zu locken. "Erhaltungsgrad 'vorzüglich', extremely fine."
"Si, señor, extraordinariamente bien conservada."
"Vater, können wir ernsthaft reden?"
"Nicht im alten Jahr", sagte er, stets bereit, etwas ins Komische zu ziehen.
Und auch im neuen Jahr wich er mir aus, speiste mich leichthin ab, anstatt mir zu vertrauen. Trotzdem, er wuchs in meinen Augen: ein Mann, der sich in schwerer Zeit für Kaiser und Reich von seinen Schätzen trennt. Ich stellte mir vor, dass er von dem Gold das Funkgerät gekauft hatte, den Helfer besoldete oder auch den Hafenmeister bestach, damit der ihm Auskünfte gab. Eines seiner Marinebücher umriss die Forderungen, die an Seeoffiziere gestellt werden mussten, wie folgt: gebraucht würden "Männer mit Charakter, Fachkenntnissen, Persönlichkeitswert, Selbstverleugnung, Energie, Taktgefühl und Verschwiegenheit". Ich fand, dass er diesem Ideal recht nahe kam, besonders im letzten Punkt... Bis etwas ganz anderes geschah.
Am 26. Januar, dem Vorabend meines Geburtstags, der mit dem des Kaisers zusammenfiel, lag auf dem Postamt plötzlich ein Brief. Nachricht von Anni – das schönste Geschenk, das ich mir wünschen konnte! Doch man hielt den Brief zurück. Erst müsse ich mich ausweisen, darauf bestand der Beamte. Ich eilte nach Haus und kehrte mit Vaters Reisepass zurück, in dem ich als sein Sohn eingetragen war. Mit einem unguten Gefühl legte ich das Büchlein vor, so als lüfte dies Vaters Tarnung und könne im schlimmsten Fall zu seiner Festnahme führen.
Der Schalterbeamte prüfte den Pass, ohne bis zu der Seite zu blättern, auf der mein Name stand. Dann nahm er das Couvert aus dem mit "H" beschrifteten Fach und gab mir beides, Brief und Pass, mit den Worten señor Harms, por favor. Ich sah, kaum sechzehnjährig, offenbar schon erwachsen aus, blieb aber, obgleich geschmeichelt und beglückt, auf der Hut. Mühsam bezwang ich meine Ungeduld. Vier Häuserblocks weiter erst, auf der Plaza Mayor, stand für mich fest, dass niemand mir folgte. Da sank ich auf eine Marmorbank gegenüber dem Regierungssitz und zog mit zitternden Fingern den Brief hervor.
Doch was war das? Meine Bestürzung konnte nicht tiefer sein, als ich die Anschrift las. Der Brief war nicht an mich, sondern an Albert Harms adressiert! Und nicht Anni Greve hatte das geschrieben, sondern ihr Vater Kurt. Überreizt und enttäuscht, ja ganz fassungslos las ich mehrmals die Namen von Absender und Empfänger. Nach all der Erwartung war das zuviel. Tränen stiegen mir in die Augen, Tränen der Wut. Hatte Kurt Greve meinen Brief vom Oktober wieder abgefangen und schrieb an Vater, um meinen Kontakt mit Anni erneut zu unterbinden? Das konnten sie, die Herren Väter, mit mir nicht machen. Ich musste wissen, was gespielt wurde! In einer jähen Wallung fetzte ich den Umschlag auf, Klarheit ging mir jetzt über alles.
Erst wesentlich später hab ich es geschafft, solche Regungen von Jähzorn, stiegen sie in mir hoch, zu beherrschen. Mein Leben wäre anders verlaufen, hätte ich den Brief unversehrt meinem Vater gebracht, an den er schließlich gerichtet war. Aber es war schon passiert, nach der ersten Zeile musste ich weiterlesen. Die Stunde der Wahrheit brach an.
Und sie war schlimm. Der Text lautete: "Rostock, den 22. November 1914... Lieber Albert, endlich haben wir ein Lebenszeichen von Euch, durch Deinen Richard, der Anni geschrieben hat. Ich hielt es freilich für besser, ihr den Brief nicht auszuhändigen. Sie hat unter Richards abruptem Weggang sehr gelitten, da möchten wir doch, dass die Wunde vernarbt. Immerhin, Dein Sohn war ihre erste Liebe; sie ist wochenlang krank gewesen.
Ihr werdet zweifellos verstehen, dass von einer Verbindung unserer Kinder, ganz abgesehen von deren Jugend, keine Rede mehr sein kann, nach all dem, was zu meinem größten Bedauern geschehen ist. Du hast dich mit den Grundstücken in Dierhagen-Neuhaus arg verspekuliert, sie sind praktisch wertlos, solange kein Mensch weiß, wann die projektierte Bäderstraße gebaut werden oder wenigstens eine Schiffsverbindung von Ribnitz zustande kommen wird. Daran ist jetzt im Kriege noch weniger als vorher zu denken. Wie konnte einem erfahrenen Makler wie Dir das nur passieren? Das Konkursverfahren der Gläubiger gegen Deine Firma, Albert, hat entsetzlich viel Staub aufgewirbelt. Sie ist im Handelsregister gelöscht worden.
Selbst mich, Deinen Freund, hat der Umfang Deiner Schuldenlast erschüttert. Du hast es bei unserem letzten Gespräch vermieden, wenigstens Deinem Schwiegervater und mir, die wir willens waren, Dir zu helfen, reinen Wein einzuschenken. Übel vermerkt wurde in der Bürgerschaft, dass Dein Haus bis unters Dach mit Hypotheken belastet ist und Du viel Mobiliar – wie auch die Jacht – noch vor dem Aufbruch zu Geld zu machen wusstest. Die Gläubiger gingen leer aus, zumal das wertvollste Pfand, Deine Münzsammlung, mit Dir verschwunden ist. Der Staatsanwalt erhob Anklage nach § 239 Ziffer 1 und 4 der Konkursordnung. In der Fassung vom 17. Mai 1898 bedroht das Gesetz den zahlungsunfähigen Schuldner mit Zuchthaus, welcher in der Absicht, die Gläubiger zu benachteiligen, Vermögensstücke verheimlicht oder beiseite geschafft und seine Handelsbücher so geführt oder verändert hat, dass dieselben keine Übersicht des Vermögensstandes gewähren.
Und wenn auch die Strafkammer des Landgerichts mit dreieinhalb Jahren unter dem Strafantrag des Staatsanwalts blieb, so bist Du doch, in absentia, wegen betrügerischen Bankrotts rechtskräftig verurteilt, zu Zuchthaus, leider. Das dürfte Dir die Rückkehr dauerhaft versperren, mehr noch als die dann fällige Wiedergutmachung des Schadens. Ich hab mich erkundigt, Albert: die Vollstreckung rechtskräftig erkannter Strafen verjährt bei Zuchthaus unter zehn Jahren, also in Deinem Fall, nach § 70 StGB Ziffer 3 erst in fünfzehn Jahren, d. h. um das Jahr 1930! Trotz alledem wünsche ich Dir, mein Lieber, in Erinnerung an die alten Zeiten einen guten Start in der Neuen Welt. Möge das Schicksal Euch dort drüben gnädiger sein als hier in der Heimat, die schon unter den Opfern stöhnt, welche der große Krieg von uns fordert. Mein Schwager Erich ist bei Ypern gefallen... Gott schütze Euch! Dein Kurt."
Die "São Gabriel"
Verstört fuhr ich zum Stadtrand und ging den Rennbahnhügel hinab auf das billige Häuschen zu, das uns nach dem Zusammenbruch geblieben war – die verwaschen graugrün und rötlich getünchte Schachtel mit der dürftigen Holzveranda und dem flachen Oberstock. Kein vorübergehendes Quartier: unsere endgültige Bleibe! Ein zerschmetternder Schlag. Ich war wie betäubt. Sollte ich denn "auf Dauer", wie Kurt Greve schrieb, in der Fremde sein, für immer von allem getrennt, was mir lieb und teuer war? Nur weil mein Vater ein rechtskräftig verurteilter Bankrotteur war, der sich im Reich nicht mehr blicken lassen durfte? Wie hatte ich mich in ihm getäuscht! Nicht fürs Vaterland gab er sein Gold hin – wir fristeten jämmerlich das Leben damit. Nicht in Montevideo, sondern in Rostock drohte ihm Verhaftung.
Mir ging auf, dass Vater wirklich gar nichts tat, außer nach und nach seine Sammlung zu verkaufen, an reiche Leute unterhalb des Monte Video oder an jenen Juwelier. Weit davon entfernt, unserer Seekriegsleitung zu dienen, vertrieb er sich mit dem Fernglas und der Flottenliste bloß die Zeit. Er war kein Patriot, für ihn war der Krieg eher ein Spiel, spannend wie ein Sportereignis. Schlimmer noch, Geld ging ihm nicht nur über das Vaterland, sondern auch über die Redlichkeit. Wie ihm da in die Augen sehen? Wie morgen an meinem Geburtstag (und dem des Kaisers Wilhelm) seinen Glückwunsch ertragen und ein Geschenk empfangen, bezahlt von dem Geld, um das er die Gläubiger geprellt hatte?
Zu meiner Erleichterung fand ich nur die Köchin vor. Sie sagte, die Eltern seien nach Playa Ramirez gefahren. Da legte ich den verhängnisvollen Brief mitten auf den Tisch und schrieb dazu: "Da ihr also weder heimwollt noch es könnt, erlaubt wenigstens mir die Rückkehr. Ich probiere es jetzt auf eigene Faust." Mit Überwindung schloss ich: "Bitte versteht mich und forscht nicht nach mir. Ich melde mich auf demselben Wege wie Onkel Kurt. Lebt wohl – Euer Richard."
Ich spürte das Endgültige des Abschieds und beeilte mich, meine geringe Habe in der Reisetasche zu verstauen. Um Mutter tat es mir leid, dem Vater schuldete ich keinen Gehorsam mehr... Wenig später verließ ich das kleine Haus nahe der Punta Brava. Ich sollte es niemals wiedersehen. Als mich nach einem Vierteljahrhundert das Schicksal wieder hierher verschlug, stand in dieser Gegend ein Villenviertel in noblem Weiß am Meer.
Was aber tun? Selbst der billigste Schiffsplatz war für mich unerschwinglich. Und welcher Kapitän würde Unannehmlichkeiten mit den Engländern riskieren, indem er einen jungen Deutschen an Bord nahm, der sich die Überfahrt durch Arbeit verdiente? Meine Hoffnung galt einem Schiff unter der grünroten Flagge Portugals, es hieß "São Gabriel" und lag seit Tagen auf Reede. Mit eigenem Ladegeschirr löschte es Landwirtschaftsmaschinen auf Leichter, die zum Bahnhofskai schwammen. Einer der Matrosen hatte mir erzählt, dass die Rückfracht – darunter lebendes Vieh – für Schweden bestimmt war. Wenn es mir nun gelang, auf einem Leichter unbemerkt an Bord zu kommen, im Durcheinander des Verladens? Machte ich die Reise als blinder Passagier, fanden mich auch die Briten nicht. Neuerdings zwangen sie jedes nach Skandinavien bestimmte Schiff dicht unter ihre Kanalküste, um es bequem nach sogenannter Konterbande durchsuchen zu können: Waren des Kriegsbedarfs für Deutschland.
Doch als ich zum Hafen kam, war das Entladen schon beendet. Die "São Gabriel" hatte südlich der Ratteninsel an einer Tonne festgemacht, für mich kaum erreichbar. Hinschwimmen, das hieß, auf meine letzte Habe zu verzichten. Stunde um Stunde verbrachte ich ratlos an der Pier neben dem Zerstörer "Uruguay" mit seiner blauweiß gestreiften Flagge. Das einzige Schiff der Marine des Landes – sechs Kanonen, zwei Torpedorohre und 120 Mann Besatzung, wie es in Vaters Flottenliste stand.
Inzwischen konnten die Eltern den Brief entdeckt haben, vielleicht suchten sie schon nach mir: zwischen Bahnhof und Zollhaus, wo sonst? Es führte nur der Seeweg nach Europa. Halb fürchtete, halb hoffte ich, dass sie mich fanden. Mir wurde Angst vor dem eigenen Entschluss. Allein der Gedanke, wie Vater mich genarrt und dass er mit unserem Haus in Rostock auch mein Zimmer dort verschleudert hatte samt all den Dingen, an denen ich hing, bestärkte mich in der Absicht, ihm den Rücken zu kehren. Er konnte mich doch nicht an sich ketten, wenn er sich hier verkroch, während Anni vor Gram verging.
Als der Abend sank, stieß ich vor einem Ecklokal wieder auf den portugiesischen Matrosen. Das erschien mir als Wink des Schicksals. Ohne langes Zögern bat ich ihn, mich an Bord zu schmuggeln – es werde sich für ihn lohnen.
"Deutscher, he?", fragte er höhnisch; man höre es an meinem Akzent. "Kannst es nicht abwarten, für deinen Kaiser ins Gras zu beißen? Geh doch zu eurem Konsulat, das zeigt dir den Weg ins Massengrab."
"Wollen Sie sich denn nichts verdienen?"
"Das kommt drauf an." Er spuckte seinen Priem aufs Pflaster und musterte mich von oben bis unten. Meine Kleidung brachte ihn wohl auf die Idee, dass bei mir etwas zu holen sei.
"Worauf kommt's an?"
"Was dir die Reise wert ist."
Ich klimperte mit dem Silbergeld in der Tasche, meinem ganzen Besitz – darunter auch die blanken Sammlerstücke, die Vater mir im Laufe der Zeit geschenkt hatte –, und zählte es vor ihm auf die Kaimauer. Mochte all das draufgehen, in Stockholm half mir ja der Konsul weiter.
"Nicht eben viel für das, was ich da riskiere."
Ich legte meine Taschenuhr dazu.
"Reicht vielleicht für die Überfahrt, Kleiner. Aber was willst du essen?"
"Mir genügt ein bisschen Zwieback."
"Quatsch. Fünf Wochen auf See, ich muss dich füttern, das erhöht mein Risiko..."
Seine Augen glitzerten gierig im Schein der Gaslaterne. Er witterte bei mir noch mehr. Da zeigte ich ihm die Goldmünze, ohne sie aus der Hand zu geben – meinen Talisman, das Unterpfand einer Freundschaft, von der nichts mehr geblieben war. "Ein Imperialdukaten, bestens erhalten", betonte ich. "Muy bien conservada, ohne Kratzer, Spuren von Abnutzung nur an den höchsten Stellen des Reliefs! Ein Sammlerstück, viel mehr wert als das, was draufsteht."
Der Matrose griff nach dem Gold. Doch ich erklärte ihm, das gebe es erst an Bord. Dies sah er ein und führte mich zu einer Jolle, die sich am Landungssteg rieb... Ich hatte ihn herumgekriegt. Fast alles auf der Welt wird für Geld getan, und Habsucht hat oft üble Folgen für den, der sie hegt, wie für den, der zahlen muss.
Wir ruderten in Richtung Punta del Rodeo über das dunkle, schmatzende Wasser, das vom Meer hereinschwappte. Die Lichter der Stadt flimmerten darauf. Der Mann hieß Pedro; ich sagte ihm, er solle mich Ricardo nennen. Wie finge er's denn an, mich unbemerkt auf das Schiff zu bringen? Keine Angst, erwiderte er, die Offiziere sind an Land, die Mannschaft hockt beim Abendbrot in der Messe, das Fallreep hat die Brückenwache nicht im Blick, und die döst sowieso im Hafen.
Düster wuchs der Rumpf des Frachters vor uns in die Höhe. Wir machten am Fallreep fest und kamen ungesehen auf das Hauptdeck. Am vorderen Ladebaum vorbei führte Pedro mich zur Back hinauf, öffnete das Schott zu einem Niedergang und stieg mit mir treppabwärts in die "Segellast": einen Raum voller Tauwerk, Leinen, Persenninge und anderem Schiffszubehör.
Zwischen der Bordwand und aufgerollten Tampen wies er mir einen Platz an. Hier sei ich sicher, einigermaßen. So oft er Wache hätte, würde er mich beim Rundgang versorgen. "Keinen Mucks, Kleiner, der Käpten frisst dich roh, ihr Deutschen habt ihm sein voriges Schiff torpediert!" (Er sagte es drastischer: unterm Arsch weggepustet.) Er nahm mein Goldstück und ließ mich mit dieser Warnung im Finstern allein. Es war geglückt! Mein großes Abenteuer hatte begonnen.
Ich bettete mich auf geteertem Segeltuch; damit deckt man bei Sturm die Lukenöffnungen ab. Es war warm, das Metall der Bordwand schwitzte. Irgendwann kam der Matrose mit Kaffee und belegten Broten. Wie spät es war, wusste ich nicht, er hatte ja meine Uhr. Überhaupt verlor ich in der ständigen Dunkelheit bald jedes Zeitgefühl.
Einmal erschollen Rufe, die Maschine begann zu stampfen. Das Schiff setzte sich zitternd in Bewegung, doch nur für Minuten, dann fiel der Anker. Zu meinen Füßen rasselte und klirrte es, als liefe nebenan die Ankerkette hinab zum Kettenkasten. Später hob ein gewaltiges Poltern an – der Frachter bunkerte Steinkohle, er lag also an der Westseite, immer noch im Hafen.
Alpträume störten meinen Schlaf. Der Kapitän verfolgte mich durch die Gänge seines Schiffs bis hinab zu den Heizern; er sah meinem Großvater ähnlich, dem Fuhrunternehmer aus der Neustadt, der mir die Neigung zum Jähzorn vererbt hat. Dann die Eltern unter den Palmen von Playa Ramirez, dem Strandband unterhalb der Rennbahn, auf den Knien vor einem, der ihnen zurief: Fünf Jahre Zuchthaus und Wiedergutmachung des Schadens! Das Bild kippte weg, Anni erschien, ihr Mund streifte mich, ich wollte sie packen, doch sie wandte sich ab und floh vor mir mit wehendem Haar, war gar nicht einzuholen und verschwand im Toben der Gewitternacht. Ich wachte auf und versuchte, mir ihr Gesicht vorzustellen – nicht einmal das gelang.
Nur das Toben blieb, ein Brüllen und Quietschen, es ging mir durch Mark und Bein. Aha, das Vieh wird verladen! Rinder und Schweine, so hörte es sich an, für das hungrige Europa. Man hievte sie wohl in Boxen an Bord, es nahm gar kein Ende. Ich legte das Ohr an die Trennwand zur Luke 1, die offenbar zum Stall geworden war. Das Ohr, nun mein wichtigstes Organ. Die Tiere grunzten und scharrten. Ich fühlte mich ähnlich eingepfercht, selbst wie ein Stück Vieh. Und doch bereute ich nichts... Endlich rasselte über mir die Kette durch das Ankerspill, wir legten ab zur großen Fahrt.
Nach meiner Berechnung begann das Pech, als wir bei Punta del Este den offenen Ozean erreichten, wo der Südostpassat bläst. Der Frachter fing an, in der rauen See zu rollen und zu stampfen. Er dampfte schräg gegen einen Starkwind an. Wellen schmetterten gegen den Bug, nebenan brüllte das Vieh, als müsse es verenden. Nach endlosem Schlingern in der Finsternis hob sich auch mir der Magen, ich spie in den Eimer, den Pedro mir hingestellt hatte. Und plötzlich fiel Licht in den Raum, das Schott ging auf, Matrosen stiegen ein, um Persenninge zum Abdecken der Lukenöffnungen zu holen. Ich verbarg mich hinter gestapeltem Tauwerk, doch sie stießen den Eimer um, fluchten über die Schweinerei und fanden meine Reisetasche. Im Handumdrehen war ich entdeckt.
Über das windumtoste Vorschiff trieb man mich aufs C-Deck hinauf in den Wohnraum des Kapitäns, der eigens von der Brücke kam: Ein feister, pathetischer Mann mit umschatteten Augen und wirrem, graumeliertem Haar, das ihm unter der Mütze hervor bis zum zweizipfligen Bart und in den Nacken quoll. Er überschüttete mich mit Drohungen und Fragen. Meine Behauptung, ich sei durch den Hafen zum Schiff geschwommen, wischte er einfach weg. Angesichts der Reisetasche kam ich natürlich damit nicht durch. Entweder, so brüllte er dramatisch, habe er einen Sträfling von der Ratteninsel vor sich oder einen der verdammten Deutschen, die gleichfalls dort hingehörten.
Sie stülpten meine Taschen um, rissen mir das Hemd vom Leib, banden meine Hände an ein Rohr und droschen mit einem nassen Ende Tau die Wahrheit aus mir heraus. Ich schrie sie ihnen ins Gesicht. Sollte ich mich für den Matrosen, der mein ganzes Geld genommen hatte, auch noch totschlagen lassen? Er wurde vor den Kapitän geführt. Der beschimpfte ihn schrill und ließ sich das Geld aushändigen, das nun in seinem Safe verschwand... Zwei Spitzbuben, einer des anderen wert.
All das geschah auf der Höhe von Rio Grande unweit der brasilianischen Küste, so dass ich schon glaubte, man würde mich dort aussetzen – zwar mittellos, doch nahe den Deutsch-Brasilianern, die in dem Bundesstaat Porto Alegre siedeln. Vermutlich hätten sie mich gut aufgenommen. Aber soviel Mühe gab man sich mit mir nicht. Ich wurde in die Luke I geschickt, zum Ausmisten und Füttern des verängstigten Viehs. Mein zerschlagener Rücken schmerzte, und da meine Kleidung bald ziemlich stank, duldete man mich weder an Deck noch gar in der Mannschaftsmesse. Ich hatte dort unten auf einer Schütte Stroh zu schlafen und kriegte bloß Speisereste herabgereicht. Wie sollte es erst werden, wenn wir bei Rio de Janeiro in die Tropensonne kamen?
Einmal brachte Pedro mir den Fraß. Er hasste mich jetzt, wollte sich mit mir prügeln, doch entweder war er zu feige oder ich ihm zu dreckig, und so blieb es bei Worten, aber was für welchen! "Hast dich zu früh gefreut, du Verräter", sagte er mit kalter Verachtung. "Meinst, es geht nach Stockholm, was? Steht auch so in den Papieren. Aber unser Ziel ist Liverpool! Dort wartet der Tommy auf dich. Du bist ihm schon per Funk gemeldet."
"Liverpool?", fragte ich halb ungläubig, halb entsetzt; der wütende Nachdruck seiner Sätze ließ kaum einen Zweifel. "Das hast du gewusst, du Teufel?"
"Im Hafen noch nicht. Der Käpten hat sich halt überlegt, wo mehr rausspringt..."
"Ihr seid alle gleich, ganz scharf aufs Geld!"
"Kann sein. Darum Liverpool! Und stell dir vor, es freut mich für dich."
Das Kaperschiff
Obwohl die See sich glättete, blieb meine Lage fatal. Kein Mensch sprach mit mir, es gab bloß Befehle. Quälend verging die Zeit. Unter Deck wurde es ständig heißer, und nur zweimal täglich durfte ich hinauf – in der Frühe, wenn die Sonne sich pompös aus dem Meer erhob, und abends, wenn sie farbenprächtig vor der unsichtbaren Küste Südamerikas unterging... Mir kamen die Wolkenbilder märchenhaft vor.
Doch der Anblick solcher Weite steigerte nur die Qual. Danach nämlich flog der Mist über Bord, und es hieß wieder treppab in den Gestank von Luke I zu gehen, wo immer gleich der Schweiß troff. Die Luft war ätzend, kaum zu atmen, nie schaffte es der Lüfter, sie zu erneuern. Unter dem Vieh hatte ich einen Freund, das Kalb Marthchen, mein einziger Zeitvertreib und Trost. Und am Ende der Reise würde Gefangenschaft drohen! Ich saß in der Falle, war aber längst unfähig, mein Pech zu beklagen. Der Mangel an frischer Luft ließ mich gähnen. Mattheit und Apathie betäubten mich.
Da, am Spätnachmittag des achten Tages, ertönten die Alarmhupen. Das Schiff kriegte Schlagseite, es legte sich jäh in die Kurve, wie um einem Eisberg auszuweichen. Ich prallte gegen eine Box, ließ die Mistgabel los und sah ein paar Tiere stürzen. Über mir war ein Pfeifen und Gerenne auf den Planken. Der Rhythmus der Maschine änderte sich, sie lief Höchstfahrt, der ganze Rumpf bebte unter ihrem Stampfen. Das Vibrieren war so scheußlich wie der Bohrer des Zahnarztes auf einem kranken Zahn. Und dann erschütterte ein Knall den Raum, ein Schlag gegen die Bordwand, so als krepiere ganz nahe eine Granate im Meer. Was bedeutete all das? Das Vieh brüllte, der Ventilator fiel aus, ich rang in diesem feuchtheißen Keller nach Luft.
Es hielt mich nicht länger unten. Zitternd band ich eine zerschlissene Schwimmweste um, die man mir gegeben hatte, und stieg mit weichen Knien hoch. Waren wir auf eine Mine gelaufen? Das Luk ließ sich öffnen, niemand beachtete mich, also kroch ich an Deck. Es schien, als sei alle Fahrt aus dem Schiff. Die "São Gabriel" schaukelte sanft in der Abendbrise. Und auf Backbord, schräg unter der Sonne, lag ockerfarben ein Frachter, kaum halb so groß wie wir... Hatte der uns etwa gestoppt – ein Holländer? Er zeigte seine Breitseite, bräunlicher Rumpf und beigefarbene Aufbauten. Am Vorsteven hing das Fähnchen des Heimathafens Rotterdam, am Schornstein hatte er eine grünweiße Reedereimarke und am Heck rotweißblau die Fahne der Niederlande.