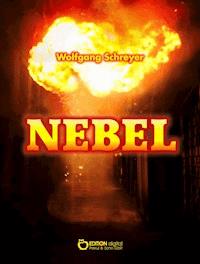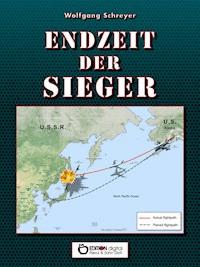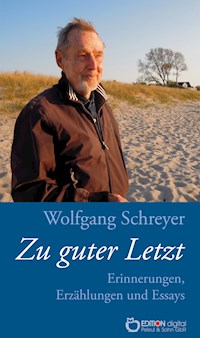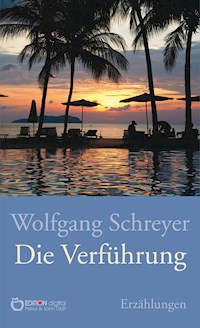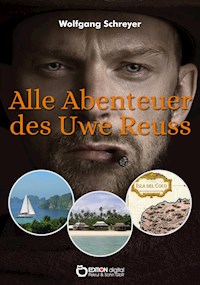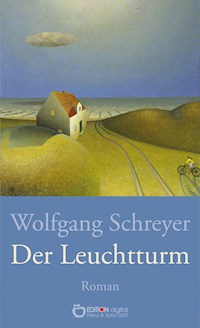
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christian Wendt lebt an der Ostsee im Ruhestand. Aber da bohren in ihm noch Fragen. Der Ex-Kriminalist will sie lösen, mehr durch Recherchen als durch Grübeln. Die Rätsel der Welt, dieses Landes und des eigenen Lebens, hängt da nicht vieles zusammen? Sein ruheloser Geist will das ergründen. Private Ermittlungen führen ihn durch die Feriensiedlung bis ins Grundbuchamt, an den Tisch Nr. 3 des Landgasthauses „Am Kiel", ja auch zum Alterssitz des ehemaligen Staats- und Parteichefs Krenz. Ein deutscher Polizist muss alles klären. Tief taucht er in längst Versunkenes, in Notlagen von heute, in die Psyche zweier Männer und einer Frau ... auch in das Dunkelfeld der eigenen Seele. Was ist uns denn passiert, wie sind wir an diesen Punkt gelangt, und welchen Sinn hat das Ganze? Ohne schlüssige Antwort kein Neubeginn! Den aber braucht dieser Mann für sein Glück, für den inneren Frieden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der Leuchtturm
Roman
ISBN 978-3-96521-456-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien 2009 im Scheunen-Verlag, Kückenshagen.
Gestaltung des Titelbildes: Paul Schreyer unter Verwendung des Bildes „Das Wetterleuchten“ von Lale Meer
2021 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Was tun, spricht Zeuss.
Die Welt ist weggegeben
Der Herbst, die Jagd, der Markt
ist nicht mehr mein.
Friedrich Schiller
DER SCHULFREUND
An einem windigen Samstag im November läutete hartnäckig das Telefon. Ich hatte gerade mein Mahl beendet, das Geschirr auch schon abgewaschen und fragte mich, wie den Rest des Tages verbringen? Nun, die Stimme im Hörer sagte es mir. Es war Helmut Löw, zwölf Jahre jünger als ich und recht selbstsicher, weil so erfolgreich; doch für ein Alphatier angenehm locker, ja charmant. Ganz überraschend lud er mich zu sich ein. Auch Bettina rechne mit mir, seine Partnerin, längst überfällig sei doch mein Besuch.
Ich sagte ohne weiteres zu. So freundlich die Einladung auch klang, ich hörte einen drängenden Unterton heraus. Das machte mich neugierig. Was hatten die zwei auf dem Herzen? Sonderbar, dass Löw um diese Jahreszeit noch einmal zurückkam ans Meer. Er war die Hauptperson, der Chef einer namhaften Werbefirma in Berlin, dort also vor Weihnachten kaum entbehrlich. Mehr als ein Wochenend-Trip an die See konnte es nicht sein. Ein Windstoß fuhr mir ins Gesicht, als ich die Finnhütte abschloss und vorging zum Carport. Bleigraue Herbstwolken, herrisch und kühl, zogen südwärts, zauberhaft angestrahlt. Über den Silberpappeln leuchtete der Himmel im Mittagslicht, er prangte in Blau, Weiß und Grau – ein festliches Bild. Ich ließ den klapprigen Kleinwagen stehen, und während ich zum Fahrrad griff, gestand ich mir ein, dass es mich auch lockte, Bettina wiederzusehen. Ein feiner Reiz ging von ihr aus, worin der lag, das blieb dunkel; ich kam nie ganz dahinter. Bei all ihrer Schlichtheit, der einfachen Bildung wirkte sie doch stets anregend auf mich. Nun ja, sie war hübsch und wesentlich jünger als Löw … Ganz zu schweigen von mir selbst, dem rüstigen Rentner. Kein Zweifel, dass es mir seit längerem an weiblicher Nähe und Zuwendung zu mangeln begann.
Am Gartentor erwartete mich, wie lästig, Manfred Pelzer.
Er war mein Nachbar und galt im Dorf als dreister, störenden Mensch, als Eindringling eben. Seit zwei Jahren eingebürgert, ergriff er in jeder öffentlichen Sitzung des Gemeinderats penetrant das Wort. Ihm hing der Ruf einer dunklen Vergangenheit an, da sollten Fäden ins Rotlichtmilieu führen. Gut, das konnte Verleumdung sein, er hatte sich hier viele Feinde gemacht. Er besaß zwei Drittel der Feriensiedlung, die vor Jahrzehnten ohne ihn entstanden war. Unser Bürgermeister hatte von ihm gesagt, er sei einer von denen, die vom ganz großen Geld träumen, aber einfach zu ungeschliffen sind, um es auch wirklich zu kriegen. Es fehlte ihm halt an Bonität: keine Manieren, kein Format. Ganz ohne Aplomb, ohne Stil schafft es keiner.
„Tüchtig, Herr Wendt“, rief er mir im Hinblick auf das Fahrrad zu, in seiner Aufdringlichkeit, die krass abwich von norddeutscher Zurückhaltung. „Immer in Form bleiben!“
„Man bemüht sich“, knurrte ich und schickte mich an, aufzusteigen.
Pelzer genügte das nicht, breitbeinig stand er mir im Weg, unbekümmert um das, was ich vorhaben mochte. Er war nachlässig gekleidet, hatte die Figur eines Boxers und das dazu passende Gesicht. „Nur ums mal festzuhalten, ganz nebenbei“, trompetete er, „das Dach Ihres Schuppens steht ein Stück über. Es ragt glatt zwanzig Zentimeter auf meine Hecke.“
„Wollen Sie denn, dass ich’s absäge?“
„I wo“, sagte er kumpelhaft. „So genau pisst kein Edelmann. Es bewässert mir ja die Hecke … Aber mal ehrlich, Nachbar, für wen strampeln Sie sich jetzt ab? Verbrecherjagd, das ist doch vorbei bei Ihnen, und tischlern tun Sie auch nicht mehr. Also was bleibt noch – fit sein für den Spaß mit Weibern?“
Verdutzt sah ich ihn an. Das war frech, es verdiente keine Antwort. Auf Pelzer einzugehen, gar Privates mit ihm zu erörtern, das schien mir unter all den närrischen Dingen meines Lebens wohl das dümmste zu sein. Was zum Teufel will der Kerl von mir? Er ist gar nicht der Typ, der die Zeit totschlägt mit Geplauder am Gartenzaun. Jeder Schritt, den er tut, dient seinem Vorankommen hier bei uns. Er sieht zwar aus wie der Türsteher eines Nachtlokals, ist aber verdammt raffiniert. Ach, ihm lag wohl bloß daran, seinen bedrohlichen Ruf zu stärken. Denn als ich, knapp nickend, nun an ihm vorbeischob, da fügte er schnoddrig hinzu: „Falls Ihnen die Damen in der Kreisstadt nicht liegen – ich kenne in Rostock auch ein paar Adressen.“
„Wie schön für Sie, Herr Pelzer.“ Ich schwang mich aufs Rad und trat zu.
„Für einsame Herzen“, sagte er noch; bloß um das letzte Wort zuhaben. Das war ihm immer wichtig.
Der Pfad am Rande des Steilufers hatte tückische Stellen voll lockerem Sand, aber ein böiger Rückenwind unterstützte mich in dem Wunsch, mein Gewicht zu halten und möglichst ein bisschen jünger zu wirken als 68. Wer rastet, der rostet. Das Ziel ist nichts, die Bewegung alles. Gut eine Stunde im Sattel, Bettina würde staunen – oder doch so tun, als imponiere ihr das. Insgeheim lag mir an derlei Anerkennung. Es fehlt einem was, wird man von keiner Frau mehr bemerkt.
Diesen Mangel schien sogar Pelzer zu wittern. Das Ärgerliche an seiner Flapsigkeit war ja, dass er damit nicht ganz daneben lag. Er sah halt den virtuellen Freier in mir und würde, falls das Gerücht stimmte, auch nicht zögern, mich entsprechend zu bedienen – bloß weil ich im Gemeinderat saß. Zwar nicht im Bauausschuss, dem sein höchstes Interesse galt als Besitzer etlicher Grundstücke, die noch kein Bauland sind. Aber in seinen Augen doch mitzureden hatte, wenn demnächst sein Plan, einen mondänen Golfplatz zu schaffen, zur Abstimmung kam.
Jetzt erst fiel mir wieder ein, dass Löw und Pelzer gleichaltrig waren, beide Mitte 50, einst sogar dicke Freunde gewesen! Kaum fassbar bei ihrer Verschiedenheit. Damals in Brandenburg, hatte Helmut Löw mir erzählt, gab es in seiner Schulklasse drei Gruppen: die Streber vorn, die Lümmel hinten, dazwischen der Durchschnitt. Für Löw, den permanent Klassenbesten, kam nur die erste Reihe in Frage. Pelzer drückte sich hinten herum, bei den Schlägern und Komikern. Trotzdem, die zwei verbündeten sich, da sie einander ergänzten. Löw half Pelzer über die Runden, der bot ihm dafür Schutz vor Angriffen in der Pause und auf dem Heimweg: das klassische Bündnis von Geist und Macht.
Da war die schöne Bettina noch gar nicht auf der Welt gewesen. Übrigens auch nicht, als ich Mitte der 70er Jahre Helmut Löw kennenlernte. Zu jener Zeit war ich mit Leib und Seele Kriminalist gewesen. Und man hatte mich, den Hauptmann der Volkspolizei, dienstlich beauftragt, ein Team der DEFA zu beraten, in dem Löw den Ton angab. Dieser junge Filmautor schien wider die Regel der Platzhirsch zu sein. Er improvisierte flott, wich gern vom eigenen Textbuch ab und drängte die wirkliche Hauptperson, den Regisseur, in puncto Dialog und Handlungsablauf leicht an den Rand. Das glückte ihm nur, weil die Regie in der Hand eines farb– und einfallslosen Absolventen der Filmhochschule lag. Gedreht wurde nahe dem Bodden, und Löw hatte es sich in den Kopf gesetzt, seinen Polizeiruf mit Irrtümern und Pannen der Ordnungskräfte zu starten: zugunsten des „menschlichen Faktors“, der „Plausiblität und Dynamik“, wie er es nannte. Er drückte sich oft pompös aus, nicht immer begriff ich ihn, doch den Drehstab beeindruckte das. Sein Vokabular überzeugte oder schüchterte die anderen ein.
Mich freilich nicht; ich musste ihn bremsen. Ihm war nämlich der Einfall gekommen, die Polizei zu blamieren, zum Ergötzen des Kino-Publikums; was sich grundsätzlich von selbst verbot. Die Genossen sollten mit ihrem Patrouillenboot immerhin Strolche stellen, amateurhafte Einbrecher und Asoziale, die Sommerhäuser redlicher Bürger vom Bodden her anliefen, sie aufbrachen und leer räumten, um mit dem Diebesgut übers Wasser zu verschwinden; anfangs spurlos. Und als das Kreisamt endlich Lunte roch und selbst ein Boot schickte, da schwebte Löw vor, es im Flachwasser jäh auflaufen zu lassen, wobei die Staatsmacht baden ging. Ihn faszinierte der pure Schauwert: ruckartig schlugen die Uniformierten hin auf Deck, einer ging sogar über Bord. Das mochte tatsächlich so schon passiert sein – ein Polizeiboot hat stets mehr Tiefgang als eine Segeljolle –, doch es im Film zu zeigen, war völlig daneben. Das hieß doch bloß „dem Affen Zucker geben“, wie ich sofort erklärt hatte. Niemals würden meine Chefs für solch eine Lachnummer Kräfte hergeben.
Bei diesem ersten Konflikt verblüffte mich Löws Einsicht, seine Bereitschaft zur Selbstkritik. Er hatte das Abwegige der Idee erfasst, strich die Szene und dankte mir unter vier Augen auch noch dafür, ihn vor dem Missgriff bewahrt zu haben. Mit seinem Hang, sich gehoben auszudrücken, nannte er den eigenen Einfall „grenzwertig“ – was ich nicht gleich verstand. „Nicht wahr“, hatte ich deshalb nachgehakt, „Sie wollen doch realistisch sein und keinen Ulk oder Schwank abliefern.“
„Es ist nicht allein eine Frage des Genres, Genosse Hauptmann“, war Löws Antwort gewesen. „Da hat mich der Teufel geritten, den Klassenstandpunkt mal glatt zu vergessen, im Eifer des Gefechts …“ Das klang damals ebenso aufrichtig wie politisch korrekt, es hatte sich mir eingeprägt. Gewisse Aussprüche, ob wichtig oder nicht, haften halt im Gedächtnis.
Ach, lang war’s her! Bilder aus einer Zeit, die mich heute eher plagen, mit dem vagen Gefühl der Trauer, des Bedauerns über den Untergang einer Ordnung, für die ich einst tapfer gestanden hatte. Helmut Löw allerdings, dank seiner beweglichen Fantasie, spielte oft mehr, als für etwas zu stehen. Es war manchmal schwer gewesen, überhaupt mit ihm zu streiten. Intuitiv nahm er möglichen Widerstand schon im Vorfeld wahr und wich Zusammenstößen aus. Die Gabe des großen Überblicks. Wie aber befähigten ihn Versöhnlichkeit und Künstlertum dazu, im Konkurrenzkampf heute zu bestehen? In dem Punkt gab er mir nicht weniger Rätsel auf als in seiner Beziehung zu Bettina, seiner reizvollen Gefährtin … Der Professorensohn und das Arbeiterkind, das er zärtlich Betti nannte; vielleicht schätzte er ja ihre Unterlegenheit, die sie zu ihm aufblicken ließ?
Einiges von dem ging mir durch den Kopf, während unter den Reifen meines Trekkingrads aus dem Sandweg ein Asphaltband wurde, das hinter den Dünen auf der Deichkrone lief. Bei dem Windrad, es war das erste hier gewesen, verengte sich der Landstrich zwischen Bodden und Meer. Links zog ein Zeesenboot vorbei, es lief südwärts, nur unter zwei seiner fünf braunen Segel. Ein Anblick, der mich daran erinnerte, selbst kein Segler mehr zu sein. Ich hatte mein Boot verkauft und dem Sportklub adieu gesagt, weil das Drum und Dran zu teuer geworden war: die Reparaturen und Bootspflege, der Mitgliedsbeitrag nebst Liegeplatz. Aber der betrübliche Verzicht entlastete mich auch, ich musste nicht mehr so peinlich aufs Wetter achten oder nach einem Segelpartner suchen.
Ich fuhr jetzt über historischen Grund. Hier mündete einstmals der Bodden, gespeist von dem Flüsschen Recknitz, in die Ostsee. Die Öffnung war erst verlandet, als die Hanse dort anno 1398 Schiffe versenken ließ, damit ihr die Stadt Ribnitz als Konkurrenz zu Rostock und Lübeck nicht in die Quere kam. Sogar der berühmte Klaus Störtebeker hatte die Passage ständig benutzt. In Erinnerung an seine Vitalienbrüder – auch Likendeeler genannt, also Gleichteiler – hieß die Bucht früher Störtebeker-Hafen. Genau an der Stelle hatten sich Sturmfluten noch mehrfach in den Bodden ergossen. Über sechs Jahrhunderte, ja bis heute, gab es öfter Bestrebungen, den Durchstich zu erneuern; natürlich aus kommerziellen Gründen. Zuletzt, um gut betuchte Segler in den Bodden zu locken. Nachdem die Russen 1994 den Flugplatz Püttnitz geräumt hatten, sollte dort eine Marina entstehen.
Ja, es boomte der Tourismus … Aber noch vor 150 Jahren, als es den Deich noch gar nicht gab, hatten Schmuggler ihr schweres Boot hier, knapp hinter Wustrow, über die Landenge gezurrt, weil sie merkten, dass ihnen preußische Zöllner den Ausgang des Boddens versperrten. Mit ihrem Schleichgut waren sie auf die stürmische See ausgewichen, hatten das Leben riskiert für ein paar Dutzend Säcke voller Salz, das in Preußen besteuert wurde, in Mecklenburg nicht. Diese Armut damals, unvorstellbar! Viel später erst brummte das Geschäft mit dem Urlaub am Meer.
Übrigens nutzte ab Mai 1962 dann sogar ein US-Geheimdienst diesen schmalsten Punkt des Fischlands zum Transport.
Statt Salz schmuggelte die National Security Agency (NSA) freilich Menschen. Es ging den Amis um das Ein- oder Ausschleusen ihrer Leute – erschwert seit dem Bau der Mauer in Berlin. Dazu dienten Mini-U-Boote und Container, eben das Arsenal moderner Tauch- und Landetechnik. Die NSA-Kampfschwimmer peilten gern den Strand in Höhe des Turms der Seefahrtschule an. Die vielen Studenten der Hochschule im Dorf boten hinreichend Deckung. Und die Container, zwei Meter lang, waren nahe dem Barnstorfer Ufer unter Wasser im Saaler Bodden geparkt. Darin karrte man dann die Agenten, wie einstmals das Salz, über die Landenge.
Bis Juni 1963 waren 13 Schleusungen so gelaufen, in beiden Richtungen. Auch andere Stellen wählte man, bis die ganze Sache im Hochsommer 1966 aufflog. Das hatte ein Rostocker Marinehistoriker namens Rudek erst kürzlich in akribischer Archivarbeit rekonstruiert. Und mit einer Veröffentlichung in der Presse, der ein Buch folgen würde, erstmals begründet, weshalb sich DDR-Bürger ab 1966 nachts nicht mehr am Ostseestrand aufhalten durften; zum Verdruss all derer, die das bis heute noch als reine SED-Willkür ansehen.
Links nun der Campingplatz für Urlauber mit Wohnmobil, im Spätherbst verlassen. Und dort, ganz im Hintergrund, das Wäldchen, in das sich die neue Feriensiedlung schmiegte – Bungalows, von Manfred Pelzer selber aufgestellt. Sein zweiter großer Coup, ortsintern mit dem Spottnamen „Pelztierfarm“ belegt. Als Objekt des preiswerten Massentourismus den Gastwirten ringsum ein Graus. Nachbar Pelzer: volksnah, unbeugsam, beharrlich. Stur wäre ein anderes Wort gewesen, penetrant ginge auch. Ein Kerl mit dem Gemüt und der Zugkraft eines Traktors, immer auf Beute aus. Wenn er lacht, sind die Augen nie daran beteiligt. Die Ostsee-Zeitung hat ihn nett porträtiert, als Jungunternehmer und Leistungsträger. Auch sein Bild gebracht, nachdem er’s geschafft hatte, die Lokalredaktion für sich zu gewinnen – wie wohl, nur mit rauem Charme? Breitbeinig stand er im Blatt, jedem Gegner trotzend, ein Robin Hood der Küste, fähig, Amtsbescheide auszuhebeln, per Gerichtsbeschluss. Bürger wie er, hieß es im Blatt, sorgten schließlich dafür, dass der frische Wind des Wachstums bei uns wehe und aus verschlafenen Badeorten kein Museum werde, kein Reservat für feinsinnige Künstler oder Asyl für Größen von gestern.
Damit meinte der Redakteur vielleicht Leute wie Egon Krenz, dessen rohrgedeckter Katen jetzt schräg unter mir auftauchte. Damals im Wendeherbst war er für kurze Zeit die Nummer eins gewesen: Generalsekretär jener Partei, der ich als Polizeioffizier natürlich angehört und von der ich mich – halb enttäuscht, halb widerstrebend – später getrennt hatte. Aus rein beruflichen Gründen, nämlich um weiterbeschäftigt, das heißt als Oberkommissar verbeamtet zu werden. Für drei Jahre bloß, dann hatte man mich gekippt, recht intrigant, und ich ging ins erlernte Handwerk zurück. Bis der Bauboom hier auslief und auch in der Tischlerei Schluss für mich gewesen war.
In Krenz hatte ich strammen Ersatz für den kranken und glücklosen Honecker gesehen und kaum mit ihm sympathisiert. Er war mir schon als FDJ-Chef zu vollmundig gewesen, programmiert auf Optimismus. Kam man anders nicht nach oben? Erst sein Buch „Herbst 89“ ließ mich besser von ihm denken. Der Ton überzeugte, die ehrliche Darstellung seines Scheiterns. Beim Lesen ging mir auf, dass auch kein klügerer oder stärkerer Mann die Partei und den Staat hätte halten können, weil ihm das ganze Umfeld ja wegbrach, mit dem Rückhalt aus Moskau … Das hatte ich Krenz kürzlich geschrieben, ihn um ein ergänzendes Gespräch ersucht, und war darauf ohne Antwort geblieben. Vermutlich hatte der genug, nicht nur von gierigen Reportern, sondern auch von Ex-Genossen wie mir, die einst, ihrer Vernunft oder den Zwängen folgend, die Partei verlassen hatten.
Und der ich mich allmählich wieder näherte – nicht erst, seitdem sie Die Linke hieß. Meiner Zuwendung lag übrigens etwas zugrunde, das mich irritierte. Schon in den 90er Jahren hatte ich begonnen, all jene zu beneiden, denen es bedeutend besser ging als mir: die Wendegewinner und Reichen, egal ob aus Ost oder West, Menschen wie Pelzer und Löw. Mein Groll galt dabei weniger bestimmten Personen als vielmehr der Ordnung, die sie begünstigte, also dem Profitsystem an sich. Erwies es sich doch bei all dem sichtbaren Glanz letztlich als das, was die Partei einst dazu gesagt hatte, in ermüdender Wiederholung. Trockener Lehrstoff und dennoch wahr: der Leistungsdruck, die Ausbeutung, das ständige Umverteilen von unten nach oben; Schröders Sozialabbau und die Aldi-Brüder, beide je 17 Milliarden schwer! „Der Aufschwung kommt bei den Menschen an“? Da hat Frau Merkel sich geirrt, doch für den Abschwung stimmte es. Der Finanzcrash schlug glatt durch. Selbst das Lokalblatt aus dem Hause Springer verglich die Krise mit dem Niedergang vor 80 Jahren, der in den Krieg geführt hatte.
Das hätte mich nicht stören müssen. Mich reizte bloß, wie da aus Ressentiments ein Weltbild entstand (das auch noch dem alten glich). Gewohnt, die eigenen Motive zu hinterfragen, merkte ich, dass mein Denken in den Strudel persönlicher Interessen geriet, durch die missliche Lage. Neid war gewiss nichts, das mich erleuchten und mir den Lauf der Welt hätte deuten sollen! Zwar, die Mehrheit urteilte so aus dem Bauch. Mir aber ging es ums Analysieren. Ich war doch ein heller Kopf und glaubte mich denen überlegen, die instinktiv reagierten, sich ablenken oder beschwatzen ließen. Und nun begriff ich, nicht besser als der Rest zu sein. Auch bei mir reichte der Blick auf steigende Preise und auf die schmale Rente hin, eine bessere Welt zu fordern: Gerechtigkeit nicht nur für mich und meinesgleichen, sondern für alle, bis hin zu den Ärmsten in der Dritten Welt.
Wie freilich sollte das gehen? Hatte ich’s nicht eine Nummer kleiner? Zurück in die Vergangenheit führte kein Weg. Der Sozialismus hatte verloren, diese Zeit war tot und begraben. Ach, da war nichts mehr zu hoffen.
*
Bettina Löw empfing mich herzlich wie einen Retter. Mit einem richtig warmen Lächeln umarmte sie mich, schmiegte sich mir sekundenlang an. Ich spürte ihren Duft, den leisen Druck ihrer Brüste und fand es schön, dass eine Hausfrau sich heutzutage noch so freuen kann über einen Gast, der nicht mal Blumen für sie hat. Sie bat mich an den Kaffeetisch, unsicher, wie ich es aufnehmen werde, dass Helmut fehlte, der mich ja hergebeten hatte. Doch, er sei daheim, oben unterm Dach – in schwierigem Gespräch mit seinem hiesigen Rechtsanwalt. Der sei überraschend erschienen, während meine Ankunft sich, wohl durch das Radfahren, verzögert habe … „Schön, Christian, dass du noch so sportlich bist“, fügte sie hinzu.
Das tat mir gut. Ich setzte mich in dem Gefühl, gerade in Abwesenheit des Hausherrn willkommen zu sein. Mir übrigens fehlte Helmut Löw auch nicht, ich genoss es, mit Bettina allein zu sein, die eben sagte: „Wer weiß, wie lange es noch dauert. Wir fangen ruhig schon an.“
Sie schenkte Kaffee ein, und wie Verschwörer machten wir uns über den Kuchen her, leichte Apfeltorte, von ihr selbst gebacken. Bettina sah adrett aus in Jeans und Pullover, das ländlich Zwanglose hob noch ihren Reiz: eine brünette Schönheit selbst nach dem strengen Maßstab der Hauptstadt. Der spitze Haaransatz ließ ihr Gesicht herzförmig erscheinen, mädchenhaft lieblich. Ich gönnte Helmut alles, außer dieser Frau.
Denn was, so fragte ich mich, verband die zwei wirklich, passten sie zueinander? Helmut war Professorensohn, hatte selber studiert, Journalistik in Leipzig. Ein wacher Intelligenzler, vielseitig, belesen, amüsant. Offenheit und Anpassungskunst verbanden sich in ihm zu dem Talent, Freundschaften zu pflegen. Bettina dagegen wirkte verspielt – neben ihm still, manchmal schüchtern. Ein Arbeiterkind eben, das es gerade mal zur Kindergärtnerin und schließlich zur Praktikantin in Löws Büro gebracht hatte. Was konnte sie dem geistig bieten?
Ich hegte da Zweifel. Seine frappierenden Ideen fielen doch kaum auf fruchtbaren Boden bei ihr; was aber die Zweisamkeit durchaus nicht trübte. Sie hatten zwar nicht geheiratet – hinter ihm lagen, ganz wie bei mir, schon zwei Ehen –, doch sie war ihm eine rührend anhängliche Gefährtin. Wenn sie sich auch schwerlich über die Wünsche und Erwartungen der Schicht, aus der sie kam, erheben konnte.
Das hatte sich mir im Vorjahr gezeigt, als wir am Strand entlang schlenderten und sie, mit Blick zu den zwei Bauten auf der Düne, kindlich stolz gesagt hatte: „Ein schöner Besitz!“ Beide Häuser, das brandneu-skurrile und das ehrwürdige von 1890, waren höchst unterschiedlich. Doch sie gehörten Helmut Löw, waren sein schuldenfreier Besitz, und er war der Mann, auf den sie ihr Leben gegründet hatte.
Eigene Ansichten vertrat Bettina am liebsten außerhalb seiner Hörweite. Löw schnitt ihr manchmal das Wort ab, im Gestus des Kavaliers, der sie davor schützt, sich zu blamieren. Wusste er doch in der Tat fast alles besser. Es war auch eine Frage der Redezeit, die immer mehr ihm zustand als ihr. Jetzt fehlte der Druck, unser Gespräch streifte sogar die USA, kein Wunder so kurz nach Obamas Wahl.
„Ich bin froh, dass er gesiegt hat“, meinte sie, und ich stimmte ihr gern bei. Dieser Mann bot eine seltene Mischung von Strahlkraft und Bescheidenheit, militante Töne sparte er aus, und Allmachtfantasien im Namen Gottes schienen ihm fremd zu sein; obwohl auch er an das Einmalige seines Landes glaubte.
„Ich find ihn toll“, sagte sie. „So cool und elegant.“
„Vielleicht bleibt seine Wahl bloß ein Symbol. Trotz bester Absichten, all die Zwänge wirken ja weiter. Immerhin kommt er aus Illinois wie Abraham Lincoln, und wie der aus kleinen Verhältnissen …"
Um ihr nicht zu missfallen, verschonte ich sie mit Politik und wandte mich ihrer Katze zu, die sich an meinem Bein rieb. Sie hieß Baffi und wurde von Bettina innig geliebt. Baffis mangelnde Scheu vor mir hielt sie für ein gutes Zeichen. In ihren Augen sprach es so für mich, dass ich selber anfing, das Tier nett zu finden. Es beschlich, besprang und jagte fast alles, was sich am Boden bewegte. Dieser durchaus männliche Trieb war mir ziemlich nahe.
Baffi, teilte Bettina mit, war noch keine zwei Jahre alt und eigentlich auch ein Kater. Da sie ihn nicht kastrieren ließ, neigte er zum Streunen; sein Revier markierte er mit Urinspritzern. In Berlin lieferten ihm Rivalen blutige Kämpfe, hier aber hatte er keinen Feind – außer den grässlichen Kötern aus der Feriensiedlung, die in der Saison zum Hundestrand strebten. Erbarmungslos hetzten die Baffi bis an den Zaun! Noch mehr freilich litt er während der Fahrt an die See, da machte er sich unglaublich flach und kroch unter ihren Sitz, anders als Helmut vom satten Klang des Porschemotors mitnichten erbaut … Ich hatte den Eindruck, Baffi sei ihr ebenso wichtig wie sonst einer Frau das Baby. Meine Chance, ihr Herz zu gewinnen, blieb dagegen gering.
Während ich das champagnerfarbene Tier streichelte, bis es zu schnurren begann, sah Bettina mich so an, als sei da noch manches zu sagen, das besser unausgesprochen blieb. Ihr Blick und die übrige Körpersprache verrieten schon Sympathie.
Der alte Fachwerkbau war sehr geräumig, doch auch hellhörig. Es drang Gemurmel zu uns herab, so dass ich schließlich fragte: „Weißt du, worum es geht da oben?“
„Bloß ungefähr … Nein, Christian, eigentlich nicht.“
Er zog sie also da nicht hinzu; das sah ihm ähnlich. Etwas in ihrem Ton bewog mich, die Frage anders zu stellen. „Seid ihr deshalb noch mal gekommen – wegen seines Anwalts?“
„Wir sind hauptsächlich wegen Pelzer hier.“
„Meinem Nachbarn, Bettina?“
„Der ist auch unser Nachbar, leider!“
„Ja, ich weiß. Kein freundlicher Zeitgenosse. Sackt ringsum alles ein, was ihm unter die Finger kommt.“
„Musste er sich auch noch hier einnisten, mit einer zweiten Feriensiedlung? All die Menschen zur Hochsaison, und der Hundestrand direkt vor unserer Nase! Es war Helmuts größter Fehler, dem Kerl die Küste schmackhaft zu machen, ihm zu schreiben, vor gut drei Jahren.“
„Wie denn, er hat ihn erst hergelockt?“
„Sie sind doch mal dicke Freunde gewesen, unzertrennlich in der Schule. Und wir fanden so schwer Anschluss in der Gegend. Die Einheimischen haben uns wohl für Wessis gehalten und scheel angeguckt. Nie kam ein gutes Wort von denen.“
„Und da ist Helmut dieser Schulfreund eingefallen? Du, ich sehe keinen Zusammenhang. Unfassbar, nach so langer Zeit.
„Nein, es gab auch später noch Kontakt. In den 80er Jahren ist Pelzer Brigadier gewesen, Meister in einem Baubetrieb, und Helmut hat über ihn geschrieben. Einen Mehrteiler fürs Fernsehen, über so ‘nen tollen Bestarbeiter. Hat selber einen Preis dafür gekriegt.“
Das war mir neu. Bettina sah mich zweifeln, flink stand sie auf und suchte im Rollschrank nach einem Beleg für ihre verblüffende Mitteilung. Selber erinnerte ich mich solch einer TV-Sendung nicht, nie hatte Helmut die erwähnt. Neben dem Schrank hafteten ein paar seiner Slogans an der Pinnwand. „Das Meer – so nah“, las ich, und „Deutschland bewegt sich“ und „Fit statt fett“ und „Für ein lebenswertes Land“. Er schätzte kurze, frohe Sätze; auch im Urlaub fielen die ihm ein. Sogar Staatstragendes kam von ihm. Auf einem Plakatfoto bedeckte Claudia Schiffer ihre Blöße mit einer wallenden Fahne der Bundesrepublik, um fremdes Kapital ins Land zu locken, natürlich auf englisch: Follow your Instincts. Invest in Germany. Land of ldeas.
Das Drehbuch fand Bettina nicht, nur eine Pressemappe dazu. Es waren Ausschnitte aus alten SED-Blättern. Die hatten Manne Pelzer zum Aktivisten oder Helden der Arbeit erklärt, im Stil jener Zeit. Und damit, sagte Bettina, sei ihrem Helmut ein schlimmer Stoff aufgehalst worden, die härteste Nuss seiner Laufbahn. Er habe das bloß angepackt, weil er sich nach einem journalistischen Ausrutscher bewähren musste – an der Basis, wie es damals hieß.
Diesmal ließ ich sie ausreden, sagte kein Wort und hörte von ihr, wie sie Helmuts Dreh pries, sich sauber aus der Affäre zu ziehen. Er hatte die Schulfreundschaft erneuert und für sein Szenarium genutzt. Manfred Pelzer gestand ihm nämlich, durchaus kein Wühler wie Adolf Hennecke zu sein, der sich einst im Bergbau total verausgabt hatte. Die Lobhudelei in der Presse war ihm peinlich gewesen, das kam bei den Kollegen schlecht an. Seine Brigade brach die Norm nur dank der Findigkeit des Meisters: schlau im Auftun knappen Materials, auf dem Tauschwege von ihm ergattert! Und eben das habe Helmut so flott gezeigt, dass all die Mängel der Planwirtschaft das Publikum zum Lachen brachten und die Arbeitskollegen sich halbwegs wiederfanden in dem Film, der „Manne der Zauberer“ hieß, recht spritzig. Mit Humor und Ehrlichkeit habe Helmut die schwierige Aufgabe gelöst; und in all den Gesprächen kamen die Schulfreunde einander wieder nahe. Ein namhafter Darsteller, der wegen seines kantigen Gesichts als proletarisches Urgestein durchging, habe stark und pfiffig den Manne Pelzer gespielt. Der sei Helmut schließlich echt dankbar gewesen – und jetzt das!
„Ja, was hat er denn gegen euch?“
„Das kapiere mal einer“, seufzte Bettina. „Der Kerl ist uns ein Rätsel! Wir fragen uns längst, was treibt ihn an?“
Das hatte sie übrigens, wie mir einfiel, bei meinem letzten Besuch schon einmal gefragt, worauf Löw pompös erwidert hatte: „Solch machtvolle Frage lässt sich nicht unterdrücken …“ Er sagte es obendrein auf englisch: „You can’t suppress such a powerful question; never stop asking, sweetheart.“ Er wusste natürlich, sie sprach kein Englisch, und genoss ihren fragenden Blick. Entlarvend, die Freude an seiner Dominanz. Das war manchmal störend an ihm, stets musste er tonangebend sein, auch auf Kosten seiner Frau. (Inzwischen hatte ich entdeckt, dies war bloß so ein Spruch gewesen, er hatte da den Slogan von BBC World News zitiert; sein Kopf enthielt auch viel Werbemüll.)
*
Die Treppe knarrte, wir traten ans Nordfenster und sahen die beiden aus dem Haus kommen. Mit seinem Anwalt, einem Herrn in richtigem Anzug, ging Helmut auf den Neubau zu, in dem die zwei verschwanden. „Ich hab’s ja geahnt, es geht wieder um ‚Pemba’“, sagte Bettina.
„Pemba“, so hatte Löwe sein schickes Gästehaus getauft, weil der Vorbesitzer das Anwesen „Sansibar“ genannt hatte und Pemba im Indischen Ozean die kleinere Nachbarinsel war. Das schien hier ortsüblich, es hatte Tradition. Die strandnahen Häuser des Seebads stammten nämlich aus der Zeit um den Ersten Weltkrieg, als man noch gern an Deutschlands reichen Kolonialbesitz dachte. Einige Häuser am Küstenweg hießen folglich „Tsingtau“, „Windhuk“ oder „Samoa“. Inzwischen wurde die Kaiserzeit wieder geschätzt, sie lag weit zurück, ihre Schatten waren vergessen. Im Nachbardorf Wustrow stand am Haus des Gastes in erhabenen Lettern: ehem. Kaiserliches Postamt, ohne dass es Einspruch gab.
Einstmals hatte der Herr von „Sansibar“, ein Kunstmaler, ein hölzernes Atelier daneben auf die Düne gestellt, um bei der Arbeit ungestört zu sein. Löw hatte es abgerissen und durch „Pemba“ ersetzt, ziemlich gewagt und auffällig. Er durfte die Düne wohl neu bebauen, weil auch das Atelier dort vorher Bestandsschutz genoss. Vielleicht hatte er dem Kreis um Bürgermeister Kesselring Rabatt eingeräumt für die gekonnte Tourismus-Werbung? In meinem Dorf war solch ein Deal schwer denkbar. Unter Rudi Feinbolz hörten wir auf kunstsinnige Leute, die sich gegen ein Verhunzen des Ortsbilds stemmten.
Verhunzung? Davon konnte keine Rede sein. Aber etwas schräg wirkte „Pemba“ auf mich doch, wie es da, drei oder vier Etagen hoch, in den Herbsthimmel ragte und sich über das Meer erhob, das im Feuer der sinkenden Sonne funkelte. Löw hatte einen Rundbau geschaffen, der sich nach oben verjüngte. Dem Ortsbild zuliebe war reichlich Schilf verwendet worden, wie es von ihm an der Windmühle des Nachbarorts bemerkt worden war. Die Fenster aussparend, umschloss Schilf das Haus von oben bis unten. Nur die Kuppel ließ sich so nicht decken, sie bestand aus Glas, und der rundum laufende Balkon aus Zinkblech wollte zu dem übrigen nicht recht passen.
Der Neubau hatte allgemein verblüfft, boshaft nannte man ihn Leuchtturm. Löw scherte das wenig, lässig steckte er den Spott weg und benutzte das Wort für sein Gästehaus selber. Nur Bettina übernahm es nicht, für sie blieb es bei „Pemba“; ihr fehlte halt sein dickes Fell.
Mein Blick glitt weg von dem Leuchtturm, hin zu ihr, die nah bei mir stand, vertieft in den Zauber des Himmels, über den die Wolken von Nord nach Süd eilten. Möwen zogen Kreise, stürzten herab oder hielten sich in der Schwebe, während das Meer den Strand überspülte, Wellen mit weißem Schaum, die man weiter draußen nicht mehr unterschied. Ihr Herz hing an „Pemba“, sie mochte den kecken Turm mehr als das solide „Sansibar“. Ihr Duft und ihre physische Nähe wurden mir schmerzlich bewusst.
Und wieder streifte mich ein Gedanke, den ich niemals äußern durfte; so dass es mich schon beschämt, ihn hier zu erwähnen. Verliert man doch wohl vor jeder Frau das Gesicht, wenn man zugibt, dass einen der optische Reiz mehr fesselt als ihr Wesen. „Du kommst nur durch den Leib an die Seele heran“, hatte Löw einmal zu mir gesagt, doch im Hinblick auf mich und Bettina hätte ihn das sehr befremdet.
Im vorletzten Sommer über den FKK-Strand stapfend, hatte ich, wie ertappt wieder wegschauend, an ihr eine Besonderheit entdeckt, die mich länger beschäftigte als vertretbar. Ihre Brüste steckten nämlich, graziös geformt, wie Bordwaffen in dem anmutigen Leib, ähnlich den Enden einer frischen, festen Gurke. Der Anblick war mir in den Schlaf gefolgt, in närrischer Begehrlichkeit wurde ich den Gedanken daran gar nicht los. Und ich hatte mich gefragt, ob Löw etwa auf ein Kind verzichte, damit ihm dies anatomische Wunder unversehrt erhalten blieb. Er hatte aus erster Ehe zwei Töchter, die eine war Ärztin geworden, die andere als Unternehmensberaterin tätig.
Ich wusste, Bettina bewunderte ihn, sie war ihm treu ergeben; und trotzdem, sie schätzte auch mich. Das Lächeln, mit dem sie zu mir aufsah, deutete dies kaum an; es sagte mir dennoch viel. Ich war weit mehr ihr Freund als der seine, sie erschien mir so schutzbedürftig neben ihm, dem Meister des Wortes … Kein Gespräch war je bis dahin vorgedrungen, ich hatte mich stets auf Andeutungen beschränkt. Man kann solch einer Frau ja nie alles sagen, was einem auf der Zunge liegt … Nein, ich gönnte sie ihm nicht.
*
Während wir beide noch am Panoramafenster standen, verließ Löw mit seinem Anwalt den Leuchtturm, aber nicht, um ins Haupthaus zurückzukehren. Sie überquerten jetzt den Küstenweg und verschwanden zwischen Windflüchtern, den dürren Birken und Kiefern des Wäldchens, das Pelzer für seine Bungalows erworben hatte – für teures Geld, unter dem Motto: Was immer im Hinterland geschieht, die Küste gehört den Investoren.
„Nun sehen sie sich auch noch den Schandfleck an“, stöhnte Bettina.
Es kam heraus, Manfred Pelzer hatte dort ganz übel provoziert. Und zwar auf dem Parkplatz der Siedlung, wo öfter sein Trabant herumstand, den er zum Jux hier fuhr. (Außerhalb sah man ihn nie damit, für Rostock nahm er stets den Volvo. Der Trabi sollte den Nachbarn wohl nur zeigen, dass er sich nicht zu fein für den war – oder wie weit die Tristesse der DDR hinter ihm lag.)
An diesem zentralen Punkt musste jeder vorbei, und Pelzer hatte dort ein Transparent gehisst, das Löw und Kesselring bezichtigte, den Strand und die Düne zu verschandeln, gegen ganz bestimmte Paragrafen und kommunale Beschlüsse. Nun, das kannte man von ihm. So hatte er im Vorjahr bereits meinen Bürgermeister und andere Mitbürger wegen angeblicher Bausünden attackiert. Der Kerl nahm bei fremden Verstößen kein Blatt vor den Mund. Dies sei nun zum Glück endlich ein freies Land, hatte er der Presse erklärt. Und das Lokalblatt hatte ihm darin beigestimmt.
„Du, ich muss wieder los, leider“, sagte ich zu Bettina. Das Alleinsein mit ihr überforderte mich. Ich war versucht, sie zu trösten, ja sie zu streicheln wie in Kind, das traurig ist.
„Das kannst du Helmut nicht antun, Christian.“
„Du, es wird finster, ich hab Gegenwind und kein Licht am Rad.“
„Er bringt dich doch im Auto heim!“
In diesem Moment trat ihr Mann aus dem Wäldchen, ohne seinen Anwalt, dessen Wagen wohl abseits geparkt war. Löw erklomm die Düne federnd, in forschem Schritt. Größer als ich und stets gebräunt, blond gelocktes Haupt einer Firma, die klein ist, aber Spitze. „Für das, was ich mache, reicht es“, hatte er mir mal erklärt. „Ein Einzelner hat das Telefon erfunden, kein Kollektiv. Ich brauche Gehilfen, kreativ bin ich selber.“ Wenn er spricht, huscht manchmal ein Schmunzeln über sein Gesicht. Es ist die Vorfreude auf ein Bonmot, das er schon kennt, sein Zuhörer aber noch nicht … Strahlend begrüßte er mich, in Wort und Gestik dem Showstar Gottschalk ähnlich. Von ihm ging der Schwung aller Werbung aus, die von Übertreibung lebt.
„Kann Dr. Quast uns helfen?“, fragte Bettina.
„Kaum“, sagte Löw über die Schulter hinweg. Er kauerte vor der Hausbar und kramte in den Flaschen. „Gegen den Text klagen, das läuft nicht, fürchtet er. Das Ding steht auf Pelzers Grund, es stört nicht den Verkehr, und der Text ist zwar rüde, aber nicht direkt beleidigend.“
„Genau wie bei uns“, warf ich ein. „Da hat er das schon mal abgezogen. Feinbolz kam vor Gericht auch nicht dagegen an.“
Bettina sagte: „Stell dir vor, Christian, er behauptet jetzt, von ‚Pemba’ aus würden die Nacktbader beobachtet! Helmuts Gäste, das wären Spanner, mit Ferngläsern oben auf dem Balkon.“
„Lass gut sein, Kleines“, brummte Löw.
Ich fragte: „Redet ihr denn gar nicht mehr miteinander?“
„Doch, oft genug. Bis zum Frühjahr hab ich’s versucht, ganz fair und sachlich. Obwohl er inzwischen so aussieht, als würde er dir die Nase abbeißen, wenn du ihn reizt. Seitdem ist Schluss. Wie ein Mensch sich doch ändern kann! Er ist zwanghaft aufs Geld fixiert.“
„Damit steht er nicht allein. Immer nach dem Motto: Wer am meisten hat, wenn er stirbt, hat gewonnen.“
„Du sagst es. Bloß noch Gier und Hass! Der Leuchtturm soll weg, davon geht er nicht ab. Den würde er am liebsten einfach in die Luft sprengen.“
„Aber doch wohl nicht als Selbstmord-Attentäter?“ Ich wollte es ins Komische ziehen, damit er beruhigte. „Na ja, vielleicht, wenn dann im Jenseits siebzig Jungfrauen auf ihn warten.“
„Was sollen ihm siebzig Jungfrauen, Chris? Drei Professionelle sind dem lieber.“
„Du spielst auf die Rotlicht-Geschichten an, die da über ihn kursieren.“
„Rotlicht? Du, es ist viel schlimmer. Hinter Manne Pelzer steht die Mafia. Was glaubst du wohl, woher sein Startgeld stammt? Er hat doch keins gehabt. Hier wird Schwarzgeld gewaschen, nicht zu knapp. Ist dir das eigentlich klar?“
„Kann sein, Helmut. Ich kenne das Gerücht. Aber, wenn schon dein Anwalt ziemlich ratlos ist, was könnte ich dann überhaupt für dich tun?“
„Dazu komme ich noch.“ Jäh richtete er sich auf und goss uns Whisky ein, Red Label, den man meist bei ihm bekam. „Eins nach dem anderen, Junge.“ Ich merkte, er stand unter Druck. Derart in Fahrt, vergaß er schon mal die eigenen Grundregeln: halte Blickkontakt, wirke nie autoritär, sprich gedämpft und vermeide ruckartige Bewegungen.
„Der Tag geht und Johnny Walker kommt“, hauchte Bettina. Ein scheuer Versuch, wieder ins Gespräch zu kommen oder die Stimmung zu entkrampfen.
Zu dritt hoben wir die Gläser. Löw nickte mir zu, aufstrahlend: der Existenzgründer und Leistungsträger dem Rentner und Minderleister. Er ließ die Eiswürfel klingeln und schwieg, ganz Boss. Etwa, um sich vor mir aufzubauen? Im Hinblick auf Bettina war das gar nicht nötig, die hing wie üblich an seinen Lippen, in banger Bewunderung … Dann aber, ganz unerwartet, platzte sie heraus. Es klang nach Empörung, nach Tränen in ihrer Stimme, als sie rief: „Warum sagst du ihm nicht alles, Helmut? Weshalb er uns wegekeln will – was er wirklich vorhat dort am Strand?“
Löw trank aus, er zögerte, wie um der fälligen Enthüllung noch mehr Gewicht zu geben. „Du hast es vorhin bereits ausgesprochen, Chris“, sagte er nun pompös. „Pelzer will die Nummer eins hier sein, der reichste Mann vor Ort. Und nicht nur das, der Rotlichtking will ehrbar werden – das Traumziel eines jeden Mafiosos. Er hat sich im Westen umgeschaut, auf der feschen Insel Sylt, und ein schmuckes Gasthaus namens ‚Sesam’ dort entdeckt. Der grandiose Grundeinfall: Schlichtheit und Demut! Bloß nicht steif sein, nicht anstrengend sein für die Kundschaft, die gerade vom Shoppen oder vom Baden kommt. Genau so ein Ding will er uns aufs Auge drücken. Also nicht fünf Sterne plus, kein Marmorpissoir, dafür Holzbänke wie im bayrischen Bierzelt, eben ein Strandlokal vorn an der Düne, mit einem Namen, der von mir sein könnte: ‚Alibaba’. Ganz schön clever, wie?“
„Gut, ich verstehe euch. Aber kann ich denn helfen?“
„Ich denke schon. Ein Mann wie du! Dein Wort in der Zeitung hat Gewicht.“
„Das heißt? Was schwebt dir vor?“
„So was wie letztes Jahr bei euch. Schreib einen Leserbrief ans Lokalblatt, als wichtiger Mann der Nachbargemeinde. Man kennt dich im Kreis noch als Kriminalist …“
„Als Tischler bin ich wohl besser bekannt.“
„Na, wie auch immer.“ Er ließ den Satz in der Schwebe, goss uns neu ein und fügte hinzu: „Was du damals für Feinbolz getan hast, nämlich das Blatt davon abgebracht, auf ihm herumzuhacken, das müsste doch auch im Fall Kesselring klappen. Für die gewählten Vertreter der Gemeinde, gegen gewisse Sonderinteressen.“
Er meinte: für seine eigenen. Gut, ich konnte es versuchen. Wenn mir auch solche Einmischung nicht lag. Ich trat lieber für kleine Leute ein (falls es die noch gab, so dicht am Meer, wo die Grundstückspreise ständig zulegten). Immerhin, manch ein Lokalredakteur verabscheute den Bürgermeister, wenn der es mal mit ihm verdorben hatte, durch raue Töne, wie sie leicht fielen im Tagesbetrieb einer Kommune, so dass die Berichterstattung litt. Das alles war absurd, und noch absurder erschien es mir, mich erneut ins Zeug zu legen, damit dieses Paar verschont blieb von lärmendem Getümmel nebenan, nachdem sein Badeplatz schon zum Hundestrand abgesunken war. Ich würde es nur für Bettina tun, weil sie mich hoffnungsvoll ansah und dermaßen an „Pemba“ hing.
Löw, nunmehr hochgestimmt, erbot sich, mich nach dem Abendessen heimzufahren. Doch ich bestand darauf, jetzt gleich das Rad zu nehmen – und rollte, im Rauschen und strahlenden Leuchten des Meeres, erleichtert die Düne hinab. Um mich den Sonnenglanz eines leer gefegten, fast wolkenlosen Himmels, der freilich bald verblassen würde, und in mir das Bild dieser kindlichen Frau.
*
Zum Glück flaute mit dem Sonnenuntergang der Nordwind ab, ich kam gut voran auf dem Deich. So flott wohl wie einst Egon Krenz, der hier im letzten Sommer der DDR jeden Morgen exakt 13 Kilometer zu joggen pflegte, zum Verdruss der Leibwächter; so verriet es uns sein Buch. „Ich baue den Frust ab“, hieß es da. „Begegnen mir Leute, hab ich ein mulmiges Gefühl. Mir ist, als würden die hinterher rufen: Was willst du hier? Dein Platz ist in Berlin! Sag dem Politbüro, wir wollen wissen, wie’s weitergeht … Doch keiner ruft hinter mir her, und das ist weitaus schlimmer.“
So oder ähnlich, der Passus haftete fast wörtlich in mir. Ahnend, dass der Kronprinz seine Ablösung betrieb, hatte Honecker ihn für vier Wochen in den Urlaub geschickt, angesichts der Katastrophe. Und jetzt, 19 Jahre später, taumelte das Land erneut in die Krise. Eine andere, wer weiß wie tiefe. Die Schlagzeilen des Tages waren: Absturz, Suche nach den Schuldigen, Gier, Unsicherheit, Verluste, Rezession … Unterwegs auf dem Trimmpfad fragte ich mich, was Löw wohl so lange mit seinem Anwalt beredet hatte, wenn es bloß um eine Schmähschrift ging, gegen die sich rechtlich ja kaum einschreiten ließ. Er hatte das Wort Leuchtturm glatt geschluckt, die Kränkung verschmerzt, was konnte ihn erschrecken an dem Text auf diesem Transparent?
Oder hielt er vielleicht noch etwas zurück? Es kam mir so vor, als sei das Bild nicht vollständig gewesen, das er geliefert hatte, in simplem Schwarz-weiß. Verblüffend die Wandlung: aus Pelzer, dem Schulfreund, war erst Manne der Zauberer geworden, und nun ein Schuft mit kriminellem Hintergrund. Zwar, über meinen Nachbarn machte ich mir keine Illusionen, dessen Geschäftsmodell war bekannt: Zehn Prozent Anzahlung vor dem ersten Spatenstich, dasselbe bei Baubeginn, noch mal zehn Prozent zum Richtfest und den Rest erst, wenn das Ganze stand. Nebenbei diskrete Spenden an Leute, die ihm gefällig waren. Alles auf Pump, finanziert von Banken, die inzwischen klamm oder pleite sind; der Kredit jeweils gesichert durch andere Immobilien, die ähnlich belastet oder derzeit schwer verkäuflich sein dürften. Da kommt ein Mann schon mal in Stress und wird womöglich rabiat.
Aber Löw, sann ich weiter, ist der am Ende wirklich besser dran? Er handelt mit Ideen und Erwartungen, und nichts schrumpft bei jäher Hysterie so wie die allgemeine Erwartung. Nach dem Kollaps der Finanzwelt sinkt der Mut zum Risiko, die Angst geht um, auch auf die Werbung schlägt das durch. Es brechen Fernsehspots genauso weg wie Annoncen in den Printmedien, steht das Wasser selbst ihm schon bis zum Hals? Nur keine Panik auf der Titanic, hatte er im September zu mir gesagt, wir kommen mit ‘nem blauen Auge noch mal davon … Das glaubt er natürlich, Zuversicht ist sein Beruf. Die alten Schulfreunde, sie konnten beide längst Getriebene sein.
Und solche Menschen sind gefährlich, auch Löw. Beim vorletzten Besuch hatte ich ihn gefragt: Wie sieht die Welt wohl demnächst aus, nach dem fatalen Crash, der kapitalistischen Kernschmelze, die uns da droht? Noch hält die Schockstarre an, weil keiner weiß, wie tief die Krise greift. Jeder fünfte Deutsche lebt schon in Armut, verschanzt in sein privates Unglück; anderthalb Millionen brauchen staatliche Beihilfe zu ihrem Lohn, sechs Millionen schuften für Niedriglohn, Helmut, ist das gerecht?
Nein, aber vernünftig, hatte er erwidert (mir unvergesslich). Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Etliche müssen halt sozial absteigen, damit preiswert produziert wird, das Land exportfähig bleibt und nicht so weit nach unten rutscht wie damals vor 80 Jahren. Der Sozialstaat muss schlank werden, er wird unser Lebensrisiko nicht mehr, wie in den fetten Jahren, abfedern können; die Zeit der Wohltaten ist passé – oder siehst du das anders?
„Für mich klingt das grenzwertig“, hatte ich darauf zu ihm gesagt. „Hast du im Eifer des Gefechts da nicht vielleicht irgendwas vergessen?“
„Und was soll das sein?“
„Zum Beispiel den Klassenstandpunkt.“
Er war baff, sah mich ungläubig an, säuerlich lächelnd. Dann schien es, als komme ihm eine Erinnerung, an vage Dinge, die nichts mehr bedeuteten. Unklar blieb, ob er das Wort als Anspielung begriff auf die Filmszene, bei der ich ihn gebremst hatte, zu seinem Glück. Und auf eine Haltung, die wir zwei einmal geteilt hatten. Vor langer Zeit, als dies noch ein Land gewesen war, in dem keiner richtig reich, aber auch keiner bettelarm werden konnte. Damals, als wir noch bescheiden waren, weniger konsumiert und doch sinnvoller gelebt hatten, tätiger zumindest, da niemand vorzeitig weggedrängt oder ausgemustert worden war.
Ich schreibe das rückschauend auf, um den Zustand anzudeuten, in dem ich mich befand. Während mir all dies durch den Kopf ging, hatte ich ohne es zu merken das letzte Stück des Weges zurückgelegt, in fahlem Licht – immerhin, der Mond stand über dem Bodden. Vor meiner Finnhütte fand ich im Briefkasten einen Stoß Prospekte, wie mir schien, und zog das Zeug heraus, um es gleich in die Papiertonne zu stopfen. Werbung! Es war, als habe der Besuch hei Löw meine stille Abneigung gegen das, was er beruflich trieb, noch verschärft.
Eigentlich lag mir, nachdem ich das Haus „Sansibar“ verlassen hatte, wenig daran, über Löws Haltung nachzudenken. Der schwamm eben im Strom der Zeit, kraftvoll wie ein Wal im Wasser des Ozeans. Doch die Prospekte in meiner Hand erinnerten mich an einen Streit mit ihm, den er mit der Feststellung begonnen hatte, das Staatsschiff der DDR habe schon durch die Last des Spitzelwesens sinken müssen: dank ihrer hunderttausend Hauptamtlichen habe die Stasi fünf Milliarden jährlich verschlungen, auf unsere aller Kosten, welches kleine Land hielte das denn auf Dauer aus?
„Werbung läuft ähnlich flächendeckend wie Mielkes Laden!“, hatte ich spontan erwidert. „Für Reklame geben deutsche Firmen glatt das Zehnfache aus, rund fünfzig Milliarden pro Jahr. Und beim Kauf der Ware bezahlst du das gleichfalls mit.“
„Mielke hat die Leute erschreckt, ich bezaubere sie“, hielt er mir prompt entgegen. „Werbung beschwingt, verführt dich zum Konsum, sie ist immer lockend und positiv – natürlich systemkonform, aber auch kreativ. Einflüstern, das will gekonnt sein! Schön, ich gebe zu, sie hat kein Gewissen; eben das bringt ihr Erfolg. Sie dient allem und jedem, und sie lebt vom Slogan, von wunderbaren Bildern, sogar in der großen Politik! Markantes, stark wie New Deal, New Frontier, Great Society, ,gute Nachbarschaft’, ‚ruhige Hand’, ‚auch du bist Deutschland’ …“