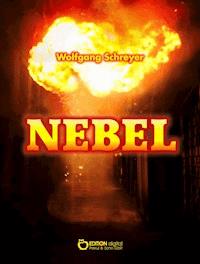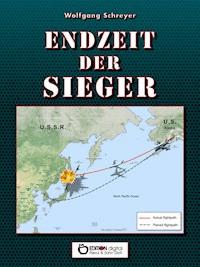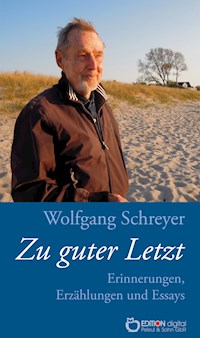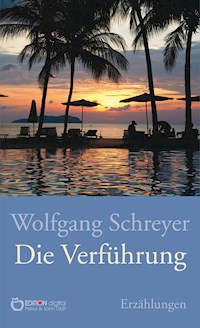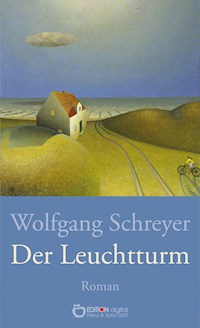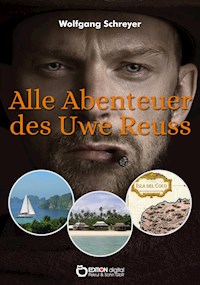7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Preludio 11 ist der Deckname eines Kommandounternehmens zur Vorbereitung der Intervention an der Südküste Kubas Anfang der sechziger Jahre. Eine Gruppe Emigranten, Abenteurer und Feinde der Revolution wird in der Sierra del Mico, einer abgelegenen, gebirgigen Gegend, abgesetzt. Der Trupp soll das Einsatzgebiet aufklären, Informationen sammeln und den Boden für das spätere Eingreifen der Hauptkräfte vorbereiten. Die Feinde haben aber ihre Rechnung ohne die Wachsamkeit und den Kampfesmut einfacher kubanischer Menschen gemacht... Ein spannender Aktionsroman von 1964, dessen Authentizität überzeugend wirkt und den heutigen Leser immer noch anspricht. Wolfgang Schreyer schrieb auch das Drehbuch zu dem gleichnamigen DEFA-Film (Gemeinschaftsproduktion mit Kuba) von 1964 (Regie: Kurt Mätzig).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Preludio 11
Roman
ISBN 978-3-86394-095-9 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1964 beim Verlag Das Neue Berlin. Dem eBook liegt die überarbeitete Fassung von 1988 aus dem Militärverlag der DDR zugrunde.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Carlos Palomino
Um drei Uhr nachts läutete das Telefon. Ich hob ab, ohne mich zu melden, hörte jemand atmen. Sie belauerten mich wie beim letzten Mal, führten ihren sinnlosen Nervenkrieg. Sicher wussten sie inzwischen, dass ich das Zimmer gewechselt hatte... Da fragte eine Stimme: "Carlos Palomino, hörst du den dumpfen Ton?"
"Wer spricht da? Wer sind Sie?"
"Das ist die Karibische Flotte mit dem ersten atomgetriebenen Flugzeugträger der Welt. Hör hin, Carlos, man hört das nicht alle Tage... Macht dich der Ton nicht nervös?"
Ich wollte antworten, doch schon war die Leitung tot. Und wieder glaubte ich das ferne Summen wahrzunehmen. Es stieg aus dem Meer, kroch über die Uferstraße, durchdrang das hermetisch verschlossene Doppelfenster des Hotels. Ein dunkler, alles durchbohrender Laut. Bei der Ankunft, gestern Abend vorm Armeeministerium, hatte ich ihn zum ersten Mal gehört. Da glaubte ich noch, er stecke in meinem eigenen Kopf. Mein Gott, wie lange war das her.
Sie hatten im teuersten Hotel Habanas für jede Etage eine spezielle Farbe, von der Lifttür bis zum Aschenbecher, das erleichterte die Orientierung und tat dem Auge wohl. Das Zimmer im zwanzigsten Stock glich haargenau meinem im elften; aber alles, was dort resedagrün gewesen war - Bettzeug, Krepppapier und Badewanne -, war hier mimosengelb. Und das gab es auch noch in Bleu, in dezentem Orange und in anderen gebrochenen Tönen. Nur die Mikrofone waren nicht angepasst, obwohl gerade da zarte Farbgebung notgetan hätte. Ich hatte längst heraus, dass hier keines installiert worden war. Anscheinend war dieses Zimmer für weniger wichtige Leute bestimmt. Ich deckte mich nur mit dem Laken zu und lauschte dem Winseln der Klimaanlage.
Doch der Schlaf wollte nicht mehr kommen. Erst dachte ich an die militärische Lage, dann an meine eigene. In gewissem Sinne hing beides zusammen. Mir gingen die Meldungen der letzten zwölf Stunden durch den Kopf. Ich zählte sie auf: die Warnung vor den Froschmännern, das US-Radarschiff auf der Höhe von Matanzas, der Sabotageakt im E-Werk dort, die atomgetriebene "Enterprise", der angeknackte Güterzug, die "Voodoo" über der Sierra, der Tieffliegerangriff auf die Avenida Monumental, das Elektronenhirn an Bord der Invasionsflotte, der Schlag gegen unsere Flugplätze. Und die Schutzhaftlisten, Alarmstufen, unklaren Weisungen, die Milizmobilisierung, Sandsackbarrikaden, Befestigung der Fichteninsel, der Entwicklungsplan für die Sierra - unsere Gegenmaßnahmen. Ich wog das gegeneinander ab. Aber da war nicht viel zu wägen.
Die Zeit verstrich, ich rollte von einer Seite auf die andere und fragte mich, was draußen geschah, hinter den luftdicht schließenden Scheiben. Das hatte sich wie toll gejagt, nun lag ich unter meterdicker Watte. Die vier Sender im Nachttischradio schwiegen, der Hausfunk spielte den "Lonely Boy" und verstummte dann auch. Das Telefon wurde todsicher von Estébans Freunden abgehört, einen Wagen mit UKW-Empfang hatte ich nicht mehr. Die Stille konnte alles oder nichts bedeuten. Falls die Yanquis nicht gerade am Malecón landeten, um ihre Botschaft wieder in Besitz zu nehmen, würde man nichts merken.
Gegen halb zwei stand ich auf; in diesem Aquarium war man von jeder Nachricht abgeschnitten. Was tun, ins Ministerium fahren? Mir fielen die erstaunten Blicke ein. ("Du hier, Carlos? Es besteht kein Grund, den Kopf zu verlieren!") - Ich duschte kalt, legte mich wieder hin. Ein Weilchen blätterte ich in dem Bedside-book. Spionagegeschichten, Raubüberfall, Erpressung, Rauschgift, Mord. "Warnung: nicht nachts lesen!" Ich knipste die Lampe aus; dies war jetzt blutige Wirklichkeit.
Über mir kräuselten matte Lichter, letzte Signale der Außenwelt. Schatten fielen, glitten und hüpften im Rhythmus der Neonwerbung quer über die Zimmerdecke. Es war, als ob sie Linien auf einen Wasserspiegel warfen, Skizzen zu längst versunkenen Bildern. Und das alles begann zu leben. Gesichter und Landschaften, Stimmungen und Erlebnisse stiegen vom Meeresgrund herauf. Selten blickt man so zurück, denn es taugt nichts. Männer wie Mädchen, an denen was dran ist, haben gewöhnlich keine Zeit dazu. Wahrscheinlich wurde ich alt - jedenfalls für unsere Begriffe. Bei uns in Lateinamerika macht man, wenn überhaupt, in der Jugend Karriere und bleibt dann stehen, fett geworden oder ausgebrannt, ein erkaltender Vulkan.
In mir aber war nichts erloschen, unendlich viel blieb noch zu tun. Ich war mit einem Zeitzünder auf die Welt gekommen. Das Leben fing für mich erst mit dreißig an, als mein Traum in Erfüllung ging, Bergingenieur zu werden. Die Eltern waren tot, auch sonst stand niemand Pate, ich wurde es aus eigener Kraft. Lange hatte es gedauert, bis das Geld beisammen war. Das Lohnniveau der fünfziger Jahre war eine erstklassige Bremse für solche Burschen wie mich. Ich war Ziegeleiarbeiter gewesen, Asphaltkocher beim Straßenbau, Monteur in einer Ölraffinerie; zwischendurch auch Zigarrenmacher, Hilfslaborant in der Zuckerzentrale Palma Soriano und Fahrer eines Elektrokarrens auf dem US-Stützpunkt Gunatánamo, wo ich mein bisschen Englisch lernte. Zuletzt hatte ich in Santiago Schreibmaschinen verkauft, für fünfzig Peso Fixum und zehn Prozent Provision. Damit gelang mir der Absprung, aber bloß, weil ich nicht verheiratet war.
Als wir die Chaussee von Bayamo nach Manzanillo teerten, schielte ich oft zu den Bergen hinüber. Dort hatten die Yanquis im zweiten Weltkrieg enorme Erzlager aufgespürt: Chrom, Kupfer, Eisen und Mangan. Das meiste ließen sie als strategische Reserve liegen, trotzdem war da Zukunft drin. Schon damals schwamm jede Woche ein Erzfrachter los, unverhüttet brachte er unser Gestein in die Estados Unidos. Sollte es ewig so bleiben? Die wahren Riesenprofite wurden längst nicht mehr aus Zucker und Bananen, sondern aus Öl und Erz gezogen - so stand es in den Büchern, die ich nach Feierabend las. Weil es auf Cuba kein Technikum für Bergbau gab, ging ich denselben Weg wie unser Erz. Pittsburgh war ein teures Pflaster, meine Ersparnisse schmolzen weg wie Ice Cream. Wenn die anderen in den Ferien heimfuhren, verdiente ich mir Studiengebühren und Zimmermiete für das nächste Semester in den Eisenerzgruben von Michigan, im Kupferbergbau der Rocky Mountains oder auf der größten Molybdängrube der Welt in Climax, Colorado.
Es war die Zeit der Korea-Konjunktur, in den Staaten wurde mit Hochdruck geschuftet, dem Kumpel ging's dabei glänzend. Zwar kostete alles das Doppelte, die Löhne aber lagen fünfmal so hoch wie bei uns. Der Arbeitsablauf war bis ins letzte durchdacht. Allmählich begriff ich, was Mannschaftsgeist war und was sie Betriebsklima nannten. Mir imponierten die Ingenieure: sie spielten den guten Kameraden und hatten damit Erfolg. Mit einem "Jim, wie geht's zu Hause?" oder 'nem "Joe, was macht das Baby?" war das natürlich nicht getan; wir hatten ein Ohr für falsche Tone. Für einen Vorgesetzten, der notfalls zu uns hielt, gingen wir durchs Feuer. Solche Burschen nahm ich mir zum Vorbild.
Was mich immer wieder packte, war der technische Standard - die blitzenden Ladeautomaten, das neue Gummiförderband. Der Steinkohlenbergbau war vollmechanisiert. Sie schälten oder schnitten die Kohle mit Hobel- und Schrämmmaschinen ab, an die sich Panzerförderer schlossen. Zwei Mann bedienten solch eine Kombine, die hunderttausend Dollar kostete, acht Leute ersetzte und viermal soviel leistete wie sie. Das Eisenerz bohrten sie mit Drill Jumbo an, einer mobilen Batterie moderner Presslufthämmer. Ihr folgte später der Superwagen mit sechzehn Bohrhämmern, die zehn Quadratmeter auf einmal abbohrten, den ganzen Streckenquerschnitt. Der Häuer saß hinterm Schaltpult, fuhr vor und zurück und passte auf die Hämmer auf; für jeden war eine Kontrolllampe da. Das schien uns übertrieben, die Kumpel murrten und behielten Recht: Von den vierhunderttausend Kohlenbergleuten des Jahres fünfzig waren zehn Jahre später nur noch reichlich hunderttausend übrig geblieben.
Als ich nach Cuba zurückkam, sah alles anders aus. In der Sierra Maestra lag der Bohrhammer den Männern auf der Schulter, sie hatten ihre ganze Kraft aufzubieten, um den nötigen Druck zu erzeugen. Ihr Mund war verpresst, der Körper vibrierte. Das Haufwerk schippten sie ächzend auf die brusthohen Hunte. Schluss mit Drill Jumbo und kein Förderband! Schweißverklebte Menschen stießen die Hunte, eine Dreivierteltonne schwer, zum Schacht. Und als ich einen Blick in die Lohnlisten warf, wurde mir endgültig klar, weshalb die US-Firmen einem eigenen Arbeiter dreitausend Dollar, einem Cubaner aber vierzehntausend Dollar im Jahr aus den Knochen zogen.
Ein Paradies für den Boss, yes, Sir. Sie suchten sich die Leute aus und diktierten die Bedingungen, der Hunger machte es ihnen leicht. Mein Diplom jedoch überzeugte sie. Ich stand vor dem Grubendirektor, frisch rasiert, einen Kopf größer als er und wohl ziemlich aufrecht; ich war nicht aus gutem Hause, mich hatte keiner gemacht. Er sagte zu mir: "Mister Palomino, wir fördern hier Eisenmanganerz unter schwierigen geologischen Verhältnissen. Ihre Sierra Maestra hat böse tektonische Störungen." Er sah mich an, als seien die Cubaner daran schuld. "Zweihundert Wagen täglich holen wir herauf. Es könnten dreihundert sein, wenn Ihre Landsleute richtig spuren würden. Ich hoffe, Sie bringen ihnen das auf passende Art bei. Well, nun zeigen Sie mal, was Sie in den Staaten gelernt haben!"
Ich nahm das wörtlich und freundete mich mit der Belegschaft an. Man übertrug mir die Untertageaufsicht über eine Schicht im Revier sechs. Die vierzig Kumpel kannte ich bald beim Vornamen, wir verstanden uns, die Förderleistung stieg. Ich wurde zum Revierleiter ernannt und zu den Sitzungen hinzugezogen. Damit ging der Ärger los, denn ich begann zu mahnen. Die Direktion sparte an allem, besonders an jenem imprägnierten Grubenholz, von dem unsere Sicherheit abhing. Die langen Stempel passten nicht in den Förderkorb, man musste den Deckel abnehmen; die Tagesleistung sank, sobald viel Grubenholz eingefahren wurde. Ich aber gab nicht nach. "In unserem Beruf, Mister Wheeler", sagte ich zum Chefingenieur, "macht man bestimmte Fehler nur einmal."
An den gefährdeten Stellen meines Reviers wurde der Grubenausbau verstärkt. Aber nun fingen sie an, einen alten Streckenvortrieb wieder aufzunehmen. Er war stillgelegt worden, weil sich Anzeichen von Standwasser gezeigt hatten. Ich schlug Flachbohrungen über dreißig Meter vor, damit wir die Gefahrenpunkte aufspüren und umgehen konnten. Das war ihnen zu zeitraubend oder zu kostspielig; nicht einmal Dammtore zur Absperrung genehmigten sie mir. Von da an schlief ich unten und ließ mich wecken, wenn geschossen wurde. Es passierte schon am zweiten Tag. Sobald die Schießschwaden von der Bewetterung weggeblasen waren, trat ich wie immer aus der Nische und ging nach vorn. Plötzlich saß mir ein Zischen im Ohr. Erst glaubte ich, die Pressluftleitung sei beschädigt worden. Dann spiegelte sich meine Lampe am Boden, aus dem Zischen wurde ein Rauschen, ich hörte Felsbrocken hereinbrechen und wusste Bescheid. "Tony, lass das Revier räumen", befahl ich dem ersten Häuer. Wir anderen zogen uns in die Hauptstrecke zurück, bis zum Telefon. "So schnell säuft keine Grube ab", erklärte ich und alarmierte den Katastrophentrupp. Wir stampften einen fünf Meter dicken Damm aus Portlandzement in die Unglücksstrecke, sauber ins Gestein verankert; zuletzt bis zum Bauch im Wasser, das aus den eingemauerten Rohren quoll. Am vierten Tag schlossen wir sie mit Hochdruckschiebern und setzten Manometer ein.
Oben gab mir Chefingenieur Wheeler die Hand. "Mister Palomino, die Direktion dankt Ihnen für diese vorbildliche Leistung, Sie haben eine Panik verhindert und unter Einsatz Ihres Lebens das Revier sechs vor totaler Überflutung bewahrt." - "Und Ihnen verdanken wir, dass es soweit gekommen ist", antwortete ich, völlig übermüdet und wahrscheinlich zu direkt. "Billig Abbaufelder erschließen, was? Das Betriebsergebnis auf unsere Kosten verbessern, nicht wahr? Wenn Sie fair sind, Sir, zahlen Sie denen eine Prämie aus, die mit mir diese verdammte Mauer gebaut haben!" Er überflog meinen Bericht und bemerkte kalt: "Ihr Englisch ist leider nicht einwandfrei. Oberingenieur Thompson wird das redigieren." Sie wollten die Ursachen vertuschen und weitermachen! Ich redete wie ein Anwalt im Plädoyer, bis Mr. Wheeler, der sowieso unter dem Klima litt, einen Herzanfall bekam. Er verstarb kurz darauf, als einziges Opfer des Wassereinbruchs.
Jetzt galt ich als Rädelsführer. Meine Akte hatte einen Fleck. Das Personalbüro degradierte mich zum Sprengmeister. Mit einem Schürftrupp zog ich durch ganz Oriente, von der Sierra del Cristal bis zum Pico Turquino. Wir waren vier: Dr. Wood, zwei Hilfsarbeiter und ich. Dr. Wood, kauzig und weltfremd wie viele Geologen, sprach fast nur mit sich selbst. Oft hob er Steine auf, spaltete sie mit seinem spitzen Hammer und musterte die Bruchflächen lauernd, mit der verkniffenen Miene eines Schmetterlingssammlers. Dann wieder ließ er uns Gräben ziehen- - zwei Meter tief, so schmal wie möglich - und schürfte drin herum. Manchmal trotzten die Baumwurzeln sogar dem Dynamit. Oder er befahl uns, ein Stück Felswand abzusprengen. Die Hilfsarbeiter schleppten die Patronen durch den Dschungel, mit ihrem Los zufrieden. Hier gab es keinen Gesprächspartner für mich. Ich fühlte mich wie Robinson. Das Personalbüro hatte die Palomino-Frage wunderbar gelöst
Mehrmals versprachen sie mir, ich dürfe in die Grube zurückkehren. Doch die Zeit verstrich, was blieb, waren die Bergeinsamkeit und die wilden Sonntage in Santiago. Da sandte der Konzern im Februar siebenundfünfzig seinen Geologen eine Landkarte zu, auf der ein Gebiet markiert war, das die Trupps meiden sollten. Dr. Wood lachte meckernd und setzte den Marsch unbeirrt fort. Das Wort "Rebellen" sagte ihm nichts. Seiner Verschrobenheit zufolge sperrten uns eine Woche darauf bärtige Männer den Weg. Sie beschlagnahmten das Dynamit und bezahlten es. Sie gefielen mir sofort. Da war es endlich, das Leben! Ich flüsterte ihnen zu: "Companeros, wenn ihr wieder was braucht..." So hatte das begonnen, aber die Jahre stürzten dahin...
Einundvierzig war ein schreckliches Alter. Man war zu jung, um eine Provinz zu regieren, aber zu alt, um mit Entschuldigungen durchzukommen. Gerade alt genug, um Herzbeschwerden zu haben, aber noch zu jung, um es einzugestehen. Erfahren genug, um Narren zu erkennen, aber noch nicht geduldig genug, um sie zu ertragen... Ich starrte zur Decke, auf die düsteren Bilder. Irgendwo lag da ein Fehler, ein furchtbarer Irrtum. Und man konnte bestimmte Fehler nur einmal machen.
Minuten später - ein hastiges Ticken an der Tür. Ich fuhr hoch, wie von einer Reitpeitsche auf den Hals getroffen. Draußen stand Inés: blond, schüchtern, kindlich. "Willst du mich noch?", fragte sie. "Ich konnte dich nicht finden, Carlos. Seit Mitternacht hab' ich nach dir gesucht!" Sie trippelte über die Schwelle, voller Elektrizität wie damals am Lift; ich empfand auch die gleiche Erregung. Sie würde der G-2 berichten, bueno, darauf kam es nicht mehr an. Sie schien zu wissen, dass ich es wusste, also würden wir nicht groß reden, sondern... Ich sah sie an und spürte wieder den zarten, reinen Hauch wie von Babypuder und frisch gemähtem Heu. Vielleicht war sie die letzte Frau in meinem Leben.
"Hier oben hast du dich versteckt", kicherte sie. "Ich klopfte unten auf elf-dreizehn: ein Mädchen. Es blitzt mich an, verrät nicht, wo du bist. Sicher deine Freundin? Hm, sie ist schön, helle Haut viel schöner als ich..." Ihre langen braunen Hände malten Danielas Kurven nach, sie spitzte kennerisch die Lippen.
"Halt den Mund, Inés", sagte ich. "Zieh dich aus." Ohne Schuhe war sie winzig, eine der Miniaturfrauen, die mir immer gefallen hatten. Als ich sie hoch hob, verstand ich zum ersten Mal, warum: meine Muskelkraft schien sich verdoppelt zu haben; sie gab mir die Illusion, ein Athlet zu sein - so ein Bursche, dem alles mühelos gelingt, den überhaupt nichts umwerfen kann.
Ihr Haar sandte mir seinen Duft in die Nase. Ich hatte Angst, sie zu zerbrechen. Von ihren Nägeln sprangen Funken, knisterten über mich weg. Ich blätterte zurück, auf der Suche nach einem Vergleich. Enriqueta in Holguin vielleicht oder das Mädchen aus der Zuckermühle von Palma Soriano, oder die rote Joan an dem Waldsee bei Pittsburgh... Aber nein, ich hatte solch eine Ekstase noch nicht erlebt. Die alten Melodien tönten wieder in mir. "Blue Tango" - der gehörte zu Enriqueta; "Wish You Here" - das war zweiundfünfzig aufgekommen, sie spielten es in Michigan; "Blueberry Hil!" - Joans Lieblingslied. Nachdem all das verklungen war, setzte ich mich auf und fragte: "Bist du auch in der Miliz wie dein Estéban?" - "Er ist nicht 'mein Estéban'. Ich hasse ihn, Carlos. Gib mir eine Zigarette. Er ist gefährlich und dabei - feig."
Ich sagte: "Nun mal zu dir. Was soll denn bloß in deinen Bericht? Ich hab dir doch gar nichts erzählt. Du kannst höchstens schreiben, er ist in dem einen Punkt okay. Ein bisschen wenig für die G-2."
Sie wurde steif wie unter einem elektrischen Schlag. "Was hat die G-2 damit zu tun?", fragte sie. "Sag das nie wieder, ich hab' schon Angst genug..." Und was dann kam, warf mich um. Eine riesige Glasplatte wurde auf meinem Kopf zerschmettert. Ich sackte abwärts durch graue Tiefen, begriff nur eins - es war alles ganz anders gewesen.
Medusen und Algen. Ein Fisch glotzte mich an. Luftblasen. Langsam trieb ich an die Oberfläche. Mir war, als hätte ich den Mund voller Glas, tausend spitze Splitter. Jetzt kannte ich den Fehler, doch es war zu spät. Verräter Palomino, an die Wand! Die Unerbittlichkeit der Revolutionstribunale. Oder war da noch ein Ausweg? "Mädchen, ich muss weg", sagte ich. "Seht mal zu, wie am besten. Ihr habt mich reingerissen, nun helft mir mal 'raus!"
Ich sagte das ohne viel Hoffnung. Ich kannte das Ende noch nicht, wusste nun aber, wann es begonnen hatte. Es hatte beim letzten Mal begongen, vor knapp einer Woche, mit jener Fahrt nach Habana: Daniela schlief auf dem Rücksitz, träumte wohl von ihrem Kind, und Ramón fuhr sanft, mit viel Gefühl für den Wagen. Ich vertraute ihm noch, er war mein Adjutant und Companero, vor dem ich kein Geheimnis hatte. Das alte harmonische Trio in dem schönen Cadillac. Zu diesem Zeitpunkt war der Landungstrupp längst unterwegs, hielt auf meinen Küstenabschnitt zu, und Estéban erwartete mich an der Rezeption, um den Köder auszulegen. Die Falle stand weit offen - ich stolperte hinein.
Die Landung
1
Der Wagen schoss ans Tageslicht, in einem fauchenden Schwarm gepressten Blechs und zischender Reifen, die unterm Meeresgrund dahingerast waren. Daniela sank gegen das Seitenpolster, war augenblicklich wach. Sie dachte sofort an ihr Kind. Wie hatte sie sich auf Habana gefreut, nach diesem Vierteljahr in der Wildnis - und nun die Ankunft verschlafen! Die Fahrt hatte länger gedauert als sonst, in Sancti Spiritus war der Comandante aufgehalten worden, danach waren sie in Dunst geraten; längs der Südküste stieg er aus dem Meer, was ziemlich selten vorkam. Nebel in den Talsenken und blasser Sonnenschein auf den Hügeln; englisches Wetter, hatte Ramón gesagt, der Europa kannte. Zuletzt auf der Via Bianca musste sie dann eingeschlafen sein, und der Fahrtwind hatte von ihrer Frisur nichts übrig gelassen.
Die Stadt brach über sie herein - grell, schmetternd, auch von oben, denn sie fuhren offen. Und als Daniela nun den Kamm durchs Haar zog, duckte sie sich vor der Wucht dieses Anpralls. Asphalt, Marmor und Bronze, elegante Fassaden, weiße Säulen unter leuchtendem Himmel, die Kuppel des Capitols, ein tutender Ozeandampfer, die Morro-Silhouette, das altersbleiche Gemäuer des Punta-Kastells, der Limonadenverkäufer am Studentendenkmal von 1871, das Plakat Combate al Imperialismo, spanische Kanonen, Parkbäume und Stanniolflitter, Sonnenreflexe in Schaufenstern, die Bacardi-Reklame, Fetzen einer Jahrmarktsmusik und die flanierende Menge, das Glitzern des Meeres vor fernem wolkenhohem Stahlbeton. All das bildete einen rauschhaften Wirbel, während der Cadillac die kreisrunde Tunnelrampe hoch kurvte, durch den Strom bunten Lacks und gewölbten Glases schwamm, um am Präsidentenpalast in die Avenida de Belgica einzubiegen.
Es war ein signalrotes, auffälliges Fahrzeug; noch vor vier Monaten hatte es der Standard Oil gehört. Ramón chauffierte rücksichtsvoll, eben ließ er ein apfelsinenfarbenes Taxi durch, doch Daniela spürte, dass man ihnen nachsah. Es war zu prunkvoll für Habana, wenn zwei Männer und ein Mädchen in Uniform darin saßen. Draußen in den Bergen von Esperanza bis zum kleinsten Küstendorf kannte jeder Carlos Palomino und gönnte ihm den Spaß, man wusste ja, was für ein Kerl er war; aber hier? Der Wagen hatte acht Scheinwerfer, das war einfach zuviel, und schwarze Lederpolster, und zwischen seinen deltaförmigen Heckflossen, an der krummen Funkantenne, flatterte ein Wimpel. Wenn Ramón den Chromring berührte, erscholl ein Fanfarenstoß, dem acht oder neun Akkorde folgten - eine ganze Melodie. Anderswo, hatte er ihr versichert, hielt die Polizei jedes Auto an, das einen Choral blies, anstatt zu hupen. Doch man war in Cuba, wo es nur tote Polizisten gab, quadratische Löcher im Chausseeasphalt, die an gewissen Punkten zum Langsamfahren zwangen.
Comandante Palomino öffnete einen Hemdknopf und zog seinen Bart heraus; er pflegte ihn auf diese Weise zu befestigen, damit er ihm nicht ins Gesicht wehte. Dabei drehte er sich zu ihr um und sagte: "Zuerst setzen wir dich bei deinem Roberto ab!" Daniela nickte, sie lächelte dankbar. Er dachte an alles, er war so energisch, so erfahren, ein wirklicher Mann. Von Anfang an hatte sie ihn bewundert. Manches an ihm mochte komisch oder rührend sein, dennoch hatte er das, was man Persönlichkeit nannte - was die Leute mochten. Er konnte nicht reden wie Fidel, und doch sprach er zu den Herzen, durch seine Art, unbeschwert zuzupacken. Mit seinen vierzig Jahren war er einer der ältesten Armeeoffiziere. Wenn sie bedachte, was er für die Revolution getan hatte und tat, kam es ihr kleinlich vor, ihn wegen des Cadillacs zu tadeln. Ramón ging in dem Punkt zu weit, er urteilte überhaupt zu streng, er grübelte so viel und nahm alles schwer. Vielleicht aber brauchten sie sich beide so, wie sie waren, Carlos und sein Adjutant
Jetzt rollten sie durch die O'Reilly, wo es hauptsächlich Bücher zu kaufen gab, mehr alte als neue. Die Fassaden rückten eng zusammen, der hell getünchte Putz warf noch die Mittagsglut zurück. Von den lackierten Balkongittern ragten Geschäftsreklamen an Stangen quer über die Straßenschlucht. Daniela atmete tief. Ach, diese tiefen Schatten, der Lärm und der üble, vertraute Geruch! Ramón hob die Linke, um anzuzeigen, dass er abbiegen wollte. Nun schlich er hinter einem Obstkarren her, den ein Neger schob. Sie spürte ihr Herz klopfen. Hier bedeutete jeder Fleck ein Stück ihres Lebens. In dieser Bodega hatte sie mit Aurelio Orangensaft getrunken, und er hatte sich ihr erklärt, fünf Tage bevor sie ihn niederknallten... Er war auf einem Bordstein in Vedado gestorben, mit zerfetzter Lunge, wissend, dass sie seine Liebe nicht erwidern konnte.
"Hier", sagte sie. Ramón stoppte. Hinter ihnen kreischten Omnibusbremsen. - "Um neun vorm Hotel", rief ihr Palomino zu, während sie ausstieg. "Grüß die Mutter und gib Roberto 'nen Kuss von mir!" Sie sah Ramóns ernstes Profil, er lächelte, aber er sagte nichts; sie winkte mit den Fingerspitzen und wandte sich um. Es war eine unmögliche Szene, hinter dem knallroten Cadillac hatte sich schon eine Kette hupender Autos gestaut, jeder kannte sie hier, die Gesichter der Nachbarn über Balkongittern und Jalousien...
Endlich das schmale, steile Treppenhaus, das Namensschild, die Klingel. Unten brüllte der Bus auf, es war, als ob die Wände bersten müssten.
Die Mutter zog sie herein, fiel ihr um den Hals. "Gestern hab' ich dir geschrieben", schluchzte sie, und ihre umschatteten Augen füllten sich sogleich mit Tränen. "Du bleibst doch, hast Urlaub? Und grade heut hab' ich frei, Frau Diaz sitzt an der Kasse... Dünn bist du geworden! Habt ihr nicht genug zu essen? Kannst dich duschen, die Leitung ist repariert. Mach leise, Roberto schläft. Hast du das Päckchen bekommen? Zieh den Pullover unter, bei euch ist es kalt, nur zwölf Grad nachts, stand in der Zeitung. Ach, mein liebes Mädchen! Was willst du, worauf hast du Appetit?" Sie lief ins Wohnzimmer voraus, eine zierliche Frau in gestickten Pantoffeln, Papplockenwickler im Haar.
Da war es wieder, ihr Heim, das alte Leben, nichts hatte sich geändert, tausend Fäden banden sie daran. Daniela spürte ein Brennen im Hals. Die Mutter, nervös und voll beklemmender Güte. Ihr welkes, liebliches Gesicht. Der Schaukelstuhl wippte noch, von dem sie aufgesprungen war, eine Handarbeit lag daneben. Die künstlichen Blumen auf dem schweren ovalen Esstisch, das Porzellanfässchen mit dem Becken zum Händewaschen, die polierte Vitrine, ihr großer Stolz, die ausgestopfte Schildkröte auf den gelben Fliesen, das Grammophon, die Bronzeminiaturen und die vielen Familienfotos, das Brautkleid der Eltern dort an der Wand. Die ganze süße Behaglichkeit, die Vater so mühsam dem Schicksal abgerungen hatte. All das zog sie auf wehmütige Weise an, und zugleich stieß es sie ab. Hier war sie glücklich gewesen, doch nun konnte sie es nicht mehr.
Nebenan nahm sie das Baby hoch, setzte sich auf ihr Messingbett. Roberto krähte zornig, und sie begriff, dass er sie nicht erkannte, auch künftig nicht erkennen würde. Sein Flaumhaar war feucht, sie zog ihm das Jäckchen aus und fragte in den Spiegel: "Wozu packst du ihn nur so warm ein?" Durch die Brandmauer drang jetzt ein Höllengetöse, das sie von klein auf kannte. Es rührte von Schießereien, Krawallszenen oder Schiffsuntergängen her, den Höhepunkten der Filme, die drüben liefen. Durch ihre Kindheitsträume war dieses Echo gehallt, hatte sie aufgeschreckt; oft hatte sie schlaflos dagesessen, das Ohr an der Wand, ohne von den Geheimnissen der Erwachsenen mehr zu erlauschen als Wutgebrüll und schauriges Gekicher. Roberto hörte auf zu weinen, er machte sich steif, es schien, als horche auch er.
"Sieh mal, wie stramm er sich schon aufrichtet", sagte die Mutter. Sie kam ans Bett, in einem Hauch Küchendunst, sie wies auf das Jäckchen. "Glaub mir, das da schadet ihm nichts, es hat dir früher auch nichts geschadet. Besser, man ist vorsichtig! Und das gilt auch für dich, Daniela. Pass auf dich auf, dort in der Sierra. Ich bete jeden Tag, dass dir nichts passiert, dass du bald abgelöst wirst und endlich nach Hause kommst. Du gehörst doch hierher, das sagen alle, die uns kennen. Wie lange hast du Urlaub diesmal?"
"Zwei Stunden", antwortete sie und sah, dass ihre Mutter sich abseits auf einen kleinen, harten Stuhl setzte; dort blieb sie mit gefalteten Händen wie ein Kind, runzelte die Brauen, als könne sie nicht gleich verstehen.
Es war schlimm. Daniela schwieg, von Mitgefühl überwältigt Die Mutter wand sich auf dem Stuhl, presste ihre Stirn gegen die Lehne, gleich würde sie aufschluchzen. Sie musste hingehen, sie streicheln, ihr schnell etwas Tröstliches sagen. Sie nahm Roberto hoch, doch mitten im Zimmer blieb sie stehen. Was war das? Überm Schreibtisch, zwischen ihrem Handelsschuldiplom und den beiden afrikanischen Masken, hing das alte Bild, die Welt von einst in Großformat. Ein schön zurechtgemachtes Paar, gefrorenes Lächeln, unerträglich kunstvoll fotografiert: Miguel und sie selbst. Das Blut pulste ihr vorn im Hals, sie fragte scharf: "Wozu holst du das vor?"
Die Mutter hob den Kopf. "Er ist Robertos Vater", entgegnete sie und gewann sofort ihre Fassung zurück.
Daniela rief: "Ich will das nicht mehr sehen!"
"Was kann er dafür? Dein Miguel ist kein Lump, Mädchen, er wollte, dass ihr heiratet, wollte weiterkommen, was werden, bloß du bist nicht...
"Hör auf! Das ist vorbei." Der alte Streit, das ewige Thema. Nur nicht wieder von neuem. Nur nicht einander das kurze Wiedersehen vergällen. Es war so sinnlos. Sie hatten sich längst alles gesagt, was noch zu sagen war... Daniela atmete tief. "Nimm's ab", bat sie, "es hat doch keinen Zweck." Sie ging zum Bett zurück, legte das Baby hin, beugte sich zärtlich darüber. Eine Stimme flüsterte ihr zu: Es hat seinen Mund, den hatte es von Anfang an, nur die Augen sind von dir, und auch die nicht ganz. Blanker Spiegel einer Menschenseele - bei ihm hat er getäuscht.
Und als sie ihren Sohn ansah, musste sie an den Augenblick der Trennung denken, an den unwiderruflichen Abschied, damals, vor über einem Jahr, auf dem Flugplatz Rancho Boyeros. "Wo ist dein Koffer?", hatte er sie im Getöse der Abfertigungshalle gefragt - "Es bleibt dabei", hatte sie ihm geantwortet und all ihre Kraft dazu gebraucht, "ich komme nicht mit, Miguel!" - "Dann kommst du nach!" Das war sein letzter Vorschlag gewesen, und er hatte ihn bekräftigt, indem er ihr das Flugbillett zusteckte. "Du kannst noch umbuchen für übermorgen, ich hol dich in Miami ab." Er hatte es nicht glauben wollen in seiner lächerlichen, imponierenden Selbstsicherheit, dass dies nun wirklich das Ende war.
Jetzt nahm die Mutter das Bild herunter, dabei murmelte sie: "Also weg damit, ganz einfach auf den Müll... Wie etwas lang Aufgestautes brach es aus ihr heraus: "So hat das nicht kommen müssen, bei Gott nicht. Aber ihr, ihr macht's euch leicht heute, mit eurer Revolution. Schafft alles ab, nicht wahr? Zucht und Anstand! Nicht alles Frühere war schlecht! Aber natürlich, jetzt seid ihr in Uniform und auch noch stolz auf das da!" Daniela fühlte, wie sie zu ihr trat und gegen ihre Pistole tippte. "Auf die Familie gebt ihr überhaupt nichts mehr. Aber glaub mir, Mädchen, es kommen auch wieder normale Zeiten... Und wer wird dich dann zur Frau nehmen?"
"Bitte, Mutter", sagte sie.
"Ach, was soll aus dir bloß werden", schluchzte es hinter ihr aus tiefster Brust. Sie drehte sich um. Die Mutter stand am Tisch, mit beiden Fäusten umklammerte sie das Bild, starrte darauf herab. Eine Träne lief an ihrer Nase abwärts und fiel auf das Glas, unter dem die Aufnahme seit einer unendlichen Zeit ruhte.
2
Miguel fühlte sich elend. Seit Stunden das schrille Surren des Motors, die fiebrigen Gespräche, das ewige Auf und Ab. Der Bug stieg aus dem Wasser, stampfte bergwärts, schnitt den Wellenkamm, versank in einem blaugrünen Tal. Wieder und wieder. Die "Caballito del diablo" ritt auf der Atlantikdünung, ein flachbordiges Sportboot, elf Schritte lang und drei breit und alle fanden, es hielte sich gut. Sicher, für Kreuzfahrten zwischen den Inseln mochte es taugen, doch bestimmt war es nicht hochseetüchtig. Seit sie im Morgengrauen von San Ambrosio aufgebrochen waren, hatte Miguel Zeit gehabt, das Boot zu inspizieren.
Lange hatte er dem Zeigerspiel überm Steuerrad zugesehen. Es gab Tachometer für die Kühlwassertemperatur, den Benzinstand, den Öldruck; der Drehzahlmesser reichte bis 4000. Hier der Kompass, dort die Lenzpumpe. Miguel war fröstelnd in die Kajüte gekrochen, zu den Ausrüstungsstücken, die keine Feuchtigkeit vertrugen. Was, fragte er sich, wenn ein Sturm aufkam? Es brauchte gar kein Wirbelsturm zu sein wie der Hurrikan Ella, der kürzlich San Ambrosio gestreift, fünfzig Königspalmen entwurzelt und die Campbaracken abgedeckt hatte. Ein ganz normales Unwetter, das fühlte er, hätte für die "Caballito del diablo" genügt.
Wenn er zu Boden sah, drehte sich ihm der Magen um. Er starrte hinaus, suchte hinter den Köpfen der Gefährten nach einem festen Punkt. Schleier überwehten die Sonne, bald erstickte sie am Firmament, dann wieder sah er ihr mattes böses Auge. Das Wasser wurde bleigrau, bekam einen feindlichen Glanz. Es war voller Haie. Doch sosehr er auch zitterte, so elend ihn der Aufenthalt in der Kajüte machte, auf eine verborgene Art war er glücklich. Er hielt sich von den anderen fern, weil sie ihn beim Träumen störten. In seinem Kopf waren so viel Bilder. Er hatte die Fremde nicht mehr ertragen; nun fuhr er heim. Auch die anderen kehrten zurück, doch das konnte nicht dasselbe sein, sie redeten, sie träumten nicht. Was immer zu Hause auf sie wartete - die Eltern, die Freunde, das gute alte Leben -, ein Mädchen wie Daniela hatten sie nicht.
Er musste an Daniela denken, wenn in seiner Brusttasche der Brief knisterte. Und auch das goldene Halskettchen darunter erinnerte ihn an sie, denn das Medaillon war von ihr, ein Geschenk zu seinem zwanzigsten Geburtstag. Ach, zwei Jahre schon war das her! Damals, kurz vor dem Sieg, schien ihnen beiden alles zu gehören. Doch wie anders war es dann gekommen. Nie aber hatte er aufgehört, an Daniela zu denken. Es war sein schlimmster Fehler gewesen, sich von ihr zu trennen.
Draußen sagte Sergio: "Um das Kap Cruz müssten wir längst herum sein." Miguel hörte den Captain antworten: "Es gibt hier eine Strömung..." - "Fragen Sie doch mal den Sextanten", schlug Humberto vor. - "Das einzige, was ihn an dem Ding je gereizt hat, sind die drei ersten Buchstaben", rief der kleine Piti krähend, und alle lachten.
Miguel lachte nicht mit. Er machte sich wenig aus ihnen. Sie hatten ihn gestern in die Gruppe aufgenommen, weil sie einen Fachmann brauchten. Der einzige, den er mochte, war Sergio. Sie nannten ihn Teniente, obwohl es hier keine Rangbezeichnungen gab. Er war mit Fidel in der Sierra Maestra gewesen. Sergio war der beste Führer, den man sich wünschen konnte. Er hatte ihnen das Ziel auf der Karte gezeigt, es schien seine Art zu sein, alles gut zu erklären. Sie wollten an einem Punkt landen, der auf der amerikanischen Seekarte Twin Rocks hieß; sein richtiger Name, hatte Sergio gesagt, sei Escollos Gemelos. Zwei Korallenklippen musste man passieren, um in ihrem Schutz einen völlig einsamen Küstenstrich anzulaufen. - "Was nützt mir das Ding ohne Mond und Sterne?", rief draußen der Captain in seinem seltsamen Spanisch. "Nehmt mal das Lot!"
Miguel ertrank in Erinnerungen; manches war schon verloschen, oder er hatte es nie gewusst. Er konnte sich jetzt nicht darauf besinnen, warum er und Daniela plötzlich angefangen hatten, einander zu küssen. Sie kannten sich schon von klein auf und hatten zusammen gespielt. Aber irgendwann, nach einer Pause, in der sie vorgaben, sich nicht mehr zu kennen, mussten sie dann aufeinander zugegangen sein. Es war ein geheimnisvoller Duft gewesen, ein Vanillehauch, eine unmerkliche Andeutung dessen, dass sie einander brauchten. Vielleicht der Seewind an der Uferpromenade, wo sie mit ihrer Mutter abends entlang spazierte; vielleicht die Form ihrer Ohren oder das Rascheln ihres Rocks, als sie die Eisenstiege zum Vorführraum hochkletterte, in dem sich ihr Vater verzweifelt abmühte, während unten das Publikum johlte und pfiff. Oder der Zimtgeruch ihrer Haut und das schwarze Haar, das sein Gesicht streifte, als sie ihm half, den Projektor anzuheben. Denn es hatte damit begonnen, dass sie zu ihm geschickt wurde, weil ihr Vater Gefahr lief, seinen jämmerlichen Posten zu verlieren.
Ihr Vater war magenkrank. Damals leitete er ein Kino im Hafenviertel, das zu einer Kette von Spielhallen, Kinos und standardisierten Cafeterias gehörte. Die chinesischen Besitzer molken ihre Kette tüchtig aus. Es war ein stickiges Loch ohne Ventilation, bis Mitternacht liefen schmutzige Filme, drei oder vier hintereinander, solange die Apparatur standhielt. Ein zittriger Lichtkegel stieß durch graue Tabakschwaden, und der Lautsprecher schleuderte englische, französische oder italienische Textbrocken über morsche Stuhlreihen. Auch spanische Sätze hätte hier niemand verstanden. Oft wurden die Filmrollen in falscher Reihenfolge eingelegt, die Leute unten merkten es kaum, sie rauchten, tranken oder knutschten. Es war das anspruchsloseste Publikum ganz Habanas; solange auf der Leinwand geliebt und gestorben wurde, fühlte es sich nicht betrogen.
Das Theater und seine Programme waren derart, dass der Alte nicht daran denken wollte, seine Tochter als Platzanweiserin einzustellen, obschon die Familie jeden Centavo brauchte. Vielmehr brachte er es fertig, sie mit sechzehn Jahren auf eine Handelsschule zu schicken, die sie irgendwie verwandelte. Danach verließ Daniela jeden Nachmittag schlank und adrett den klimatisierten Schaltersaal der Royal Bank of Canada - nun ganz unerreichbar, wie es aussah, für die Jungen ihres Viertels. Wer sie ansprach, erhielt keine Antwort. Das schwarze Haar fiel ihr über den Rücken. Aufrecht wie im Traum schritt sie an den offenen Eckkneipen vorbei, aus denen es hinter ihr her pfiff, an den grell lackierten Fensterladen der Nachtlokale - die Fahrer hörten auf, Flaschen abzuladen, stießen sich an und starrten ihr nach. Sie schritt durch Wellen von Kaffeegeruch, Autodunst, Automatenmusik, eine schöne dunkle Blume, und alles glitt von ihr ab.
Eines Nachts aber hatte er sie hinter dem verchromten, mit hundert Fingerspuren behafteten Zahlbrett der Kinokasse entdeckt. "Ach du, Miguel", hatte sie leise gesagt. Ihre Hand zitterte, als sie ihm das Billett zuschob. Er sah die Schweißperlen zwischen ihren Brauen, und in den schrägen Augen, die sie durch den üblichen Strich verlängert hatte, nistete Müdigkeit. Er war so überrascht gewesen, sie in dieser Umgebung zu finden, dass ihm nichts Gescheites einfiel, bis das Luchsgesicht ihrer Mutter im Schalterfenster auftauchte. Ein paar Tage danach klopfte Daniela atemlos bei ihm an. Er war der Einzige in der Straße, der einen Projektor reparieren konnte. Nachdem der Apparat wieder lief, nannte der Alte ihn Miguelito. Auch Daniela sagte so zu ihm, als ihr Vater ein halbes Jahr später starb; und er nannte sie "mi chinita", wegen ihrer Mandelaugen. Sie waren kohlschwarz, wie made in Hongkong - eine Anspielung, die sie mit einer Grimasse, wenn nicht einem Schlag auf seinen Mund zu quittieren pflegte.
Eines Abends kam die Stunde der Bewährung. Es war noch ein Dritter dabei gewesen, der schöne Aurelio, ein Vetter von ihr. Er trug Milch aus und spülte die Kannen, was ihm fünfundsechzig Peso monatlich einbrachte. Danielas Mutter hatte ihn gebeten, den Ruf ihrer Tochter zu schützen, wenn sie selbst die Zusammenkünfte nicht überwachen konnte. Aurelio erwies sich als zäher Begleiter, denn er hatte sich in seine Cousine verliebt. Er trug ein Bärtchen und war stark; von den Molkereigehilfen war er der beste Boxer. Zu dieser Zeit, im Frühjahr achtundfünfzig, gehörte Miguel längst einer der Widerstandsgruppen an, die in Habana Flugblätter und Bomben legten, um mitzuhelfen, Batistas Diktatur zu stürzen. In seiner Gruppe gab es mehrere junge Frauen, und ihm war die Idee gekommen, Daniela der mütterlichen Aufsicht dadurch zu entziehen, dass er sie für diesen Kampf gewann. Doch auch Aurelio trat der Gruppe bei.
An jenem Abend hatten sie an einem Transformatorenhaus in Jesus del Monte eine Mine angebracht, eine selbstgefertigte Ladung von vernichtender Kraft. Während Miguel den Zünder auf siebzig Minuten stellte, hielten die anderen Wache. Die Laufzeit war reichlich bemessen, sie hätten über die Avenida de Agua Dulce die Altstadt erreicht, bevor in Jesus del Monte das Licht ausging und die übliche Jagd losbrach - wenn sie nicht zwischen dem Transformator und der Bushaltestelle, gerade als sie sich trennen wollten, von einem Streifenwagen gestoppt worden wären. Die Polizei hatte damals angefangen, Jugendliche wahllos aufzugreifen. Es war kurz nach dem gescheiterten Generalstreik gewesen, und die Schergen des Regimes waren überaus nervös.
Nie wird er die Szene vergessen. Sie stehen zu dritt im Flur des 39. Reviers, die Hände erhoben, das Gesicht zur Wand. Die Wand ist beschmiert. Im Rücken schneidende Stimmen, jemand spuckt aus, ein Gewehrkolben knallt auf die Fliesen. Wühlende Hände durchsuchen sie nach Druckzetteln und Waffen. Der Leutnant fragt Daniela: "Was willst du denn mit zwei Burschen? Sind das beides deine Liebhaber?" Sie antwortet: "Nein, ich hab' mich noch nicht entschieden." - "Dann beeil dich", brüllt er und zerrt ihr die Bluse aus dem Rock. "Schlaf mit beiden! Wie viel hast du schon gehabt?" - "Ich hab' sie nicht gezählt" - "So ein Andrang bei dir?" - "Ach wo, ganz normal." Die Polizisten fangen an zu lachen, die da ist köstlich, eine tolle Nummer, die bindet mit Batista nicht an, so viel Sex macht nicht in Revolution. Man jagt die drei hinaus, sie springen auf einen Bus, gleich darauf liegt die Vorstadt im Dunkeln, eine ferne Detonation, und der motorisierte Schrecken prescht sirenenheulend durch die Straßen.
Von dieser Minute an ist alles anders. Die beiden Männer werden von zärtlichen Empfindungen durchbebt, sie fassen tausend Entschlüsse. Auch Daniela ändert sich, sie begreift, was es heißt, die Probe bestanden zu haben. Sie spürt ihre Kraft, widersetzt sich der Mutter, ist nicht länger schüchtern, braucht Sicherheit nicht mehr zu spielen. Im Bus presst Miguel wild ihre Hand, ihm scheint es, als blicke sie eher Aurelio an. Immer wieder hört er sie sagen: "Ich hab' mich noch nicht entschieden." Kann es wahr sein? Aus dem alltäglichen Paar mit seinem verliebten Aufpasser wird etwas Neues, Süßes, Qualvolles. Von nun an verlässt er die beiden oft mit dem schrecklichen Gefühl, den Kameraden ermorden zu können, ohne es zu bereuen. Aurelio, um ihr seinen Wert zu beweisen, stürzt sich in verzweifelte Abenteuer. Bei einem Attentat auf den Senator Fraga wird er auf offener Straße erschossen. Daniela weint in Miguels Armen; er schwört, sie nie zu verlassen... Er hat das Versprechen gebrochen, doch nun kehrt er heim, und alles wird gut
Draußen rief Rico, der Neger: "Sechseinhalb Faden, Sir! Wir müssen dicht vor der Küste sein." - "Wohl kaum", antwortete der Captain. "Das sind erst die Tiburones-Bänke." - Rico sagte: "Ich kann das Land schon riechen." - "Und wie riecht Cuba, mein Sohn", fragte Piti, "nach Zucker, he?" Miguel kroch schnell aus der Kajüte, bat um den Feldstecher, doch sosehr er sich auch anstrengte, er sah keine Spur von Land. Es war ringsum überhaupt nichts zu sehen. Die "Caballito del diablo" ritt durch weiße Nebelschwaden.
3
Wenn Carlos Palomino auf einen Tag nach Habana fuhr, zur Übernahme von Ausrüstung, zu einem Gespräch mit Fidel oder einer Routinebesprechung im Armeeministerium, dann war ihm das bei aller Arbeitslast ein Vergnügen, und er gestand es sich ein. Er genoss die Fahrt, chauffierte auch selbst, trank am Straßenrand den billigen Zuckerrohrsaft, freute sich auf die Stadt und auf die alten Kampfgefährten, die er zu treffen hoffte. Unterwegs sang er Liedchen wie "Cuando me emborracho, no sé que me pasa..." und trommelte dazu den Rhythmus. Und jetzt, während sie die San Lázaro aufwärts rollten, sah er einer Mulattin nach; in ihrem blauvioletten hautengen Kleid erinnerte sie an eine Gazelle. Das meiste hier war sehenswert und gut. Sogar die Busse gefielen ihm, die finsteren Qualm ausspien, seit sie mit sowjetischem Öl fuhren. In allem steckte so viel Leben - davon bekam ein Mann nie genug. "Ach, Junge, das haben wir bloß einmal im Monat, falls überhaupt", sagte er, den Ellenbogen auf der Lehne, eine Zigarre zwischen Daumen und Zeigefinger. "Tut's dir nicht manchmal leid?"
"Ich fühl' mich draußen wohler, Carlos", antwortete Ramón. "Bei uns." Hinter der Universitätstreppe gab es eine Stauung. Die grünblaue Flanke des einstigen Hilton Habana ragte rechter Hand empor, aus dem zwanzigsten Stock hatte sich ein Sohn des amerikanischen Gummigiganten Firestone aufs Pflaster gestürzt. Über den gläsernen Schwingtüren, die in die Halle führten, bröckelte das Mosaik ab.
"Na, man kriegt die Einöde satt. Irgendwo verpasst du was, wenn du in den Bergen 'rumkrauchst und dich hauptsächlich mit Steinen unterhältst... Damit seid nicht ihr beide gemeint." Palomino blies die Backen auf, er dachte an Daniela - die Gedankenverbindung war absurd. Eine so quicklebendige Helferin bekam er nie wieder. Nach achtstündiger Fahrt war sie ausgestiegen, als hätte sie eben Hiltens Schönheitssalon verlassen. Sie brachte es fertig, niemals halb erledigt auszusehen. War sie wirklich am Ende, löste sie sich völlig auf und hockte hilflos im Stabsquartier, bis ihr jemand zu essen gab oder sie mit Nachdruck auf ihr Zimmer schickte. "Das war ein Schwachkopf", äußerte er ohne rechten Zusammenhang, "der sie damals hat sitzen lassen."
Ramón schien gleich zu verstehen. "Das ist etwas anders gewesen. Als er wegging, wusste er nicht, dass sie ein Kind haben würden. Sie stritten sich, da hat sie's ihm nicht mehr gesagt. Er sollte nicht deswegen bei ihr bleiben."
"Und warum der Krach?"
"Er wollte emigrieren, sie war bei uns eingetreten."
"Ist das ihre Version, Ramón?"
"So erzählt es die Mutter."
"Und weshalb ist er weg?"
"Er war Hochfrequenztechniker, die ganze Firma ging 'rüber. Tochterbetrieb von General Electric. Die Dinge, die er dort machte, werden seitdem in Cuba nicht mehr gebaut."
Der Wagen schoss über die Rampa. Palomino warf den Zigarrenrest weg. Jeder Umsturz brachte eine Vielzahl persönlicher Tragödien hervor, und dies war nicht die schlimmste. Er hätte kaum darüber nachgedacht, wäre das Mädchen weniger reizvoll gewesen. Sie kreuzten die Calzada, er sah das Sternenbanner vor dem hellen Klotz der amerikanischen Botschaft. Im Konsulatseingang drängten sich gutgekleidete Menschen, vermutlich nach Visa für die USA. Hol sie der Teufel! Jetzt fiel ihm auf, wie gut Ramón Bescheid wusste; er war der erste, der mehr über Daniela herausgebracht hatte, wenn auch hintenherum. Sie selbst sprach nie davon.
Der Malecón war nass, das Meer schlug über die Uferbrüstung. Am José-Marti-Park fuhren die Autos links, um den Gischtsäulen auszuweichen. "Ich weiß, weshalb Habana wie ein Magnet auf dich wirkt", sagte Ramón plötzlich. "Du hast zu lange in Oriente gelebt, in der Einsamkeit."
Palomino warf ihm einen Blick zu. "Stimmt, da hab' ich mich gelangweilt..." Er kannte die Art seines Adjutanten, über andere nachzudenken und jeder Bemerkung auf den Grund zu gehen. Ramón war oft damit beschäftigt, sich von den Mitmenschen ein möglichst zutreffendes Bild zu machen. "Immer nur Steine beklopfen und Erz aufspüren, das dann doch keiner fördern durfte. Drum bin ich auch mit Fidel gegangen, als er vor vier Jahren in meine Gegend kam."
"Und der wirkliche Grund? Das war doch ein Entschluss auf Tod oder Leben."
"Komm, hör schon auf mit der Heldenverehrung. Es gibt keine Helden, jeder tut was er muss."
"Klar... Ich jedenfalls hab' hier 'raus gemusst. Habana ist nicht Cuba, für mich. Fidel hätte Santiago zur Hauptstadt machen sollen." Ramón bremste, der Wagen glitt unter das Spannbetondach eines Hotelportals.
"Großer Gott, Santiago", murmelte der Comandante. Ein Boy trat aus dem Schatten und fragte nach ihrem Gepäck. Palomino schüttelte den Kopf, er stieg aus.
"Meine Telefonnummer hast du", sagte Ramón. "Ich bin Punkt neun zurück."
"Wenn du's bis dahin schaffst, deinen Papa für die Revolution zu gewinnen?" Palomino winkte ihm zu, ließ den Schlag knallen und schritt über anthrazitfarbene Stufen. Vor einer schneeweißen Plastik, die vielleicht einen Schwan darstellte, hielten Milizionäre an Sandsäcken Wache. Sie grüßten, als sie ihn kommen sahen, und er legte zwei Finger an die Mütze. In der Drehtür blitzte sein Spiegelbild. Die Stabsbesprechung fand diesmal im nobelsten Hotel des Landes statt. Er überlegte, wie lange es dauern würde und was für Getränke sie hatten. Ausgedehnte Konferenzen waren ihm ein Gräuel; was er schätzte, waren die Gespräche in den Pausen.
Drinnen fröstelte ihn, die Klimaanlage war noch dem Yanquigeschmack angepasst, auch die Musik. Sie rieselte von durchbrochenen, bizarr geschwungenen Wänden, alte Weltschlager, mild arrangiert, viel Geigen, kein Gesang. Stormy Weather, Some of These Days, er mochte das, es erinnerte ihn an seine Studienzeit im Ausland, damals, als alles noch vor ihm lag
Hierher kam er zum ersten Mal. Jesus, das war keine Empfangshalle, eher ein Konzertsaal, polierter Marmor und cremefarbenes Leder, lang wie eine Reitbahn, mit einer Serie ausgeklügelter Hindernisse, Blatthecken, Polsterbänke, Steinhürden, Stehlampen und einem künstlichen Teich. Auch Tore, die vom geraden Weg ablenkten zum Spielkasino, zum Nightclub, zur Bar; davor ein Weib aus Messing, anstelle des Bauchs ein Loch, das Material jedoch war überall erstklassig. Und zwischen feinem Publikum - Soldaten. Recht so, die Rebellenarmee hatte das Sesam öffne dich gesprochen, ihr verdankten die Zivilisten, die heute hier logierten, die gesenkten Zimmerpreise. Das Beste war der Blick durch die gläserne Nordwand, man sah über flitzende Autodächer auf den Golf von Mexiko, und die Brandung spritzte hoch.
Nahe der Rezeption trat jemand vom Hotelpersonal auf ihn zu. "Buenos dias, Comandante! Der Stabschef ist auf achthundertzehn." Palomino nickte, er folgte dem Mann zu einem leer stehenden Lift. Sein Gehabe war das eines leitenden Angestellten; er hatte dichtes graues Haar, und Palomino wusste sofort, dass er ihm schon einmal begegnet war. Doch wann und wo?
Als der Mann die Lifttür schloss, fiel ihm sein Vorname ein: Estéban. Mehr aber nicht, und er gab sich auch keine Mühe; in den letzten Jahren hatte er viele hundert Menschen kennen gelernt "Gibt's was Neues?", fragte er, um nicht unhöflich zu sein.
Der Lift ruckte an. Estéban sagte zurückhaltend, wie ein Ober, der ein Gericht empfiehlt: "Wir erwarten für heute die Landung eines Trupps."
"See oder Luft?", fragte Palomino so, als erkundigte er sich nach der Zubereitung - eine Routinefrage aus seinem militärischen Alltag. Erst nachdem er sie gestellt hatte, wurde ihm bewusst, was für ein Gespräch er da führte. Er sah zwei Möglichkeiten: Der Mann gehörte zum eigenen Abwehrdienst oder er war ein Konterrevolutionär. Zweifellos hatte er unten auf ihn gewartet und diese Situation absichtlich herbeigeführt. War er ein Feind, riskierte er seine Festnahme - wozu? Allerdings, es gab auch Nachrichtenhändler, die Informationen verkauften, und Leute, die ihre Komplizen verrieten, um sich bei der Regierung anzubiedern. Solche Existenzen hatte es stets gegeben, daheim in Esperanza kannte er auch ein paar, und sie hatten sich als nützlich erwiesen. "See oder Luft?", wiederholte er und blickte den anderen von oben bis unten an, doch noch immer stellte sich keine Erinnerung ein.
Estéban hob die Schultern. "Wahrscheinlich See." Neben ihm leuchteten die Etagennummern auf, und Palomino merkte, dass sie über den achten Stock weg glitten, wo der Stab tagte, irgendwo unters Dach, hinauf zum Sonnenbad und den Massagesalons. Er wurde neugierig. Der Bursche wollte ihn unter vier Augen sprechen und hatte das gut inszeniert Er trug spitze schwarze Schuhe; auf seinen eigenen Stiefeln lag eine Puderschicht von rotem Sierrastaub. Womöglich gelang es ihm in der nächsten Minute, eine neue Nachrichtenquelle zu erschließen. Er fragte: "Und warum informieren Sie mich?"
Estéban bremste den Lift, er antwortete höflich: "Vielleicht betrifft es Ihren Abschnitt, Comandante."
4
Miguel schwang sich als erster über Bord, das Gerät auf dem Rücken, wasserdicht verpackt - den Infrastrahler, für den sie ihn brauchten. Zu seinen Füßen gurgelndes Wasser, matter Wellenschlag. Einen Augenblick verharrte er rittlings auf dem Holz. Sein Herz pochte hart, er wünschte, man würde ihm erlauben, dort sitzen zu bleiben.
Die "Caballito del diablo" war gekentert. Sie hatte im flachen Nebel ein Riff gestreift und war jeder Anstrengung zum Trotz Zoll um Zoll vollgelaufen, während der Captain mit äußerster Motorkraft auf das unbekannte Ufer zuhielt. "Ihre Rückfahrkarte gilt nicht mehr", hatte Humberto ihm zugeschrien. Dann ein Ruck, der Menschen und Fracht durcheinander warf. Der geborstene Rumpf war über Fels geschrammt, bis er aufknirschend festsaß. Das Boot hatte sich quer zur See gelegt und landeinwärts geneigt, als ob es ihnen noch einen Dienst erweisen wollte.
Das Wrack zu verlassen war leicht. Miguel spürte Korallengrund unter den Sohlen. Das Wasser war voll brauner Algen und wärmer als die Luft, es reichte ihm bis knapp über die Knie, die Schwimmwesten würden sie nicht brauchen. Ihn störte nur, dass er die Küste nicht mehr sah. Von Deck aus hatte er zuletzt ein Stück Strand erspäht und den Abstand auf zwei- bis dreihundert Meter geschätzt. Aber alles, was er durch den Dunst nun noch wahrnahm, waren ferne Bergkuppen. Wie abgeschnitten schwebten sie vor ihm, eine Fata Morgana, in das Licht seiner Hoffnung getaucht. Algen umschlangen seine Waden, torkelnd trat er in ein Loch.
Wie er sich gegen die schmatzende Flut stemmte und nach Grund tastete, rief jemand hinter ihm: "Halt, zusammenbleiben! Wir gehen gemeinsam los!" Das war Sergio, ihr Führer, der immer das Richtige sagte und tat. "Waffen nehmen und Gerät, Verpflegung kriegen wir an Land", hörte er ihn befehlen. "Jetzt anfassen, Kette bilden!" Rico hielt ihm die Hand hin, doch statt sie zu nehmen, fuhr Miguel fort, auf die Bergkuppen zu starren. Sie gehörten zur Sierra del Mico, den Affenbergen; da mussten sie hin, dort wurde der Trupp erwartet. Ihr Anblick aber flößte ihm eine Melancholie ein, wie sie kein Landschaftsbild je in ihm wachgerufen hatte. Die Sierra war nur eine Etappe auf diesem langen, langen Weg - ach, würden sie jemals ans Ziel kommen?
Er lief durch aufglucksende Wogen und hörte in seinem Rücken das Stapfen und Keuchen der Gefährten. Was gingen ihn diese Männer an? Humberto fluchte, Piti schimpfte mit Rico... Gewiss, auch sie schickten sich an, ihre Heimat zurückzugewinnen, die sie gleichfalls lieben mochten, jeder auf seine Art. Doch keinem konnte das Herz so brennen wie ihm. Was immer zu Haus auf sie wartete, so ein Mädchen hatten sie nicht. Sie waren zu nüchtern, dachten zu praktisch, auch Sergio, der eben dem Yanqui erklärte, man könne wegen der sinkenden Dämmerung nicht nochmals zum Wrack zurück. Wozu auch? Um Verbandzeug und Essen zu bergen; sie waren dabei, Cuba zu betreten, und dachten an den Sack mit Konserven!
Auf seinen Schulterblättern drückte das Gerät, und er sah die Berge nicht mehr. Liefen sie in die Irre? Das Wasser wurde tiefer, Furcht sprang ihn an, schwimmen konnte er nicht. Von den Escollos Gemelos keine Spur, an einer falschen Stelle waren sie gelandet, Captain McLash hatte schlecht gesteuert, dafür watete er nun mit ihnen, doch das war kein Trost. Eher dies: Auch Fidel war so gestrandet, im Dezember sechsundfünfzig. Große Sachen fingen oft mit einer Schlappe an. Cespedes war aus Yara verjagt worden, kaum dass er die Republik Cuba ausgerufen hatte, damals vor hundert Jahren, und dennoch... Er stolperte und griff in nassen, ansteigenden Sand. Jenseits der Böschung - graues Gestrüpp. O Gott, das Ufer! "Companeros...", keuchte er, Salz auf den Lippen.
"Still!" Neben ihm warf Sergio den Tragsack ab, in dem die Gewehrläufe klirrten. Dann sah er die übrigen der Reihe nach hochklettern. Humberto fragte: "Alles in Ordnung?" - "Nein." Sergio wies in Richtung des Wracks. "Wer das findet, weiß Bescheid." Der kleine Piti warf sich schnaufend zu Boden, Rico trug einen Teil seines Gepäcks. Als letzter erreichte McLash den Strand. Er war gestürzt sein, Nylonanzug troff. "Finden die nie", rief er, "nicht vor morgen früh. Los, Jungs, weiter!" Er stieß Piti an. "Los, hoch! Das Bad hat uns doch gut getan."
5
Palomino stand im Vorzimmer des Stabschefs, er war zu spät gekommen, doch die Nachricht, die er soeben erhalten hatte, wog das auf. Meldungen dieser Art waren ebenso wichtig wie die Kenntnis der allgemeinen Lage des Landes, oft noch interessanter. Den Comandante ärgerte nur, dass es ihm nicht geglückt war, die Quelle aufzudecken. Estéban hatte versichert, er habe die Bemerkung, ein konterrevolutionärer Trupp werde bei den Escollos Gemelos landen, letzte Nacht am Black-Jack-Tisch des Spielkasinos aufgefangen - was sicher gelogen war. Er verlangte auch keine Belohnung. Palomino aber wusste, dass man solche Informationen, außer von Freunden, niemals umsonst bekam. Wie stand dieser Mann zur Revolution, weshalb wandte er sich gerade an ihn, und was war der Preis?
Noch immer konnte er sich nicht entsinnen, unter welchen Umständen er ihm früher begegnet war. Entscheidende Ereignisse kamen nicht in Betracht; sein Personengedächtnis war ausgezeichnet, die Mitwirkenden der Szenen, die in seinem Leben wichtig waren, hatten sich ihm für immer eingeprägt. Dieses dichte graue Haar und das länglich-schlaue Gesicht! Er erinnerte sich folgender Worte: "Dann ist es besser, Sie verabschieden sich." In einem peinlichen Zusammenhang musste Estéban das zu ihm gesagt haben - nicht heute, sondern damals.