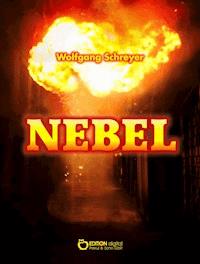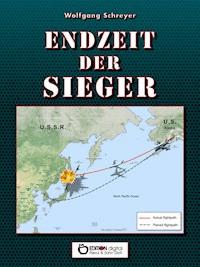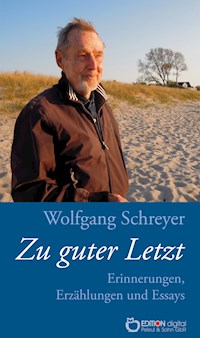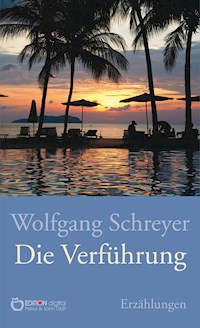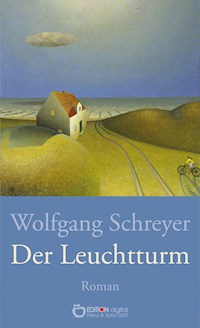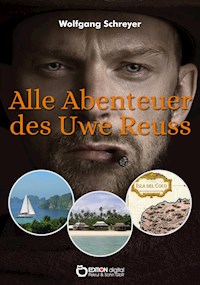8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Dominikanische Tragödie
- Sprache: Deutsch
Santo Domingo, Frühjahr 1961: eine Handvoll junger Männer -Offiziere, Söhne der Reichen - will den Diktator Trujillo stürzen. Dessen Herrschaft aber ist perfekt gesichert, in 31 Jahren versteinert. Kann ein Putsch in diesem Polizeistaat glücken? Im Mittelpunkt steht Juan Tomás, des Diktators 1. Adjutant. Aufgewachsen unter Trujillo und fest eingefügt in den Alltag des Regimes, das System der Korruption, totaler Kontrolle und befohlener Verehrung, löst er sich innerlich daraus erst, als man ihn nötigt, im Namen der Staatsräson seine Liebste zu verlassen, heuchlerische Texte zu schreiben und dem Chef ein Mädchen zuzuführen, das sich dem widersetzt. Gezwungen, Menschen zu vernichten, will Tomás durch die Tat sein Prätorianerdasein beenden. Er will das Beste für sein Land. Was wollen seine Gefährten? Das Buch schildert die Verschwörung, deren Ursachen und Folgen minutiös nach Dokumenten und der Erinnerung von Augenzeugen. Es führt in die bizarre Welt einer Bananenrepublik: vom Nationalpalast, der prunkvoll-barbarischen Machtzentrale, in den uralten Stadtkern, das Villenviertel und den Hungergürtel der Metropole, an Sandstrände, in Kirchen, durch Zuckerrohrfelder zu heimlichen Rendezvous, in Armeestäbe, in die US-Botschaft und das Haus der Mätressen bis zum Ort des historischen Attentats. Zwischen Spitzeln und Ministern, Star-Journalisten und Oppositionellen, der Millionärstochter Cindy und der Schauspielerin Angelique, zwischen aufrechten und zerbrochenen Menschen sucht Tomás seinen Weg - zwischen Ehrgeiz und Freundschaft, Hass und Liebe, Irrtum und Einsicht. Der Verfasser hat in jenen Jahren mehrfach Cuba bereist und das Geschehen auf der Nachbarinsel nach dem Zeugnis dominikanischer Emigranten festgehalten. Gestützt auf solche Erfahrungen erzählt er das Ende der Ära Trujillo ohne eine Spur von Schwarzweiß. Deutlich werden die Zwänge, die alle Akteure treiben und doch hemmen, ihr Werk fördern, entstellen oder scheitern lassen. Ein Hauch von Ironie und Tragik durchdringt diesen Roman. Das Buch erschien erstmals 1971 beim Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Der Adjutant
Die Dominikanische Tragödie, 1. Band
ISBN 978-3-86394-101-7 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1971 beim Mitteldeutschen Verlag Halle - Leipzig
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2012 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Statt eines Vorworts
"Die spanisch-amerikanische Diktatur hat eine eigene Typologie, die sie von anderen Diktaturen unterscheidet. Natürlich tragen sie alle gemeinsame Züge, aber der Hauptunterschied besteht darin, dass die spanisch-amerikanische Diktatur in der Form der westlichen Demokratie erscheint. Es gibt eine Konstitution, periodische Wahlen werden abgehalten, die Regierung teilt sich in die drei klassischen Gewalten, die Menschenrechte werden erklärt... Aber jede dieser Institutionen wird in der Praxis pervertiert und ist schließlich nur noch das Instrument des absoluten Willens eines gewalttätigen Menschen, der gewöhnlich der Präsident der Republik ist und es ewig bleiben möchte."
Jesús de Galíndez
"Ich meine, es gibt ein Alter, über das der Mensch nicht hinausgehen sollte: den Zeitpunkt, in dem das Leben abzunehmen beginnt; da die Flamme erlischt, die die leuchtendsten Stunden in der Existenz jedes Menschen erhellte; da die Kräfte absterben, die den Menschen in der Zeit seiner Würde vorangetrieben haben."
Fidel Castro
Erstes Kapitel
1
Als Hauptmann Juan Tomás erwachte, fiel ihm Angelique ein: die funkelnden Augen, der vibrierende Körper, die bernsteinfarbene Haut. An ihren Zunamen erinnerte er sich nicht. Ein französischer Name; er musste auf dem Programmzettel stehen. Für halb neun hatte er sie in den Palast bestellt, zu einem der Gespräche, die sich in gewissem Abstand wiederholten – alle drei oder vier Monate, mit wechselnden Partnerinnen. Anfangs hatten sie ihn amüsiert, und es war noch immer eine Abwechslung im Dienst. Trotzdem wollte er nicht daran denken. Es gab weiß Gott Wichtigeres als diese Mädchen.
Er hörte die Zeitung durch den Briefschlitz fallen, ein angenehmer Laut, satt und zivil. Seit seiner Ernennung zum Chef des Adjutantenkorps genoss er das Vorrecht der Stabsoffiziere, privat zu wohnen. Nicht mehr der Kasernengeruch, die Karabiner auf dem Korridor, kein Pfeifen, kein Trompetenstoß. Dafür die Huptöne vom Parque de la Independencia, die Glocken der Kathedrale und das Schiffstuten vom Río Ozama... Selbst auf die Dienste seines Burschen hatte er verzichtet.
Druckfrisch roch "El Caribe", die beste Zeitung des Landes. Tomás überflog den Leitartikel; er behandelte den geistigmoralischen Aspekt der Krise. Tirados Stilkunst in Ehren, doch dazu war nichts Neues mehr zu sagen, sofern man (wie es stets geschah) die wirtschaftlichen Folgen beiseite ließ. Tomás blätterte um und fand diese Notiz: "Papst Johannes XXIII. ist gestern beim Besteigen des Podiums des päpstlichen Thrones im Vatikanpalast, wo er eine Audienz abhielt, auf der siebenten Stufe gestürzt. Seine Heiligkeit fiel auf die Hände und richtete sich mit Hilfe des Majordomus und des Geheimkämmerers wieder auf. Der Papst scheint keine Verletzung davongetragen zu haben, und die Audienz fand statt, wie von vatikanischer Seite mitgeteilt wurde."
Das war natürlich Tirados Hand. Aus der Nachrichtenfülle wählte er unfehlbar dies und setzte es auf Seite zwei, mit der Überschrift: "Papst glitt aus vor seinem Thron". Das Oberhaupt der Kirche wurde sanft verhöhnt, glatt, unangreifbar! César Eduardo Tirado – ein Journalist von Rang, auch wenn er morgen auf höheren Wink jeden anderen ebenso geschickt herabsetzen würde, sei es nun Lopez Mateos, Quadros oder Kennedy. Er schrieb immer amüsant.
In der Kaserne hatte Tomás mit seinen Kameraden "La Nación" gelesen, das Staatsorgan – sehr eintönig, steif wie die Handelszeitung "Diario del Comercio" und zähflüssig wie der ehrbare "Mensajero Cristiano", das Blatt des Erzbischofs. "La Nación" hatte er gründlich satt. Über Sport, Mode, Kriminalität und die feine Gesellschaft schrieb das Staatsorgan so wenig wie über Streiks und Revolten im Ausland, ein Thema, das auch die anderen Blätter mieden. "Wir befassen uns lieber mit den positiven Seiten im Leben der Völker", hatte Tirado kürzlich dazu erklärt, in seinem "Caribe", den Tomás bei aller Einschränkung mit Vergnügen las... Er vertiefte sich in die Lokalnachrichten, doch seine Gedanken schweiften ab.
Arme "Nación"! Es hieß, Rafael Trujillo selbst greife in die Gestaltung ein. Mitunter strich er in letzter Minute einen Artikel und ersetzte ihn durch selbstverfasste, längst bekannte Texte, die er dem Volk einzuprägen wünschte. "Wenn ein Mann an deinem Haus vorbeigeht, der die geltende Ordnung ändern will, so zeige ihn an", forderte der letzte Leitartikel, der Tomás erbittert hatte. "Es ist der böseste aller bösen Menschen. Der Verbrecher, der im Gefängnis sitzt, hat jemanden umgebracht oder etwas gestohlen. Aber der Kommunist will alle Menschen umbringen, die er trifft, und alles stehlen, was er finden kann, auch das, was dir und deinem Nachbarn gehört. Er ist dein schlimmster Feind..." Wahrlich, simpler ging es nicht. Man war bei Gott kein Freund der Roten, doch es lag ja auf der Hand, dass in Russland niemand mehr am Leben wär, wenn der Kommunist jeden umbrachte, den er traf, und alles stahl, was er fand. Da hatte der Chef zu sehr vereinfacht.
Manches verbesserte Trujillo aber auch. Byzantinische Schnörkel, die seinem Sinn für militärische Kürze zuwiderliefen, straffte er eigenhändig. Er hasste ja trotz allem Kriecherei. Aus der Floskel "Der Wohltäter des Vaterlandes, Generalissimus Dr. Rafael Leonidas Trujillo Molina, erwähnte in seiner erleuchteten und transzendentalen Ansprache..." war seit geraumer Zeit "Generalissimus Rafael L. Trujillo sagte in seiner bedeutenden Rede..." geworden. Allzu blumige Wendungen ("Wir geben den Inhalt der Worte des Wohltäters wieder, so wie wir ihn von seinen erhabenen Lippen pflücken durften") waren ganz verschwunden. Dennoch blieb das Staatsblatt langweilig wie der Kirchenbote, der gemäß Artikel XXVI des Konkordats jeden Sonntag ein Gebet für den Generalissimus druckte – dafür von anderer Werbung freilich absah, bis auf Annoncen für Mineralwasser, fromme Bücher oder Kunstsalons.
Gewiss, die übrigen Zeitungen boten nicht viel mehr. Ihre kritischen Beiträge zielten stets aufs Ausland und ähnelten einander. Sie waren allesamt mild wie der Koitus eines Kardinals, wie man im Offizierskorps scherzhaft sagte. Wer nur die Presse las und einheimische Sender hörte, der erfuhr zum Beispiel nie, dass die Organisation Amerikanischer Staaten ihrem törichten Waffenembargo und dem Boykott des dominikanischen Zuckers auch noch eine Ausfuhrsperre für Erdöl, Treibstoff, Lastwagen und Ersatzteile hinzugefügt hatte. Vielmehr musste er der Meinung sein, die Regierung Kennedy lasse nur eine Anstandsfrist verstreichen, um die Handelssperren der Ära Eisenhower endlich aufzuheben. Diesen irrigen Eindruck erweckte nicht nur "La Nación".
Tatsächlich verfälschte die ganze dominikanische Presse Erklärungen Kennedys und erst recht Chruschtschows, indem sie das meiste einfach wegließ. Von Castros Reden nahm sie gar nicht erst Notiz. Ihr Informationswert war beschränkt, Tomás wusste und bedauerte es; an ihre Gleichförmigkeit hatte er sich wie jedermann gewöhnt. Umso mehr bewunderte er Tirado. Welch ein Kunststück, das Einerlei aufzulockern und eine flotte Zeitung zu machen, mit lebhaftem Lokalteil, schwarzer Chronik, Klatschspalte und Glossen, die manchmal die Zensurgrenze streiften! Neulich hatte er sogar einfließen lassen, dass es Leute gäbe, die da glaubten, "La Nacíon" sei außerstande, dem Trujillismus Stimme und Gewicht zu verleihen. So gewagte Sachen las man gern.
Tomás warf die Zeitung weg. Er beneidete Tirado nicht um sein Talent. Wie viel Geist und Ausdruckskraft auf Politik vergeudet!... Im Bad vergaß er ihn ganz. "Heute ist Montag der siebzehnte April", hörte er den Rundfunksprecher sagen, und dann meldete La Voz Dominicana die Landung bewaffneter Emigranten auf der Nachbarinsel Cuba. Juan Tomás schloss sofort die Dusche. Schon am Sonnabend, nach dem mysteriösen Luftangriff auf die cubanischen Flugplätze, hatte er derartiges erwartet. Nun erfüllte ihn kalte Spannung. Da der Sender weiter nichts brachte, schob er den Skalenknopf weiter.
Im nordamerikanischen Rundfunk verlas man einen Aufruf der Exilcubaner: "Vor Morgengrauen haben cubanische Patrioten in den Städten und im Gebirge die Schlacht zur Befreiung unseres Vaterlandes von der despotischen Herrschaft Castros..." In was für Städten, in welchem der Gebirge? Tomás verschüttete Kaffeebohnen, so viel Ungenauigkeit machte ihn krank.
Radio Habana sagte: "Seit zwei Uhr nachts greifen Landungstruppen vom Meer und aus der Luft verschiedene Punkte des nationalen Territoriums im Süden der Provinz Las Villas an..." Miliz und Revolutionsarmee hätten den Kampf aufgenommen. Es herrsche Ausnahmezustand. Jeder solle an seine Arbeit gehen. Dann schmetterte Marschmusik.
Aus. Das war alles. Von der Invasionsküste keine Einzelheiten. Vermutlich hatten beide Seiten eine Nachrichtensperre verhängt, wie im Kriegsfall üblich. Hauptmann Tomás aß rascher als sonst. Der Kampf trug sich tausend Meilen westwärts zu, er ging ihn im Grunde nichts an. Die Dominikanische Republik war unbeteiligt, Alarmbereitschaft würde es nicht geben. Dennoch fand er keine Ruhe mehr, bis er den Ausgang kannte. Und das war sehr natürlich, so reagierte auch ein Arzt, der von einer gewagten Operation erfuhr – auf seinem Fachgebiet, in einem fremden Land.
Tomás fuhr im Lift hinab und tauchte in das Gewimmel der Conde-Straße. Himmel, im letzten Sommer hatte die Landungsbrigade von hier, von dieser Insel aus, aufbrechen wollen! Ein paar tausend Exilcubaner waren damals in der Dominikanischen Republik versammelt, und er, Tomás, hatte helfen sollen, sie zu schulen – als einer der beiden Spezialisten für Guerilla- und Landeaktionen, die die Armee hatte. Doch dann war der Plan zurückgestellt worden, hatte sich alles zerschlagen. Die Anfeindungen, denen das Land ausgesetzt war, machten es unmöglich. Umsonst hatte er sich auf diese Aufgabe gefreut. Die Camps im Landesinneren waren geschlossen, die Emigranten ausgewiesen worden; und jetzt schlugen sie los! Mit welchem Erfolg? Er hoffte, im Dienst mehr zu erfahren.
Das Straßenbild war wie sonst. Der Fahrzeugstrom trieb um den Ring am Parque de la Independencia, wirbelte alte Lotteriezettel auf. Keine Zeitung hatte ein Extrablatt gedruckt. Das taten sie doch sonst, wenn es einem Erzfeind an den Kragen ging... Es war wohl noch zu früh. Auf den verwitterten Quadern des Conde-Tors schimmerte der Tau. Hier am Ostrand des Parks verlief vor hundert Jahren die Stadtmauer von Santo Domingo. Jetzt ruhten dort im Schrein der Nation die drei Befreier Duarte, Mella und Sánchez.
Den Weg von seinem Appartementhaus zum Nationalpalast ging Tomás stets zu Fuß. Er liebte das Geschäftsviertel um diese Zeit, den Geruch der frisch besprengten, noch schattigen Plätze, den Anblick der altersgrauen Kirche und der modernen Gebäude, die nach den Verheerungen von 1930 errichtet worden waren. Ihn erfrischten der Auto- und Kaffeedunst, die Automatenmusik aus den Cafeterias. Wenn er frühmorgens durch die Menge schritt, mit anderen die Straße überquerte oder manchmal ein Glas Limonade trank, fühlte er sich den Menschen nahe. Ein romantischer Impuls, gewiss. Doch war dies nicht das Volk, aus dem Männer wie er herausgehoben waren, um es zu schützen? Ohne die Armee würde es in Anarchie und Chaos versinken, von dem feindlichen Nachbarn Haiti ganz zu schweigen.
Auf die ockergelbe Fassade des Teatro Sánchez warf eine Königspalme gefiederte Schatten. Die falschen ionischen Säulen hatten dem Hurrikan leider widerstanden... Er dachte an Angelique und spürte ein schwaches Unbehagen. Woher mochte es rühren? Noch immer entsann er sich nicht ihres Namens; er sah nur ihre Hände, die schlanken Arme, den zuckenden, schmalen, doch gar nicht zerbrechlichen Leib wieder vor sich und fühlte unklaren Widerwillen. Scheute er die zweite Begegnung, das kleine Gespräch, diese Routinesache? Fürchtete er sie etwa, die schwarzen Augen, die auf der Bühne reizvoll gesprüht und ihn nachher so ernsthaft gemustert hatten? Ach, es hatte nichts mit ihr zu tun. Er bekam es eben satt, diese Pflanzertöchter, Offiziersfrauen, Karnevalsschönheiten, Stewardessen oder Schauspielerinnen einzuführen und vorzustellen – Damen aller Hautfarben, die den Palast in einen Kalifenharem verwandelt hätten, wären sie gleichzeitig dort erschienen. Zum Glück aber kamen sie einzeln, so dass es auszuhalten war.
Die Spannung wollte nicht weichen. Tomás stellte sich die Landungsküste vor, das Durcheinander der Sturmboote, Infanteristen und Panzer. Diese Operation zu planen, welch eine Aufgabe im Vergleich zu der, mit der er betraut worden war! Seit Wochen brütete er nun darüber, schrieb Entwürfe und fühlte, dass er nicht zu Rande kam; es war eine Plage.
Der Armeeminister selbst hatte sie ihm übertragen; viel Ehre für einen Hauptmann von 28 Jahren. Allerdings war die Auswahl nicht groß gewesen. Außer ihm kam nur Major Caamaño ernstlich dafür in Betracht; vielleicht noch Korvettenkapitän Montes Arache, der Kommandeur der Marinekampfschwimmer. Eine delikate Angelegenheit: Die Historische Akademie hatte den Minister gebeten, jemanden zu benennen, der einen Beitrag für ihr Geschichtswerk schrieb – den militärhistorischen Teil zum Band VI der Neuesten Geschichte der Dominikanischen Republik.
Hauptmann Tomás, Militärjournalist, das klang schmeichelhaft, doch es ergaben sich Schwierigkeiten. Er hatte die fünf Bände, die früher erschienen waren, ohne viel Nutzen gelesen. Sie behandelten die ersten 25 Jahre der Ära Trujillo; das Militärische kam überall zu kurz. Es stimmte ja, die Armee war niemals wirklich eingesetzt worden, abgesehen von dem traurigen Grenzkonflikt mit Haiti, der in Band II mehr beschönigt als geschildert wurde. Weder hatte es inneren Aufruhr noch Angriffe von außen gegeben, wenn man die kleine Landung bei Luperón beiseite ließ; sie lag zwölf Jahre zurück und hatte eher die Polizei beschäftigt. Die Teilnahme am zweiten Weltkrieg war eine Formalität gewesen. Band III stellte die Versenkung deutscher U-Boote heraus; faktisch aber hatte man nur den USA ein paar Luft- und Marinebasen überlassen.
Ach, es war ärgerlich; in dem ganzen Zeitraum keine Waffentat. Band IV erwähnte die Einführung der einjährigen Wehrpflicht im Jahre 1947 – ein Beispiel für Lateinamerika, wo es sonst nur Berufssoldaten gab. Im Übrigen fasste das Geschichtswerk den Werdegang der Armee in wenigen Sätzen zusammen, fast so, wie es den Aufbau des Geheimdienstes überging; was noch verständlich war. Es untertrieb sogar die Stärkezahlen: den Landstreitkräften schrieb es 12 000, der Flotte 6000, der Luftwaffe 4000 und der Militärpolizei 10 000 Mann zu; diese 32 000 Mann seien dank ihres hervorragenden Ausbildungsstandes und der glänzenden Bewaffnung imstande, jedem Störenfried einen vernichtenden Schlag zu versetzen.
All das war dürftig, prahlerisch, es konnte ihm nicht Vorbild sein. Die bisherige Geschichtsschreibung endete 1955, mit dem Wirtschaftswunder – milagro económico – und der Silberhochzeit Rafael Trujillos mit dem Vaterland, wie es amtlich hieß, und den glanzvollen Vorbereitungen zur Weltausstellung in Ciudad Trujillo: dem Bau der beiden Autobahnstücke, der Erweiterung des Hafens, dem Ausbau der Universitätsstadt und des Geländes der Messe des Friedens und der Brüderlichkeit der Freien Welt... Nach dem Wunsche der Historiker sollte Band VI ähnlich ausklingen, erfolgsbetont, den steilen Aufschwung würdigend, der schönen Zukunft zugewandt. Sie hatten ihn ersucht, kraftvolle Töne anzuschlagen und auch in ihren Schlussakkord einzustimmen. Doch so viel Harmonie bot sich diesmal nicht; 1960 war die Krise ausgebrochen. Und schon ein Jahr zuvor hatte mit den Landungen im Norden jene Guerillatätigkeit begonnen, der sein Augenmerk besonders galt.
Das Unternehmen war im vorletzten Juni nach ein paar Wochen blutig gescheitert. Hier fand sich endlich die Waffentat! Die siegreiche Abwehr wollte er beschreiben, das war der Kern der Aufgabe, die Tomás ebenso anzog wie bedrückte. Der militärische Ablauf bildete das Forschungsobjekt – Gegenstand der Analyse und Quell seiner Sorge. Denn einerseits galt die Zerschlagung der 235 Guerilleros als bedeutendste Militäraktion dieser Periode. Doch andererseits war daraus ein schädlicher Mythos entstanden, die Legende der "Helden des 14. Juni", eine Art Passionsgeschichte, um angebliche Märtyrer gerankt. Ihr musste Tomás entgegentreten, ohne die Leistungen der Guerilleros zu verkleinern; wer den Feind schmähte, der verdunkelte den eigenen Sieg. Auch hätte ihm jede Herabsetzung die Lust an der Sache genommen. Er wollte die Wahrheit finden und darstellen, ein heikles Problem. Die Rettung lag, wie es schien, im sorgsamen Studium der Einzelheiten.
Und während sich ihm nun zwischen uralten Akazien der Blick auf den Nationalpalast öffnete – die Freitreppe, die wehende Flagge, der römische Giebel auf den acht Säulen, die mächtige Kuppel darüber –, wünschte er sich Tirados Formulierungsgabe und die Sachkenntnis jener Offiziere, die die Eindringlinge damals vernichtet hatten. Seine Aufgabe war lösbar, wie jede andere auch; wozu sonst hatte er sich den Kopf im Ausland mit Kriegsgeschichte voll gestopft?
Tomás schritt auf den Nebeneingang zu, das vier Meter hohe Eisengitter und die Sandsteinpfeiler, unter denen die Posten standen. Die wohl gegliederte Front des Palastes leuchtete in der Sonne, die reinen Formen italienischer Renaissance traten klar hervor. Und wie so oft empfand er in diesem Augenblick Stolz. Welche Auszeichnung, hier tätig zu sein. Dort an der Nordostecke, im zweiten Stock des linken Flügels, war die Adjutantur; dicht am Zentrum der Macht. In seinem Schreibtisch lag das Material, sobald der Dienstbetrieb lief, würde er sich den 59er Vorgängen zuwenden. Das blieb reizvoll trotz allem, ein geistiges Wagnis – die beste Arbeit, die es mitten im Frieden für ihn gab.
2
Im Erdgeschoß begegnete ihm Major Arturo Pezuela, mit dem er das Zimmer teilte. Sie begrüßten einander freundlich, ohne Händedruck. "Acht Uhr", sagte Pezuela, ein magerer kleiner Mann mit korrekt gescheiteltem, glatt anliegendem Haar, der immer höflich, sauber und pünktlich war. Er trug nie eine Uhr und zeigte gern, dass er trotzdem jederzeit wusste, wie spät es war. Seine Zugehörigkeit zur Seguridad Nacional, der Staatssicherheit, störte Tomás nicht; er hatte den Sicherheitsorganen nichts zu verbergen, und Pezuela schien der umgänglichste Vertreter der Seguridad, den man sich wünschen konnte. Es war sein Ehrgeiz, gut informiert zu sein, und insofern hatte er einen Posten inne, der genau seinen Neigungen entsprach. Als sie die Marmortreppe im Nordflügel hinaufstiegen, fragte er etwas maschinenhaft: "Amüsiert über Sonntag?"
"Ich war in Boca Chica", antwortete Tomás.
"Roulette – oder Mädchen?"
"Nur so am Strand. Ein bisschen Wasserski..."
"Gehen Sie doch mal ins Kasino! Da merkt man nichts von der Krise."
"In meinem Portemonnaie ist immer Krise."
"Treffpunkt aller Schönen von Boca Chica. Viele neue Gesichter." Pezuelas weiße Zähne schimmerten im Dämmerlicht des Treppenhauses.
Tomás öffnete die Tür zum Warteraum für die Besucher des Präsidenten, er ließ den Major vorgehen. "Sie – ein Freund der Damenwelt?"
"Wir kennen uns noch zu wenig. Kommen Sie doch mal mit mir nach Boca Chica."
"Schön, warum nicht", sagte Tomás höflich.
"Wann passt es Ihnen – Mittwochabend?"
"Nein, da hab ich Dienst."
"Nächsten Sonntag?"
"Da ist das Pferderennen. Tut mir leid, Pezuela."
Sie passierten die leeren Stuhlreihen, ihre Schritte hallten von den Wänden, an denen die Bilder früherer Präsidenten hingen: Santana, Báez, Gonzáles, Guillermo, Billini, Heureaux... Am Ende die Tür mit der Aufschrift "Cuerpo de Ayudantes." Peinliche Stille. Tomás spürte, der Major erwartete einen Gegenvorschlag. Was sollte er tun? Ihm lag nichts an einer persönlichen Bekanntschaft, er war froh, dass er im Dienst mit Pezuela auskam. Es gehörte zu den Ungereimtheiten seiner Stellung als Chefadjutant, dass er Hauptmann war und Pezuela Major. Ein zehn Jahre älterer Major war sein Untergebener, formell gesehen; er hatte nie begriffen, warum das so war. Vieles im Palast wurde nach einem barocken Schema geregelt, das auf mangelnder Abgrenzung und planmäßiger Vervielfältigung der Kompetenzen zu beruhen schien. Dem Geschäftsgang war das abträglich, vielleicht hatte es gar keinen Sinn; es konnte aber auch ein Mittel sein, um Machtballungen vorsichtshalber schon auf mittlerer Ebene vorzubeugen.
Sie betraten das Adjutantenzimmer. Ihre beiden Schreibtische waren vollkommen gleichartig, hatten dasselbe Schreibgerät, dieselben Telefone, dieselben bronzenen Stiefel als Briefbeschwerer, für Pezuela und für ihn; bis auf die Messingglocke, die bei Pezuela stand... So schuf man eine Atmosphäre ständiger Rivalität, die es den Führern gestattete, die Untergebenen gegeneinander auszuspielen. Ob dies wirklich beabsichtigt war und wem es zugute kam, wer vermochte das zu sagen? Er war erst seit Jahresanfang Chefadjutant, und was ging es ihn auch an. Wahrscheinlich ließ der Wohltäter seine engsten Vertrauten – den Regierungschef, den Präsidenten und den Armeeminister – gleichfalls miteinander wetteifern, so dass sich das Spiel ganz oben wiederholte. Womöglich war dies überhaupt ein fundamentaler Grundsatz allen Herrschens, was wusste denn er? Er verstand es allenfalls, ein Bataillon zu kommandieren; doch Kriegführung und Staatskunst hatten offenbar nichts miteinander zu tun.
"Und wie ging's gestern Abend?", hörte er den Major fragen.
"Im Teatro Sánchez?"
"Ach, nichts Besonderes." Tomás nahm die Mütze ab. "Ganz wie immer... Wenn Sie das ein Jahr lang machen, fühlen Sie sich wie ein Laufbursche."
"Jetzt übertreiben Sie, Tomás."
"Sie hat nicht mal mit der Wimper gezuckt."
"Vielleicht schüchtern Sie die Frauen ein", sagte der Major leichthin, ohne Vorwurf. Er rückte die Akten, das Schreibzeug und den Briefbeschwerer so, dass rechte Winkel entstanden. "Wie alt ist sie denn?"
"Dreiundzwanzig. Sie heißt Angelique."
Pezuela behauchte und rieb die elektrische Glocke wie jeden Morgen. "Das klingt; sieht sie auch so aus?"
"Sie sieht besser aus als sie spielt. Milchkaffee, aber europäisch im Profil. Ziemlich groß und sehr schlank."
"Mulattin! Das hab ich mir gedacht. Der Chef kommt immer auf den Gegentyp zurück. Die hellen Damen fesseln ihn nie lange... Was wird jetzt mit der Tochter von General Román? Soll sie irgendwie verheiratet werden?"
"Es scheint, er behält sie nebenbei", antwortete Tomás. Er suchte in seiner Schublade nach dem Programmzettel, fand ihn aber nicht. Wenn sie nachher kam, würde er sie mit dem Vornamen anreden müssen, Künstlerinnen waren in dem Punkt wohl nicht empfindlich.
Auf Pezuelas Tisch schlug die Glocke an. "Er ist schon da", sagte der Major. "Um diese Zeit! Die Krise lässt ihn nicht schlafen... Wie hat er das Mädchen denn entdeckt?"
"Gar nicht. Der Chef hat sie nie gesehen. Sie muss ihm empfohlen worden sein. Er geht ja nicht ins Theater."
"Wir haben es ihm meist ausreden können."
"Diesmal mit Recht. Das Stück war schwach." Für einen Moment fühlte Tomás sich versucht, den Inhalt zu erzählen, um Pezuela zu versöhnen. Doch er sagte nur: "Ein Lustspiel – die Herrschaft ist verreist, die Diener tanzen um den Tisch, ein bisschen obszön, Angelique immer voran; das macht sie gut. Plötzlich kehrt die Herrschaft zurück, die Diener kuschen, bloß sie merkt's nicht, tanzt weiter... Großer Applaus. Ein Volksstück. Es hätte den Chef gelangweilt..."
"Das Teatro Sánchez ist zu verwinkelt. Man sitzt in einer Falle. Wir hätten wieder alle Karten aufkaufen müssen."
"Ihre Männer hätten sich amüsiert."
"Wohl kaum. Die Bühne ist für Leute, die nichts erleben. Liebe und Tod und Spaß, wer von uns braucht da Ersatz?"
"Pezuela, ich staune."
"Wieso?" Der Major klappte eine Akte zu, in der er geblättert hatte; er gab sich gern den Anschein, ohne Unterlagen auszukommen und darin nur andeutungsweise zu lesen. Es war einer der gelben Aktendeckel, die Berichte über Einzelpersonen enthielten.
"Sie haben darüber nachgedacht", sagte Tomás. "Über die Kunst, das Theater..."
"Wir kümmern uns um alles. Zu wann ist sie herbestellt?"
"Für halb neun."
"Weshalb so streng, Tomás?"
"Sie soll sich an Frühaufstehen und Pünktlichkeit gewöhnen."
"Da muss sie aber lange warten. Erst das Schwimmen, die Gymnastik, dann hält der Innenminister Vortrag. Balaguers Zeitungsschau und die Nachträge in der Ordensliste, das geht bis zehn. Danach hat sich der Polizeidirektor angemeldet... Was fangen Sie unterdessen mit dem Mädchen an? Übers Wetter reden, oder von der Krise?"
"Die üblichen Erläuterungen. Sie begreift wohl noch nicht ganz. Gestern, in ihrer Garderobe..."
"Ja?"
"Etwas war anders als sonst. Keine Schrecksekunde. Nicht das gewohnte Stammeln, als sie merkte, für wen ich spreche. Sie nahm es zu leicht. So, als wäre ihr gar nicht klar, was es wirklich bedeutet."
"Hm", machte Pezuela. "Sie lebt noch nicht lange hier."
War sie im Ausland, wollte Tomás fragen, doch er hielt inne, befremdet, sonderbar berührt. Was war das? Tatsächlich, sein Gehilfe wusste mehr! Er trat zu ihm und sah auf die gelbe Akte. "Mlle. Angelique Tibaux", las er in der dünnen, sauberen Druckschrift des Majors. – "Darf ich?"
"Bitte nicht." Pezuela breitete die Hände über den Dossier.
"Ach, das halten Sie geheim?"
"Durchaus nicht, Hauptmann. Das Material ist einfach zu dünn, ich möchte es noch keinem zeigen."
Tomás wandte sich ab, er wollte keinen Streit. Wie immer in solchen Fällen ermöglichte es ihm Pezuelas geschmeidige Art, sein Gesicht zu wahren und nichts auf die Spitze zu treiben. Einer der kleinen Zusammenstöße, die ihm seine Tätigkeit vergällten. Die Folge fehlender Zuständigkeitsgrenzen, der unklaren Unterstellungsfrage! Pezuela unterstand ihm im Adjutantendienst, nicht in Sicherheitssachen, doch wo fingen die an, wo hörte der Adjutantendienst auf? Natürlich hätte er ihm jetzt Einblick geben können, ein paar Informationen wären ja dienlich gewesen für das bevorstehende Gespräch, aber sollte man darauf bestehen? Man kannte die Geheimniskrämerei der Seguridad, die Oberen hatten es dem Major sicher untersagt, und er war zu loyal, das Verbot auch nur in Belanglosigkeiten zu umgehen. – "Wie alt sie ist, das steht doch drin. Das hätten Sie mich nicht fragen müssen."
"Ich hab's eben erst nachgelesen." Pezuela legte die Akte weg. "Geboren im Oktober siebenunddreißig in Haiti. In einem Nest gleich hinter der Grenze... Übrigens, sie verspätet sich."
"Also keine Dominikanerin", sagte Tomás. "Das hätte ich gestern schon wissen dürfen, oder bin ich dafür auch nicht kompetent?" Er sah Angelique wieder vor sich in der Enge ihrer Garderobe; die Schweißtröpfchen in ihrem Nacken, die festen Schulterblätter, die biegsame Taille. Sie saß vorm Spiegel und steckte ihr Haar auf, der ungeheure Blumenstrauß, den er ihr auf die Bühne geschickt hatte, lag unbeachtet neben dem Schminktisch. Als sie fertig war, hatte sie sich umgewandt, ihn angesehen und gesagt: "Gut, ich werde kommen." Ihm war gleich ein schwacher Akzent aufgefallen. Soviel er wusste, sprach man in Haiti – auf dem Lande, wo sie herkam – Creolé, einen französisch-spanisch-afrikanischen Mischmasch, und betete Urwaldgötter an. Nach Puder und Sandelholz hatte es bei ihr geduftet. Er fühle sich wie ein Dompteur, der ein exotisches Tier zähmen soll, dessen Launen niemand kennt. Die Überraschungen begannen schon, sie hatte zugestimmt und ließ ihn warten.
"Erscheinung und Wesen, dazwischen läuft die Trennlinie unserer Kompetenzen." Pezuela stand am Fenster, er schob die Jalousieblätter auseinander und blickte hinab. "Da die Erscheinung ausbleibt, sprechen wir vom Wesen – oder dem Wesentlichen."
"Was halten Sie für wesentlich?", fragte Tomás. Er rückte an dem bronzenen Stiefel, seinem Briefbeschwerer, ein Zeichen von Nervosität. Ihn reizte Pezuelas philosophische Ausdrucksweise. Wenn der Major versuchte, den Gebildeten zu spielen, war er unerträglich.
"Sie haben sich um die Person bemüht, wir um den Hintergrund. Ich frage mich jetzt doch, weshalb sie nicht erschrak, als Sie ihr offenbarten... Ja, es gibt eine Erklärung: Sie kann gewusst haben, was ihr angetragen wird. Sie hat es vorher gewusst."
"Gewusst? Von wem? Wer wusste es denn?"
"Der sie dem Chef empfohlen hat. Oder ist es Ihr Vorschlag gewesen, Tomás?"
"Sie wissen, ich erlaube mir das nie."
"Und Sie ahnen auch nicht, von wem der Hinweis kam? Etwa – General Román? Der gibt doch öfter solche Tipps. Oder Oberst Luna? Die Luftwaffe hat die besten Weiber an der Hand."
Tomás ließ den Bronzestiefel los. "Finden Sie es heraus, wenn Sie müssen, Major. Und verschonen Sie mich damit."
"Ich hatte auf Ihre Unterstützung gehofft, Hauptmann. Wir müssen ein Schutzgitter sein, das alles fernhält, was dem Wohltäter schaden könnte." Pezuela trat vom Fenster weg, er wies auf Trujillos Räume. "Jede Person, die durch diese Tür da geht, ist ein Sicherheitsrisiko!"
"Meine Unterstützung ist Ihnen immer gewiss – in dem Maße, ich dem ich mit Ihrer Hilfe rechnen kann."
"Ich bin überzeugt, dass wir uns stets soweit entgegenkommen, wie es unsere Vorschriften gestatten", erklärte Pezuela förmlich; er schloss seinen Rollschrank ab und steckte den Schlüssel ein. "Würden Sie mich jetzt entschuldigen? Ich möchte doch einmal nachsehen, wo Ihre Besucherin steckt. Vielleicht lässt die Wache sie nicht passieren, oder sie hat verschlafen."
"Gut, tun Sie das."
"Ich nehme meinen Einwand zurück", sagte Pezuela, um einen versöhnlichen Abgang bemüht. "Es war richtig, sie so früh herzubitten. Nicht auszudenken, wenn der Chef auf sie warten müsste."
3
Nachdem der Major gegangen war, zog Tomás seine Aufzeichnungen hervor. Die Landungen und Kämpfe im Inneren, erst 22 Monate war das her, und doch fiel es merkwürdig schwer, verlässliche Augenzeugen zu finden. Die damals leitenden Offiziere dienten in Puerto Plata oder in Santiago; er war an den Palast gebunden und sie kamen nur selten in die Hauptstadt. Fast hatte er den Eindruck, dass sie seiner Einladung auswichen. Wollten sie sich nicht erinnern, war ihnen die Sache peinlich? Es waren doch viele Orden dafür verliehen worden.
Um die Gegenseite stand es trostlos. Von den 235 Guerilleros lebte anscheinend keiner mehr. Einige waren im Kampf gefallen – die Unterlagen bewiesen das nur für sechs Mann –, die meisten hatten sich nach und nach ergeben, hungrig, verwundet, ohne Munition. Waren sie ausnahmslos hingerichtet worden? Es sollten auch Ausländer darunter gewesen sein: etwa zwanzig Venezolaner, zehn Cubaner und zwei Nordamerikaner; das machte die totale Auslöschung zweifelhaft. Bei jeder Aufruhrhandlung gab es Mitläufer, Verführte, minder Schuldige – war da nicht unterschieden worden? Das Material besagte, dass zuletzt drei Mann kapituliert hatten. Ihnen war ein gerechtes Urteil zugesichert worden, falls sie sich ergaben, doch es hatte nicht ein einziger Prozess stattgefunden, zumindest keine öffentliche Verhandlung; das widersprach den strengen Regeln der dominikanischen Gesetzlichkeit. Und nirgends waren Überlebende zu finden, weder im Victoria-Gefängnis noch in La Cuarenta oder Kilometer 9; Pezuela hatte dort für ihn nachgeforscht. Das erschwerte seine Arbeit sehr, denn die Wahrheit hatte immer zwei Seiten...
Tomás sah auf die Uhr. Schon fünf vor neun, ein schlechtes Zeichen! Sich derart zu verspäten, das hatte noch keines der Mädchen gewagt, die er in den Palast bestellt hatte, um sie dem Wohltäter vorzuführen. Ein Warnsignal. Mit ihr würde es womöglich Schwierigkeiten geben... Was glaubte diese kleine Schauspielerin wohl, wer sie war?
Er wandte sich wieder den Papieren zu, doch seine Gedanken schweiften ab. Gestern hatte er Major Caamaño von dieser Arbeit erzählt, als sie am Strand von Boca Chica lagen; dessen Reaktion hatte ihn enttäuscht. "Lass die Finger davon, Juan", hatte Caamaño gesagt. "Du wirst Ärger haben." – "Nicht mehr zu ändern, Francisco; Befehl von Román." – "Dann mach es so knapp wie möglich und bohre nicht drin herum. Meiner Ansicht nach ist das kein Ruhmesblatt für die Armee. Zuviel Tote! Und nicht mal die Seguridad hat sie auf dem Gewissen, wie es scheint. Die meisten Überlebenden sind in San Isidro erschossen worden."
Näheres hatte Caamaño nicht gewusst oder nicht sagen wollen. Zur Zeit der Kampfhandlungen waren sie beide außer Landes gewesen, auf einem Lehrgang in Fort Gulick, der amerikanischen Heeresschule in der Panama-Kanalzone, wo man ihnen die neueste Taktik der Partisanenabwehr gezeigt hatte... Ob Caamaño seinen eigenen Rat befolgt hätte? Francisco tat auch nichts halb, er würde an seiner Stelle genauso handeln und der Sache auf den Grund gehen. Tomás kannte ihn lange genug. Sie hatten überhaupt viel gemeinsam: den Jahrgang, die Ausbildung auf der Kriegsschule Haina und in den USA, die glatte Karriere und ihre Väter, die darüber wachten – beide Gefolgsmänner Trujillos von Anfang an und heute hoch geehrte Mitglieder der Generalität. Der alte Caamaño stand zweifellos noch mehr in Gunst als General Tomás, der in La Romana am Ostzipfel der Insel residierte. So oft er Francisco traf, vermieden sie es, von ihren Vätern zu sprechen. Besonders die Vergangenheit war tabu, ihr Aufstieg während der dreißiger Jahre, in die der Grenzkonflikt mit Haiti fiel.
Aber die 59er Ereignisse, was sollte ihn daran wohl schrecken? Ein Einfall war abgewehrt worden, sicher übertrieben hart, nicht ohne Anzeichen von Rachsucht. Doch kein Land der Welt ging sanft mit bewaffneten Emigranten um, die zurückkehrten, um die Regierung zu stürzen... Er zog die Landkarte aus den Papieren. Auffällig war die Wahl der Landungspunkte: Estero Hondo und Maimón, zwei unbedeutende Küstenorte 20 und 60 Kilometer westlich von Puerto Plata; gut 100 Kilometer südlich davon die Luftlandung in der Zentralkordillere – 55 Mann bei Constanza. Was bezweckte das nur, wo lag das operative Ziel?
Tomás konnte keines entdecken; die Zersplitterung der Kräfte schien ihm sinnlos. Noch etwas anderes war sonderbar. Auf halber Strecke zwischen Estero Hondo und Maimón, den Orten der Seelandung, lag das Nest Luperón, wo zehn Jahre zuvor, am 19. Juni 1949, jene merkwürdige Luftlandung stattgefunden hatte: fünfzehn Mann waren in einem Flugboot gekommen, das in der Bucht von Luperón gewassert hatte... Warum immer an demselben Küstenstrich? Lud der Strand dazu ein, das Hinterland, die Cordillera Septentrional? Es gab doch ein Dutzend Plätze mit ähnlicher Geographie. Tomás beschloss, bei nächster Gelegenheit in die Provinz Puerto Plata zu fahren und die Orte anzusehen. Mit dem Lokaltermin ließ sich die Befragung der maßgebenden Offiziere verbinden.
Er starrte weiter auf die Karte. Wenn das Auffächern der Invasionsgruppen militärisch sinnlos war, dann musste die Logik woanders liegen. Es war absurd, zu glauben, die Angreifer hätten sich verflogen und auf See verirrt, wie es in einem der Berichte stand. Viel näher lag es, anzunehmen, dass sie an den Landungsstellen auf Beistand gehofft hatten. Im Bürgerkrieg dominierten oft politische Faktoren; denen war er nicht nachgegangen, es reizte ihn auch jetzt nicht sehr. Der Angriff wurde allgemein als ein Schlag dominikanischer Castro-Anhänger aufgefasst; sechzehn Kommunisten sollten daran teilgenommen haben. Sie konnten nicht mehr reden, waren erschossen worden, obschon das Land keine Todesstrafe kannte. Das Höchstmaß, 30 Jahre Kerker, bei Gott, das hätte doch genügt.
Leutnant Costa trat ein, der jüngste der Adjutanten, ein hellhäutiger Jüngling spanischen Typs. "In Cuba geht es drunter und drüber, Hauptmann", berichtete er; das zarte Oval seines Gesichts rötete sich vor Eifer. "Die amerikanischen Nachrichtenagenturen melden soeben den Fall von Santiago. Auf der Fichteninsel sollen zehntausend politische Gefangene befreit worden sein und sich dem Aufstand angeschlossen haben. Die Flottenbasis Mariel ist anscheinend von Castro abgefallen. Straßenkämpfe in Habana! Laut AFP ist der Emigrantenführer Miró Cardona schon in Oriente eingetroffen, und Castros Bruder Raúl hat man dort verhaftet. In drei von sechs Provinzen sind die Exilcubaner erfolgreich gelandet! Sie stehen an einigen Punkten schon fünfzig Kilometer tief im Land!"
Tomás schickte den Leutnant weg. Das hörte sich gut an, doch Costa, den er sonst mochte, wurde ihm dadurch unsympathisch; diese naive Begeisterung. Die Berichte klangen übertrieben, das hätte ein Offizier von Costas Intelligenz merken müssen. Soviel Erfolge, sieben Stunden nach Beginn der Invasion? Natürlich waren es keine amtlichen Berichte, sondern Agenturmeldungen – die übernahm man nicht kritiklos. Kein Konflikt in Lateinamerika ohne vorfabrizierte Siegesnachrichten! Immerhin, die Angreifer hatten Fuß gefasst, auf Cuba gab es offenbar feste Landeköpfe, ganz anders als hier im Juni 59; da waren die Guerilleros vom ersten Tag an gejagt worden. Hinter ihnen hatte eben keine Großmacht gestanden, sie waren auf sich selbst gestellt gewesen.
Die Vergangenheit ließ ihn nicht los. Fest stand, die Guerilleros waren von Cuba aus aufgebrochen, das nun seinerseits auf ähnliche Weise überfallen wurde. Die wenigen Vernehmungsprotokolle, die bei den Akten lagen, stimmten darin überein, dass die cubanische Ostprovinz der Ausgangspunkt gewesen war. Ein Venezolaner sollte jene DC-3 gesteuert haben, die im Morgengrauen des 14. Juni unglaublicherweise 55 Mann bei Constanza abgesetzt hatte. Wo war er aufgestiegen? Dies und andere Details des Fluges schienen nirgends vermerkt...
Sechs Tage später dann die Seelandung der 180 Guerilleros bei Estero Hondo und Maimón. Die Invasion galt als erster Versuch Castros, die "Revolution von der Sierra Maestra bis zu den Anden" zu tragen. Tomás zweifelte nicht daran, doch brachte diese Deutung ihn nicht weiter. Auf wessen Hilfe konnten Linksextremisten denn im öden Norden und im Hochgebirge hoffen?
Und schließlich die rätselhafte Geschichte des Leutnants Simón Buenaventura, eines der drei Männer, die sich als letzte ergeben und denen man einen fairen Prozess versprochen hatte. Hier im Palast, im Venezianischen Spiegelsaal, war Buenaventura der Presse gezeigt worden; der ehemalige Luftwaffenleutnant trug dabei Hauptmannsuniform. Und Oberst Abbes, der Direktor des Militärgeheimdienstes SIM, hatte den Journalisten erklärt, Buenaventura sei kein Verräter, sondern ein Held, vom Wohltäter selbst befördert und ausgezeichnet. Er habe sich den Banditen im Auftrag des SIM angeschlossen, um diesen über Funk zu informieren... Das trojanische Pferd mit den Hauptmannssternen. Die Auslandskorrespondenten waren ihm auf der Spur geblieben, sie wollten ein Interview. Da wurde amtlich gemeldet, der Hauptmann sei bei einem Patrouillenflug ins Meer gestürzt. Die Korrespondenten fuhren zum Luftwaffenhauptquartier San Isidro. Dort versicherte man ihnen, seit Wochen werde keine einzige Maschine vermisst. Der Held aber blieb verschwunden.
"Eine undurchsichtige Sache", hatte Caamaño gestern dazu gesagt. "Buenaventura soll auf der Pressekonferenz fahrig gewirkt und wenig gesprochen haben. Wahrscheinlich war er mit den Nerven herunter. Es kann doch durchaus sein, dass er eingeschleust worden war und die Aktion von A bis Z über Funk verraten hat. Später ist er dann, weiß der Teufel wie, in Ungnade gefallen..."
Tomás hatte aufgelacht, er wusste es besser, wenigstens in einem Punkt. Buenaventura war tatsächlich Funker gewesen, die Guerilleros hatten auch einen Sender gehabt. Ihre Funksprüche waren aufgefangen worden, doch der SIM hatte sie nicht entschlüsseln können. Ein paar davon – zu Zahlenreihen chiffrierte Texte – lagen bei dem Material. Das einzige Originaldokument der anderen Seite, und Tomás konnte es nicht verwerten! Aber er wollte den Dingen auf den Grund gehen. Wozu gab es Entschlüsselungs-Computer in den USA, die angeblich jede Chiffre brachen? Über den Luftwaffenadjutanten hatte er die Funksprüche dem Rest der amerikanischen Beratergruppe zugeleitet, der trotz des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen noch in San Isidro saß. Kein unbedenklicher Schritt; niemand hatte ihn genehmigt. Doch die Spur war ja kalt – ein erledigter Fall ohne Gegenwartsbezug, nur mehr Objekt historischer Forschung... Nun wartete er täglich auf die Antwort der Military Assistance and Advisory Group.
4
Angelique kam elf Minuten nach neun. Tomás spürte sofort, dass sie auf ihn anders wirkte. Statt des hautengen Kleides trug sie eine blau gestreifte weiße Hemdbluse mit geschlossenem Kragen, an ihr war nichts Herausforderndes mehr. "Ich freue mich, dass Sie gekommen sind", sagte er herzlicher als beabsichtigt. "Hat man Sie abgeholt?"
"Nein, wieso?" Angelique blieb stehen. "Sie haben nach mir geschickt? Ich bin ein bisschen durch den Park spaziert und hab mich verspätet."
Das war die ganze Entschuldigung; und – deutlicher als gestern – ihr Akzent. "Machen Sie sich darüber keine Gedanken." Er gab ihr die Hand und merkte, dass ihm ihr Zuname von neuem entfallen war; der hatte doch auf Pezuelas Dossier gestanden. "Das ist diesmal nicht so schlimm, Señorita Angelique... Falls Sie mir diese Anrede erlauben."
"Warum nicht?" Sie lächelte etwas gezwungen und beendete den Händedruck einen Moment zu früh. "Es ist sowieso nicht mein richtiger Name. Eigentlich heiße ich Anyka." Sie sah ihn erschrocken an, als bereue sie es, das gesagt zu haben. Von ihrer gestrigen Sicherheit war nicht viel geblieben.
"Ein afrikanischer Name?"
Sie nickte beklommen. Er fand, dass er sie beruhigen musste. "Damit Sie sich keine Sorgen machen, Señorita Angelique: Man möchte Sie heute nur kennen lernen. Eine Plauderei von zwanzig, dreißig Minuten. Dies ist der Amtssitz, keine Privatresidenz. Der Wohltäter ist ein Vormittagsmensch; da arbeitet er besonders hart. Die Gegenwart von Künstlern regt ihn manchmal an... Sie müssen also weiter nichts befürchten."
Sie schien ihm nicht zuzuhören, sah nervös umher. Waren das dieselben Augen, die gestern so feurig und frech von der Bühne gefunkelt und ihn später so durchdringend gemustert hatten? Jetzt erinnerte ihr Blick an ein Tier, das nach einem Ausweg sucht. "Dahinter sitzt Rafael Trujillo?" Sie wies auf eine der drei Flügeltüren.
"Nicht direkt", antwortete Tomás. "Erst kommt die Leibwache."
"Und dann der Generalissimus?"
"Er hat seine Räume gerade verlassen. Sobald er sie wieder betritt, ertönt dort die Glocke."
"Wo ist er denn?"
"Um diese Zeit geht er mit dem Chef des Protokolls die Titel und Orden durch."
"Seine eigenen?"
"Gewiss."
"Dauert es lange?"
"Ständig kommt etwas hinzu, wie jetzt der Stern von Portugal. Das muss in die Sammlung eingefügt werden. Es sind neunundachtzig höchste internationale Auszeichnungen; dazu sechs Ehrendoktorhüte, die Professur der Universität Pittsburgh und der Titel eines Großkreuzträgers vom Orden des Heiligen Gregorius; der vorletzte Papst hat ihn verliehen. Auch Literaturpreise sind dabei."
"Zählen Sie das immer so hübsch auf?"
"Oft, Señorita. In der Person des Wohltäters ehrt die Welt unser Land, die dominikanische Nation."
Angelique deutete auf die mittlere Tür. "Wohin geht es dort?"
"In die Präsidialkanzlei. Da regiert unser Staatsoberhaupt, Héctor Trujillo, der jüngste Bruder des Wohltäters. Héctor ist Drei-Sterne-General. Im Augenblick ist er nicht da – auf Kreuzfahrt im Atlantik. In seiner Abwesenheit führt Vizepräsident Joaquín Balaguer, der ehemalige Außenminister, die Staatsgeschäfte. Faktisch ist er der Regierungschef. Bitte, fragen Sie weiter; es ist mir ein Vergnügen, Ihnen zu antworten."
Doch nun fragt sie nichts mehr. Ihr Blick streifte die Wandkarte, die Fahne der Republik, das Porträt des Chefs und das Staatswappen: drei gekreuzte Flaggen mit Bibel und Kreuz und der Überschrift "Gott, Vaterland, Freiheit"... Erst jetzt nahm Tomás ihre dünnen großen Ohrringe wahr, ein fremdartiger Schmuck, vielleicht handgemacht, aus Elfenbein oder sehr hellem Holz. Er hatte sie gestern schon bemerkt, doch angenommen, sie gehörten zu ihrem Kostüm. Je zwei verschieden große Ringe, die ständig schwangen. Das schwarze Haar war straff zurückgekämmt, nicht aber künstlich geglättet. Eine der wenigen Farbigen, die nicht versuchten, sich dem weißen Vorbild anzupassen.
Da sie verstummt war, sagte er: "Das ist mein Schreibtisch. Ich bin der Armeeadjutant; einer von acht. Aber nehmen wir doch Platz."
Sie übersah den Stuhl, den er ihr zurechtrückte. "Wie wird man das – Adjutant?"
"Man besucht unsere Kriegsschule und ein bis zwei ausländische Militärakademien."
"Man muss nicht zur Elite zählen? Die Herkunft ist nicht Vorbedingung?"
"Nein, Señorita Angelique, hier macht jeder seinen Weg. Das entspricht dem Wesen unseres Staates. Der Generalissimus selbst ist das beste Beispiel. Er war der Sohn eines kleinen Postbeamten, hat als Plantagenarbeiter und Telegrafist angefangen, ehe er in den Polizeidienst trat... Mein Vater war nicht ganz so arm, ein Ingenieur; heute ist er General."
"Gehört Ihre Familie zum Clan?"
"Wozu, bitte?" Tomás trat hinter sie und spürte wieder den Sandelholzduft. Er hatte sich getäuscht – sie mochte sich kleiden wie sie wollte, es ging ein provozierender Reiz von ihr aus. Für einen Augenblick dachte er sie sich in den Armen Trujillos... So nahe das lag, er gab solchen Vorstellungen niemals nach, da sie ihn immer irritierten, auf unklare Art zu demütigen schienen.
Sie sah ihn an und sagte: "Zu den achttausend Reichen, die keine Steuern zahlen, Hauptmann."
"Nein, Señorita", antwortete er langsam. "Mit der Familie des Generalissimus sind wir nicht verwandt. Mein Vater wurde für seine Verdienste befördert... Dort am Nebentisch sitzt Major Pezuela, der Sicherheitsadjutant. Seguridad Nacional. Mit ihm haben Sie weniger zu tun." Für Eroberungen ist die Armee zuständig, fügte er im Stillen hinzu.
Plötzlich fragte sie: "Gibt es viele politische Häftlinge bei Ihnen?"
"Nein, nein", er schüttelte den Kopf. "Nicht mehr als woanders, würde ich sagen."
"Sind Sie sicher, dass Sie das glauben?"
"Vollkommen sicher." Er war es wirklich. In der New York Times, die das Presseamt ständig für Balaguers Zeitungsschau in die Adjutantur schickte, hatte Tomás kürzlich erst gelesen, es gäbe nach einer Schätzung von Amnesty International derzeit eine Million politisch, religiös oder rassisch Verfolgter in den Kerkern der ganzen Welt. Legte man diese Norm – 0,3 Promille der Bevölkerung – hier zugrunde, so hätte das Land tausend politische Häftlinge haben dürfen. Und es waren auch nicht mehr, wenn man annahm, dass in La Victoria, in La Cuarenta, in Kilometer 9 und auf den Inseln Saona und Beata je zweihundert solcher Menschen festgehalten wurden. Vielleicht war ihre Sterblichkeit höher als anderswo (von den Guerilleros hatte ja keiner überlebt), doch das entzog sich seinem Urteil, da fehlte ihm jede Vergleichsmöglichkeit. Überhaupt, wie kam sie jetzt darauf? Das führte ab und stand in keinem Zusammenhang mit seiner Aufgabe.
"Auf etwas sollte ich Sie vorbereiten", sagte er. "Der Wohltäter ist körperlich nicht so groß, wie man nach den Denkmälern und Bildnissen meinen könnte. Er misst einen Meter fünfundsechzig, hält sich freilich sehr gerade. Ich rate Ihnen zu flachen Absätzen."
Auf Pezuelas Tisch schlug die Glocke an. "Er ist zurück, wird uns bald rufen", fuhr Tomás fort. "In einem täuschen die Bilder nicht: Er ist neunundsechzig, sieht aber zwölf Jahre jünger aus. Die Frische verdankt er seiner Willenskraft und dem Sport. Er schwimmt, turnt, reitet und trainiert fast täglich auf dem Eis."
"Sie haben eine Eislaufbahn?"
"Hier nicht, in der Privatresidenz. Es gibt dort auch ein Kino, eine klimatisierte Turnhalle und eine Klinik mit Zahnstation; womöglich lernen Sie das bald einmal kennen."
"Meine Zähne sind gut, Hauptmann." Ihre Lippen verzogen sich zu einem schnellen Lächeln; ein großer, afrikanischer Mund.
"Für einen Besuch empfiehlt sich helle, zart getönte Kleidung. Er selbst trägt gern weiße Anzüge und handgemalte Hundert-Dollar-Krawatten aus den USA. Machen Sie nie eine Bemerkung darüber. Auch nicht über das Staatsgewand. Es mag überladen wirken, mit den schweren Schulterstücken und den Schwalbenschwänzen aus Goldbrokat; dazu die goldgestreiften blauen Hosen, die Schärpe in den Landesfarben und der gefiederte Zweispitz... Die kleine Gala aber steht ihm glänzend. Der Chef trägt die kleine Gala nur, wenn er nach San Cristóbal auf sein Landgut fährt. Die große ist für Staatsempfänge und Paraden."
Angelique strich durch das Zimmer, sie schien wieder das Mädchen vom Teatro Sánchez zu sein – die pfiffige Dienerin, die in die Räume der Herrschaft dringt und schließlich um den Tisch tanzt, mit dieser frechen Hüftbewegung, die Beifallsstürme verursacht hatte.
"Auch über sonstiges verlieren Sie besser kein Wort: die kugelsichere Weste, die er manchmal anlegt; den Essenprüfer, der die Speisen vorkostet. Dasselbe geschieht mit dem Wein. Jede Flasche wird vor seinen Augen entkorkt; er liebt keine Kommentare dazu... Gänzlich tabu ist María Martínez Trujillo. Sie lebt auf dem Landsitz bei San Cristóbal."
"Das ist seine dritte Frau, nicht wahr?"
"Die Erste Dame der Republik – seit sechsundzwanzig Jahren, und er verehrt sie tief." Tomás senkte die Stimme wie immer, wenn er zu dieser Mitteilung kam. "Sie ist die Mutter des Oberbefehlshabers der Luftwaffe. Damit er sie heiraten und seinen ältesten Sohn Ramfis legitimieren konnte, erließ der Kongress damals ein neues Ehegesetz. Danach durfte jede Verbindung geschieden werden, die fünf Jahre lang kinderlos geblieben war."
"Steht er nicht über dem Gesetz?"
"O nein, der Wohltäter hegt und pflegt Recht und Gesetzlichkeit. Nichts hasst er mehr als Unordnung, auch im persönlichen Leben. Da reizen ihn schon winzige Unregelmäßigkeiten bis aufs Blut. Unermüdlich arbeitet er für das Wohl der Nation, nie weniger als zehn Stunden. Jeder Tag ist ausgefüllt, zumal jetzt in der Krise."
"Wie mühsam für Sie, in seinem Tagesplan eine Lücke zu finden für Besucher wie mich."
"Na, das ist mir eine Freude... Falls Sie sich entschließen können, meine bescheidenen Winke ernst zu nehmen, ist doch alles gut. Betrachten Sie das einfach als eine Art Premiere. Man mag etwas Herzklopfen haben, doch dann bereichert sie einen, menschlich und künstlerisch."
"Wieso?" Angelique schlug die langen Beine übereinander; es war ihm endlich geglückt, ihr einen Stuhl hinzuschieben.
"Die Begegnung mit ihm", sagte Tomás. "Ein unumschränkter Herrscher über drei Millionen! Das Erlebnis der Macht... Ihre Darstellungskunst wird reifen."
Sie sah ihn an, als argwöhnte sie, dass er sich lustig mache. War er zu weit gegangen? Sie hatte wohl ein Ohr für Zwischentöne. Doch dieser letzte Appell, der Hinweis auf Trujillos Herrlichkeit, war – in der oder jener Form – ein Bestandteil seines Vortrags. Er sollte den schnöden Schluss verdecken, den Köder, das nackte Angebot.
"Und das ist noch nicht alles", hörte Tomás sich sagen (der Satz, mit dem er meist zu Ende kam.) Es lief ja immer wie von selbst, fast ohne sein Zutun, eine vorgegebene Rolle; er musste sich bloß auf die Mitspielerin einstellen, darin lag ein Reiz, im Grunde aber waren die Szenen öde und austauschbar.
"Gewiss, die geistigen Werte sind das Wichtigste." Er setzte sich nun auch – so, dass sie ihn nicht ansehen musste. "Dennoch bedarf es auch materieller Güter. Das moderne Leben zwingt sie uns förmlich auf, und wir passen uns ihm schließlich an. Einer der vierzig Wagen des Chefs..." Er blickte auf seine Notizen. "Ja, der cremefarbene Chevrolet! Der gehört ab heute Ihnen!"
Er nahm eine rasche Bewegung wahr und kam ihrem Einspruch zuvor: "Ich weiß, Ihnen liegt nichts daran. Nicht deshalb sind Sie gekommen, und Sie würden sich auch weigern, einen Chinchilla-Mantel oder Juwelen anzunehmen – all die kleinen Überraschungen, die der Generalissimus nun einmal liebt, mit denen er seine Begleiterinnen so gern überhäuft. Inés Roman, die Tochter des Armeeministers, fand das auch lästig, ja peinlich; sie hat es hartnäckig zurückgewiesen, bis er ihr seine zweitgrößte Jacht schenkte. In dem Punkt ist er wie ein Kind. Wenn Sie ebenso standhaft sind, könnte es sein, dass er das Teatro Sánchez über Nacht abreißen lässt und in drei Wochen ein Schauspielhaus baut, das Ihrer und der Hauptstadt würdig ist... Doch einmal müssen Sie ihm nachgeben."
Angelique sagte leise: "Sie sollten nicht so mit mir reden."
"Wie, Señorita?"
"So, verzeihen Sie, geckenhaft. Wie man mit Menschen nicht spricht... Sonst müsste ich versuchen, ohne Ihren Rat auszukommen."
Tomás sah, wie sie sich vorbeugte und seine Notizen vom Tisch wischte. Eine Aufwallung! Das war neu, afrikanisch, nie da gewesen, er sah auch keine Vernunft darin – jede, die herkam, lief doch von selbst in den goldenen Käfig; es gab keinen Zwang, nur Verlockung.
Während er nach Worten suchte, sprach sie schon weiter, und er merkte, dass sie sich wieder fing. "Überhaupt, das ist alles nicht so wichtig. Ich brauche keine Tipps und keinen Wagen. Um mich müssen Sie sich nicht sorgen... Sie sind Offizier, Chef des Adjutantenkorps, lieben Ihren Beruf, nehme ich an.
Weshalb sprechen wir nicht darüber, wenn ich schon warten muss?"
"Was möchten Sie hören?", fragte Tomás; das Gespräch glitt ganz aus der gewohnten Bahn. "Die Dienstvorschrift der Armee? Das Exerzierreglement?"
"Natürlich, ich bin es nicht wert", sagte sie dumpf, mit ihrem kehligen Akzent. "Ich bin ein Mensch, den man verachtet und verhöhnt! Weil ich es nicht wage, mich zu widersetzen."
"Bitte, beruhigen Sie sich! Wir wollen doch vernünftig bleiben..."
Angelique stand auf. "Merken Sie nicht, dass Sie mich schlecht behandeln? Sie benehmen sich unwürdig, Hauptmann, reden wie ein Kuppler... der Sie ja auch sind!"
Sie trat hinter den Stuhl, umklammerte die Lehne und rief ihm zu: "Ich hab seit gestern doch nur die Wahl, zu gehorchen oder das Land zu verlassen! Wissen Sie das nicht, oder sind Sie schon so abgestumpft, dass es Ihnen gleichgültig ist? Was wir hier reden, ist verachtenswert, ich nehme mich gar nicht aus. Aber Sie, in Ihrer überheblichen Routine, sind viel verächtlicher!"
Tomás schoss das Blut zu Kopf, er sprang auf und starrte sie an. Ein paar Atemzüge lang war es totenstill. Er hörte nur einen Laut, der von ihren doppelten Ohrringen kam. Sie schüttelte den Kopf, voller Abscheu und Hass... Er griff nach dem bronzenen Briefbeschwerer. Ihm wurde klar, dass er sie nicht mehr beruhigen konnte. Nach ihren kränkenden Worten fehlte ihm dazu auch die Kraft. Unmöglich, sie dem Chef vorzuführen, der in wenigen Minuten rufen würde. Nahm er sie so mit hinein, riskierte er einen Skandal, einen Auftritt mit bösen Folgen für sie und für sich selbst. Er sah ja, sie war äußerst erregt, sonst hätte sie ihn niemals dermaßen beleidigt. Ihm das ins Gesicht zu schleudern, das! Und ihr Zorn steigerte sich noch, jeder Beschwichtigungsversuch, zu dem er sich aufraffen konnte, hätte ihren Zustand nur verschlimmert.
"Mir scheint, wir sind beide etwas nervös", sagte er mit Überwindung. "Bekanntschaften sollte man in bester Stimmung schließen. Verschieben wir es auf morgen, Señorita? Sind Sie einverstanden – morgen um halb zehn?"
Er brachte sie zur Tür und rief nach Leutnant Costa. Der Leutnant war angewiesen, sie nach Hause zu fahren, in dem cremefarbenen Chevrolet, und ihr das übliche Couvert zu überreichen, das den Zündschlüssel, die Papiere und dreihundert Pesos enthielt.
Da ging sie an Costas Seite durch den Warteraum, der sich schon mit Bittstellern füllte. Sie hatte Tomás nicht mehr angesehen. Er kehrte schweißgebadet an seinen Tisch zurück. So etwas war ihm noch nie passiert... Als er sich setzte, merkte er, dass er den bronzenen Stiefel noch immer in der Hand hielt.
5
Gegen halb sechs stieg Tomás in den stahlblauen Dodge, der ihn gewöhnlich nach Hause fuhr. Sergeant Ferro, ein Mann mit vorspringendem Kinn und übergroßen Händen, chauffierte beinahe unmerklich, eine Kunst, durch die er es weit gebracht hatte: Ferro durfte den Präsidenten fahren, manchmal sogar den Chrysler des Chefs. Er hatte unter den Akazien gewartet, das Sitzleder war angenehm kühl. Nun glitt er durch den Schatten die Anhöhe hinab, auf der der Nationalpalast stand, bog rechts in die Calle 30 de Marzo ein und trieb ohne jeden Aufenthalt auf den Kreisverkehr zu. Der Wagen trug statt der Inschrift "Lang lebe Trujillo" das Staatswappen im Nummernschild; er hatte überall Vorfahrt.
Als sie den Parque de la Independencia hinter sich hatten, erblickte Tomás am Bordstein seines Blocks einen weinroten italienischen Sportzweisitzer. Er fühlte sich sogleich erfrischt. Sicherlich wartete Cindy oben schon auf ihn, sie hatte ja seinen Schlüssel. Er schenkte dem Sergeanten einen Peso und sprang aus dem Dodge.
Cindy war da, nichts Besseres konnte es jetzt geben! Er würde den Tag vergessen – all die Zusammenstöße und Reibereien, die Nervenanspannung im Dienst, Folgen der unklaren Lage auf Cuba gewiss –, auch wenn Cindy wie üblich kaum eine Stunde blieb. Er drückte den Etagenknopf im Lift. Cindy Fonseca y de las Llamas, die Tochter Romero Fonsecas, des reichsten Mannes von Puerto Plata. Nie ließ sie sich von Tomás begleiten, aus Rücksicht auf ihre Familie. Aber sie kam zu ihm, so oft sie mit ihrer Mutter hier war; die Fonsecas wohnten dann immer in der Suite A des Embajador-Hotels. Und sie kam meist in der Dämmerung, bis zu dem Augenblick, da die Geschäfte schlossen. Sie hatte ihn überredet, in die teure El Conde-Straße zu ziehen. Er wusste, sie täuschte Einkäufe vor, wenn sie ihn besuchte. Vor dem Modehaus Gonzalez fiel selbst ihr weinroter Flitzer nicht auf. Mit zweiundzwanzig schon so zielbewusst – nun ja, kein Wunder bei diesem Vater. Romero Fonseca, kaum über vierzig, Importeur und hundertfacher Hausbesitzer, war einer der wenigen Millionäre, die sich mit den Trujillos arrangiert hatten, ohne im Clan aufzugehen. Dazu gehörte mehr als Verschlagenheit, dazu brauchte man Rückenschutz, Freunde im Ausland wie General Motors, deren Interessen er hier wahrnahm.
Im Vorraum stand der Kühlschrank offen, Cindy hatte sich Eis geholt für die Drinks und das Klimagerät abgeschaltet. Das tat sie, um dann beiläufig zu sagen, ihr sei schrecklich heiß... Alles war durchdacht, das störte ihn manchmal an ihr, doch dann erst hinterher. Eine erfahrene Geliebte war natürlich höchst erfreulich. Und wie schmeichelhaft, sie fuhr dem ganzen Verehrerschwarm davon und kam zu ihm! Er war abhängig, im Vergleich zu ihr mittellos, die Wohnungsmiete ruinierte ihn – als Ehemann kam er niemals in Frage.
"Juancito", rief sie, ihr Mund versengte ihn, und das lange blonde Haar kitzelte seinen Hals; sie ging ihm bis ans Kinn. "Zwei Wochen haben wir uns nicht gesehen! Wir dürfen uns nie wieder so entsetzlich lange trennen..."
Die Art der Begrüßung war fester Brauch. Cindy machte sich von ihm los, als läge darin nun das Heil, und wich auf die Couch zurück, während er sich davor setzte, in den indianischen Hartholzstuhl, den sie ihm zum Geburtstag geschickt hatte: ein wuchtiges, unbequemes, unschätzbar wertvolles Stück einer versunkenen Kultur. Sitz und Lehne, von einem Indiokopf gekrönt, schwangen ineinander, waren mitsamt den Beinen aus einem mächtigen Stamm herausgeschnitzt worden. Das gab es nirgends zu kaufen, Cindy hatte es als Beweis ihrer Liebe vom Landsitz der Fonsecas entführt. Tomás sollte an sie denken, so oft er den Stuhl ansah; doch der erinnerte ihn eher an das peinliche Aufsehen, das die Anlieferung verursacht hatte. Ein zweites Stück stand im Nationalmuseum, den Touristen englisch erläutert: Pre-Columbian wooden ceremonical seat from the Taína culture.
Cindy fragte: "Was macht dein Harem?"
Die Frage gehörte zum Ritual, doch heute beschwor sie Hässliches herauf, die kränkende Szene im Adjutantenzimmer... Er schilderte sie und merkte, es tat ihm gut. "Es fehlte nicht viel, und sie hätte mich angespuckt", sagte er. "Danach starrten wir uns schweigend an. Ihre Ohrringe klapperten, es war schauderhaft und rührend. Dünne große Ringe aus Elfenbein, ich glaube, in Afrika zieht man sie durch die Nase. Es hätte gut zu ihr gepasst."
"Du hast dich elend gefühlt, nicht wahr?"
"Ja; wie beim ersten Autounfall. Weißt du, nichts Ernstes, der Wagen fährt noch, nur ein paar Beulen im Blech und der Lack ist ab. Man ist drauflos gerast, elegant in die Kurve, hat sich sicher geglaubt und dabei doch gewusst, dass es einmal passiert. Das Mädchen hat ja Recht. Meine Schuld! Ich muss so ungeschickt gewesen sein, dass sie es nicht wie die anderen für sich behalten konnte. Es stimmt, was sie mir vorwirft, ich bin ein Kuppler – der Obereunuch, wie man den Chefadjutanten hinterm Rücken bei uns nennt."
"Armer Juancito! Was kannst du dafür? Du bist Offizier und führst Befehle aus."
"Wenn es nur solche für mich gäbe, würde ich meinen Abschied nehmen. Das mindeste wäre – Versetzung zur Truppe. Doch da ist manches, wofür es lohnt, im Amt zu bleiben."
"Zur Truppe? Denkst du gar nicht an mich?... Es ist wieder schrecklich heiß bei dir." Sie streifte die Bluse ab. "Wie hältst du es bloß aus in deiner Uniform?"
"Warte einen Augenblick. Lass uns noch ein bisschen reden, Cindy. Du kennst doch den Norden. Was, meinst du, haben die Guerilleros im vorletzten Sommer bei euch gewollt? Weshalb sind sie da gelandet, wo sie keine Unterstützung fanden? Rote gibt es in den Städten, möglicherweise auch im Zuckerrohr, aber nicht bei Maimón oder Estero Hondo."
Cindy sah ihn aus ihren Kastanienaugen an. "Wer sagt dir denn, dass es Rote waren? Du glaubst das, weil es in der Zeitung stand? Oder weil sie aus Cuba gekommen sind? Vor zwei Jahren ist Cuba noch nicht rot gewesen, Juancito. Denk mal darüber nach."
Sie ließ ihn nicht aus dem Blick, lächelte schwach und zog die Strümpfe so langsam von den Beinen, dass es ihm schwer wurde, an seiner Sache festzuhalten. "Es waren gar keine Roten?", fragte er. "Was dann – Liberale? Auf wen wollten die sich bei euch stützen?"
"Es war eine gemischte Mannschaft, genau wie die Karibische Legion vor zwölf und vor vierzehn Jahren", antwortete sie; ihre Stimme klang heiser, dunkel, tiefer als sonst. "Vielleicht mehr Linke als damals, was weiß denn ich. Guck dir doch die Teilnehmer der früheren Expedition an! Wer war siebenundvierzig dabei? Unser Freund Ramírez aus San Juan und Rodriguez, der größte Grundbesitzer von La Vega. Dann Horacio, der Bruder deines verehrten Tirado vom El Caribe. Ein Kurzgeschichten-Autor namens Juan Bosch. Und schließlich der Teufel in Person – Castro selbst, damals allerdings erst Studentenführer... Bei Luperón neunundvierzig ein ähnliches Bild, gemischte Truppe, fast dieselben Gesichter."
"Du weißt gut Bescheid, Cindy."
"Ich höre eben hin, wenn Vater sich unterhält. Es ist doch bei uns passiert." Sie stützte sich auf die Ellenbogen und schnippte mit dem Finger wie eine Schülerin, die die richtige Antwort weiß. "Wenn deine Juni-Leute Hilfe suchten, dann eher nach rechts als nach links."
Tomás nickte benommen. Ein ganz neuer Gesichtspunkt, der einiges veränderte... Plötzlich wurde ihm bewusst, dass Cindy auf ihn wartete. Nur die Brille hatte sie noch nicht abgenommen; nach ihren Spielregeln war das seine Sache. "Jedenfalls suchten sie vergebens." Er knöpfte die Uniformjacke auf. "Sie sind im Stich gelassen worden, man hat sie verraten."
"Wozu so große Worte?" Cindy hob die Schultern, eine Bewegung, die alles Übrige auslöschte. "Angst ist eine viel menschlichere Erklärung..." Ihre Brüste waren zu groß für den schmalen Oberkörper, sie spreizten sich leicht zu den Achseln hin. Unter seiner Berührung richteten sich die Spitzen auf, er küsste sie und spürte, wie sie die Arme um ihn schlang. "Ach, Juancito!" Sie zog ihn zu sich herab. "Wieder nur eine halbe Stunde..."
6
Nachdem Cindy gegangen war, nahm Tomás seine Aufzeichnungen aus dem Dokumentenkoffer. Er hatte entdeckt, dass er nach ihren Besuchen viel konzentrierter war. Sie regte ihn an, ihr Einfluss war unverkennbar. Erstaunlich, er konnte mit ihr alles besprechen, ohne Auswahl und Tabu. Darin lag ein besonderer Reiz dieser heimlichen, rauschhaften Verbindung, die ihm so zerbrechlich schien wie Cindys Arme.
Diesmal aber wollte ihm nichts geraten, und er verstand auch, wieso. Ihre Bemerkung über die Landungsgruppe war schuld. Sie warf neues Licht auf die Affäre, berührte das politische Ziel der Rebellen und damit den Kern seiner Arbeit – widerstrebend gestand er sich den Zusammenhang ein. Kein Umsturzversuch Castro freundlicher Roter, sondern die Aktion einer gemischten Gruppe, die Hilfe von rechts erhofft hatte, von den Grundbesitzern im Norden? Wenn das zutraf, war seine bisherige Darstellung in entscheidenden Punkten falsch, musste falsch sein, da sie auf unrichtigen Voraussetzungen beruhte. Daher also die fehlende Logik, das Unstimmige des militärischen Ablaufs.
Er nahm sich vor, ihre Angaben nachzuprüfen, sobald er zur Schauplatzbesichtigung und zur Befragung der Offiziere in die Provinz Puerto Plata kam. Trotzdem drängte es ihn schon, seinen Text zu korrigieren. Er breitete die Seiten vor sich aus und suchte nach fehlerhaften Passagen. Vielleicht ging es ohne allzu große Änderungen ab? Er hatte sich doch immer da, wo politische Werturteile nötig waren, instinktiv kurz gefasst... Aber nein, es begann gleich am Anfang! Er strich das Adjektiv "linksextremistisch" und ersetzte es durch "wirrköpfig" – eine Bezeichnung, die ihn nicht zufrieden stellte. Das klang zu harmlos, wenn der Feind gemeint war, doch was gab es noch? Anarchisch, umstürzlerisch? Die Wortsuche war eine Qual.
Tomás blätterte um. Er entfernte "eine Castro hörige Gruppe", schrieb "staatsfeindliche Elemente unterschiedlicher Zusammensetzung" und fand das saftlos, verschwommen. Offenbar konnte man nur genau Bekanntes präzise formulieren; er wusste noch zuwenig, das war klar. Dennoch reizte ihn die Verwandlungsarbeit. Er kam sich vor wie ein Zauberkünstler und empfand ein eigentümliches Vergnügen. Was für ein biegsames Instrument war doch die Sprache! Damit ließ sich viel erreichen. Das trickreiche Auswechseln von Wortgruppen – politische Begriffe, an denen ihm nichts lag – würde es ihm erlauben, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Ereignisse in ihrem logischen Ablauf zu schildern.
Auf einmal ließ er den Federhalter los. Er sah eine neue Komplikation, eine unüberwindbare Barriere. Cindys Deutung half ihm, den Ablauf zu verstehen, verhinderte aber jeden Versuch einer Beschreibung: Die Aktion galt als kommunistisches Unternehmen, und er war bis in Einzelheiten der Ausdrucksweise an diese Auffassung gebunden. Wich er von der offiziellen Lesart ab, riskierte er sogar eine Strafanzeige.
Vor sechs Jahren hatte der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das alle öffentlichen Äußerungen, die mit der historischen Wahrheit nicht übereinstimmten, als Geschichtsfälschung unter Strafe stellte. Was aber als wahr zu gelten hatte, darüber befand den Paragraphen nach die Historische Akademie zu Ciudad Trujillo, eben die Behörde, in deren Auftrag er jetzt tätig war.
Tomás schob die Papiere zusammen. Ihn überkam Mutlosigkeit, ein Gefühl der Ohnmacht. Nein, es hatte keinen Zweck. Er war Soldat, kein Magier wie Tirado, der täglich virtuos auf dem straff gespannten Draht der amtlichen Diktion balancierte. Er konnte das nicht. Begriffe wie "Karabiner", "Luftlandung" oder "Division" waren klar, handhabbare Größen, auch wenn ihr Inhalt sich allmählich wandelte mit der Entwicklung des Militärwesens. Aber "linksextremistisch", "Castro hörig", was hieß denn das? Schwankender Boden, den man besser nicht betrat... Und enttäuscht beschloss er, den Auftrag zurückzugeben. Er würde wahrheitsgemäß sagen, dass er kein Stilkünstler und dem hohen Anspruch des Geschichtswerkes nicht gewachsen sei.
In diesem Moment läutete das Telefon. Tomás hob ab und hörte Costas Stimme; er hatte den Leutnant zuletzt gesehen, als der Angelique durch den Wartesaal hinausgeleitete. "Hauptmann", sagte er, "ich bin eben erst aus Bonao zurück. Der Chef hatte mich mit einem Brief zu seinem Bruder geschickt. Ich komme daher erst jetzt dazu, Ihnen zu melden, dass die Señorita das Couvert nicht angenommen hat. Sie hat es sogar abgelehnt, den Zündschlüssel zu nehmen."
"Wo haben Sie den Wagen gelassen?"
"Der Chevrolet steht vor ihrer Tür in der Peña-Straße. Ich hab nicht abgeschlossen und das Couvert ins Handschuhfach getan, falls sie es sich noch überlegt. Es sah aber nicht so aus, Hauptmann; ein schwieriger Fall. Und der Wagen steht da im Parkverbot. Was soll ich tun?"
"Ich kümmere mich selbst darum", sagte Tomás und legte auf. Eine schöne Bescherung! Das Parkverbot war belanglos, warum erwähnte Costa das? Und niemand rührte einen Wagen an, der das Staatswappen trug. Doch dass Angelique sich so benahm, war ein schlechtes Zeichen. Es konnte sogar bedeuten, dass sie die Verabredung nicht einhalten wollte. Was, wenn sie sich morgen nicht im Palast einfand? Es hatte viel Mühe gekostet, dem Chef zu erklären, ein jäher Schwächeanfall – infolge nervöser, freudiger Erregung – habe sie daran gehindert, sich ihm pünktlich vorzustellen. Falls es wieder nicht dazu kam, gab es Skandal! Mit ihr nahm der Ärger kein Ende.
Tomás fuhr nach unten. Die Calle Peña war von seinem Haus nur fünf Minuten entfernt. Hinter dem Edificio Copello bog er links ab und hatte sie schon vor sich. Eine lange, schlecht beleuchtete Altstadtstraße, an beiden Enden in Helligkeit getaucht. Vom Parque de la Independencia lief sie schnurgerade hinab zum Meer. Unten huschten Autolichter in steter Folge über die Avenida Jorge Washington; hinter der Einmündung in den Seeboulevard sah er die Leuchtbake auf der kleinen Mole. Und irgendwo in der Mitte glomm dicht über dem Pflaster trübrot ein Augenpaar – das Hecklicht zweifellos, es hing etwas schief.
Die Calle Peña war menschenleer, so früh am Abend. Wie die meisten Straßen der Innenstadt wurde sie nur in einer Richtung befahren, doch jetzt ruhte der Verkehr. Nach dem Wirbel und Lärm der El Conde fand Tomás die plötzliche Stille sonderbar. Die Calle Peña war sehr schmal, die vergitterten Fenster und kahlen Mauern bedrückten ihn, seine Schritte hallten wider. Ein lästiges Echo, es klebte an den Wänden, und nun begriff er Costas Sorgen. Der Chevrolet stand halb auf dem Trottoir, trotzdem schien er die Fahrbahn zu versperren. Natürlich schritt da kein Polizist ein, man schlug in solchen Fällen einen Bogen; Tomás' Verdruss wuchs, sein Ordnungssinn empörte sich. Seit acht, neun Stunden diese sinnlose Verstopfung!
Es roch nach Seewind und toten Fischen. Hinter der nächsten Ecke stand ein kleines stumpfnasiges Auto ohne Licht, es blockierte die unglaublich enge Seitengasse. Einer der deutschen Volkswagen, die die Seguridad Nacional benutzte. Staatssicherheit, zur Bewachung des Chevrolets? War es deshalb hier so still? Das Auftauchen der Seguridad sprach sich immer schnell herum. Welch übertriebener Aufwand! Eine Kette grotesker Maßnahmen, wegen einer Schürze. Diese Dame rief die Staatsmacht auf den Plan.