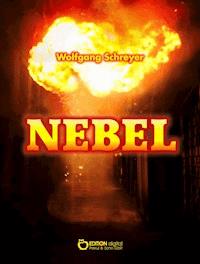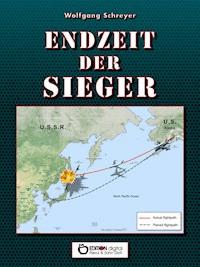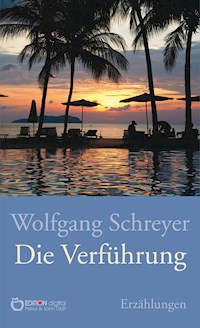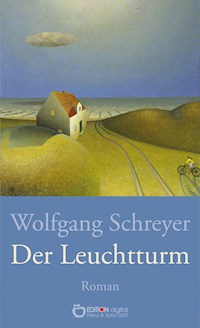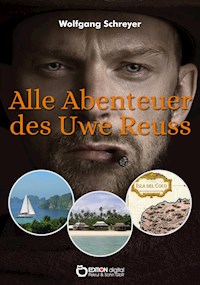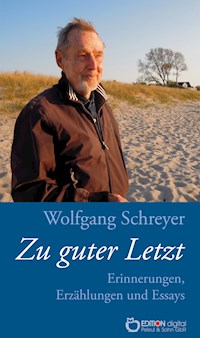
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wolfgang Schreyer, Jahrgang 1927, einer der populärsten Autoren spannender Gegenwartsliteratur in der DDR, legt kurz vor seinem 90. Geburtstag einen Band mit neuen Texten vor. Unter dem Titel „Zu guter Letzt - Erinnerungen, Erzählungen und Essays“ sind fiktive Erzählungen und journalistische Betrachtungen versammelt, etwa zum deutschen Literaturbetrieb, sowie Essays zum Spannungsfeld von Anpassung, Opportunismus und Zensur – damals wie heute. Immer aus der eigenen Biografie schöpfend, schreibt Schreyer so lesbar, geistreich und ironisch, wie seine Leser es von ihm gewohnt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Schreyer
Zu guter Letzt
Erinnerungen, Erzählungen, Essays
ISBN 978-3-96521-460-6 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 2016 im BS Verlag Rostock.
Gestaltung des Titelbildes: Paul Schreyer
2021 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Das Wachs schmilzt
In Hemingways Meisterwerk „Der alte Mann und das Meer“ wehrt der Fischer Santiago schreckliche Haie ab, bis sie ihm noch den letzten Rest seines Fangs entreißen. Er folgt der Losung des Autors: Ein Mann kann vernichtet werden, aber nicht besiegt. Und wenig kümmert ihn sein Hautkrebs; trotz Sonnenschutz hat der ihn befallen durch die UV-Strahlen, gnadenlos reflektiert vom Meer. Gilt diese Krebsart doch als vergleichsweise harmlos; selten nur dringt sie unheilbringend tiefer ein in den Leib.
Das glaubte auch ich, fern des karibischen Lichts beim Wassersport auf Kopfschutz stets verzichtend. Doch im hohen Alter hat sowas seinen Preis. Jene Rostocker Hautärztin, die mir schon ein Geschwür sehr gekonnt von der Stirn geschnitten hatte, fand bald noch eine unklare Neubildung unterhalb des linken Ohrs, von ihr im Fachjargon „Raumforderung“ genannt. Flugs schickte sie mich nach Greifswald zur Hochschul-Medizin, deren Ruf – nicht nur in puncto Gesichtschirurgie – längst bis in die alten Bundesländer gedrungen ist. Stellen doch Studenten von dort heute schon fast die Hälfte aller Neubewerber an jener altehrwürdigen Universität.
Ende April 2015 nahm die mich freundlich auf. Das Klinikum ist modern, für fast jedes Körperteil gibt es ein Extrahaus, hübsch errichtet zwischen Parkplätzen und Grünanlagen, mit komfortablen Zweibettzimmern, in denen man (ohne den üblichen Aufpreis) zuweilen ganz allein liegt. Den Gang davor reinigt ein rollender Roboter – lautlos bis auf seine Stimme, die ab und an koboldhaft vor ihm selber warnt ... Da hätten auch Gangster vom Rang Al Capones oder Lucky Lucianos sich wohlgefühlt und gewusst, man gibt ihnen hier in aller Stille ein neues Gesicht, das keinem Steckbrief des FBI mehr gleicht.
Dies erwägend, wirkte ich im Bett wohl so entspannt, dass die Ankömmlinge betreuende Psychologin mir mein Alter, 87, nicht glauben mochte. Das könne ja auch ein Zahlendreher sein, sagte ich, es müsse wohl 78 heißen. Darauf sah sie, bei mir Demenz vermutend, aufs Krankenblatt: Nein, der Jahrgang sei 1927 wie bei Hans-Dietrich Gentscher und Günter Grass ... „Ja“, ergänzte ich, „auch wie bei Josef Ratzinger – alle vier haben wir einst als Flakhelfer in den Himmel geschossen und Kardinal Ratzinger ist trotzdem Papst geworden!“ Da spürte sie, ich bedurfte keines Zuspruchs mehr und ließ von mir ab.
Nun zog noch ein Mitpatient ein, der, sehr viel jünger als ich, bei den Gebirgsjägern von Bad Reichenhall Stabsfeldwebel gewesen war. Den erwärmte es, wieviel ich über sein Idol wusste, den Weltkriegs-II-Generaloberst Dietl; jenen Helden von Narvik und Petsamo, der, im Juni 1944 verstorben, das Ausscheiden des Waffenbruders Finnland nicht mehr hatte erleben müssen ... Ich gab mich dem Gefährten als Fahnenjunker der traditionsreichen 9. Flakdivision zu erkennen, nahm ihn mit Sätzen im Militärstil („bitte Herrn Stabsfeld Fenster öffenen zu dürfen“) als Vorgesetzten ernst und bedauerte nur die Abwesenheit meines Bruders oder des älteren Sohns – dann nämlich wären hier Veteranen aus drei deuschen Armeen (Wehrmacht, Bundeswehr & Nationale Volksarmee) friedlich vereint gewesen; doch bloß ich hatte da echt Pulver gerochen.
Endlich rollte man mich zwecks Narkose in ein Gemach, das recht optimistisch Aufwachraum hieß. Mit bandagiertem Schädel dann in der Tat wieder erwacht, sagte mein Zimmergefährte, ich hätte im Schlaf gesprochen – was man sonst von mir nicht kennt – und dabei den Satz „Das Wachs schmilzt“ wiederholt. Außerstande, dies zu deuten, fühlte ich die Qual des Nichtbegreifens. Noch nie hab ich mich an Träume exakt erinnern können. Da blieb schon im ersten Moment nur ein verblassendes Bild, wie ein trauriger Ton aus einem alten Lied, doch es gab keine Story.
Tags darauf führte der Professor, der den Tumor entfernt hatte, mich im Rahmen seines Lehrauftrags den meist weiblichen Studenten vor. Erstmals im Leben saß ich in einem Hörsaal unten, als Anschauungsobjekt, dessen präoperativer Kopfinhalt als CT-Film erschien, vom Operateur im Fachlatein erläutert. Zuletzt selber gefragt, wie ich mich nach dem Eingriff denn fühle, sagte ich, schon davor sei Besserung erfolgt. Als nämlich der Chefarzt bei der ersten Visite mit fünf ausgesucht hübschen Studentinnen zu mir gelangt sei, da hätten diese mir der Reihe nach in die Augen geschaut und dabei zart mein Gesicht betastet; das werde einem ab 80 ja kaum noch zuteil, es habe ein Glücksgefühl ausgelöst, also Endorphine heilungsfördernd in mir freigesetzt ... Nunmehr vom Patienten zum Entertainer mutiert, fügte ich, durch das Gelächter bestärkt, noch soviel Erbauliches an, dass der Professor, um sein Programm zu retten, mich bald hinausführen ließ.
Unklar blieb nur, was für ein Wachs da geschmolzen sein mochte. In grübelndem Nichtstun verstrichen sechs Tage. Erst daheim ging mir auf, all meine Keckheit im Klinikum war nichts anderes gewesen als das Pfeifen des Feiglings im dunklen Wald. Und der Quell des Traumgeschehens fand sich nun in einem Buch, verfasst von mir selbst vor 60 Jahren und damals auch verfilmt. Meinem Spaß an frecher Reklame folgend, speziell im Rüstungsgeschäft, hatte ich seinerzeit aus US-Fachzeitschriften Werbetexte geschöpft und sie ziemlich gern im Roman zitiert.
,„Das Wichtigste bei jedem Flug ist die Landung' (Ikaros, Sohn des Daidalos)“, stand da in meiner Übersetzung. „Daidalos war ein Kerl vom Typ ‚Selbst ist der Mann'. Er schnallte ein Paar selbstgestrickte Schwingen um, gefertigt aus Federn und Wachs, und nahm seinen Sohn Icky mit zu 'nem kurzen Hupf. Dies waren Ickys letzte Worte, als das Wachs zu schmelzen begann. Aber an unserem modernen Kampfflugzeug ist nichts Selbstgestricktes mehr! Deltaflüglig und strahlgetrieben stärkt es Amerikas Luftverteidigung.“
Tief hatte sich das eingeprägt, solch schnödes Verwursten von griechischer Mythologie zur Werbung im Kalten Krieg. Kein Wunder, dass mir dies hochkam, als ich selber loszog gegen den ultimativen Feind – nicht Ronald Reagans „Reich des Bösen“, sondern gegen den Sensenmann, der zuletzt doch stets über uns siegt. Denn „herunter kommen wir immer“, wie der Volksmund weiß. Bis dahin aber heißt es Haltung bewahren, und da hilft schon ein Scherz, ein flotter Spruch – gute Laune spornt an.
Sogar zum Wagnis dieses Endbuchs. Nach dem letzten Roman („Der Feind im Haus“) von 2011 war mir nichts mehr geglückt, außer einer Handvoll Storys und Essays, erschienen in Zeitschriften wie Ossietzky oder Risse. Kurze Texte, gern verfasst nach einem Rat des unvergesslichen Stefan Heym: „Mach es möglichst trocken.“ Damit meinte er: Je bizarrer der Einfall, desto penibler die Darstellung, um glaubhaft und lesbar zu sein – das beste Rezept für Realsatire ... Davon nun etwas als Abschiedsgruß an meine Leser, an den treuen Rest?
Doch schon die Titelwahl fiel schwer. Die besten Ideen waren längst anderen gekommen. „Abendlicht“ hieß es bei Stephan Hermlin, „Abspann“ bei Hermann Kant; „Alles schmeckt nach Abschied“ hatte Brigitte Reimann einst geklagt, „Ans Ende kommen“ Dieter Wellershoff, und „Schatten im Paradies“ sah Erich Maria Remarque ganz zuletzt. Wichtig war mir die kleine Silbe letzt – schicksalhaft weist sie hin auf Sinkflug und Landung. Gemäß der üblichen Lebensdauer des deutschen Mannes von mir einst falsch datiert auf die Jahrtausendwende! Frischer Seewind, thermische Rätsel oder gute Pflege haben das Aufsetzen in meinem Fall verzögert.
Aber vielleicht ging: „Mein letztes Wort“? Doch, das konnte passen. Es klang hinreichend entschlossen, mit leisem Anhauch von Ironie, die mir oft geholfen hat. Und wenn das dem Verleger missfiel, so wollte ich ihm Alternativen nennen wie „Letzter Seufzer“, „Endstation“ oder „Nichts geht mehr“, die ihn gewiss noch weniger locken würden. Womöglich einigten wir uns im Gläserklirren schließlich zu Reimen aus meiner Tangerhütter Drogistenzeit, etwa: „Alles hat einmal ein Ende / Nur mein Kräuterschnaps hat keins / Er löscht alle Seelenbrände / Immer trinken wir noch eins“.
Ziemlich nüchtern aber möchte ich nunmehr auf eine Tagebuchnotiz wie diese oder einen journalistischen Text immer etwas Fiktives folgen lassen, also eine reizvoll-rätselhafte Story. Denn das bin ich meinem Ruf als Spannungsautor schuldig, hart erworben dank den reichlich sechs Millionen verkaufter Bücher, welche die Fachwelt mir noch immer freundlich zuschreibt. Und man weiß ja, „Abwechslung ergötzt“, wie es im alten Rom schon hieß.
Das Femme-Syndrom
Mir scheint, Triumph und Fehlschlag liegen oft ganz dicht beieinander. Als Jungarzt indischer Herkunft kannte ich meinen Platz in diesem Land. Der war recht ärmlich, fast ohne Aufstiegschance. Wer Anshu Gani heißt, der ist schon dankbar, wenn ein so feines Haus wie die Jupiter-Klinik an Hamburgs Elbchaussee ihn überhaupt beschäftigt. Mehr als Erfolge am Krankenbett trug mich denn auch die Sympathie des Pflegepersonals. Von meinem Titel Dr. med. Gani leitete es den hübschen Spitznamen „Ganymed“ ab – passend zum Stil der Klinik, die da im Geist antiker Mythen dem bildungsbürgerlichen Anspruch seiner Patienten folgt.
Bekanntlich ist Ganymed bei Ovid ein schöner Jüngling gewesen, der als Mundschenk diente. Und ich wirkte wohl recht liebenswürdig auf all die Nymphen hier, ohne mir viel darauf einzubilden oder ihnen etwa nachzustellen. Dank meines sanften, mitunter leicht zwitterhaften Wesens verstand ich stets Frauen so gut wie die Männer. Das zarte Geschlecht lockte und bremste mich zugleich, als wirke da ein geheimes Tabu. Im Umgang mit Frauen hielt ich manchmal inne, um meine Gefühle zu entwirren. Das spürten sie und nahmen es für Respekt, den ihnen männliche Ärzte oft versagen. Ihr Haupt aber, die Stationsschwester Bernadine, neigte sich mir erst zu, als ich ihr die CD Gentlemen of Swing schenkte, mit dem Titel „Bernadine“, zu einer Big Band festlich gesungen von Pat Boone, dem lonely star of jazz.
Der Tag, der soviel veränderte, fing für uns übel an: mit dem Selbstmord eines depressiven Patienten, den wir ambulant betreuten. Die dringend nötige stationäre Behandlung hatte er verweigert, als seinem Ruf in der Geschäftswelt abträglich. Wir nannten ihn „Neptun“, nach dem römischen Gott des Meeres, weil er im Vorstand seiner Großreederei zu den wichtigsten Wirtschaftsführern der Hansestadt zählte. Folglich trübte sein Tod die Leitungssitzung unserer Chefärzte am Tag nach dem Unglück vom 3. Advent. Um so genau zu sein, wie ihr Deutschen das mögt – es war der 15. Dezember 2014, an dem sich mein Schicksal entschied.
Anfangs folgte das Gremium der Deutung meines Vorgesetzten, des Psychiaters und Neurologen Dr. Anselm Helms. Als den behandelnden Arzt von „Neptun“ nahm er mich mit ins Obergeschoss, wo der elitäre Kreis tagte. Dort führte Helms das tragische Geschehen ganz wesentlich auf den anstehenden Umzug des Konzerns zurück, dessen steuergünstige Verlegung nach Dublin. Das habe „Neptun“ den Rest gegeben: Heim und Familie seien der letzte Halt des Siebzigjährigen gewesen ... Nun ging das Wort an mich, und ich versuchte, Helms' Darstellung taktvoll zu ergänzen. Das jedoch schlug fehl, die Dynamik des Falls riss mich hin. Denn ich wusste aus all den Gesprächen, mein Patient war mehr noch ein Opfer jener Ängste geworden, die derzeit durch viele Chefetagen geistern; nämlich der Furcht vor den Folgen der Frauenquote.
Man wandte sich mir missbilligend zu. Es schien hier unüblich, sich derart abweichend zu äußern. Jeder der Herren hegte wohl das stolze Gefühl, Primus zu sein, der Beste seines Fachs. Eine klassische Arroganz, tief wurzelnd im Status des Klinikums als herausragendem Hort der deutschen, ja der europäischen Medizin. Zumal der Chirurg Dr. Hartmut Beinhorn wirkte, als er mich unterbrach, so grimmig wie einst Marcel Reich-Ranicki, wenn er im Fernsehen einen Roman verriss. Doch unter dem ruhigen Blick des Klinikdirektors Professor Justus Theyssen fasste ich Mut.
Und was ich da vortrug aus meinen Notizen, das schien mir erdrückend. „Dreißig Prozent in der Leitung“, hatte der Verstorbene gestöhnt. „So steht es im Programm der Großen Koalition ... Pure Ideologie als gesellschaftliche Weichenstellung, auf die jetzt alles drängt, ohne Rücksicht auf Verluste beim Sachverstand – solch Schmuck der Statistik wird zum Desaster! Von kompetenten Spitzenfrauen gibt's doch viel zu wenige, wir suchen ja händeringend. Da hievt man dann welche auf Chefsessel, die von außen kommen und den Laden nicht kennen. Diese Damen müssen scheitern – und das trifft uns viel härter als die Entgeltgleichheit von Mann und Frau oder selbst der Mindestlohn. Wir werden wettbewerbsunfähig! Nein, diese elende Quote überleben wir nicht ..." Ich sah hoch von meinem Papier in all die kühlen Mienen und schloss: „Nun, auf ihn selber traf das leider zu.“
Es bezeugt die Spannung, unter der ich stand, dass mir erst jetzt aufging, es war eine reine Männerriege, die mich da stumm umgab. Die leitende Radiologin nämlich, acht Prozent des Gremiums verkörpernd, war schon im Weihnachtsurlaub. Ach, wie nur legt man den Finger in die Wunde des Quotenschocks, wenn der Finger bebt, weil all das ja auch einem selber gilt? Die Ärzte trommelten stumm auf den Tisch, was das Peinliche der Situation noch unterstrich, jetzt hier im eigenen Haus.
„Unsere Kundschaft ist in Not, und zwar landesweit“, fasste Kurt Maybach dies zusammen, der kaufmännische Leiter. Er war als Diplomvolkswirt über McKinsey, Pfizer und Ratiopharm zu uns gelangt und wirkte souverän mit seiner klangvoll tiefen Stimme. „Wir sollten schon versuchen, den Bedrängten beizustehen.“
„Bloß wie?“, fragte Professor Theyssen. „Mir zeigt sich da kein Weg.“
Obwohl hier nur Randfigur, meldete ich mich zu Wort. „Vielleicht, indem wir Topmanagern, soweit sie den Hauch eines weiblichen Elements in sich spüren“, sagte ich halblaut und scheu, „die Chance eröffnen, zum anderen Geschlecht zu konvertieren.“
„Das ist ein Witz, ja?“, schnappte Dr. Schneyder, unser Gynäkologe. Im Zweifel zur Abtreibung neigend, hieß er hausintern wie auch bei seiner Klientel insgeheim Damenschneider. „Und ein mieser dazu!“
„Lassen wir ihn ausreden“, bat Kurt Maybach. „Selbst wenn es verdammt nach Tabubruch klingt.“
„Nun ja, ein winziger Teil unserer Eliten könnte das womöglich in Erwägung ziehen“, räumte Dr. Scharf widerstrebend ein, der Hautarzt. „Aber ein echter Spitzenmann, hochkarätig, führungsstark? Allenfalls doch so ein Weichei ohne Durchschlagskraft.“
Man stimmte ihm zu, jemand rief „es reicht!“, auch fielen Worte wie „Voodoo-Trick“ oder „Zirkusnummer“. Und wiederum sprang Maybach mir bei. „Auch in manchem Alphatyp steckt doch ein ominöser Kern“, hielt er fest. „Erinnern wir uns mal an Edgar Hoover, den Vater des durchaus effektiven amerikanischen FBI. Wie der im Amt stets den Stählernen gab und gnadenlos Feinde jagte, um nachts dann in Schwulenbars zu tanzen, in Frauenkleidern, meine Herren! Wünschen Sie weitere Beispiele? Ich kann gern damit dienen.“
Vor seiner Eloquenz wich man zurück. Ich merkte, wie er Feuer fing. Ihm tat sich da ja ein neues Geschäftsfeld auf! Der Spitzname Reibach hing ihm an, zu Unrecht, sah er sich doch seitens unserer Konzernmutter schwer bedrängt. Ständig wünschte man in Luxemburg, von wo aus der Hippokrates-Kliniktrust über hundert Häuser wacht, schwarze Zahlen von ihm, möglichst hoch. Und er gab, was blieb ihm übrig, den Druck weiter an die Stationen: optimale Auslastung der Betten, unseres medizinischen Geräts und des ärztlichen Potenzials! Ein Topmanager, so hörte ich ihn jetzt sagen, werde sich prinzipiell keiner Idee entziehen, die dem Firmenwohl dient. Das sechsstellige Honorar für unser Haus, dies seien bei den heute üblichen Gagen plus Boni eher Peanuts für ihn.
Die Debatte, hoch emotional geführt, endete erst, als Professor Theyssen sie stoppte. „Wir bringen es in diesem Kreis auch nur auf acht Prozent“, bemerkte er trocken und wandte sich an mich. „Hilfreich wäre gewiss der übliche Selbstversuch des Erfinders. Würden Sie, Herr Gani, denn der Tradition folgen und für sich persönlich soweit gehen wollen?“
Alle starrten mich an; es verschlug mir die Sprache. Doch als ich den Dr. Beinhorn giftig lachen hörte – kurz wie bei einem Kasinowitz –, da entfuhr es mir: „Wenn es der Klinik nützt, durchaus, jederzeit.“
Mein jäher Trotz hatte eine Doppelwirkung, er belustigte die Runde und er überzeugte sie. Erstmals fühlte ich mich ernstgenommen hier im Haus, fast schon als dessen Retter. Denn nun nickte man mir staunend zu!
Und Kurt Maybach besiegelte den Akt mit Aplomb. „Wie wir wissen, ist Jupiter, unser Schutzpatron, der höchste Gott im alten Rom gewesen. Er wachte über die Verträge, den Schwur und das Recht. Er konnte ein fliehendes Heer wieder zum Stehen bringen, also den bedrohten Staat schützen ... Ja, und genau das erwartet man jetzt von uns.“
Er blieb die stärkste Figur am Tisch, ein Vollgasprofi, in seiner Präsenz und Schlagkraft halt der tolle Werbemann, auf den so griffige Slogans zurückgingen wie „Schlank und schön durch Östrogen“. Gemäß seiner Neigung, ins Englische zu gleiten, fiel ihm für die neue Bedrohung das Wort female threat ein; von der Runde abgemildert zu the female factor. Mein Therapievorschlag hieß bei ihm „Tina“: ein Kürzel für There is no alternative ... Dr. Garcia, der Herzspezialist, warb für „la salida“ (der Ausweg). Prof. Theyssen indessen wischte das weg, ihm lag Französisches näher; die neue depressive Störung erklärte er zum lebensbedrohlichen Femme-Syndrom. Das wurde bald auch der amtliche Ausdruck; man findet ihn heute in medizinischen Lexika dicht bei Stichworten wie Fallsucht, Fehlgeburt und Feminismus.
Im Abwärtslift raunte mein Chef mir zu: „Übrigens wundert es mich nicht, dass dies von Ihnen kam.“ Er hatte die Gabe, Unangenehmes zu äußern, ohne grob zu werden. Ich freilich fühlte mich von ihm durchschaut, hatte ich doch von klein auf geahnt, etwas musste anders sein mit mir. Ein richtiger Bengel war ich nie gewesen, hing an keinem Klettertau, Fußball war mir schnurz – mit der Mutter kochen oder häkeln aber schön. Es schien ein Irrtum der Natur, aus mir einen Knaben zu machen; nur mein Glied war männlich, das Gehirn eher einfühlsam, ja weiblich. Dieses kann man nicht ändern, wohl aber den Rest.
Helms allerdings meinte es viel böser, rein beruflich, denn beim Verlassen des Lifts zischte er: „Dem Haus möchten Sie dienen, mein Lieber? Mehr doch wohl sich selbst!“
Gut, dass ich ihm nicht widersprach, damals im Dezember 2014. Denn schließlich hat er recht behalten. Heute stehe ich als Oberärztin Anja Gani an seinem Platz, zugunsten der Statistik und glücklich als Frau. Da erfreut mich der wunderbare Frank Sinatra, wenn er singt: What a difference a day makes, twentyfour little hours ... Und ich genieße es, mit Bernadine shoppen zu gehen, sie berät mich beim Einkauf, ob nun von Schuhen oder von Haarfarbe in der Drogerie. Ja, wir mögen es, uns gegenseitig herauszuputzen. Mein Gehalt hat sich verdreifacht, mit dem flinken Geschlechtswechsel hab ich überhaupt kein Problem – und vergesse nie, all das verdanke ich dem heilsamen Schock des jüngsten Kulturwandels, kurzum: der Quote.
Drei Mann in einem Boot?
Anfang der 90er Jahre traf ich auf der Leipziger Buchmesse meinen gleichaltrigen Kollegen Harry Thürk. Dank der drei bis vier Millionen Bücher, die es auf Deutsch von jedem gab, galten wir als zwei der erfolgreichsten DDR-Autoren und schätzten einander seit unseren Kriegsbüchern, erschienen 1954 und 1958; auch hatten wir in Prag wie in Moskau denselben Übersetzer. Thürks „Stunde der toten Augen“ hatte ich gegen Kritiker verteidigt, die ihm vorwarfen, er neige zu Hemingways harter Schreibweise, dem „hard boiled style“. Ohne befreundet zu sein, blieb unser Umgang stets entspannt. Seine Stoffe lagen in Fernost, war er doch von 1956-58 Redakteur in Peking gewesen und sprach sogar chinesisch; mich hatte es eher in die Karibik oder in die USA gelockt.
Und nun klagte er mir, der SPIEGEL habe ihn jüngst zum „Konsalik des Ostens“ erklärt. Dieses Los teilte ich mit ihm, genau dasselbe war mir passiert. Bald nach dem Mauerfall hatte ein SPIEGEL-Reporter namens Matussek unsere Kulturszene durchforscht und dabei nicht nur u. a. das Theater in Anklam geschmäht, sondern auch mich, und zwar als „Konsalik der SED“. Welch ein Etikett! „Simmel der DDR“, das hätte mir noch gepasst; stand ich doch mit dem drei Jahre älteren Wiener Johannes Mario Simmel längst in Gedanken- und Bücheraustausch. Aber Konsalik – mit ihm in einem Boot?
Ach, das wurmte uns, obwohl wir von Konsaliks Texten kein Wort kannten – nur die Urteile dazu in Literaturzeitschriften und Fachlexika. Das Schriftsteller-Lexikon des Bibliogaphischen Instituts Leipzig von 1988 etwa ignorierte ihn gänzlich. Während es den Erfolgsautor Hans Helmut Kirst („08/15 in der Kaserne“) noch halbwegs gelten ließ, schwieg es Heinz G. Konsalik einfach tot. Die 1972er Ausgabe desselben Werks hatte ihn zwar noch erwähnt, doch unter das Stichwort „Dwinger, Edwin Erich“ verbannt, zusammen mit jenen Verfassern „antibolschewistischer Machwerke“, die, wie es dort hieß, „von reaktionären westdeutschen Kreisen stark geförderte „literarische Bewältigung der deutschen Vergangenheit“ betrieben. So schrecke Konsaliks Roman „Der Arzt von Stalingrad“ (2 Millionen Stück seit 1958, auch verfilmt) vor keiner Verzerrung der Tatsachen zurück.
Und weiter teilte das Lexikon mit: „H. G. Konsalik (eigtl. Autorenteam unter der Leitung von Heinz Günther, dem noch Benno von Marroth und Günter Hein angehören)“ stehe Leuten wie Josef Martin Bauer nahe, dessen Roman „So weit die Füße tragen“ selbst westdeutsche Blätter als Propaganda gegen Russland empfunden hätten: „Eine von Primitivität wie Verleumdungen strotzende Schilderung der Flucht eines deutschen Kriegsverbrechers aus einem Gefangenenlager am sibirischen Ostkap; das Buch wurde bereits dreimal als mehrteiliger Fernsehfilm gesendet.“
Derweil habe Konsalik „sich zu einem der massenwirksamsten Schriftsteller in Westdeutschland entwickelt.“ All seine Bestseller, „meist in faschistischem Frontjargon“, seien „gemeingefährlicher Kitsch, der dem Leser einträufeln soll, wie tüchtig und unbesiegbar die Deutschen wären und dass der Krieg ein mystisches Geschehen sei ...“ Ja, damit stand Konsalik exakt in der Tradition Dwingers, dessen Trilogie „Die deutsche Passion“ in gut zwei Millionen Exemplaren verbreitet war. Den Endband „Zwischen Weiß und Rot“ kannte ich aus dem Bücherschrank meiner Eltern.
Dies im Sinn, fanden wir am Messestand des Heyne Verlags, zum 70. Geburtstag Konsaliks präsentiert, „seine zwölf besten Romane als Jubiläumsausgabe“ – schmucke Taschenbücher zum Aktionspreis von 8 DM. Thürk schlug eins davon auf, es hieß „Alarm! Das Weiberschiff“ und spielte auf einem Atom-U-Boot der USA, das nach endloser Tauchfahrt im Eismeer fünf hübsche Mädchen halberfroren rettet ... Zwecks Heilung muss man sie flink entkleiden. – „Welch ein Weib“, las mir Thürk vor, „mit hohen Brüsten, schlanken Hüften, langen Beinen und einem braunen Kräuselpelz zwischen den Schenkeln. Und diese ganze verdammte Schönheit ging vor ihm her, mit zuckenden Hinterbacken und sanft schwingenden Brustwarzen ...“
„Faszinierend banal“, sagte ich; „aber Millionen fliegen darauf.“
„Und so viele Fliegen können sich nicht irren“, ätzte er. Ja, wir waren sauer auf Konsalik, weil Vielschreiber wie er es mit ihren kapitalstarken Verlegern schafften, uns aus dem Buchmarkt zu drängen, der jetzt täglich 250 Titel neu anbot; vor dem Mauerfall waren es hier nur zwei Dutzend gewesen.
Bevor Harry Thürk, an den Spätfolgen des über Vietnam versprühten US-Entlaubungsgifts leidend, Ende November 2005 verstarb, sechs Jahre nach Heinz G. Konsalik, wies er mich noch auf dessen Roman „Manöver im Herbst“ hin. Schon das Motto ließ aufmerken. „Allen Deutschen“, hieß es da, „die aus zwei Weltkriegen, zwei Geldentwertungen, zwei totalen Zusammenbrüchen und über 50 Millionen Kriegstoten noch nichts gelernt haben, mit Beklemmung gewidmet“.
Das Buch schildert den Lebenslauf eines Berufssoldaten von 1913 bis in die Ära Adenauer. Der Held bringt es vom kaiserlichen Fähnrich bis zum Oberstleutnant der großdeutschen Wehrmacht; zuletzt ist er Textillieferant der Bundeswehr. Restlos karrierefixiert, bewahrt er starr die apolitisch staatstreue rein militärische Haltung. Mir bewies dieser Text, der Mann konnte schreiben, und er war schon früh über jene deutschnationale Sicht hinausgelangt, die er mit Dwinger und dessen Epigonen doch zu teilen schien.
Rätselhaft? Heute findet man bei Google dazu, der Roman habe ein „vergleichsweise geringes Publikumsinteresse gefunden“ und sich „bisher am schlechtesten verkauft. Schon ein Vorabdruck, der 1960/61 in der ‚Frankfurter Illustrierten' erschienen war, sei – so Konsalik – hinter den Auflagenerwartungen zurückgeblieben.“ Das Buch nehme im Gesamtwerk eine Sonderstellung ein, inhaltlich wie auch stilistisch. „Erst die allgemeine ‚Konsalik-Welle', die 1978/79 einsetzte, trieb auch die Auflage dieses Romans bis Ende 1984 auf über 400.000 Exemplare.“
Bei Wikipedia erfährt man, Konsalik – der eigentlich Heinz Günther hieß – „sage über seine zur Trivialliteratur zählenden Werke selbst: ,Ich schreibe nur für meine Leser, ich bin Volksschriftsteller' ... Ab 1939 war er bei der Gestapo tätig. Im Zweiten Weltkrieg wurde er dann Kriegsberichterstatter in Frankreich und kam als Soldat später an die Ostfront, wo er in Russland schwer verwundet wurde.“ Als kommerziell erfolgreichster deutscher Autor veröffentlichte er bis zu seinem Tode fast 160 Romane mit einer Gesamtauflage von über 80 Millionen Exemplaren.