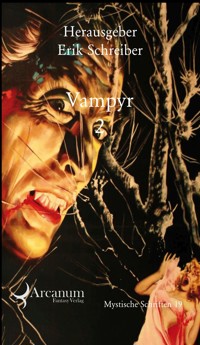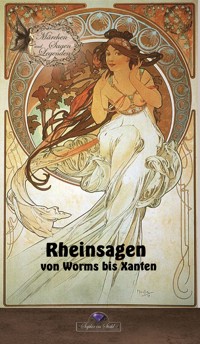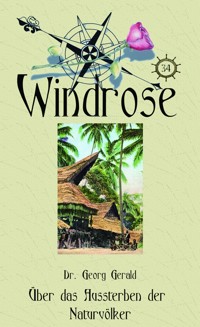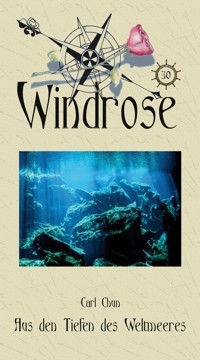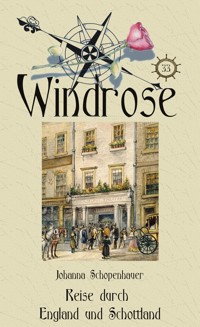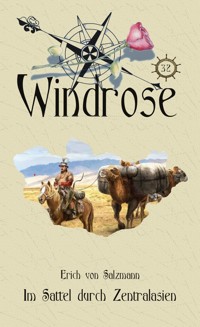4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Märchen Sagen und Legenden
- Sprache: Deutsch
China, abgeleitet aus dem Namen der Ch'in-Dynastie, heißt in der Eigenbezeichnung Chung-kuo, was das "Reich der Mitte" bedeutet. Es umfasste ein Territorium in der Größe Europas und seine Geschichte ist geprägt durch unablässige Kämpfe um die Vorherrschaft der einzelnen Regionen. Zum ersten Mal wurde es unter Shih Huang-ti aus der Ch'in-Dynastie im 3. Jahrhundert. v. Chr. geeint. Zur dauerhaften Reichseinigung kam es unter der Han-Dynastie. Das damals geschaffene zentral gesteuerte Regierungssystem mit einem Kaiser an der Spitze und verwaltet von einer mit Zivilbeamten besetzen Bürokratie hielt sich bis zum Jahr 1912.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Chinesische Geister- und Liebesgeschichten
Saphir im Stahl
Märchen Sagen und Legenden 21
e-book: 248
Titel: Chinesische Märchen 3
Chinesische Geister- und Liebesgeschichten
Erscheinungstermin: 01.07.2024
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Simon Faulhaber
Lektorat: Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Märchen Sagen und Legenden
Chinesische Geister- und Liebesgeschichten
Saphir im Stahl
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Wandbild
Der Richter
Das lachende Mädchen
Die Füchsin
Die Wege des Liebenden
Die Krähen
Die Blumenfrauen
Der närrische Student
Der Gott im Exil
Das Land im Meer
Das Blätterkleid
Der Ärmel des Priesters
Der Traum
Musik
Die Schwestern
Wiedergeburt
Vorwort
Bei meinen Studien über die Dämonen-Mythen lernte ich, zuerst durch Übersetzungen, sodann durch die freundliche Unterweisung des Herrn Chingdao Wang, die chinesischen Sammlungen von Geistergeschichten und insbesondere das klassische Liao Tschai Tschih Yi kennen. Etwas zog mich an ihnen an, was Erzählungen dieser Gattung bei keinem andern Volke in gleichem Maße besitzen: die Atmosphäre von Vertrautheit und Übereinstimmung. Dämonen werden hier von Menschen, Menschen von Dämonen geliebt und besessen; aber die so zu uns kommen und um uns werben oder uns erfassen, sind nicht Incubus und Succubus mit dem schwankenden Grauen der Jenseitigkeit in ihrer Gegenwart, sondern Wesen unseres Weltkreises, nur in einer tieferen, dunkleren Schicht geboren. Den Berichten keltischer Bauern über ihre Begegnungen mit den Gespenstern sind die chinesischen Geschichten an Bildsicherheit und Richtigkeit der Rede verwandt; aber hier redet nicht die Mystik eines helläugigen Grauens, sondern die Magie des Selbstverständlichen. Die Ordnung der Natur wird hier nicht durchbrochen, sondern erweitert; nirgends stockt die Fülle des Lebendigen, und alles Lebendige trägt den Samen des Geistes.
Nicht allein in Tieren, Pflanzen und Gestein erblüht das Dämonische und will sich zur Menschengestalt wie zu einer Frucht verdichten: Was deine Hand verfertigt hat, begehrt zu atmen und sich Atmendem zu vermählen; was dein Sinn erdacht hat, regt und reckt sich als ein Wirkliches in die Sichtbarkeit hinein; jede Tat kann dir einen Dämon zeugen, der als dein Freund, als deine Gattin, als dein Sohn in dein Haus tritt und dir vergilt. Aber all dies ist nicht unheimlich; es ist das Heim, es ist das Leben.
Dieses Volk, in dem Laotses Lehre von der allumfangenden Bahn und Buddhas Lehre von der allbewirkenden Tat beieinander, ja miteinander wohnen, hat in seinen Geistergeschichten ein Lied der verschwisterten und verliebten Elemente ersonnen, ein Lied für Götter und Menschen.
Das chinesische Volk war es, das die im Liao Tschai vereinigten Geistergeschichten ersonnen hat. Gedichtet hat sie Pu Ssung-ling, von seinen Freunden Liu-hsien, „der Letzte der UnsterbIichen“ genannt, der im siebzehnten Jahrhundert lebte und um 1680 sein Werk vollendete. Von seinem Leben wissen wir nicht viel mehr als dies, dass er bei den offiziellen Prüfungen kein Glück hatte und dass ihm daher die Laufbahn des Staatsbeamten verschlossen blieb; dies war, wenn wir dem Chronisten glauben dürfen, die Ursache, dass er sich dem Niederschreiben von Erzählungen zuwandte. Er selbst hat in einer Vorrede seines Buches, die er nahezu sechzigjährig verfasste, keine Begebenheiten, nur die Schwere und Schwermut seines Lebens mitgeteilt.
„In meiner Jugend war ich mager und andauernd kränklich, unfähig mich durchzusetzen. Unser Haus war kalt und öde wie ein Kloster; und dort, mit meiner Feder pflügend, war ich arm wie ein Mönch mit seiner Bettelschale.“
Das Ungeschick und die Traurigkeit sind auch alle späteren Jahre über bei ihm geblieben. „Ich bin hin und her geschleudert worden, nach der Richtung des Windes, einer Blume gleich, die in den Kot fällt. Aber die sechs Pfade der Wanderung sind fürwahr unerforschlich, und ich habe kein Recht zu klagen. Gleichviel: Die Mitternacht betrifft mich bei der erlöschenden Lampe, dieweil der Sturm seine traurige Weise pfeift; und auf meinem freudlosen Tisch flicke ich meine Geschichten zusammen.“
Seine Geschichten sind in der gleichen Art entstanden wie alle große Märchendichtung: dass er die Erzählungen der Leute in seinem Herzen sammelte und sie aus seinem Herzen neu erzählte.
Wo es anging, suchte er Aufzeichnungen der Erzähler über das berichtete Ereignis zu erhalten, obgleich er, wie die einheitliche Sprache seines Buches — die heute in China allgemein mehr als die irgendeines andern modernen Prosawerks bewundert wird — beweist, nirgends einen unmittelbaren Gebrauch davon gemacht hat. „Ich bin“, sagt er, „von dem Geiste Ssu Tung-pos getrieben, der zu lauschen liebte, wenn einer von dem Wunderbaren erzählte. Ich veranlasse die Leute niederzuschreiben, was sie mir sagen, und dann mache ich eine Geschichte daraus. So haben mir im Lauf der Zeit meine Freunde aus allen Gegenden vielen Stoff herbeigebracht, und bei meiner Liebe zum Sammeln ist ein großer Haufen daraus geworden.“ Das Buch zirkulierte lange in der Handschrift, da Pu Ssung-ling die beträchtlichen Kosten der Veröffentlichung nicht tragen konnte; erst 1740 wurde es von seinem Enkel herausgegeben. An Wirkung und Anerkennung scheint der Dichter zeitlebens nicht viel erfahren zu haben. Am Schlusse seiner Aufzeichnungen heißt es:
„Ach, ich bin nur der Vogel, den es vor dem Winterfrost graut und der in den Zweigen keine Zuflucht findet; die Herbstgrille, die den Mond anzirpt und sich an die Tür schmiegt, um ein wenig Wärme zu erhaschen. Denn wo sind sie, die mich kennen?“
*
Der Titel des Buches möchte deutsch etwa durch „Merkwürdige Mitteilungen aus der Arbeitsstube „Zuflucht'“ wiedergegeben werden. Das sind die ungefähr vierhundert Geschichten in der Tat: merkwürdige Mitteilungen. Sie berichten von allen seltsamen und wunderlichen Dingen, von den Mären der Wanderer und den Träumen der Einsamen: von singenden Fröschen und schauspielernden Mäusen, von Seeschlangen und Riesenvögeln, von Schneefall im Sommer, von Überschwemmungen und Erdbeben, von absonderlichen Krankheiten und ungewöhnlichen Todesarten, von Reisen in das Land der Menschenfresser und in das Land, wo Schönheit für Hässlichkeit und Hässlichkeit für Schönheit gilt, von Erlebnissen in der Unterwelt, von Scheintoten und von Auferstandenen, von allerlei Zauberkünsten, von vergrabenen Schätzen, von Goldmachern, von Weissagungen, von Wahrträumen; dazwischen fehlt es nicht an Satiren: auf parteiische Beamte, auf ungerechte Examinatoren, auf unwissende Ärzte, auf verlogene Priester — oft in der Form, dass die sozialen Verhältnisse der Unterwelt geschildert werden, die denen des Menschenreiches ganz ähnlich sind. Die zahlreichsten und bedeutendsten aber sind die Geschichten von Geistern: von Tiergeistern, von Pflanzengeistern, von Wassergeistern, von Wolkengeistern, von Geistern, die in den Augen, und von Geistern, die in einem Bilde wohnen, von abgeschiedenen Geistern, von Geistern aller Art, und von ihrer mannigfachen Relation zu Menschen, vor allem von den Gefahren und den Beglückungen ihrer Liebe zu Menschen. Denn sie alle suchen den Menschen: um mit ihm zu spielen wie mit einem Spielzeug oder um mit ihm zu spielen wie mit einem Freunde, um ihn zu strafen oder um ihn zu belehren, um mit ihm zu zechen oder um mit ihm zu arbeiten, um ihm zu helfen oder um von ihm Hilfe zu erhalten, um ihm eine Liebe zu geben, die ihm kein Wesen seiner eignen Art gewähren kann, und um in seiner Liebe ein Leben zu empfangen, das ihnen einzig durch die Gemeinschaft mit einem Menschen zugänglich ist. Dem Menschen ist diese Liebe zuweilen bedrohend, oft nur beseligend; dem Dämon ist sie stets die Erfüllung.
Einen besonderen Rang nehmen die Fuchsgeister ein, die in vielerlei Gestalt erscheinen, zumeist aber in der eines schönen Mädchens, das sich einem Manne nähert, seine Liebe gewinnt, ihm Kinder gebiert, sein Haus verwaltet und in diesem Zusammensein eine zugleich festere und lichtere Form der Existenz erwirbt. Man hat diese seltsame Bevorzugung des Fuchses unter anderem darauf zurückgeführt, dass er, wenn er im Winter einen zugefrorenen Fluss oder See überschreitet, den Kopf immer wieder ans Eis hält und auf das darunter fließende Wasser horcht. So verbindet er gleichsam das Reich unter dem Eise, den Bezirk des Yin, der weiblichen dunklen Urgewalt, mit der hellen Welt des Yang, des männlichen und tätigen Elements.
Einzelne Erzählungen aus dem Liao Tschai sind in europäische Sprachen übertragen worden. Eine reichhaltige Auswahl gab Herbert A. Giles heraus (Strange Stories from a Chinese Studio, neue Auflage London 1909); leider hat er nach englischer Art alle Stellen, die ihm anstößig schienen, weggelassen oder paraphrasiert. Ich habe mit Hilfe des Herrn Wang (Herr Gustav Gast hatte die Freundlichkeit, mir ein paar von ihm und einem Chinesen hergestellte Übertragungen zur Verfügung zu stellen, die ich verglichen, aber nicht benützt habe.) mehrere in Giles' Buch enthaltene Geschichten vollständig und getreu wiedergegeben, und ebenso einige bisher unübersetzte. Ausgewählt habe ich, außer etlichen, die ich aus anderen Gründen nicht vermissen wollte, die schönsten und merkwürdigsten Erzählungen von der Liebe zwischen Menschen und Dämonen.
Martin Buber
Das Wandbild
Meng Lung-tan, ein Bürger von Kiang-si, wohnte in der Hauptstadt bei einem Kü-jen (Magister) namens Tschu. Eines Tages führte sie beide der Zufall in einen Tempel, in dem sie weder weite Hallen noch Zellen der Betrachtung fanden, und nur einen alten Priester in nachlässiger Gewandung. Als er die Besucher erblickte, ordnete er seine Kleider und ging den Kommenden entgegen, führte sie sodann umher und zeigte ihnen die Standbilder der Unsterblichen. Die Wände zu beiden Seiten waren mit lebensähnlichen Bildern von Menschen und Tieren schön ausgemalt. An der Ostwand war eine Schar von Feen dargestellt, unter denen ein Mädchen stand, dessen Jungfrauenlocken noch nicht in den Matronenknoten verschlungen waren. Es pflückte Blumen und lächelte, seine Kirschenlippen schienen sich bewegen, das Feuchte seiner Augen überfließen zu wollen. Herr Tschu schaute sie eine gute Weile an, ohne den Blick abwenden zu können, bis ihm alle Dinge außer dem Bilde, das ihn umfing, entschwanden. Da fand er sich plötzlich in der Luft schwebend, als ritte er auf einer Wolke, und es geschah ihm, dass er durch die Wand kam und in einem Räume war, wo Hallen und Gezelte von anderer Art als die Wohnungen Sterblicher sich aneinanderreihten. Hier predigte ein alter Priester Buddhas Gesetz, und eine dichte Menge von Hörern umgab ihn. Herr Tschu mischte sich unter die Menge. Nach einigen Augenblicken nahm er eine sanfte Berührung an seinem Ärmel wahr. Sich umwendend, sah er das vorher betrachtete Mädchen, wie es lachend von dannen ging. Herr Tschu folgte ihr sogleich und kam, der Windung eines Geländers folgend, in ein kleines Gemach, in das er sich nicht einzutreten getraute. Aber die junge Dame blickte sich um und schwang die Blumen, die sie in der Hand hatte, ihm zu, als winke sie ihm weiterzugehen. So trat er ein und fand sonst niemand darin. Sogleich umarmte er sie, die sich ihm nicht verwehrte.
Sie hatten etliche Tage zusammengelebt, als die Gefährtinnen des Mädchens Verdacht schöpften und Herrn Tschus Versteck entdeckten. Da lachten sie alle und sagten scherzend: „Meine Liebe, nun wirst du wohl bald Mutter werden, und da willst du das Haar noch wie die Jungfrauen tragen?“
Sie brachten ihr die geziemenden Nadeln und den Kopfschmuck und hießen sie ihr Haar aufbinden, wobei sie sehr errötete, aber nichts sagte. Dann rief eine von ihnen: „Schwestern, wir wollen gehen. Sonst könnten wir den beiden lästig werden.“ Da kicherten sie wieder und liefen davon.
Herr Tschu fand, dass seine Freundin durch die veränderte Haartracht noch schöner geworden war. Der hohe Knoten und das krönende Gehänge standen ihr wohl zu Gesicht. Er nahm sie in seine Arme, liebkoste sie und trank ihren süßen Duft. Während sie nun in inniger Gemeinschaft beieinander waren und die Lust sie wie eine Ewigkeit umfing, erscholl plötzlich ein Geräusch wie das Stampfen schwersohliger Stiefel, begleitet von Kettenklirren und dem Lärm einer zornigen Rede. Die junge Frau sprang erschrocken auf, und sie und Herr Tschu lugten hinaus. Sie erblickten einen Herold in goldener Rüstung, mit pechschwarzem Gesicht, der Ketten und einen Hammer in den Händen trug und von allen Mädchen umgeben war. Er fragte: „Seid ihr alle hier? “
„Alle“, erwiderten sie.“
„Wenn ein Mensch“, sagte er, „hier verborgen ist, entdeckt es mir sogleich, dass es euch hernach nicht gereue.“ Sie antworteten wie zuvor, es sei keiner da. Der Herold machte nun eine Bewegung, als wolle er den Ort durchsuchen. Das Mädchen stand da, tief verwirrt, mit aschfahlen Wangen. In ihrem Entsetzen hieß sie Herrn Tschu sich unter dem Bette verbergen. Sie selbst aber verschwand durch eine kleine Gittertür. Herr Tschu in seinem Versteck wagte kaum zu atmen.
Nach einem Weilchen hörte er die Stiefel in die Stube und wieder hinaus trampeln, der Schall der Stimmen wurde allmählich ferner und schwächer. Das beruhigte ihn ein wenige, aber immer noch hörte er Laute von Wiesen, die draußen auf- und niedergingen und nachdem er eine lange Zeit in seiner eingeklemmten Lage zugebracht hatte, begann es ihm in den Ohren zu sausen, als sei eine Grille darin, und seine Augen brannten wie Feuer. Es war fast unerträglich; dennoch verhielt er sich ruhig und w^artete auf die Rückkehr des Mädchens, ohne an Ursache und Zweck seines gegenwärtigen Schicksals zu denken.
Indessen hatte Meng Lung-tan das Verschwinden seines Freundes bemerkt. Er dachte sogleich, es müsse ihm etwas zugestoßen sein, und fragte den Priester, wo er sei. „Er ist die Predigt des Gesetzes hören gegangen“, erwiderte der Priester.
„Wohin?“, fragte Herr Meng.
„Oh, nicht sehr weit fort“, war die Antwort. Darauf klopfte der alte Priester mit dem Finger an die Wand und rief: „Freund Tschu! Wie kommt es, dass Sie so lange ausbleiben?“ Da war die Gestalt des Herrn Tschu auf der Wand dargestellt, das Ohr geneigt in der Haltung eines Lauschenden. Der Priester fügte hinzu: „Ihr Gefährte hat einige Zeit auf Sie gewartet.“
Sogleich stieg Herr Tschu von der Wand herab und stand wie durchbohrt, mit starrenden Augen und zitternden Beinen. Herr Meng war sehr erschrocken, fragte ihn jedoch ruhig, was geschehen sei. Es war aber dies geschehen, dass er, während er unter dem Bett versteckt lag, einen donnergleichen Hall vernommen hatte und hinausgestürzt war, um zu sehen, was es sei.
Jetzt bemerkten sie alle, dass das junge Mädchen auf dem Bilde die Haartracht einer verheirateten Frau angenommen hatte. Herr Tschu war darüber sehr verwundert und fragte den alten Priester nach der Ursache. Der antwortete:
„Gesichte haben ihren Ursprung in denen, die sie sehen. Welche Erklärung kann ich da geben?“
Diese Antwort war für Herrn Tschu sehr wenig befriedigend und auch sein Freund, der einige Beängstigung empfand, wusste nicht, wie er sich all das zurechtdeuten sollte. Sie stiegen die Stufen des Tempels hinab und gingen von dannen.
Der Richter
In Ling-yang lebte ein Mann namens Tschu Erhtan, den seine Freunde Hsiao-ming nannten. Er war ein stattlicher und kühner Bursche, aber am Geiste beschränkt, und obgleich er sich rechtschaffen mühte, etwas zu lernen, hatte er noch keinen Grad erlangt. Als er eines Tages mit seinen Studiengefährten zechte, sagte einer von ihnen scherzend zu ihm: „Alle Welt redet von deinem großen Mut. Wohl denn, wenn du jetzt in der Nacht in das Qualengemach des Tempels gehst und uns den Höllenrichter der linken Vorhalle bringst, wollen wir dir ein Festmahl geben.“
Es war nämlich im Stadttempel zu Ling-yang eine Darstellung der zehn Höfe des unterirdischen Gerichts mit allen Göttern und Dämonen, die aus Holz geschnitzt waren und dem ersten Blick lebendig erschienen. In der östlichen Halle stand das lebensgroße Bild eines Richters mit grünem Gesicht, rotem Bart und einem grauenvollen Ausdruck. Zuweilen hörte man in der Nacht aus beiden Hallen den Schall der Geißelung und des Verhörs, dass sich dem Vorübergehenden die Haare sträubten. Deshalb meinten die jungen Leute, das würde für Herrn Tschu eine schlimme Aufgabe sein. Er aber lächelte, erhob sich von seinem Sitze und ging geradenwegs in den Tempel. Nach wenigen Augenblicken hörten sie ihn draußen rufen: „Hier habe ich den Herrn Rotbart mitgebracht!“ Sie standen auf, und herein kam Tschu, auf seinem Rücken das Bildwerk, das er auf dem Tische aufstellte.
Sodann goss er dreimal seinen Becher vor ihm aus. Seine Gefährten sahen ihm zu, eine Furcht wandelte sie an und sie wagten nicht, sich wieder hinzusetzen; zuletzt baten sie Tschu, den Richter wieder zurückzutragen. Er aber goss noch einmal Wein zur Erde und sprach das Bild mit diesen Worten an: „Ich bin ein tollköpfiger, unwissender Kerl! Möge der Herr Lehrer es mir nicht zum Bösen anrechnen! Mein armes Haus ist in der Nähe, und so oft Sie Lust dazu verspüren, sind Sie eingeladen, mit mir ein Glas Wein in Wohlwollen zu trinken.“ Sodann trug er den Richter wieder an seinen Ort.
Am nächsten Tage gaben ihm die Freunde das versprochene Festmahl, von dem er halbberauscht heimkehrte. Da er aber fand, er habe noch nicht genug zur vollen Heiterkeit getrunken, entzündete er die Lampe und goss sich einen neuen Becher voll. Plötzlich teilte sich der Bambusvorhang und der Richter trat ein. Tschu stand auf und rief: „Wehe mir! Ich werde sterben! Ich habe Sie gestern beleidigt, und nun sind Sie gekommen, um mir den Kopf abzuhauen.“
Der Richter strich seinen Bart, lächelte und sagte: „Durchaus nicht. Sie haben mich gestern freundlich eingeladen, Sie zu besuchen; und da ich an diesem Abend einige Muße habe, bin ich gekommen.“
Tschu war sehr erfreut, das zu hören, und bat den Gast, sich zu setzen; dann machte er selbst das Geschirr zurecht und ging daran, den Wein zu wärmen. (Man trinkt in China den Wein mit Vorliebe gewärmt und in Tassen.)
„Die Luft ist warm“, sagte der Richter, „wir wollen den Wein kalt trinken.“
Tschu gehorchte, setzte die Flasche auf den Tisch und ging hinaus, um seinen Dienern zu befehlen, ein Mahl zu rüsten. Seine Frau war sehr bestürzt, als sie hörte, wer der Besucher war, und bat Tschu, nicht zurückzugehen; er aber wartete nur, bis die Speisen bereit waren, und trug sie in sein Zimmer. Nun tranken sie, ein jeder aus dem Glase des andern, und nach einiger Zeit fragte Tschu nach dem Namen seines Gastes. Der Richter antwortete:
„Lu ist mein Familienname, einen anderen habe ich nicht.“ Danach unterhielten sie sich über Gegenstände des Schrifttums; was immer Tschu zu wissen begehrte, der Richter gab ihm den Bescheid. Dann fragte der Gast, ob Tschu Verständnis für Verse habe, worauf dieser erwiderte, er könne zur Not das Gute vom Schlechten unterscheiden; nun trug der Richter ein kleines Poem aus der Unterwelt vor, das denen der Sterblichen nicht unähnlich schien. Er war ein wackerer Zecher und trank zehn Becher in einer Folge. Tschu aber, der schon den ganzen Tag beim Wein verbracht hatte, schlief bald ein, den Kopf auf den Tisch gelehnt. Als er erwachte, flackerte die Lampe im Verlöschen, der Morgen dämmerte, und sein Gast war nicht mehr da.
Von dieser Zeit an besuchte ihn der Richter alle zwei, drei Tage, und bald wuchs zwischen ihnen eine innige Freundschaft auf. Oft brachte jener die Nacht auf Tschus Lager zu. Tschu zeigte ihm die Aufsätze, die er verfasst hatte, und der Richter strich kreuz und quer die Fehler an und rügte die Arbeit. Eines Nachts fühlte sich Tschu bald müde vom Trinken und ging zuerst zu Bette; der Richter trank allein weiter. In seinem trunkenen Schlafe war es Tschu, als spüre er einen Schmerz in seinem Leibe. Erwachend bemerkte er, dass der Richter, der am Bette saß, ihm die Brust geöffnet hatte und damit beschäftigt war, seine Eingeweide herauszunehmen und zu ordnen.
„Es war doch keine Feindschaft zwischen uns“, rief Tschu, „warum wollen Sie mich töten?“
„Fürchten Sie nichts“, antwortete der Richter lachend; „ich bin nur dabei, Ihr Herz gegen ein klügeres umzutauschen.“ Er tat nun in Ruhe die Eingeweide wieder an ihren Platz, schloss die Öffnung und legte ihr einen engen Verband auf. Auf dem Bett war kein Blut, und Tschu fühlte nichts anderes als eine leichte Erstarrung in seinem Leibe. Nun sah er, wie der Richter ein Stück Fleisch auf den Tisch legte, und fragte ihn, was das sei.
„Ihr Herz“, sagte Lu, „taugte nicht zum Verfassen von Aufsätzen, denn seine Löcher sind verstopft. Ich habe Sie mit einem besseren versehen, dass ich in der Unterwelt aus vielen tausenden von Menschenherzen gewählt habe, und behalte nun das Ihre, um es an dessen Stelle zu bringen.“ Darauf ging er und schloss die Tür hinter sich.
Am Morgen löste Tschu den Verband und betrachtete seinen Leib, an dem die Wunde völlig verheilt war und nur einen roten Streifen hinterlassen hatte. Von dieser Zeit an machte er große Fortschritte in der Schriftkunst, und was er einmal gelesen hatte, vergaß er nicht mehr. Nach einigen Tagen zeigte er einen Aufsatz, den er gemacht hatte, dem Richter. Der sagte:
„So geht es an. Aber Ihre Bestimmung ist nicht, ein großes Glück zu empfangen, und Sie werden keinen höheren Grad als den des Kü-jen erreichen.“
„Wann wird mir dieser Grad zufallen?“, fragte Tschu.
„Noch in diesem Jahr“, antwortete der Richter, und so war es. Tschu wurde der Erste beim Hsiu-tsai-Examen, (Baccalaureus), und dann einer der ersten fünf für den Kü-jen-Grad. Seine alten Gefährten, die sich vorher über ihn lustig zu machen pflegten, starrten einander erstaunt an, als sie von seinem Erfolg erfuhren und seine Aufsätze sahen. Sobald sie von ihm hörten, wie es zugegangen war, baten sie Tschu, auch sie mit dem Richter bekannt zu machen.
Der Richter willigte ein, und sie bereiteten ein Mahl zu seinem Empfang. Als er aber am Abend erschien, mit flatterndem rotem Bart und Augen wie Blitze, wich das Blut aus ihren Wangen, ihre Zähne klapperten und einer nach dem andern schlich sich hinaus. Tschu nahm nun den Richter mit nach Hause, wo sie weiter zechten. Als ihm der Wein zu Kopf gestiegen war, sagte er: „Dass Sie meine Brust geöffnet und mein Herz umgetauscht haben, ist eine große Wohltat. Aber es gibt noch etwas, womit ich Sie behelligen möchte, wenn es angeht?“
Der Richter fragte ihn, was er meine, und Tschu sagte; „Wenn man das Herz umtauschen kann, wird man es wohl auch mit dem Gesicht tun können. Nun hat meine Frau eine nicht üble Gestalt, aber ihr Gesicht ist recht garstig. Ich bitte Sie, Ihre Kunst an ihr zu versuchen.“
Der Richter lachte und sprach: „Wohl! Wir wollen zu gelegener Zeit darauf zurückkommen.“
Einige Tage danach klopfte der Richter um Mitternacht an Tschüs Tür, der schnell aufstand und ihn hereinbat. Als er die Lampe anzündete, gewahrte er, dass der Richter etwas unter seinem Rock verborgen trug. Auf seine Frage, was es sei, antwortete Lu: „Es ist die Kleinigkeit, um die Sie mich jüngst ersucht hatten. Ich konnte nicht gleich einen schönen finden; darum habe ich einige Tage gesäumt. Endlich habe ich einen Passenden bekommen und nun bringe ich ihn Ihnen.“ Er zog nun einen schönen Mädchenkopf hervor und zeigte ihn Tschu, der bemerkte, dass das Blut am Halse noch feucht war.
„Wir müssen eilen“, sagte der Richter, „und Sorge tragen, die Hühner und Hunde nicht zu wecken.“ Tschu befürchtete, die Tür, die zum Zimmer seiner Frau führte, könnte verriegelt sein, aber der Richter legte seine Hand darauf und sie öffnete sich sogleich.
Tschu führte ihn nun zum Bette, wo die Frau auf der Seite liegend schlief. Der Richter gab ihm den Kopf zu halten und zog aus seinem Stiefel eine Stahlklinge, die wie ein Löffelstiel geformt war. Mit der strich er über den Nacken der Frau, wie man eine Melone öffnet, und ihr Kopf fiel vom Kissen. Er nahm nun den Kopf, den er gebracht hatte, schloss ihn sorgsam an, drückte ihn fest und legte die Frau zwischen zwei Polstern zurecht. Dann befahl er Tschu, den alten Kopf zu begraben, und ging. Bald darauf erwachte die Frau und spürte eine seltsame Starrheit am Halse. Als sie mit der Hand dran rührte, fand sie getrocknetes Blut; bestürzt rief sie die Dienerin und ließ sich Waschwasser bringen. Die Dienerin ging geängstigt daran, das Blut abzuwaschen, von dem sich das ganze Wasserbecken rötete; als sie nun aufblickte, sah sie ein fremdes Gesicht und erschrak. Die Frau nahm einen Spiegel, schaute hinein und erkannte sich nicht. Da kam ihr Gatte und erzählte ihr, was sich ereignet hatte. Als er sie genauer betrachtete, sah er ein schöngebildetes Gesicht; um den Hals ging ein roter Strich und die Haut über ihm war von einer andern Farbe als die darunter.
Es hatte sich aber dieses zugetragen: Ein Beamter namens Wu hatte eine sehr schöne Tochter, die, obgleich schon neunzehn Jahre alt, noch unvermählt war, da ihr zweimal der Bräutigam kurz vor der Hochzeit durch den Tod genommen worden war. Am Laternenfeste ging sie in den Tempel, sich das Qualengemach anzusehen. Unter den Leuten, die ihr begegneten, war ein nichtswürdiger Mensch, der eine Leidenschaft zu ihr fasste. Er erkundete ihre Wohnung, stieg in der Nacht auf einer Leiter ein und drang in ihr Schlafzimmer, wo er zuerst die vor dem Bett schlafende Dienerin ermordete und sodann das Mädchen umarmen wollte. Als sie sich wehrte und um Hilfe rief, geriet er in Zorn und schlug ihr den Kopf ab. Die Mutter hörte den Lärm und sandte eine Magd ins Zimmer, um nachzusehen, was geschehen sei; so wurde der Mord entdeckt. Man brachte die Leiche in die Halle, legte den Kopf daneben, und alle weinten und klagten die ganze Nacht durch. Als man am nächsten Morgen die Decke abnahm, war der Rumpf da, aber der Kopf war verschwunden. Die Dienerinnen wurden für ihren Mangel an Wachsamkeit gezüchtigt, und Herr Wu brachte den Vorfall zur Kenntnis der Behörden. Der Präfekt ordnete Nachforschungen an, aber die Tage vergingen, ohne dass man eine Spur entdecken konnte. Indessen erreichte die Kunde von der Kopfverwandlung in der Familie Tschu Herrn Wus Ohren. Er fasste einen unbestimmten Verdacht und sandte eine alte Dienerin hin, um nachzusehen, worauf sich das Gerücht gründe. Sie erkannte verwirrt die Züge ihrer toten jungen Herrin, lief zurück und erzählte es ihrem Herrn. Herr Wu, der nicht erdenken konnte, warum der Rumpf zurückgelassen worden war, glaubte nun, Tschu habe seine Tochter durch Zauberei getötet, und begab sich sogleich zu ihm, um die Wahrheit zu ermitteln. Tschu sagte ihm: