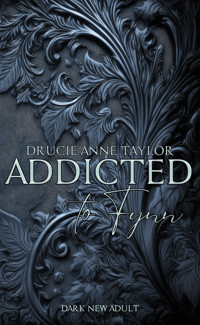12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Erlebe die Geschichten von Dimitri und Julijana, Anatolij und Vania sowie Aleksandr und Samantha. Begleite Familie Wolkow und ihre Leibwächter durch ihr turbulentes Leben, das von mächtigen Feinden bedroht wird. Doch sie wären nicht die Wolkows, wenn sie sich ihren Feinden nicht entgegenstellen würden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dangerous Heroes
DARK REAPER - DARK BEAST - DARK MONSTER
DANGEROUS HEROES SAMMELBAND
BUCH ZWEI
DRUCIE ANNE TAYLOR
Copyright © 2020 Drucie Anne Taylor
Korrektorat: S.B. Zimmer
Satz & Layout © Julia Dahl
Umschlaggestaltung © D-Design Cover Art
Auflage: 01 / 2024
Alle Rechte, einschließlich das, des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. Dies ist eine fiktive Geschichte, Ähnlichkeiten mit lebenden, oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Alle Markennamen, Firmen sowie Warenzeichen gehören den jeweiligen Copyrightinhabern.
Triggerwarnung
Liebe Leserin, lieber Leser,
Dieses Buch ist voller Brutalität, Schimpfwörter, Flüche und vielen weiteren Beschreibungen, die dich schockieren könnten. Wenn du einen rosaroten Liebesroman erwartest, der sich strikt an die Realität hält, wird dich dieses Buch enttäuschen. Diesmal habe ich bewusst Grenzen ausgelotet und überschritten. Dieses Buch ist reine Fiktion, nichts von dem, was darin geschieht, passiert wohl so im wahren Leben und wenn doch, dann in den Schatten, in die wir nicht blicken.
Also wenn du zartbesaitet bist oder empfindlich auf explizite Gewaltdarstellung reagierst, kann ich dir nur von dieser Geschichte abraten. Denn ich weiß, dass sie dir in diesem Fall nicht zusagen wird. Du wirst es hassen, mich verfluchen und das Buch oder deinen E-Book-Reader womöglich an die nächstbeste Wand werfen wollen. Aus dem Grund möchte ich hiermit anmerken, dass ich keinerlei Haftung für beschädigte Einrichtungsgegenstände oder ähnliches übernehme.
Jedem anderen wünsche ich viel Spaß mit dem zweiten Sammelband der Dangerous Heroes.
Triggerpunkte: Gewalt gegen Frauen, sexuelle Gewalt, Folter, grafische Darstellung von Gewalt und Blut.
Inhalt
Dark Reaper
Prolog
1. Der Namenlose
2. Julijana
3. Mikhail
4. Julijana
5. Mikhail
6. Julijana
7. Ivan
8. Mikhail
9. Kyrill
10. Julijana
11. Dimitri
12. Julijana
13. Anisja
14. Dimitri
15. Julijana
16. Kyrill
17. Dimitri
18. Alessia
19. Samara
20. Julijana
21. Dimitri
22. Julijana
23. Dimitri
24. Ivan
25. Julijana
26. Dimitri
27. Julijana
28. Dimitri
29. Vladimir
30. Julijana
31. Dimitri
32. Julijana
Epilog
Dark Beast
Prolog
1. Anatolij
2. Vania
3. Anatolij
4. Vania
5. Anatolij
6. Vania
7. Anatolij
8. Vania
9. Anatolij
10. Vania
11. Jurij
12. Anatolij
13. Vania
14. Anatolij
15. Vania
16. Anatolij
17. Vania
18. Vladimir
19. Anatolij
20. Vania
21. Anatolij
22. Vania
23. Anatolij
24. Vania
25. Anatolij
Epilog
Dark Monster
Prolog
Prolog
1. Samantha
2. Aleksandr
3. Samantha
4. Aleksandr
5. Samantha
6. Aleksandr
7. Samantha
8. Aleksandr
9. Samantha
10. Aleksandr
11. Samantha
12. Aleksandr
13. Milena
14. Aleksandr
15. Milena
16. Ivan
17. Aleksandr
18. Milena
19. Aleksandr
20. Milena
21. Aleksandr
22. Milena
23. Aleksandr
Epilog
Über die Autorin
Weitere Werke der Autorin
Rechtliches und Uninteressantes
Dark Reaper
GEGEN JEDE VERNUNFT
Einst gehörte ihm die Welt, nun fristet er sein Dasein in einer dunklen Zelle. Er hatte alles, was das Herz begehrt, doch sein Verrat verdammte ihn zu einem Leben ohne Namen. Von der Bratwa verurteilt, sitzt er seine Zeit in einem Verlies ab, ohne die Hoffnung, jemals wieder das Tageslicht zu sehen. Doch was geschieht, wenn die Sonne auf wundersame Weise und in Gestalt der schüchternen Julijana wieder in sein Leben tritt und ihm neue Hoffnung gibt?
Julijana wünscht sich nichts sehnlicher als die Freiheit. Ausgebrochen aus einer brutalen Ehe wird sie wegen der Geschäfte ihres Mannes von der berüchtigten Familie Wolkow geschnappt und verhört. Nachdem sie Vladimir Loyalität geschworen hat, wird sie von ihm nach L.A. gebracht, um ihr ein Leben in Sicherheit zu ermöglichen. Jedoch darf sie die schützenden Mauern nicht verlassen, denn die Vergangenheit könnte an jeder Ecke lauern. Als Ivan Wolkow ihr aufträgt, sich um einen namenlosen Gefangenen zu kümmern, weiß sie nicht, ob sie ihre Angst vor Männern überwinden kann.
Allen Widrigkeiten zum Trotz entwickelt sich zwischen den beiden ein zartes Band, das die byki der Wolkows zu zerstören drohen. Julijana fasst einen Entschluss, der beide in Lebensgefahr bringt, doch der Ruf der Freiheit ist lauter, als jener der Vernunft.
Prolog
JULIJANA
Fünf Jahre zuvor
Moskau
Rennen!
Ich musste unbedingt rennen. Vigors Männer würden mich sonst kriegen. Ich hatte solche Angst vor ihnen, dass ich nicht wusste, wo mir der Kopf stand. Es war unerträglich, mich zur Eile antreiben zu müssen, aber ich durfte nicht stehenbleiben.
Um keinen Preis der Welt.
Ich hasste diesen Mann so sehr und heute, nach drei Jahren grausamer Ehe, war mir endlich die Flucht gelungen. Ein unachtsamer Moment und ich konnte mich absetzen. Seine byki hatten nicht aufgepasst, als sie mich in eine Boutique begleitet hatten, nun musste ich schnellstmöglich weg. Ich wusste, dass mein Mann irgendwo in der Nähe war, deshalb musste ich auf der Hut sein. Wenn er mich in die Finger kriegen würde, würde ich es nicht überleben, aber das war mein geringstes Problem. Die Tracht Prügel, mit der er mich ins Grab befördern würde, machte mir auch keine Angst. Wovor ich mich zu Tode fürchtete, war die Tatsache, dass er keinen Halt vor meiner Familie machen würde. Um meine Eltern sorgte ich mich nicht besonders, denn sie hatten mich bereitwillig an Vigor verkauft, aber um meine Schwester Anisja machte ich mir Sorgen. Sie sollte nicht leiden, weil ich mich aus meiner Ehe und von meinem gewalttätigen Ehemann befreit hatte.
»Da hinten ist sie!«, rief einer der Leibwächter meines Mannes.
Ich warf einen Blick über meine Schulter und keuchte. Sie waren viel näher, als ich dachte. Ich hatte höllische Angst, dass sie mich schnappen würden.
Vor mir kam ein Wagen mit quietschenden Reifen zum Stehen. »Boshe moy!«, stieß ich aus.
Zwei Männer in anthrazitfarbenen Anzügen stiegen aus, ein dritter ließ das Fenster hinter dem Beifahrersitz herunter. »Julijana Tarasowa, schön Sie zu sehen.«
Ich wollte den Wagen umrunden, aber einer der Männer packte mich. »Was tun Sie denn?«, fragte ich panisch, da ich glaubte, dass sie mich an Vigors Männer ausliefern würden.
»Wir nehmen Sie mit, Gospozha Tarasowa«, sagte der Alte auf dem Rücksitz und schon wurde ich zum Kofferraum bugsiert. Ich wehrte mich, kam aber nicht gegen den Hünen an. »Lassen Sie mich los!«, verlangte ich unruhig und hätte beinahe um Hilfe gerufen, aber andererseits waren diese Männer mein Weg in die Freiheit – nicht wirklich, aber sie würden mich zumindest von Vigor wegbringen. Und dann hatte er keine Macht mehr über mich.
»Hören Sie auf!«, schrie ich und neben mir schlug eine Kugel ein.
»Rein da!«, verlangte der Mann Marke Berggorilla, packte mich im Nacken und stieß mich in den Kofferraum. Kaum lag ich darin, wurde die Klappe über mir zugeschlagen. Und nur einen Moment später setzte sich das Auto in Bewegung.
* * *
Als ich aufwachte, befand ich mich in einem muffigen Raum. Ich blinzelte gegen die Müdigkeit und fragte mich, was passiert war, dass ich mich so benommen fühlte.
»Wie schön, dass Sie wach sind, Gospozha Tarasowa«, sagte eine tiefe Stimme.
Ich bewegte den Kopf und erkannte einen groß gewachsenen Mann. Er sah dem erschreckend ähnlich, der auf der Rückbank saß. »Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Vladimir Wolkow.«
»Der Schlächter von St. Petersburg!«, entfuhr es mir und Panik kroch meinen Rücken hinauf.
»Genau der.« Er nahm einen Stuhl, stellte ihn vor mich und nahm darauf Platz. »Unterhalten wir uns ein wenig.«
Ich schluckte. »Was wollen Sie von mir?«
Er sah mich völlig emotionslos an. »Antworten, Gospozha Tarasowa.«
»Werden Sie mich töten?«
Daraufhin schüttelte Wolkow den Kopf. »Nein, ich werde Sie weder foltern noch umbringen, aber gegebenenfalls werden die Männer meines Vaters nicht ganz so zimperlich mit Ihnen umgehen, wenn Sie mir nicht verraten, was wir wissen wollen.«
Meine Brust schnürte sich zu und plötzlich hatte ich das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Ich fühlte mich hilflos, was ich im gefesselten Zustand ja auch war, und glaubte, die Pest gegen die Cholera eingetauscht zu haben.
»Also, verraten Sie mir, mit wem Ihr Mann Geschäfte macht«, begann er und drehte eine Pistole in seinen Händen. »Es interessiert uns brennend, warum Vigor Tarasow so tut, als würde ihm die gottverdammte Stadt gehören, seit er die Geschäftsbeziehung zu uns beendet hat.«
Schwerfällig holte ich Luft. »Mit den Tschechen. Ich habe ihn mit Janko und Adam Novák reden hören, aber mehr weiß ich nicht.« Tränen nahmen mir die Sicht. »Ich will ihn verlassen, aber er lässt mich nicht gehen. Heute ist mir die Flucht gelungen und ich wurde von Ihren Männern aufgehalten. Ich weiß sonst wirklich nichts über Vigors Geschäfte.«
»Mhm«, gab er nachdenklich von sich und musterte mich aus kalten braunen Augen. »Warum sind Sie vor ihm weggelaufen?«
»Weil er mich wie Dreck behandelt, Gospodin Wolkow. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß.«
»Sie wissen wirklich nicht mehr über die Geschäfte Ihres Mannes?«
Hektisch schüttelte ich den Kopf. »Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er mit den Nováks Geschäfte macht. Bei Adam Novák war eine junge Frau, die mir sagte, dass sie zur tschechischen Mafia gehören, aber sie wusste sonst auch nichts.« Die Tränen rannen ohne Unterlass meine Wangen hinab, das Schluchzen raubte mir jeglichen Sauerstoff und die Angst ließ mich zittern.
Er schnalzte mit der Zunge. »Na schön. Wohin wollen Sie jetzt?«
»Ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen soll. Vigor wird mich bestimmt überall finden.«
»Mhm«, machte er wieder und steckte die Waffe in das Schulterholster, das er trug. »Wenn Sie mir und meiner Familie Ihre Loyalität schwören, kann ich dafür sorgen, dass Sie in Sicherheit sind, auch wenn das Leben dann ein paar Einschränkungen für Sie bereithält.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte ich ängstlich. Wenn er mir dieses Angebot machte, warum war ich dann noch gefesselt? Ich wollte weder etwas mit den Wolkows noch den Nováks zu tun haben. Diese Männer waren gnadenlos, brutal und ohne jeden Skrupel. Sie mordeten zu ihrem Vorteil, sie begingen Verbrechen, die nicht bestraft wurden, und sie hielten das Land in ihren Händen.
Nicht die Politiker waren die Machthaber in Russland, die Wolkows waren es.
»Sie werden meiner Familie dienlich sein, ansonsten kann ich nichts für Sie tun.« Er neigte den Kopf. »Verstehen Sie das?«
Ich nickte hektisch.
»Und wie entscheiden Sie sich?«, wollte er wissen. Vladimir Wolkow klang weder kalt noch gefährlich, unerklärlicherweise hatte seine Stimme einen warmen Klang angenommen.
»Garantieren Sie mir, dass Vigor mich nicht finden wird?«
Vladimir Wolkow nickte knapp.
Es war wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera, aber das Schicksal, das er mir bot, erschien mir angenehmer als jenes, das mich an Vigors Seite erwartete.
Ich stimmte zu und wusste, dass mein Leben damit nicht mehr in meinen Händen lag.
* * *
Der Namenlose
Tag sechshundertvierunddreißig in meiner feuchten und muffigen Zelle. Ich konnte mich nicht frei bewegen, bekam kein Tageslicht zu sehen und von frischer Luft wollte ich gar nicht erst anfangen. Zum Pissen und Scheißen stand ein Eimer in der Ecke, der den Gestank innerhalb dieser Mauern noch verschlimmerte. Die byki meines Cousins leerten ihn nur einmal pro Woche, das waren die einzigen fünf Minuten, in denen jemand diesen Raum betrat. Das Essen wurde durch einen Schlitz unter der Tür durchgeschoben, ebenso eine kleine Flasche Wasser am Tag.
Niemand sprach mit mir.
Niemand sah mich an.
Ich war der Namenlose, der es nicht wert war, beachtet zu werden.
In den letzten Wochen und Monaten hatte ich eine Menge Zeit zum Nachdenken – und ich bereute meine Taten. Beinahe hätte ich meine Frau vergewaltigt, nur um ihr zu zeigen, dass ich der Stärkere von uns beiden war, nur um sie zu bestrafen, weil sie gegen die Regeln meines Vaters verstoßen hatte, nachdem ich alle Glauben gemacht hatte, tot zu sein. Ich hatte mich wie ein gottverdammter sukin syn verhalten. Am besten hätte ich mich meiner Frau niemals zu erkennen gegeben, aber als ich hörte, dass mein Cousin sie flachlegt, sah ich rot. Und ich wollte die beiden leiden sehen. Heute wusste ich, dass das der dümmste von all meinen Fehlern war. Mein Vater war tot, meine Schwester ebenfalls und der Erbe des Pakhans saß in dieser nach Scheiße stinkenden Zelle, um auf sein Ende zu warten.
»Geh da rein und mach ihn sauber«, hörte ich Aleksandr sagen, er war der Chef der nochnoy storozh. Er war einer von Papas loyalsten Männern, doch nun diente er Ivan, meinem gottverdammten Cousin, der die Stellung meines Vaters übernommen hatte.
Die Tür wurde geöffnet und dann sah ich sie. Mit gesenktem Blick kam sie herein, wagte es nicht, mich anzusehen, und zuckte zusammen, als die Metalltür krachend ins Schloss fiel. In ihren Händen hielt sie eine Schüssel, der ein Aroma entstieg, das jenes in der Zelle langsam vertrieb. Sie stellte die Schale, in der ich nun Wasser erkannte, vor meine Füße. Ihre Hand zitterte, als sie den Waschlappen hineintauchte.
»Was wird das?«, fragte ich müde. Essen bekam ich kaum, gerade genug, um nicht zu verhungern, und eine Flasche Wasser am Tag. Es war viel zu wenig, wenn man bedachte, dass ich einst im Überfluss gelebt hatte.
»Go-Gospodin Wo-Wo-Wolkow hat befohlen, dass ich Sie wasche«, antwortete sie scheu, sie stammelte sogar ein wenig.
»Warum?«
Sie hob den Waschlappen, doch ich umklammerte ihr Handgelenk. »Ich weiß es nicht«, sagte sie sofort und versuchte, sich mir zu entziehen.
Unzufrieden gab ich sie frei und betrachtete sie, als sie anfing, meine Füße zu waschen. Sie hatten mir alles genommen, womit ich mir hätte schaden können. Ich trug keine Schuhe, keinen Gürtel, nicht einmal einen vernünftigen Herrenanzug, sondern einen Overall, der genauso widerlich roch wie diese Zelle. Schlafen musste ich auf einem Lager aus Stroh, das durch die feuchten Wände klamm geworden war. Wenn mich der Hunger nicht irgendwann umbringen würde, würde der Schwarzschimmel es übernehmen. »Wer bist du?«
»Niemand«, wisperte sie, ohne den Blick zu heben.
»Sag mir deinen Namen«, verlangte ich ruhig.
»Juna«, sagte sie leise.
»Und weiter?«
»Ermakowa.«
Ich musterte sie, da ich das Gefühl hatte, dass sie nicht ehrlich zu mir war.
Sie fürchtete sich, aber warum?
War sie auch eine Gefangene meines Cousins? »Woher kommst du?«, fragte ich auf Russisch.
»Aus Moskau.«
»Weißt du, wer ich bin?«
»Der Namenlose«, antwortete sie und bekreuzigte sich.
Sie hatten mir meinen Namen genommen.
Diese Strafe war mit dem Tod vergleichbar.
Ich war zu einem Niemand geworden. »Nein.«
Nun hob sie den Blick und mich trafen die schönsten Augen, die ich je gesehen hatte. »Die Nachtwächter sagten, dass Sie keinen Namen haben.«
Ich schüttelte den Kopf, vermied es jedoch, ihr meinen Namen zu nennen. Würde sie ihn hören, würde sie wissen wollen, was ich getan habe.
Juna wusch mich, bis der ganze Dreck von meiner Haut gewichen war. Schließlich erhob sie sich mit der Schüssel in der Hand. Ihr Blick schweifte durch die Zelle, bevor er mich traf. Juna schenkte mir ein verdammt trauriges Lächeln, das mein Herz für sie brechen ließ. Boshe moy, ich war so weich geworden, seit ich in dieser Zelle saß. Sie wandte sich ab, ging zur Tür und klopfte zweimal fest dagegen.
Das kleine Guckloch, anders konnte man es nicht nennen, wurde geöffnet. »Fertig?«, fragte Aleksandr.
Sie nickte ihm zu.
»Gut.« Er öffnete die Tür und sah zu mir. »Dir wird gleich saubere Kleidung gebracht. Du solltest zusehen, dass du sie schnellstmöglich anziehst. Der Pakhan wird zu dir kommen.«
Ich zuckte mit den Schultern.
Nur wenige Minuten später warf Aleksandr mir einen sauberen Overall zu. »Anziehen.«
»Ja, Sir!«, erwiderte ich bellend wie ein Soldat und wandte mich von der Tür ab, die im nächsten Augenblick wieder krachend zurück ins Schloss fiel. Ich schälte mich aus dem schmuddeligen Overall, den ich seit Wochen trug, bloß um ihn im nächsten Moment gegen das gleiche Modell auszutauschen, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, das es sauber war. Der Geruch von Stärke verfing sich in meiner Nase, reizte sie und meine Haut begann zu jucken.
Ivan war ein Wichser.
Er wusste genau, dass ich allergisch darauf reagierte, ließ es sich aber nicht nehmen, jeden einzelnen verfickten Overall stärken zu lassen. Es würde Tage dauern, bis meine Haut keine Reizungen mehr aufwies und der Juckreiz endlich nachließ.
* * *
Als die Eisentür das nächste Mal geöffnet wurde, betraten meine Cousins den Raum. Ich blieb auf dem Boden sitzen und schaute zu ihnen hoch. Während Vlad keine Miene verzog, rümpfte Ivan die Nase. »Steh auf!«, verlangte er dann.
Ich rührte mich nicht.
»Ich sagte, dass du aufstehen sollst!«
»Und du hast nicht bitte gesagt«, erwiderte ich in unserer Muttersprache, da er zuvor Englisch gesprochen hatte.
Er kam näher und sah mich vernichtend an. »Steh auf!«, herrschte er mich sodann an.
»Dimitri, tu dir selbst den Gefallen und steh bitte auf«, sagte Vlad ruhig, während Ivan vor Wut kochte.
Ich wusste einfach zu gut, wie ich diesen Wichser zur Weißglut treiben konnte. »Sehr gern«, richtete ich mich an Vlad und erhob mich.
»Das nächste Mal reagierst du gefälligst sofort«, knurrte Ivan, der mir einen vernichtenden Blick zuwarf.
»Das nächste Mal bekommst du auch einen Knicks, meine kleine Prinzessin«, konterte ich voller Sarkasmus, doch im nächsten Moment verpasste er mir einen festen Hieb in den Magen. Ich krümmte mich nicht, aber das Keuchen konnte ich nicht unterdrücken. Dennoch war der Spruch es wert, gesagt zu werden.
»Hab gefälligst ein bisschen Respekt vor deinem Pakhan!«, grollte er.
»Du bist nicht mein Pakhan!«, erwiderte ich ungehalten. »Was wollt ihr von mir?«
Ivan holte ein Schreiben aus seiner Innentasche. »Unterschreib das.«
»Was ist das?«
»Deine Scheidungspapiere.«
»Offiziell bin ich tot.«
»Ich weiß, deshalb ist es auf ein Datum vor über drei Jahren datiert. Also unterschreib die Papiere!«
Ich schüttelte den Kopf. »Warum sollte ich? Du hast meine Frau geheiratet, ich sitze hier fest, für dich ist das doch eine Win-win-Situation.«
Er schnaubte. »Unterschreib. Die. Verfickten. Papiere!«
Vlad legte seine Hand auf Ivans Schulter. »Es bringt nichts, Dimitri anzuschreien, Bratan.«
»Stimmt«, pflichtete ich meinem ältesten Cousin bei. »Es bringt nichts, mich anzuschreien, mein lieber Ivan.« Ich schenkte ihm ein Lächeln, das ihn sicher noch wütender werden ließ. Was soll ich sagen? Das war meine einzige Möglichkeit, ihm zu zeigen, dass ich ihm nicht in den Arsch kroch. Was Samara an ihm fand, verstand ich nicht, aber ich gönnte ihr das Glück von Herzen. Immerhin hatte sie ein noch größeres Arschloch geheiratet, als ich es damals war.
»Tu uns allen den Gefallen und unterschreib die Papiere, Dimitri. Auch wenn alle Welt denkt, dass du tot bist, sollte diese Sache bereinigt werden«, bat Vlad ruhig.
»Was bekomme ich dafür?«, wollte ich wissen. Ich wollte ihnen nicht einfach meine Unterschrift geben, denn es musste etwas zu bedeuten haben, dass sie diese nicht gefälscht hatten. Zudem war das eine Gelegenheit, ein paar Zugeständnisse aus Ivan herauszupressen.
»Was willst du dafür haben?«, hakte Ivan ungeduldig nach.
»Einen Tag pro Woche in der Sonne und dass mir die Kleine künftig das Essen bringt, die mich vorhin gewaschen hat, und während ich esse bei mir ist. Außerdem will ich einen Rasierer, denn mal ehrlich, ich sehe aus wie der verschissene Weihnachtsmann.«
»Welche Kleine?«, fragte nun Vlad.
»Juna. Sie war bei mir, um mich zu waschen, bevor ihr kamt. Ich will, dass sie mir das Essen bringt und Zeit mit mir verbringt, bevor ich noch durchdrehe, weil ich mit mir und meinen Gedanken allein bin«, antwortete ich aufrichtig. Die Kleine konnte meine Rettung sein und ich wollte herausfinden, ob ich sie dazu bringen konnte, mich hier rauszuholen. Ich musste nur ihr Vertrauen gewinnen, ihr ein paar Krokodilstränen vorweinen, sie gegebenenfalls auf meinem Strohlager ficken und dafür sorgen, dass sie Gefühle für mich entwickelt … Kein leichtes Unterfangen, aber definitiv eine Herausforderung, die ich annehmen wollte.
Vlad sah Ivan an. »Ich würde sagen, dass du auf seine Forderung eingehen und ihm diese Zugeständnisse machen solltest, Bratan.«
Ivan nickte ruppig. »In Ordnung. Einmal pro Woche darfst du in Begleitung derNachtwächter nach draußen, aber du wirst keinen Fluchtversuch unternehmen, denn sie werden dich sofort erschießen. Und diese Kleine wird sich um dich kümmern, aber du lässt die Finger von ihr. Wenn du dich ihr näherst, wird Vlad sich dir mit seiner Kastrationszange nähern. Und du bekommst einen elektrischen Rasierer.«
»In Ordnung.« Ich streckte meine Hand aus. »Hand drauf?«
Er sah mich angewidert an, doch dann schlug er ein. »Abgemacht.«
Ich setzte meine Unterschrift unter die Scheidungspapiere und betrachtete Ivan. »Denk an deine Ehre und halt dich an unsere Abmachung.«
Er schnaubte und ich wusste genau, dass und wie sehr ich ihn gereizt hatte, denn niemand stellte die Ehre eines Wolkows oder eines Sorokins infrage.
Niemand!
* * *
Julijana
Warum hatte ich dem Namenlosen meinen Spitznamen genannt?
Es war der Name, unter dem ich in Los Angeles lebte, seit Vladimir Wolkow mich hierher gebracht hatte. Allerdings war es kein freies Leben, denn ich musste den Wolkows loyal ergeben sein, so wie zuvor Sergej Sorokin, und jeden ihrer Befehle befolgen. Vladimir hatte mich damals vor dem sicheren Tod bewahrt, als er mich nach Amerika brachte. Ich wurde seinem Onkel unterstellt, aber der war vor geraumer Zeit ermordet worden, danach musste ich Ivan Wolkow, dem neuen Pakhan und Erben der Sorokin-Bratwa, Treue und Loyalität schwören.
Das Verlies lag im Keller einer Villa, die ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit war. Ich hatte ein Zimmer unterm Dach, wo mir keine Menschenseele begegnete. Die nochnoy storozh und byki, die hier arbeiteten, ignorierten mich, außer sie bekamen von höchster Stelle den Befehl, dass sie mir eine neue Aufgabe zuweisen sollten.
Ansonsten war ich unsichtbar.
Es war nicht das schlechteste Los, das ich gezogen hatte, denn wenn mich niemand sah, konnte mir niemand zu nahe kommen. Aber dieser Mann, dieser namenlose Mann, den ich heute waschen musste, weil der Pakhan und sein Bruder ihren Besuch angekündigt hatten, hatte mich gesehen. Als unsere Blicke miteinander verschmolzen, hatte er mir das Gefühl gegeben, dass er direkt in meine Seele sehen konnte. In jenem Moment hing ich gebannt an seinen Augen und fragte mich, was er verbrochen hatte, dass er hier eingesperrt worden war. In letzter Zeit kamen immer mehr Männer her, deren Schreie mich nachts aus dem Schlaf rissen oder um diesen brachten. Ich wusste genau, dass sie ihren Tod fanden, wenn sie so laut schrien, dass ich glaubte, sie würden auf meinem Bett sitzen und mich anschreien. Es machte mir Angst und so viele Male hatte ich um Ohrenstöpsel gebeten, doch hatte man meine Bitte immer ignoriert.
Niemand interessierte sich dafür, was aus mir wurde.
Bloß Vladimir Wolkow sah gelegentlich nach mir und erkundigte sich, wie es mir ging, aber er war der Einzige. Bis vorhin, als der Namenlose mich ansprach, hatte ich sogar ernsthaft geglaubt, das Sprechen verlernt zu haben, weil ich es so selten tat. Heute war das erste Mal, dass ich seit Monaten ein paar Sätze gesprochen hatte. Ich gehörte nicht zu den Menschen, die Selbstgespräche führten, oder einfach nur sprachen, um sich reden zu hören. Vigor hatte all das zerstört, was mich damals ausgemacht hatte. Ich erkannte mich selbst nicht mehr, obwohl ich mich schon vor einigen Jahren von ihm befreien konnte. Allerdings kam es mir heute so vor, als hätte ich eine Gefangenschaft gegen die andere eingetauscht. Manchmal glaubte ich sogar, dass meine Schritte überwacht wurden, obwohl man mir sonst weismachte, dass man sich nicht für mich interessierte.
Ich kochte nicht, ging nicht einkaufen und in der Küche hielt ich mich nur auf, wenn die Köchin zum Essen rief. Dann saß ich mit all den düsteren Gestalten an einem Tisch, die für die Wolkows tätig waren, und versuchte, nicht gesehen zu werden. Es gelang jedes Mal. Doch heute war Aleksandr Karinski zu mir gekommen, um mir zu sagen, dass ich einen Gefangenen zu waschen hätte, weil der Pakhan seinen Besuch angekündigt hatte. Mir war es sofort eiskalt den Rücken hinuntergelaufen.
Als es an der morschen Tür des Dachbodens klopfte, zuckte ich zusammen. »D-da?«, rief ich, da ich der englischen Sprache nicht mächtig war. Ich beherrschte bloß meine Muttersprache, weshalb ich fest davon überzeugt war, dass dies hier der einzige Ort sei, an dem ich verstanden wurde – zumindest, wenn jemand mit mir gesprochen hätte.
Vladimir betrat mein Zimmer – ich erhob mich sofort. »Hallo, Julijana«, sagte er mit warmer Stimme.
Wie Sergej Sorokin es stets von mir verlangt hatte, senkte ich den Blick, um ihm so Respekt zu zollen. »G-guten A-abend, Gospodin Wolkow.«
»Wie geht’s dir?«
»G-gut.« Ich holte tief Luft, um die innere Unruhe zu vertreiben, aber es wollte mir nicht gelingen.
»Sieh mich an.«
Langsam hob ich den Blick und erkannte, dass er müde aussah.
»Du siehst traurig aus.«
Ich schüttelte kaum merklich den Kopf. »Das bin ich nicht.«
Daraufhin neigte er seinen, um mich zu betrachten, und er kam mir näher. »Sicher?«, hakte er nach, als er seine Hand unter mein Kinn legte und es nach oben drückte, sodass ich gezwungen war, zu ihm auf- und geradewegs in seine braunen Augen zu blicken.
»Da«, erwiderte ich eingeschüchtert. Auch nach all den Jahren, in denen ich ihn ein wenig kennengelernt hatte, machte er mir Angst. Vermutlich lag es daran, dass er mir damals gedroht hatte, mich umzubringen, sollte ich mich illoyal verhalten. Meine Unterlippe zitterte ein wenig.
Seine Augenbrauen zuckten kurz, doch dann wurde seine Miene wieder neutral. »Du hast heute jemanden kennengelernt, erinnerst du dich?«
Ich nickte, so gut es mit seiner Hand an meinem Kinn ging.
»Der Pakhan hat entschieden, dass du diesem Mann täglich das Essen bringen und ihm Gesellschaft leisten sollst«, fuhr er unbeirrt fort.
Ich entzog mich seinem Griff und sah ihn ratlos an. »Warum d-d-denn?« Meine Stimme war leise und brach beinahe, weil ich mit der Information überfordert war.
»Ich stelle seine Entscheidungen nicht infrage, das solltest du auch nicht tun.«
Hart schluckte ich den Kloß in meinem Hals hinunter, doch er drückte weiter unablässig gegen meinen Kehlkopf und drohte, mich zu ersticken. Nachdem ich vor Vigor weggelaufen war und Vladimir mich in die USA gebracht hatte, wollte ich nichts mehr mit Männern zu tun haben, aber dann wurde ich von Sergej Sorokin dazu verdammt, in diesem Haus voller byki und nochnoy storozh zu leben. Sie hätten mich mit einer neuen Identität ziehen lassen können, aber nein, stattdessen war ich zu einem namenlosen Geist geworden. Bloß Vladimir Wolkow hatte ihn sich gemerkt, alle anderen sprachen mich mit Kleine, Schnecke oder sonst irgendeinem Spitznamen an, auf den ich nicht reagierte. Oftmals tat ich das erst, wenn jemand, der mich ansprach, direkt vor mir stand. Dann konnte ja nur ich gemeint sein, was vielleicht einmal alle paar Monate vorkam.
»Dir wird nichts geschehen. Er wird dich nicht berühren, auch nicht mit dir sprechen, sondern nur deine Gesellschaft genießen.« Der warme Tonfall, den er an den Tag legte, brachte nichts.
Mein Herz raste und ich hatte Angst vor dem Mann in der Zelle. Ich wusste nicht, wer er war oder was er verbrochen hatte, aber es musste etwas Grausames gewesen sein, wenn er zu diesem Leben verurteilt worden war. Eingesperrt zu sein, war in meinen Augen schlimmer als der Tod. Ich war innerlich bereits gestorben, deshalb störte es mich vermutlich nicht so sehr, aber andere Menschen sollten dieses Schicksal nicht ertragen müssen. Jeder Mensch hatte es verdient, frei zu sein und selbst über sein Schicksal zu bestimmen. Hier wurden einem die Entscheidungen vom Pakhan abgenommen. Er bestimmte, was wann mit wem geschah, wenn man sich ihm widersetzte oder seine Regeln brach. »Bist du bereit dafür?«
Wieder musste ich schlucken. »Ich …«, nervös brach ich ab und knetete meine Hände.
»Ja?«
»Ich muss … das tun, oder?«
Er nickte langsam.
Schwerfällig holte ich Luft. »Ich bin nicht bereit, aber … ich … ich werde die Aufgabe … übernehmen u-u-und zu Ihrer … Zu-Zufriedenheit erfüllen«, sagte ich leise und rieb nervös meinen Nacken. Meine Haut prickelte, aber das war immer der Fall, wenn sich ein Mann in meinem Zimmer befand. Schon damals, als ich noch an Vigors Seite war. Ich hatte ihn nie geliebt, aber mein Vater hatte mich einfach mit ihm verheiratet, nachdem Vigor ihm eine ordentliche Stange Geld für mich geboten hatte. Der Firma meiner Familie, die damals in finanziellen Schwierigkeiten steckte, half es und ich war mir sicher, dass sie, seit dem Tag meiner Verlobung, wieder im Luxus lebten. Vigors Familie gehörte zu den Superreichen und solche Menschen konnten sich alles kaufen – selbst ihre Partner. Manche begaben sich freiwillig in lieblose Ehen, andere wurden hineingezwungen, so wie ich. Und nur wenigen gelang die Flucht. Meine wäre mit Sicherheit gescheitert, wären Stanislav Wolkow und seine byki nicht aufgetaucht. Bestimmt wäre ich gestorben, hätte Vladimir Wolkow mich nicht in die USA gebracht, aber ich wollte nicht länger unter ihrer Fuchtel stehen. Ich hatte Vigor verlassen, um mein Leben und mein Schicksal in meine Hände zu nehmen, aber die Bratwa ließ es nicht zu. Als ich ihnen meine Loyalität versprach, begab ich mich in ihren Besitz. Ich war nichts weiter als eine Schachfigur, die man beliebig aufs Feld setzen oder von ihm herunternehmen konnte.
Ich war ein Niemand, genauso wie der Namenlose in jener Zelle.
»Sehr gut«, sagte Vladimir lächelnd.
»Aber …«
Seine Miene nahm fragende Züge an. »Was ist noch, Julijana?«
»Wie ist sein Name?«, fragte ich vorsichtig und senkte den Blick, als er den Kopf neigte. Ich konnte nicht gut damit umgehen, wenn er mich so ansah. Es kam mir jedes Mal so vor, als würde er meine tiefsten Geheimnisse lesen können.
»Er hat keinen Namen.«
»Und wie soll ich ihn … ansprechen?«, wollte ich wissen.
»Kozel würde passen.« Ziegenbock.
Irritiert hob ich den Blick. »Ich möchte ihn nicht beleidigen.«
»Nenn ihn Mikhail.«
»Mikhail«, wiederholte ich leise. »Ist das wirklich sein Name?«
Vladimir nickte. »Es ist einer seiner Namen.« Er räusperte sich. »Aber du wirst ihn nur in seiner Zelle verwenden, verstanden?«
»Ja«, entgegnete ich hektisch nickend und schaute zur Seite.
Seine bohrenden braunen Augen taxierten mich. »Es geht nur um eine Stunde am Tag, Julijana, du wirst es überleben.«
Ich räusperte mich. »Ich habe eine Frage.«
»Stell sie.« Daraufhin setzte ich zum Reden an, jedoch unterbrach er mich: »Aber sieh mich dabei an.«
Ich sah wieder zu ihm und holte tief Luft. »Ich würde gern das Grundstück verlassen.«
Vladimir hob eine Augenbraue. »Warum?«
»Ich habe so viel über die Stadt gelesen, dass ich gern mehr davon sehen würde. Seit fünf Jahren bin ich in diesem Haus, habe nie das Grundstück verlassen, obwohl dort draußen eine wunderschöne Welt auf mich wartet. Ich möchte mich nur für einen Tag frei fühlen«, mit jedem Wort wurde meine Stimme leiser, bis ich den letzten Satz kaum hörbar von mir gab.
»Du weißt, dass das nicht geht.«
»Aber warum nicht?« Nun klang ich verzweifelt, aber ich riss mich zusammen, damit die Tränen nicht übermächtig wurden. Hier hatte ich mir das Weinen abgewöhnt. Einmal war ich dabei erwischt worden und man hatte mich schwach genannt, sogar ausgelacht, seither verbarg ich meine Gefühle.
»Vigor mag untergetaucht sein, nachdem du ihn an uns verraten hast, aber seine Männer suchen sicher immer noch nach dir, um dich wegen deines Verrats umzubringen«, antwortete er. Vladimir kam zu mir und legte seine Hände auf meine Schultern. »Ich weiß, dass du die Welt sehen möchtest, aber du bist immer noch in Gefahr.«
»Und meine Familie«, begann ich, »ist sie auch in Gefahr?«
»Ich gab dir damals das Versprechen, mich um ihren Schutz zu kümmern, und das halte ich.«
»Danke«, sagte ich ergeben und nahm auf meinem Bett Platz, jedoch erhob ich mich sofort wieder, weil ich nicht respektlos sein wollte. Ich durfte mich erst setzen, wenn er es erlaubte.
»Setz dich ruhig.«
»Danke«, wiederholte ich und ließ mich zurück auf die Matratze plumpsen. »Wegen meiner Bitte …«
»Hm?«
»Ich habe mich seit damals verändert. Vigors Männer würden mich sicher nicht erkennen.«
»Nur weil deine Haare länger sind und dein Gesicht ein wenig erwachsener aussieht, bist du kein anderer Mensch geworden, Julijana. Sie würden dich erkennen, deshalb solltest du dich hinter den sicheren Grundstücksmauern aufhalten.« Vladimir ging vor mir in die Hocke. Er tat es zum ersten Mal, um auf Augenhöhe mit mir zu sprechen. »Du stehst unter unserem Schutz, aber du musst Opfer bringen, damit wir dich beschützen können. Verstehst du das?«
»Ja«, antwortete ich kleinlaut. »Ich lasse meine Bitte fallen«, fuhr ich noch leiser fort.
Seine Mundwinkel zuckten, jedoch zeigte er mir kein Lächeln. »Sehr gut.« Vladimir richtete sich wieder auf. »Romana wird dir Bescheid geben, wenn sie das Essen gekocht hat, dann wird Aleksandr dich zu ihm bringen.«
Ich nickte. »Ich werde meine Aufgabe erfüllen.«
»Sehr gut. Ich vertraue dir, Julijana, enttäusch mich nicht.«
»Niemals«, entgegnete ich ergeben und stand auf. Ich brachte Vladimir zur Tür und ohne ein Wort des Abschieds ließ er mich allein. Verwirrt von seinem Besuch, mehr noch von seinen Worten, ging ich ans Fenster und sah hinaus. Mich trennte nicht viel von meinem Traum, die Stadt zu sehen, aber niemals würde ich auf die Idee kommen, die Wolkows zu hintergehen. Sie hatten mir das Leben gerettet, auch wenn ich eine Gefangenschaft gegen die andere eingetauscht hatte. Hier lebte ich wenigstens in Frieden und musste mich nicht jeden Tag vor meinem Mann fürchten. Denn ich war mir sicher, dass Vigor mich früher oder später totgeschlagen hätte.
Seufzend begab ich mich zum Bett und ließ mich auf die harte Matratze fallen.
* * *
Das heftige Pochen ließ mich die Augen aufschlagen und zur Tür blicken. Ich hatte das Gefühl, dass sie jeden Moment aus den Angeln brechen würde, weshalb ich mich schnell erhob, um sie zu öffnen.
»Romana hat das Essen fertig. Zeit, deine Aufgabe zu erledigen«, sagte Aleksandr übellaunig.
Ich nickte ihm zu. »D-darf … K-kann ich mir noch die Haare kämmen.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht ewig Zeit, um auf dich zu warten.«
Ein resignierter Laut drang über meine Lippen und ich folgte ihm mit hängenden Schultern in die Küche.
Als ich die Portion sah, die ich Mikhail bringen sollte, wunderte ich mich. »Fehlt noch etwas?«, fragte ich vorsichtig.
Romana sah mich streng an – sie war eine untersetzte ältere Frau, die ihre langen grauen Haare zu einem strengen Dutt gebunden trug, und meistens in einer schwarzen Kittelschürze arbeitete. »Nein, es fehlt nichts.«
Ich schluckte. »Aber es ist so wenig.«
»Er wird gerade so am Leben erhalten«, mischte Aleksandr sich ein.
»Soll ich mit ihm essen?«, erkundigte ich mich. »Oder es ihm nur bringen.«
»Hat der knyaz‘ dich nicht aufgeklärt?«, hakte sie nach.
»E-er sagte nur, d-d-dass ich ihm das Essen bringen und ihm G-G-Gesellschaft leisten soll«, erklärte ich kleinlaut und sackte etwas in mich zusammen.
»Dann nimm dir auch eine Portion«, schnappte sie und ließ eine der Aluminiumschalen vor mich fallen. Es schepperte, als sie auf den Boden aufschlug, und ich zuckte zusammen.
Zitternd hob ich sie auf, dann nahm ich mir eine Portion des Mittagessens. Es gab Kartoffelsuppe mit Fleischeinlage und Brot. Außerdem bediente ich mich an den Wasserflaschen, die herumstanden.
»Nur eine Flasche«, wies Romana mich streng an.
Ich schluckte. »Ich dachte, er würde auch etwas bekommen.«
»Du sollst nicht denken, Juna!«, herrschte sie mich so laut an, dass ich zusammenzuckte.
Ich verstand nicht, warum sie mich gerade so behandelte, sonst war sie immer freundlich zu mir. Aber womöglich gefiel ihr nicht, dass die Wolkows mir eine Aufgabe gegeben hatten.
»Er wird eine Flasche Wasser bekommen«, schaltete Aleksandr sich erneut ein. »Immerhin ist es seine Tagesration.«
Unruhig stellte ich meinen Teller auf das Tablett, legte zwei Scheiben Brot dazu und steckte die Wasserflaschen in die Bauchtasche meines weiten Pullovers. Nachdem ich zwei Löffel dazu gelegt hatte, nahm ich das schwere Tablett an mich und balancierte es auf den Flur.
Aleksandr führte mich in den labyrinthartigen Keller, in dem man sich problemlos verlaufen konnte. Hier unten hielten sich ein paar byki auf, die die Gefangenen bewachten. Aber so viel ich wusste, gab es momentan nur den Mann ohne Namen, oder Mikhail, wie ich ihn nennen durfte, der verpflegt wurde.
»Ich komme dich in einer Stunde abholen«, sagte er, nachdem wir die Zelle erreicht hatten.
Mit einem Nicken verschwand ich durch die Metalltür, die er nach seinen Worten geöffnet hatte, und betrat die Zelle.
Mikhail saß im Schneidersitz auf den Boden und sah mich müde an, als ich mich ihm langsam näherte. Etwa einen Meter vor ihm blieb ich stehen, stellte das Tablett auf den Boden und reichte ihm seinen Suppenteller. »Was ist das?«, wollte er wissen.
»K-kartoffelsuppe«, antwortete ich leise.
»Isst du mit mir?«
Ich nickte langsam und setzte mich auf der anderen Seite des Tabletts auf den Boden. »Hier ist Ihr Löffel«, wisperte ich und reichte ihm diesen.
Als er ihn mir abnahm, streiften seine Finger meine Haut. Diese kleine Berührung jagte einen Blitz durch meinen Körper, der mich für einen Moment erstarren ließ. »Danke«, sagte er schwach und lehnte sich mit dem Teller in der einen und dem Löffel in der anderen Hand zurück.
Ich rang mir ein schwaches Lächeln ab, das sicher nicht meine Augen erreichte.
»Du bist Russin.«
»Ja.«
»Woher kommst du?«
»Moskau«, sagte ich knapp und griff zu meinem Teller, allerdings hatte ich gar keinen Appetit, weshalb ich das aufgeheizte Aluminium bloß festhielt. Meine Hände waren kalt und es fühlte sich unnatürlich heiß an, aber wenigstens wärmte es mich in dieser eiskalten Zelle ein wenig. Es wunderte mich, dass Mikhail noch nicht erfroren war.
»Meine Familie stammt aus St. Petersburg.«
Ich sah auf meine Suppe.
»Du redest nicht gern, nicht wahr?«
Daraufhin schüttelte ich den Kopf.
»Warum nicht?«
»Weiß ich nicht«, antwortete ich eingeschüchtert. Ich wusste nicht, warum, aber dieser Mann jagte mir Angst ein. Er wirkte gefährlich, obwohl er so freundlich klang und seine hellbraunen Augen so unschuldig wirkten.
»Das muss doch einen Grund haben.«
»Nein«, wisperte ich. Widerwillig hob ich den Blick und sah ihm beim Kauen zu. Die Schale in meiner Hand kühlte langsam ab, dennoch hatte ich nicht vor, meine Portion zu essen.
Als Mikhail seinen Suppenteller wenig später auf das Tablett stellte, bot ich ihm meine Portion an. »Bist du nicht hungrig?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Und du willst mir dein Essen geben?«
Ein Nicken und ich hielt ihm meine Kartoffelsuppe unter die Nase.
»Danke, Juna.«
Ich zog nur einen Mundwinkel hoch, doch versteinerte meine Miene schnell wieder.
Er aß, auch das Brot genoss er und ich erkannte, dass sein Gesicht etwas mehr Farbe annahm. »Ich habe schon lange nicht mehr so viel gegessen, bis ich satt war.«
»Tut mir leid«, sagte ich leise.
»Ich danke dir, Juna.«
Ich holte die Wasserflaschen heraus, reichte ihm eine und öffnete dann meine. Nachdem ich einen kleinen Schluck getrunken hatte, ließ ich meinen Blick durch den dunklen Raum schweifen.
»Nicht gerade einladend, hm?«
»Nein.«
»In sechsundneunzig Tagen bin ich seit zwei Jahren hier drin.«
»Warum?«, fragte ich und schaute zu ihm.
»Wegen meiner Taten.«
»Welche?«
»Sie waren grausam, das hier ist meine Strafe.«
»Gehörst du zu denen, die schreien, Mikhail?«
Er sah mich überrascht an, dann zuckten seine Mundwinkel und er schenkte mir ein Lächeln, das mein Herz etwas schneller schlagen ließ – ich schob es auf die Aufregung, weil er beängstigend wirkte. »Ich wurde schon lange nicht mehr mit einem meiner Namen angesprochen.«
»Vladimir Wolkow sagte, dass nur ich Sie damit ansprechen darf.«
Überrascht hob er eine Augenbraue, aber der skeptische Ausdruck ließ ihn mehr überfordert wirken. »Ich bin ein Gefangener, du darfst mich duzen«, meinte er, nachdem er seine Miene wieder unter Kontrolle hatte. »Immerhin tue ich das auch.«
»Okay.« Das war eines der wenigen englischen Worte, die ich aufgeschnappt hatte, und nachdem ich Vladimir Wolkow gefragt hatte, was es bedeutet, und erfahren hatte, dass es eine Bestätigung war, benutzte ich es ab und zu. Als ich erkannte, dass er dabei war, sein Wasser zu leeren, reichte ich ihm meine Flasche.
»Danke«, sagte Mikhail abermals.
»Was hast du getan, dass du hier drin bist?«
Er räusperte sich. »Ich habe Schande über die Familie gebracht und unverzeihliche Dinge getan, die ich inzwischen bereue.« Mikhail lehnte sich gegen die Mauer hinter sich und legte den Kopf in den Nacken. »Wenn man hier drin ist, hat man eine Menge Zeit zum Nachdenken.«
Mir fiel ein, dass er meine Frage, ob er zu jenen gehören würde, die ich schreien hörte, übergangen hatte, weshalb ich sie erneut stellte.
»Nein, ich werde nicht gefoltert.«
»Wer dann?«
»Männer, die ihre Leben verwirkt haben«, sagte er schlicht und trank einen weiteren Schluck Wasser. »Mich lassen sie hier drin verrotten, was eine viel schlimmere Strafe ist.«
»Hast du diese Zelle jemals verlassen?«
»Nein, aber bald werde ich das. Der Pakhan hat mir eine Stunde«, mit den Fingerspitzen deutete er Anführungszeichen an, »Freigang pro Woche erlaubt.« Dann neigte er den Kopf, was mich unweigerlich an Vladimir Wolkow erinnerte. »Warum bist du hier?«
»Zu meinem Schutz«, antwortete ich.
»Warum?«
»Ich wurde verfolgt, dann von den Wolkows hierher gebracht. Sergej Sorokin schickte mich in dieses Haus, damit ich in Sicherheit bin«, antwortete ich leise.
»Sergej Sorokin?«
»Ja.«
»Er war ein großer Mann, bis der Hass ihn geblendet hat.«
Unwissend zuckte ich mit den Schultern. »Ich hatte nur einmal mit ihm zu tun.«
»Du hast ihn nicht mehr gesehen, seit du hierher geschickt wurdest?«
»Nein, ich weiß nur, dass er vor ungefähr zwei Jahren gestorben ist«, entgegnete ich und zog meine Beine an. Ich schlang die Arme um sie, weil es mich fröstelte. »Ich weiß nicht, wie er zu seinen Mitmenschen war.«
»Er war ein Schwein«, sagte Mikhail schlicht. »Ein wirklich mieses Schwein.«
Dieses Gespräch war unangenehm, aber ich wollte den Pakhan nicht enttäuschen, weshalb ich es nicht unterband. »Kanntest du ihn gut?«
»Sehr gut sogar.«
»Woher?«, wollte ich wissen.
»Ich bin … war … für ihn tätig«, antwortete er zögerlich.
»Hat er dich hier eingesperrt?«
Mikhail schüttelte den Kopf. »Das war Ivan Wolkow.«
»Der Pakhan«, murmelte ich. Aber ich verstand immer noch nicht, welche Verbrechen er begangen hatte, dass die Bruderschaft ihn eingesperrt hatte. Vladimir hatte mir einmal erklärt, dass jedes Verbrechen gegen die Bratwa mit dem Tod bestraft wird. Ich wollte nicht weiter nachhaken, denn Mikhail wirkte nicht so, als wolle er noch länger über dieses Thema sprechen.
Hinter mir ertönte ein schabendes Geräusch, weshalb ich mich schnell erhob. Ich nahm die leere Wasserflasche an mich, auch hob ich das Tablett mit dem benutzten Geschirr hoch.
»Ist die Stunde schon vorbei?«, fragte Mikhail, als die Metalltür geöffnet wurde.
Als ich mich dorthin umdrehte, sah ich Aleksandr nicken. Ich schaute noch einmal zu Mikhail. »Gute Nacht.«
»Ebenso«, erwiderte er, aber würdigte mich keines Blickes.
Ich verließ die Zelle und folgte dem Nachtwächter in die Küche, nachdem er Mikhail eingeschlossen hatte.
»Hat er mit dir gesprochen?«
»Ja.«
»Worüber?«
»Er sagte, er sitzt dort drin, weil er ein schlimmes Verbrechen begangen hat«, antwortete ich aufrichtig. »Und dass er den alten sowie den neuen Pakhan kennt.«
Aleksandr musterte mich streng. »Sonst noch was?«
»Nein«, entgegnete ich kleinlaut. »Ich habe ihm einfach nur zugehört.«
»Und dann war das das Einzige, was er sagte?«, hakte er argwöhnisch nach.
»Nein, er sagte auch, dass er seit fast zwei Jahren dort drin ist und seither nicht mehr im Freien war.«
»Das wird sich wieder ändern. Der Pakhan hat entschieden, dass er einmal pro Woche die Zelle verlassen darf«, sagte Aleksandr ernst.
»Warum sagen Sie mir das?«, erkundigte ich mich verwirrt. Ich war nicht wichtig für diese Männer, deshalb wunderte es mich, dass er mir diese Dinge erzählte.
»Konversation«, sagte er schlicht und wies mich an, das benutzte Geschirr zu spülen.
* * *
Nachdem ich stundenlang damit beschäftigt gewesen war, die Küche zu putzen und alles zu spülen, hatte ich mich in mein kleines Schlafzimmer auf dem Dachboden zurückgezogen. Die Luft roch muffig, aber nicht so schlimm wie in Mikhails Zelle. Seine aufrichtigen hellbraunen Augen verfolgten mich, blickten mir entgegen, wann immer ich meine schloss. Ich wusch mich an dem kleinen Waschbecken, sehnte mich einmal mehr nach einer richtigen Badewanne oder einer Dusche, aber die Männer ließen mich das Bad nicht benutzen. Und jenes unter dem Dach war baufällig. Dort durfte ich weder duschen noch baden. Ich verstand nicht, warum ich meiner Körperpflege nicht auf der ersten Etage nachgehen durfte, aber wollte keinen Ärger riskieren, indem ich es doch tat. Deshalb wusch ich mich immer am kleinen Waschbecken in meinem Zimmer. Es war zwar nicht dasselbe, aber ich war froh, mich überhaupt waschen zu können.
Nachdem ich die Seife aus meinen Haaren gewaschen hatte, wickelte ich ein Handtuch um sie und legte mich ins Bett. Ich hatte nur ein Stück Kernseife, kein Duschgel oder Shampoo, aber nach fünf Jahren hatte ich mich daran gewöhnt, auf jeden Luxus verzichten zu müssen.
* * *
Mikhail
Seit einer Woche kam Juna zu mir, brachte mir das Essen und überließ mir zumeist noch ihre Portion. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich mich nicht schwach fühlte. Aber wann immer ich versuchte, mehr über sie zu erfahren, blockte sie ab. Juna sprach nicht viel, sie fragte, bekam eine Antwort und stellte womöglich noch eine Frage, aber dann schwieg sie wieder. Dass sie meinen Blicken auswich und sich bei jeder Berührung verkrampfte, ließ mich nur erahnen, was sie durchgemacht hatte. Womöglich war sie vor jemandem weggelaufen und deshalb hier. Sie kannte meinen Vater, aber ich hatte keine Ahnung, ob ich sie jemals gesehen hatte. Viele von Papas Geschäften interessierten mich damals nicht. Vladimir, Ivan und ich hatten als Kinder zwar eine Menge Unterricht bekommen und wurden in viele Angelegenheiten eingeweiht, aber meistens hatte ich nicht zugehört. Jedoch war ich vor fünf Jahren schon mit Samara zusammen und wir hatten im Haus meines Vaters gelebt, das jetzt von Ivan und meiner Frau bewohnt wurde. Na ja, Samara war nicht mehr meine Frau, wir hatten die Scheidungspapiere gefälscht und Ivan hatte meine Unterschrift bekommen. Ich wusste, dass er das nur getan hatte, um sie zu schützen, falls jemals herauskommen sollte, dass ich damals nicht gestorben bin, nachdem ich meinen Tod vorgetäuscht hatte. Denn hätte jemand davon erfahren, hätte ihr ein Verfahren wegen Bigamie gedroht.
Das hatte sie nicht verdient.
Als ich erfuhr, dass sie sich auf meinen Cousin eingelassen hatte, wollte ich ihr wehtun. Und beinahe hätte ich das auch getan. Nein, ich wusste, dass ich sie verletzt hatte, aber ich kannte sie. Sie kam bestimmt damit zurecht, sonst würde ich nicht mehr leben. So gut kannte ich meinen Cousin.
Die schwere Tür zu meiner Zelle wurde geöffnet. »Dein Hofgang, Junge«, sagte Aleksandr ernst und deutete auf den Gang.
Ich erhob mich von meinem Strohlager und folgte ihm nach draußen. Das Neonlicht auf dem Flur blendete mich und ich kniff die Augen zusammen, bis ich mich daran gewöhnt hatte. »Werde ich bewacht oder bin ich allein im Garten?«
»Du wirst bewacht oder glaubst du, der Pakhan riskiert, dass du abhaust?«
»Ihr hättet mich erschossen, bevor ich die Mauer erreicht habe.«
»Stimmt.«
Ich schnaubte wegen seiner Selbstsicherheit. Früher war ich nicht anders. Ich fühlte mich unantastbar, weil ich der knyaz‘ war. Mit einem Fingerschnippen sorgte ich damals dafür, dass ganze Familien ausgelöscht wurden, heute verhallte es in meiner schimmeligen Zelle. »Wird die Kleine auch im Garten sein?«
»Ich weiß es nicht.«
»Warum nicht?«
»Weil ich sie nicht überwache.«
»Aber du bringst sie immer zu mir.«
Aleksandr blieb stehen und drehte sich zu mir um. »Das ist etwas Anderes. Mein Befehl lautet, dich im Auge zu behalten, und nicht das Mädchen, das hier Zuflucht sucht und unter dem Schutz der Bruderschaft steht. Nun hör auf, meine Geduld, auf die Probe zu stellen.«
»Warum sollte ich?«
Er schnaubte. »Wenn du nicht der knyaz‘ gewesen wärst, hätte ich dich schon längst erschossen«, knurrte er dann.
Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Dennoch sagte ich nichts, um ihn nicht noch weiter zu provozieren. Schließlich setzte er sich wieder in Bewegung und ich folgte ihm. Die frische Luft war eine Wohltat und ich atmete tief durch. Es fühlte sich an, als würde sie meine Lungen reinigen, die sicher voller Schimmelsporen waren. Ich nahm mehrere tiefe Atemzüge, bis das Kratzen in meinem Hals verschwunden war. Die Sonne schien, wärmte meine Haut und ich genoss es, sie endlich wieder zu spüren.
Als ich die Lider aufschlug, sah ich sie.
Juna hockte vor einem Blumenbeet und grub Löcher in die Erde. Ich machte einen Schritt auf sie zu.
»Was wird das?«, schaltete Aleksandr sich ein und stellte sich mir in den Weg.
Ich sah ihn finster an. »Ich werde doch wohl helfen dürfen, wenn ich sehe, dass sie sich abmüht, oder?«
Er drehte sich um und betrachtete Juna für meinen Geschmack etwas zu lange. »In Ordnung«, sagte er schließlich, ohne mich anzusehen.
»Spasibo«, erwiderte ich, trat an ihm vorbei und ging zu Juna. »Kann ich helfen?«
Sie hielt inne und schaute zu mir auf, dabei schirmte sie ihre Augen mit ihrer rechten Hand vor der Sonne ab. »Ich bin gleich fertig.« Danach konzentrierte sie sich wieder auf ihre Aufgabe.
Beim näheren Hinsehen erkannte ich, dass sie noch vier Paletten mit Blumen neben sich aufgereiht hatte. »Das sind gut und gerne vierzig Blümchen.«
»Aber es dauert nicht so lange, sie einzupflanzen«, entgegnete sie, ohne mich anzusehen.
»Ich mache dir einen Vorschlag«, begann ich und ging in die Hocke.
Juna schaute immer noch nicht zu mir.
»Wenn du mich ansehen würdest, wäre es etwas angenehmer, mit dir zu sprechen.«
Seufzend drehte sie den Kopf und sah mich an, allerdings fixierte sie einen Punkt auf meiner Stirn.
»Ich grabe die Löcher und du pflanzt die Blumen ein.«
Junas Mundwinkel zuckten kurz, bevor sie sich geschlagen gab. »In Ordnung.« Sie überließ mir die kleine Schaufel und ich fing an, Löcher in die Erde zu graben. Juna krabbelte um mich herum, nahm das erste Stiefmütterchen, oder was auch immer das für Blumen waren, in die Hand und pflanzte es in das Loch, das sie zuvor noch gegraben hatte.
»Wie geht’s dir heute?«, erkundigte ich mich, um Konversation zu führen.
»Ich bin müde, aber sonst ist alles gut.« Sie hielt inne und sah mich an. »Wie geht’s dir?«
»Sehr gut. Ich atme das erste Mal, seit sehr langer Zeit, wieder frische Luft.«
Endlich zeigte sie mir den Anflug eines Lächelns. »Es freut mich, dass es dir gut geht.«
»Mich auch«, erwiderte ich, dann konzentrierte ich mich wieder auf die Aufgabe, die ich ihr abgenommen hatte.
Aleksandr hielt sich in unserer Nähe auf, behelligte uns aber nicht.
»Was hast du heute so gemacht?«
»Ich habe gefrühstückt und nach dem Frühstück wurde ich in den Garten geschickt.« Sie räusperte sich. »Das ist bereits das dritte Beet, das ich umgrabe und bepflanze.«
»Ich weiß gar nicht, wie spät es ist.«
»Ich auch nicht. Ich arbeite einfach, bis ich wieder ins Haus gerufen werde«, sagte sie leise. »Vorher lässt sie mich sowieso nicht aufhören.«
»Wer?«
»Romana. Sie ist die Köchin und na ja, ich glaube, sie leitet dieses Haus gemeinsam mit Aleksandr«, antwortete sie leise, sodass nur ich sie hören konnte.
Ich nickte verstehend. »Romana also.« Ich wusste genau, von wem sie sprach. Die Alte war ein Drachen ohnegleichen. Ich hatte sie nie leiden können und schon als Teenager hatte ich mir geschworen, sie in die Wüste zu schicken, sobald ich die Stellung meines Vaters übernommen hatte. Aber Ivan hatte meinen Posten übernommen, nachdem ich meinen Tod vorgetäuscht hatte, um diesem Leben zu entfliehen. Wäre Samara damals nicht zur perfekten Bratwa-Ehefrau geworden, hätte ich sie mit mir genommen. Aber sie hatte sich zu gut in dieses Leben gefügt und manchmal sogar die Formulierungen meines Vaters heruntergebetet, wenn ich mich über ihn aufgeregt hatte. Und irgendwann hatte ich angefangen, mich zu »entlieben«, bis ich schließlich den Entschluss gefasst hatte, für meine Familie zu sterben. Natürlich hatte ich sie im Auge behalten, um sicherzugehen, dass sie alle zurechtkamen. Heute wusste ich, dass es dumm war. Es wäre besser gewesen, sie alle hinter mir zu lassen und irgendwo ein neues Leben anzufangen.
»Sie ist wirklich streng und ich glaube, sie mag mich nicht«, sagte Juna niedergeschlagen, als sie zu einem weiteren Blümchen griff, um es einzupflanzen.
»Wie kann man dich denn nicht mögen?«, wollte ich wissen.
Mitten in der Bewegung hielt sie inne. »Ich glaube, das ist ganz einfach.«
Todesmutig, weil ich wusste, Aleksandr würde mich erschießen, wenn er glaubte, dass Juna in Gefahr war, legte ich meine Hände um ihre beiden kleinen, die die Blume umklammert hielten. »Nein, es ist wirklich verdammt schwer, dich nicht zu mögen, Juna«, raunte ich ihr zu und im nächsten Moment spürte ich das kalte Metall von Aleksandrs Magnum am Hinterkopf. »Du lässt sie ganz langsam wieder los«, knurrte er.
Ich atmete tief durch, dann zog ich mich etwas von Juna zurück. Es war zum Kotzen, dass ich sie nicht einmal berühren durfte, ohne dafür eine Waffe an den Kopf gehalten zu bekommen.
»Gut so«, merkte er an und nahm die Magnum von meinem Hinterkopf. »Ist alles in Ordnung, Kleine?«
»Er hat mich nicht bedroht«, erwiderte sie leise, doch ich sah das Funkeln in ihren bernsteinfarbenen Augen. War sie etwa wütend, weil er uns unterbrochen hatte?
»Das ist auch besser so«, brummte Aleksandr und zog sich zurück.
»Es tut mir leid«, wandte ich mich an sie.
»Warum?« Sie schaute wieder auf das Beet vor uns, statt mir ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken.
»Ich hätte wissen müssen, dass er eingreift, wenn ich dich berühre.«
Daraufhin tastete sie nach meiner Hand. »Vielleicht greift er ja nicht ein, wenn ich dich berühre.«
Ich erstarrte, als sie mich schließlich berührte. Ihre Finger waren zwar eiskalt, aber ich hatte das Gefühl, dass sich ein Feuer in meinem Arm ausbreitete.
Juna schaute an mir vorbei und grinste leicht. »Nein, dann greift er nicht ein.« Schließlich konzentrierte sie sich wieder und setzte immer mehr Blumen in die Erde. Die Löcher grub sie einfach mit den Händen, weil ich immer noch zur Salzsäule erstarrt war.
Es war das erste Mal, dass sie mich aus freien Stücken berührt hatte. Sonst war es immer nur zu flüchtigen Berührungen gekommen, die wiederum sie erstarren ließen. Was war ihr geschehen, dass sie sich so verhielt? Ich wollte mehr über sie erfahren, nein, ich wollte alles erfahren, aber wusste, dass ich mich ihr vorsichtig nähern musste.
* * *
Aleksandr räusperte sich hinter uns. »Kleine, geh ins Haus.«
Juna schaute zu ihm. »Ich bin noch nicht fertig. Romana wird sicher wütend, wenn ich jetzt schon ins Haus gehe.«
»Geh. Ins. Haus!«, herrschte er sie so laut an, dass sie zusammenzuckte.
Juna senkte den Blick, rappelte sich auf und eilte zum Haus.
Irritiert sah ich ihr nach, bis Aleksandr mir gegen die Schulter stieß. »Deine Stunde ist um.«
Ich erhob mich und ließ mich von ihm in meine Zelle bringen. Aleksandr zog die Tür hinter mir zu, nachdem ich mich freiwillig in die schimmeligen Mauern begeben hatte. Seufzend ließ ich mich auf meinem Strohlager nieder und lehnte mich mit dem Rücken gegen die Wand. Die Luft hier drin war abgestanden, feucht, faulig und ich überlegte fieberhaft, wie ich diesem Höllenhaus entkommen konnte. Lediglich Juna war ein Lichtblick, wenn ich mich in dieser dunklen Zelle befand.
Auf einmal zerrissen Schreie die Stille und ich zuckte überrascht zusammen. Vermutlich war Vlad wieder am Werk und quälte irgendjemanden. Ich wusste es nicht, aber es war die einzige Erklärung für das Gezeter. Unter seinen Händen wurden die härtesten Kerle zu eingeschüchterten Kastraten – im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Cousin wusste, wie er ihnen ihre Geheimnisse und Pläne entlocken konnte, ohne sie zu schnell umzubringen. Das große Finale war meistens seine Kastrationszange oder Starterkabel, die einem mehrere Volt Strom direkt in den Schwanz jagten, bis man sich vollpisste, heulte und am Ende seinen Kopf verlor.
* * *
Erst Stunden später war das Geschrei verstummt und ich wusste, dass Vlads Opfer tot war. Hierher kamen sie nur, wenn ihnen ihr Ende blühte. Die Metalltür wurde mit einem Schaben geöffnet und eine leichenblasse Juna trug ein Tablett hinein. Sie stellte es vor mich und wandte sich ab.
»Bleibst du heute nicht bei mir?«
Sie hielt inne, ihre Schultern sackten hinab, dann drehte sie sich zu mir um. »Ich glaube, ich kann heute nicht mit dir essen.«
Mein Blick fiel auf das Tablett. Es standen zwei Teller darauf, ebenso sah ich die beiden Wasserflaschen, die darauf lagen. »Warum nicht?«, erkundigte ich mich, als ich sie wieder ansah.
»Ich habe gerade einen … einen Ma-Ma-Mann o-o-ohne K-K-Kopf gesehen«, stammelte sie und ich erkannte die Tränen, die in ihren Augen standen, ebenso das Zittern ihres Körpers.
Ich stand auf und überwand die wenigen Schritte bis zu ihr. Juna senkte sofort den Blick, sie schwankte. Ohne noch länger nachzudenken, zog ich sie an mich und umarmte sie fest. »Es ist alles gut.«
Sie schüttelte hektisch den Kopf. »Nein, ich … ich glaube, ich … werde d-d-d-das Bild nicht mehr … nicht mehr los«, schluchzte sie.
Ich legte meine Hand in ihren Nacken, streichelte sie und hoffte, dass sie sich beruhigen würde, aber dem war nicht so. Ihre Beine gaben unter ihr nach und ich ging mit ihr auf die Knie. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, in der wir einfach nur so da saßen und ich darauf wartete, dass sie sich fing. Um sie zu beruhigen, begann ich, ein russisches Kinderlied zu singen. »Ein Lächeln erhellt einen düsteren Tag. Ein Lächeln weckt einen Regenbogen am Himmel. Teile dein Lächeln mit jemandem und es wird mehr als nur einmal zu dir zurückkehren. Und dann wird es wohl so sein, dass die Wolken plötzlich zu tanzen beginnen, und die Grille auf der Geige zu klimpern anfängt …«
Sie wurde ruhiger. »Meine Mama hat mir das immer vorgesungen.« Ihre Stimme klang heiser.
Als sie den Blick hob, streichelte ich mit meiner linken Hand die Tränen von ihrer Wange. »Wie fühlst du dich?«
Ihre Unterlippe zitterte. »Ich … weiß es nicht.«
Ich erhob mich und nahm sie auf meine Arme, dann trug ich sie zu meiner Schlafstätte. Dort setzte ich mich wieder und zog sie auf meinen Schoß.
Juna lehnte ihren Kopf an meine Schulter. Ihr Körper zitterte unentwegt, während ich weiter Das Lächeln sang. Dieses Lied hatte Mama mir immer vorgesungen, als ich noch ein Kind war. In diesem Moment erinnerte ich mich an Anastasia, meine Schwester, die viel zu früh aus dem Leben geschieden war, und meinen Vater, der meine Kindheit zu einem militärgleichen Drill gemacht hatte. Unbeschwerte Momente verbrachte ich bloß mit Mama und Anastasia.
»Mikhail?«
»Hm?«
»Danke«, wisperte sie.
»Wofür?«
»Dass du mir Halt gibst, das hat seit Jahren niemand getan«, fuhr sie gedämpft fort und sah mich an. Ihre Augen waren gerötet, ihre Nase geschwollen und ihre Wangen nass.
Vorsichtig nahm ich ihr Gesicht in meine Hände. »Dafür musst du mir nicht danken.«
Ihre Lider fielen zu.
»Warum vermeidest du es immer wieder, mich anzusehen?«
»Erinnerungen.«
»Woran?«, hakte ich nach.
»An jemanden, der mein Leben zur Hölle gemacht hat«, antwortete sie leise und wollte sich von mir lösen, aber ich ließ es nicht zu.
»Ich würde dir niemals wehtun, Kotenok«, raunte ich und legte meine Stirn an ihre. Kätzchen.
Ihre Unterlippe zitterte, ihr Atem streifte mein Gesicht. »Wirst du mich jetzt küssen?«
»Ist es das, was du willst?«, fragte ich mit rauer Stimme.
»Nyet«, hauchte sie, doch ihr Blick fiel auf meine Lippen. »Das möchte ich nicht.«
»Und wenn ich es trotzdem tue?«
»Werde ich schreien.«
Ich schnaubte amüsiert, wischte eine weitere Träne von ihrer Wange und gab sie frei. »Lass uns essen, Kotenok.«
Juna kletterte von meinem Schoß und ließ sich neben mich sinken. »Ich bin nicht hungrig.«
Daraufhin betrachtete ich sie. »Hast du heute schon gegessen?«
»Ja, aber der Appetit ist mir vergangen, als die byki mir die Leiche dieses Mannes entgegengetragen haben«, antwortete sie und schluckte hart. Sie sah zu mir. »Wenn du möchtest, kannst du meine Portion auch essen.«
Ich wollte nicht, dass sie mir dabei zusah, wie ich beide Portionen aß. Ich wollte, dass sie auch etwas zu sich nahm, statt darauf zu verzichten, wie sie es in den letzten Tagen getan hatte. Juna wirkte ausgelaugt, müde und vor allem hatte sie abgenommen. »Ich möchte, dass du es isst.« Ich bemühte mich darum, entschieden zu klingen, obwohl ich diesen Tonfall ewig nicht mehr angeschlagen hatte. Ich nahm ihren Teller und reichte ihn ihr. »Bitte iss etwas.«
Seufzend gab sie sich geschlagen. »In Ordnung.«
»Danke.« Lächelnd nahm ich mir meine Portion und begann zu essen, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen.
Sie aß zurückhaltend, aber das störte mich nicht.
Hauptsache sie aß.
* * *
E