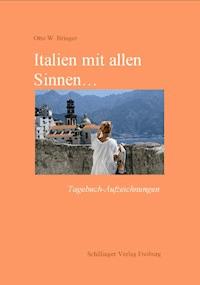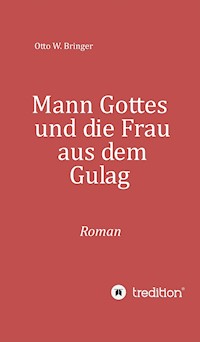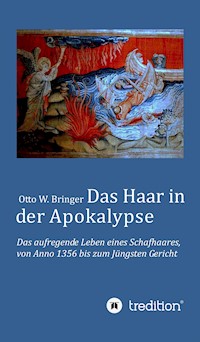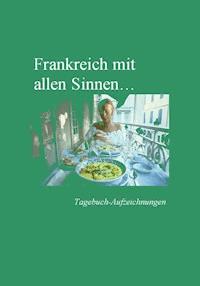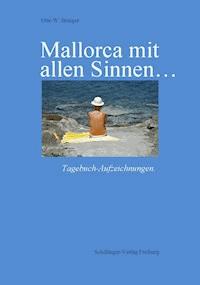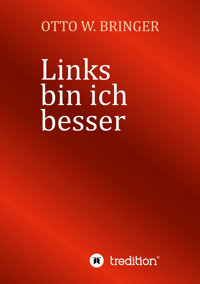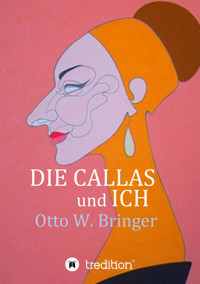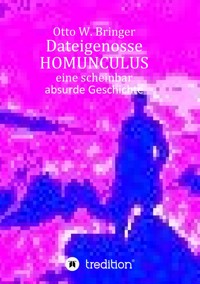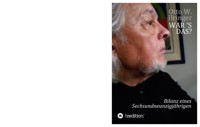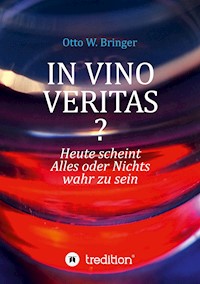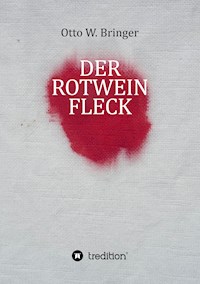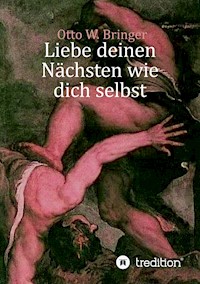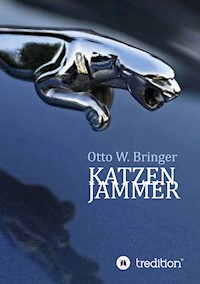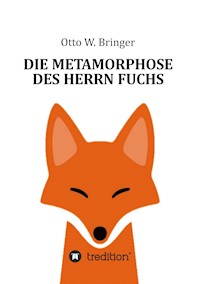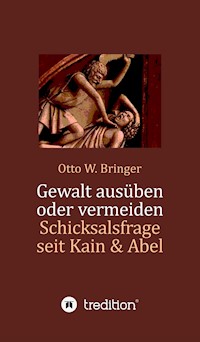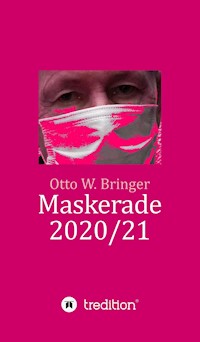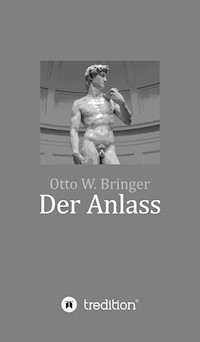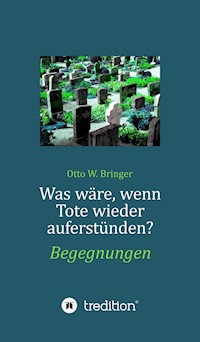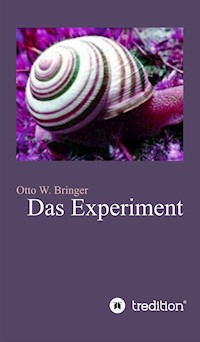
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte des Philippe Emmanuel Escargot erzählt von einem hochbegabten Jungen. Er ist klein von Statur aber ein großer Träumer. Häuser will er für die Menschen bauen, die wie Schneckenhäuser aussehen. Die Natur ist für ihn eine unerschöpfliche Fundgrube … zu erkennen, wie Häuser von Tieren entstehen, sich Sozialstaaten bilden, die denen der Menschen überlegen sind fasziniert ihn. Er lebt im Elsass, hat mit Bestnoten das Gymnasium geschafft und wurde im Krieg mit dem Kreuz der Ehrenlegion ausgezeichnet. Das wurde mit einem Stipendium für die Technische Hochschule in Strasbourg belohnt. Er hat immer noch Schneckenhäuser im Kopf, doch seine Professoren halten seine Idee für nicht staatskonform und relegieren ihn kurz vor dem Examen. Er versucht in einer einsam gelegenen Hütten Klarheit zu gewinnen. Gott ist im Spiel und Aurélie, eine Kommilitonin. Seine Mutter und ihr Mann, der nicht sein Vater ist, ebenfalls. Alle Gedanken kreisen um sein Schneckenhaus. Erfolge und Niederlagen wechseln sich ab, wirklich real werden sie nicht. "Muss ich selber eine Schnecke sein, um Schneckenhäuser für Menschen bauen zu können?", fragt er sich und probiert es aus. Das Experiment scheint zu gelingen. Roman oder Parabel? Kleine Menschen wollen oft größer sein, um respektiert zu werden, schaffen Großes und bringen andere dazu, nachzudenken. Über Groß und Klein. Oder umgekehrt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Otto W. Bringer
Das Experiment
Otto W. Bringer
Das Experiment
Copyright: © 2017 Otto W. Bringer
Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlaggestaltung und künstlerische Bearbeitung der Archivfotos vom Autor
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
ISBN 978-3-7439-8309-0 (Paperback)
ISBN 978-3-7439-8310-6 (Hardcover)
ISBN 978-3-7439-8311-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Aller Anfang ist klein
Krieg – eine Chance?
Warum Theologie?
Ein Haus darf keine Schnecke sein
Perspektiven
Die schöne Aurélie
Grande Ballon
Ein Paradies für Tiere
Liebe eine Himmelsmacht?
Hieronymus im Ried
Corbusier lockt
Irrititationen
Paris
Typique Corbusier?
Unterwegs nach Marseille
Der Afrikaner
Aus der Traum?
Präsentation in Venedig
Die Formel
Aller Anfang ist klein
Philippe war klein. Als 6jähriger einen Kopf kleiner als alle anderen in seiner Klasse. Er blieb klein als Erwachsener, wie Charles Aznavour. 1,50 m in etwa. Mit dem er über siebenundzwanzig Ecken verwandt ist, meint man es charakterlich. Wie er ehrgeizig. Sehr ehrgeizig. Wie kleine Menschen oft danach streben, größer zu sein als sie sind. Die fehlenden Zentimeter ausgleichen durch Anstrengung. Hoch gesteckte Ziele. Der größte zu sein in ihrem Metier. Der Erfinder des Taschenschirms „Knirps“ war auch 1,50 m klein, sein Schirm 25 cm kurz. Weltweit berühmt, weil unerhört praktisch. Soweit aber ist Philippe noch nicht.
Philippe hatte noch einen zweiten Vornamen: Emmanuel. Wie der Sohn Johann Sebastian Bachs. Ein fast so großer Komponist wie sein Vater. Unser Philippe Emanuel aber ganz und gar nicht musikalisch. Das Gegenteil eher. Als Baby schon krähte er lauthals Protest, wenn seine Mama ihm ein Schlaflied vorträllerte. Sich bemühte, ihrer Stimme einen weichen Klang zu geben. Damit ihrem kleinen Philippe endlich die Augen zufielen. Der aber griff nach den Bauklötzchen, die seine Mama ihm immer wieder aufs Kissen legte, wenn er sie in hohem Bogen auf den Boden geworfen hatte. Spielmaterial eines geborenen Genies.
Eines Abends schien er eingeschlafen, atmete lauter als sonst. War seine Mama aus dem Zimmer, begann er mit den Klötzen zu bauen. Schob das Kissen beiseite und begann die würfelförmigen, 5 × 5 × 5 cm dicken Kuben aufeinander zu stapeln. Einen nach dem anderen, nicht gerade akkurat. Aber sie blieben aufeinander. Schwankten ein bisschen. Schwankten mehr, legte er einen neuen Klotz darauf. Bis zum dreizehnten. Dann fiel der Turm zusammen. Überlegte, woran liegt das? Die Matratze zu weich? Jetzt könnte einer zweifeln, dass ein zweijähriger Bub schon physikalisch denken kann. Aber Philippe war wie gesagt ein Genie. Kletterte aus dem Bettchen, nahm das Kissen mit und schleppte es bis in die Ecke des Zimmers.
Holte die Bauklötze durchs Gitter aus dem Bett auf den Boden, der ein glatter Boden war. Schön blank gebohnertes Parkett aus Eichenholz, im Fischgrätmuster verlegt. Setzte den ersten Klotz, den zweiten, dritten aufeinander. Wunderte sich gar nicht, dass der Turm noch beim dreiundzwanzigsten Bauklotz stand und nicht schwankte. Ob er sich fragte: bin ich bin ein Zauberkünstler? Einer, der Häuser bauen kann, Kirchen und Türme, so hoch bis jenseits der Wolken? Ein kinderfreundlicher Mensch würde es ihm unterstellen.
Vielleicht sogar ganz klitzekleine Häuser zu bauen, wie Schnecken sie auf ihrem Leib herumschleppen, wo sie auch sind? Häuser, in die sie gerade hineinpassen, ziehen sie sich zusammen. Maßgeschneidert, Platz gespart. Hätte er sie schon gekannt.
Philippe aber unzufrieden. Stieß den Turm aus dreiundzwanzig Bauklötzen mit dem Ellenbogen um, dass es klickerte und kleckerte, der letzte Klotz nur noch klock machte. Holte sich das Kissen aus der Zimmerecke und zog es sich über den Kopf. Stellte sich vor den Spiegel an der Wand. Und sah die Bescherung. Kleiner Mann im großen weißen Haus noch kleiner als er war. Machte ein paar Schritte und dachte: „Großes, weißes Haus auf Wanderschaft.“ Der Mensch in ihm unterwegs zu neuen Zielen. Unterwegs und dennoch zuhause. Jeden Tag. Jede Nacht. Weißes Haus über dem Kopf.
Das wichtigste bei Menschen und den meisten Säugetieren, geschützt zu sein unter einem Dach. In dem man sich wohl fühlt, weich wie ein Kissen, in das man sich verkriecht, wenn ’s draußen unwettert. Hat je einer in einem solchen Haus gewohnt? Von Zelten abgesehen sind sie alle aus hartem Stein. Wände, Böden ebenso. Überall lauern Gefahren, sich zu verletzen. Beule am Kopf, Schulter verrenkt, Knöchel gebrochen. Und erst die Treppenstufen. Schwindelanfälle, wenn sich die Stufen zehnmal aufwärts wendeln. Und das soll menschenwürdig sein? Ehrlich. Haus wie ein Kissen ist optimal.
Jetzt kann einer denken, verrückte Geschichte die vom wandernden Haus. Das weich ist wie ein Kissen. So etwas gibt es nicht. Weil es so etwas nicht geben kann. Nicht geben darf. Wo kämen wir denn hin, wenn alle Menschen auf Wanderschaft gingen? Unterwegs zu neuen Zielen. Sich niederließen für eine Weile da, wo es ihnen besonders gut gefiel. Niemanden um Erlaubnis fragen. Die Behörden hätten ein Problem. Und erst die Politiker. Flüchtlinge sind es nicht, weil sie ständig weiterziehen. Residenten auch nicht, weil sie keine festen Häuser bauen. Vorübergehende Hotelgäste auch nicht, weil sie nirgends nächtigen, zu Abend essen und zahlen. Sie wandern und wandern und fressen das Grün der Blätter von Löwenzahn, Klee und Sauerampfer. Und niemand hat einen Schaden davon. Für den Fall, dass solche Menschen Schnecken sind.
Philippe Emmanuel war Klassenbester in Mathematik und Physik. Schon in der Quarta wie Galilei und Einstein interessiert an dem, was jenseits ihrer Berechnungen existieren könnte. Neugierig wie ein Kind sagt man. Wohl dem, der ein Kind ist und bleibt ein Leben lang. Der Himmel soll ihnen sicher sein, heißt es in der Bibel. Eine der meistdiskutierten Stellen.
Als er noch nicht in der Schule war, streifte er mit seinem Großvater durch Wälder und Auen. Sie wohnten damals in Bergheim, nicht weit von Sélestat im Elsass. Die Gegend bis zum Rhein flach mit Pappelreihen entlang von Kanälen. Wenig bebaut, hie und da ein Wochenendhäuschen. Gewundene Wege, eine schmale asphaltierte Straße nach Colmar. Hin und wieder ein Hügel mit Heide oder Ginster. Ein Kiefernwäldchen. Steinkreuz am Weg mit unlesbarer Inschrift. Die Bank davor eingeknickt, vermoost. Lauter Kleinigkeiten. Die große Welt weit weg. Mooriges Gelände linksseits gurgelt und gluckst gedankenlos vor sich hin.
Grande-père kannte sich hier gut aus. Als Professor in Botanik und Biologie ein As. Streifte er an Wochenenden mit seinem Enkel durch Wälder und Auen, konnte er ihm alles erklären. Seine Neugier wecken, die er nie mehr verlor. Viele verschiedene Pilze wachsen im Herbst unter den Bäumen, wie hoch geschossen. Fliegenpilze, weiße Punkte auf ihren roten Hüten. „Vorsicht giftig“, riet er ihm, „bloß nicht berühren“. Aber schön fand Philippe sie doch. Schöner als die Maronenröhrlinge, die sich zu einem wenig ansehnlichen Haufen zusammendrängen. Nicht so königlich aussehen wie ein Fliegenpilz. Dass Unbekömmliches immer so schön sein muss, verstand er damals nicht.
Auch nicht, dass Steinpilze mit den dicken braunen Hüten die leckersten sein sollen. Verdrehte Welt, dachte er und suchte etwas, was schön und gleichzeitig lecker ist. Oder so andersartig, dass man es lieben muss. Da sah er plötzlich ein seltsam gemustertes, blassgelbes Tier über den Weg kriechen. Wie ein dicker Wurm mit zwei Fühlern, die sich ständig hin und her bewegen. Eine Art Haube auf dem Rücken. „Großpapa, was ist das für ein komisches Tier?“ „Phlip“, so nannte er den Kleinen gelegentlich, „das ist eine Schnecke, un Escargot. Wie der Name unserer Familie. Einer unserer Vorvorfahren soll das Schnecken-Pfännchen erfunden haben.
Deshalb heißen wir so. Wenn wir Dich in der Schule anmelden, dann mit dem Namen Philippe Emmanuel Escargot.“
Im Elsass spricht man beide Sprachen. Klein Phlip war es so gewohnt. Im Elternhaus sprach man Alemannisch und Französisch. Hochdeutsch lernte er erst in der Schule. Grand-père erzählt weiter: „Als deutsche Truppen 1940 wieder einmal unser Land besetzt hatten, schien es Deinen Eltern besser, ihren Namen «Escargot» bei der Behörde ins deutsche «Schnecke» umschreiben zu lassen. Dein Urgroßvater, gerade gestorben, hat es zum Glück nicht mehr erlebt. Er war stolz, ein Franzose zu sein. Blieb der Jean Paul Escargot. Stets wehte die Trikolore an seinem Haus. Um Mitternacht zum 14. Juli jedes Jahres zog er seine Gardeuniform an, nahm seine Trommel, wirbelte die Schlegel und sang die Nationalhymne. So laut, dass die Nachbarn aus den Betten sprangen: „Allons enfant de la patrie.“
Als ich in die Schule ging, rief mich der Deutschlehrer schon mal: Hallo Schneck. Als wollte er prüfen, ob ich ʼs verstanden hatte und eine zwei in Deutsch verdiene.“ Klingt schon lustig, fand Philippe Schneck ohne e.“
Seit dieser ersten Begegnung lassen ihn Schnecken nicht mehr los. Es machte ihm Spaß ein Schneck zu sein, rief laut: „Ich bin ein Schneck, ein Schneck, ein Schneck, trallera, trallera.“ Dachte, es fehlt mir nur das Haus auf meinem Rücken. Eines Tages werde ich es bauen. Fasziniert von seiner runden Form, wie übergestülpt. An beiden Seiten gedreht wie die Schnecken mit Rosinen und Zuckerguss aus der Bäckerei. Beobachtete das langsame Auf und Ab des Schneckenleibes, sich selbst mit der Haube auf dem Rücken vorwärts zu bringen. Haus kann man es schon nennen, dachte er.
Es ist Schneckenzeit. Abends kocht Mama Schneckensuppe, Elsässer Spezialität. Weinbergschnecken sind lecker, weil sie den Geschmack von Glück auf die Zunge legen sollen. Besonders, wenn sie komplett im eisernen Pfännchen gegart werden. Die Schnecke mit Kräuterbutter fest gestopft im eigenen Haus. Mit Salz, viel Knoblauch und Petersilie gewürzt, ein Fest für die Götter. Philippe ist skeptisch. Muss man jetzt auch das Haus essen, weil es mit gebraten wurde? Sieht seine Eltern greifen es mit einer Zange, halten es fest, zupfen das Fleisch mit einer kleinen Gabel heraus, stecken es in den Mund. Macht es genauso und es schmeckt. Schmeckt ihm gut. Schön und lecker, wie er es sich wünschte.
Aber das Haus? Was macht man mit all den Häusern? Achtzehn leere Häuser sind es, die nach dem Essen auf leeren Tellern liegen. Zu nichts mehr nutze. Was er so liebt, soll in den Mülleimer. „Pas du tout, je veux construire une maison pour mois. Ein Haus aus leeren Schneckenhäusern bauen kein Problem“, denkt er. „Man klebt sie einfach aneinander, übereinander zu einer Pyramide.“ Aber das sieht nicht mehr schön aus. „Viele leere Schneckenhäuser sind Abfall. Ein einziges das Ideal. Nicht im Grundbuch einzutragen, weil man mit ihm ständig unterwegs ist. Bis ans Ende der Welt, möglicherweise.“
Schnecken tragen ihr Haus auf dem Rücken, wohin sie auch kriechen. Schleichen wäre treffender gesagt. Schleimige Spuren hinterlassen, wo sie auch waren. Ein Detektiv könnte ihnen leicht folgen, wären sie Verbrecher. Zum Glück brechen Schnecken keine Gesetze. Können nicht davonzulaufen wie Hunde, wenn sie ihr Häuflein fallen gelassen. Flitzen schon gar nicht wie klitzekleine Ameisen. Die nichts hinterlassen als Eifer. Schnecken sind vom Schöpfer gewollte Symbole der Langsamkeit. Die Menschheit zu mahnen, ihren Tätigkeitsdrang zu bremsen und nachzudenken. Bevor sie aktiv werden. Großpapas Schlussfolgerung Jahre später.
Grand-père hatte ihm immer alles genau erklärt. Kannte Philippes Neugier. Und wollte sie befriedigen. Wundert sich schon gar nicht mehr über das phänomenale Gedächtnis des kleinen Phlip. „Der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum“, scherzt er. Schon als Dreijähriger begabt, hoch begabt. Begabter als alle im Kindergarten. Die Leiterin meinte, man könne ihn gleich aufs Realgymnasium schicken. Lesen und schreiben konnte er schon mit dreieinhalb. Das Einmaleins in der ersten Klasse sowieso. Großpapas Erzählungen über die Wunder der Natur, die Vorzüge der Langsamkeit in seinem Kopf gespeichert wie in einem Computer. Vergleicht sie mit dem Lehrstoff an der Schule und meint, er könnte vieles besser machen. Anders vor allen Dingen.
Erinnert, gerade vier Jahre, mit Grand-père vor einem seltsamen Hügel stand. Angelehnt an den borkigen Stamm einer Kiefer. Aus Erde und abertausend kleinen Zweigen, Nadeln und Blättchen. Sah winzige Krabbeltiere mit drei Körperteilen. Nur lose miteinander verbunden, wie es schien, was sie sehr beweglich machte. Bauch mit sechs Beinchen, dicker Schwanz und kleiner Kopf mit zwei langen Fühlern. Eilig, eilig Zweiglein und Blättchen auf ihrem Rücken schleppen. Pflanzenteile und Harz von Nadelbäumen. Alles schön zu verkleben, damit es fest wird und ein Haus, das nicht zusammenbricht.
Für viele hundert, hunderttausende Ameisen in einem Nest. Das man einen Ameisenhügel nennt. Vielhundert mal größer als sie selber sind. Bis zu zwei Meter hoch und bis zu fünf Meter im Durchmesser. Für den kleinen Phlip war es ein Kunstwerk. Mit Fleiß gebaut, oberirdisch und so tief in die Erde gegraben wie hochgetürmt.
Jetzt weiß er, dass Ameisen alle zwei Wochen ihre Gänge reinigen, damit sich keine Schadstoffe bilden. Sich orientieren durch ausgesendete Düfte, Ultraschall und einen ausgeprägten Tastsinn. Sogar eine Art Antenne zwischen Bauch und Schwanz, das Notsignale aussendet. Wenn sie verschüttet wurde. Weiß, dass viele hundert Straßen in ihrem Innern den Verkehr regeln. Besser als jedes Ampelsystem in modernen Städten.
Als Großpapa es ihm damals erzählte, hatte er noch keine Pläne. Jetzt will er auch solche Häuser bauen. Für viele Menschen. Die wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Der Ameisenstaat ist die bestorganisierte Demokratie. Mit mehreren Königinnen, Männchen, die ihre Eier befruchten und Hundertschaften von fleißigen Arbeitern. Die im Handumdrehen Soldaten sind, nähert sich ein Feind. Sind die Eier gelegt, kehren die Königinnen zurück in ihr Elternhaus oder gründen eine neue Kolonie.
Heute denkt er, Frankreich könnte sich ein Beispiel an ihnen nehmen. Die überbordende Bürokratie durchlüften. Die ENA allen Begabten öffnen, nicht nur den Eliten. Damit die Besten das Land verwalten. Der Beste Präsident wird. Nicht weil er die ENA absolviert, sondern seine Wahlversprechen einlöst. Aber … welcher Staat ist ideal? Politiker reden zwar von morgens bis abends, versprechen das Blaue vom Himmel. Und können es nicht einlösen. Weil sie die Sorgen ihrer Bürger nicht wirklich kennen. Utopien im Kopf. Beamte wollen sich keine Blöße geben, die ihre Pension gefährdet. Philippe wollte schon als Schüler der école maternell alles wissen. Fragte seinem Grandepère Löcher in den Bauch. Las Bücher aus seinem Schrank. Noch bevor er den Dreisatz beherrschte. Die französischen Könige aufzählen konnte.
Ein Bienenstock, las er, ist anderes als ein Ameisenhügel. An geschützter Stelle in der Natur kunstvoll zusammengebautes Zuhause für ein ganzes Volk. Wabenhaus nennt man es. Oder von Imkern als Korb oder Rahmen an eine Stelle gehängt, wo sie sie beobachten können, ihren Honig ernten. Arbeitsbienen erkennen den Vorteil und nutzen das Menschenwerk. Bauen es aus mit sechseckigen Waben, exakt 120 Grad jeder Winkel. Alle absolut gleich groß, aus hauchdünnem Wachs in Form gedrückt, korrigiert. So lange bis es passt. Gebaut und täglich gereinigt von Arbeitsbienen. Die außerdem den ganzen Tag unterwegs sind, Nektar sammeln. In den Waben ablegen. Mensch erntet das, was er Honig nennt. Schleudert ihn aus den Waben, füllt ihn in Gläser und verkauft ihn für teures Geld. Die Arbeitsbienen sammeln weiter, den Sommer lang, die Vorratskammern zu füllen. Wir kaufen Honig und delektieren uns an dieser Götterspeise auf knusprigem Croissant jeden Morgen.
Das natürliche Wachs, von Honigbienen abgesondert, dunkelt mit der Zeit durch Bebrütung, verschmutzt. Deshalb nehmen Imker es ihnen ab, um es zu schmelzen und ihnen gereinigt für den Bau von Waben wieder zur Verfügung zu stellen. Bienen gewöhnen sich schnell an diese Art der Versorgung. Sondern aber weiter Wachs ab. Das wiederum diesen Prozess durchläuft. Ein Bienenvolk kann bis zu 40000 Bienen umfassen. Jedes Volk hat eine Königin. Eine Mehrzahl von Arbeitsbienen. Wenige Drohnen, die Eier der Königin zu befruchten. Bis zu 1000 Eier legt sie pro Tag. Nicht jedes muss befruchtet werden. Es schlüpfen doch junge Bienen aus. Parthenogenesis (Jungfernzeugung) nennt es die Wissenschaft. Die Drohnen sterben, haben sie ihre Arbeit getan. So ist das bei den Bienen. Ameisen und Bienen, beides Völker. Jedes mit eigenen Gesetzen des Zusammenlebens. Fähig zu großartigen Leistungen. Philippe bewundert sie ihrer Baukunst wegen.
Was er nicht wissen kann: 1978 veröffentlichte der spätere Präsident François Mitterand ein Buch mit dem Titel «L’abeille et l’architecte». Die Biene und der Architekt. Im Vorwort ein Ausspruch von Karl Marx: „Die Biene verwundert mit der Struktur ihrer Zellen aus Wachs mehr als ein Architekt. Das unterscheidet die Expertin Biene vom schlechten Architekten: Sie konstruiert ihr Zellenhaus zuerst im Kopf und dann im Bienenkorb.“ Mitterand will es in seinem Buch auf die Politik angelegt wissen. In vielen Gesprächen, an aktuellen Beispielen exemplifiziert. Neue Erkenntnisse der Forschung eingebaut. Im Bienenvolk hat jede ihre Aufgabe. Alle das Ziel, als Volk zu überleben. Machen wir es wie die Bienen, das Resümé Mitterands. Sieht die Politiker in der Pflicht, klare Leitbilder zu entwickeln, nach denen die Gesellschaft leben kann. Er selbst bemüht, sie drei Jahre später als Präsident in Gesetze zu fassen.
Schneckenhäuser aber inspirieren Philippe am meisten. Weil sie nur von einer Schnecke bewohnt werden. Individualisten nennt er sie. So wie er selbst einer ist. Sein Name wird noch berühmt. Schon Ideen im Kopf, die er eines nicht fernen Tages realisieren wird, fest überzeugt. Ein Schneckenhaus für Menschen. Aufzüge zu den Etagen. Umlaufende Galerien mit Rollbändern zu den Zimmern. Alles innen bewegt sich wie das Haus, das sich bewegt, dahin wo Mensch es steuert per Mausklick. Von Wasserstoffmotoren bewegt. Fenster mit Sensoren, die öffnen und schließen, wenn Mensch „auf“ oder „zu“ denkt. Oder auch „stopp“ wenn es bleiben soll wie es gerade ist.
Das ideale Haus für Individualisten. Die gut allein leben können. Wie die Schnecke in ihrem Haus. Sich selbst genug, eine selbstbewusste Individualistin, könnte man meinen. Im Gegensatz zu Bienen- oder Ameisenvölkern ganz auf sich gestellt und quasi allein auf der Welt. Ohne Bezug zu anderen Schnecken. Sieht man sie zuhauf, in Weinfeldern zum Beispiel, folgt jede von ihnen ihrer eigenen Nase, respektive ihren Fühlern. Fressen und genießen ihre Freiheit. Droht Gefahr, schlupf sind sie in ihrem Haus verschwunden. In das stabile Schneckenhaus pickt kein noch so aggressiver Spatz ein Loch. Philippe will die Außenhaut seines Hauses aus Carbon bauen lassen. Praktisch unzerstörbar.
Denkt zurück an die Spaziergänge mit seinem Grandpère am Wochenende durch Wiesen, Wald und Gestrüpp. Blieb alle Augenblicke stehen. Seinem wachen Blick entging nichts, was irgendwie gebaut war. Die Blätter von Bäumen im Herbst bunte Haufen wurden. Die wie Grabhügel aussehen. An den unter ihnen begrabenen Sommer erinnern. Bis ein Herbstgewitter sie wegfegte wie Kehricht. Und nur noch der blanke Waldboden übrig blieb. Ein Rest von Wärme aufstieg, die er spürte im Atem der Luft. Hörte von seinem Großpapa, dass Kirschlorbeer den strengsten Winter übersteht. Grünt das Jahr über und wächst so dicht, dass Menschen ihn pflanzen, um ihre Vorgärten einzuhecken. Regelmäßig schneiden, damit es schön aussieht. Nicht selten höher als einen Meter. Unerwünschte Einblicke zu abzuwehren. In ihrem Blätterwerk haben ungezählte Käfer, Spinnen, Motten und Larven ihr zuhause.
Sah er tief hängende Tannenäste, dachte er sofort an ein Zelt. Dach, unter das man kriechen kann, wenn es regnet. Und seltsamerweise nicht nass wird. Fächer der Farne ein ähnliches Zuhause für Hunde oder Babys. Wollte immer wieder an dieselben Stellen, um zu sehen, was und wie es sich verändert, wächst und größer wird im Laufe der Zeit. Früh schon hatte er die Idee, ein Haus zu bauen, das aussieht wie Natur. Eines, das anders ist als die meisten im Dorf. Mit Steildach oder flach wie ein Brett. Sein Haus wäre kugelförmig wie ein Pilz, Kartoffelbovist zum Beispiel. Spitz und hoch wie ein Tannenzapfen mit geschlossenen Läden. Breit gefächert wie der einer Kiefer. Mit Balkonen auf jeder Etage. Oder wie ein Dodekaeder mit zwölf Ecken statt vier. In die Erde versenkt wie das Ameisennest. Oder hoch oben eine Aussichtskabine auf einem stählernen Gestell ohne Aufzug. Dort zu wohnen, zu bleiben, bis die Welt untergeht am Jüngsten Tag. So nannte sein Religionslehrer Gottes Strafgericht am Ende der Zeit.
Er wollte sich nicht vorstellen, dass eines Tages alles vorbei ist. Hört er die Meisen-Babys zwitschern, wenn ihre Mama oder Papa auf dem Nest gelandet, einen Wurm im Schnabel, sie zu füttern. Zum ersten Mal sah er, wie Singvögel aus Zweiglein und Gräsern Nester flechten wie Körbchen. Manche tief wie ein Trichter, andere flach wie eine Schale. Alle Ränder von außen nach innen gebogen. Zu schützen die Brut. Geklemmt in die Astgabel eines Baumes oder das enge Gefecht einer Hecke, damit es nicht herunterfallen kann. Kein Feind es erreicht.
Interessiert beobachtete Phlip das Weibchen beim Eierlegen. Kam zwei- dreimal am Tag zu gucken und Tage danach noch. Nacheinander, nie gleichzeitig legte sie ein Ei nach dem anderen ins Nest. Erst dann begann es, sie auszubrüten. Verließ dann und wann für kurze Zeit das Nest, die Eier zu lüften. Die Brutzeit dauert bei Singvögeln zwei bis vier Wochen. Futter besorgt das Männchen, damit das Weibchen gesättigt auf den Eiern hockend genug Wärme speichern kann. Sind die Jungen geschlüpft, ist ständiges Füttern ebenso wichtig. Damit die Jungen kräftig wachsen und bald ihre Flügel schwingen. Auf und davon flattern um einen Partner zu suchen. Dasselbe Spiel zu treiben wie ihre Eltern. Nachwuchs zeugen, Eier legen, Küken ausbrüten und so weiter, und so weiter.
Eines Tages hockte er sich auf den weichen Waldboden, Würmer, Raupen und anderes Getier auf ihrer Wanderschaft zu beobachten.
Sah einen flachen Stein, unter dem es ständig hinein und heraus krabbelte und kribbelte. Winzige Zweizentimeterschnecken verkrochen sich dort wie unter ein schützendes Dach. Großpapa sagte, sie bleiben dort, weil es besser ist, nicht gesehen zu werden von fressgierigen Vögeln. Verstecken sich, bis sie größer gewachsen und das Haus auf ihrem Rücken seine endgültige Größe erreicht hat.
Und sie sich in dieses Haus zurückziehen können bei Gefahr.
So genau hatte er es nicht gewusst bisher. Sah genauer hin und entdeckte tatsächlich auf ihrem Rücken ein Gebilde, das mit der Zeit ein Schneckenhaus werden könnte, das er kannte. Alles ist Werden und Vergehen, lernte er. Aus Klein wird Groß. Auch er will groß werden eines Tages. Der größte, weil er klein von Gestalt ist. Er will sich schlau machen in Büchern. Klüger werden als alle anderen, die mit ihren 1,90 m protzen, als wäre es ihr Verdienst.
Nahm sich vor, sobald als möglich zu beginnen. In der ersten Klasse wusste er, was Konjunktiv vom Indikativ unterscheidet, ein Subjet vom Objekt. Wann welche Zeichen gesetzt werden müssen. Und welche. In der zweiten Klasse lernte er Pythagoras: A-Quadrat plus B-Quadrat gleich C-Quadrat. Las das erste einer Reihe von Büchern über Schnecken, die ihm Großpapa nach jedem Zeugnis schenkte. Spürte, Schnecken werden sein Leben von Grund auf ändern.
In einem dieser Bücher entdeckte er solche, die sie bisher auf ihrer Spurensuche nie gesehen. Schneckenhäuser, deren Spiralform durch farbige Streifen auffallen. „Guck mal Grande-père, gibt es solche Schnecken auch bei uns?“ Fasziniert von grünlichgelben und blauvioletten Linien, die die Form der Spirale nachzeichnen. „Es sind seltene Exemplare. Vielleicht von mineralischen Böden in Hochgebirgstälern beeinflusst. Kann aber auch sein, die Schnecken haben sich im Laufe von Jahrmillionen einer buntscheckigen Umgebung angepasst. Sozusagen getarnt. Wie bei uns die Weinbergschnecken die beigegraue Farbe des Lößbodens in den Weinbergen angenommen haben. Farbe ist das beste Mittel, nicht aufzufallen und gefressen werden. Nachteil: unachtsame Spaziergänger zertreten, ein Fuhrwerk überrollt sie, dass die Häuser zerbrechen und die Schnecke stirbt.“
„Übrigens sind Muscheln im Meer auch kleine Wunder. Vielseitiger ihre Form als die von Schnecken. Sie bewegen sich mit einem Fuß, den sie verlängern je nach Bedarf. Sich im Wasser fortzubewegen oder einzugraben in den sandigen Boden. Muscheln haben kein Gehäuse, sondern zwei Klappen, die sie öffnen, wenn sie Algen fressen. Schließen, wenn sie genug haben und nicht gestört werden wollen. Beliebt sind Venusmuscheln bei Kunstliebhabern. Erinnern an das Gemälde von Botticelli, auf dem die Göttin Venus aus der Schale ebendieser Muschel steigt. Austern in ihren rauen Schalen und köstlichem Fleisch isst man roh. Jakobsmuscheln eine Delikatesse, die Du als Coquille de Sainte Jaques kennst. Wenn Deine Mama sie an Feiertagen zubereitet. In ihren eigenen Schalen grillt mit Sahne und Curry. Am teuersten sind die, in deren Schalen eine Perle solange heranreift, bis sie für viel Geld verkauft werden kann. Schau Dir die Perlenkette deiner Mama mal genau an. Alle diese Meerestiere sind außen unansehnlich. Innen aber schimmert Perlmutt. Anregung für Künstler, Perlen daraus zu schleifen für Ringe und Ketten. Möbel mit Intarsien aus Perlmutt zu veredeln. Glasbläser und Töpfer anregt, Glasgefäße oder Keramikschalen mit solchen Mustern und Oberflächen herzustellen.“
„Jetzt aber zurück zu unserem Hauptthema: Schnecken sind die einzigen Landbewohner, die Häuser, in denen sie wohnen, auf dem Rücken tragen. Haben in erster Linie eine Schutzfunktion. Ruckzuck verschwindet sie darin, wenn Fressfeinde sich nähern. Vogel, Fuchs, Maus oder Maulwurf. Außerdem schützt es die Schnecke wirksam vor dem Austrocknen. Ihr breiter Leib schließt das Haus unten ab, wenn sie sich hinein verkrochen. Nähert sich der spitze Schnabel einer Krähe, zieht sie sich noch mehr zusammen. Und die Krähe fliegt unverrichteter Dinge davon.
Das Haus, aus Kalk gebaut und durch seine Form so stabil, dass es normalen Druck aushält. Kleine Schäden reparieren sich automatisch. Kalkbrei schließt Risse und kleine Lücken sofort, wird rasch fest. So ist also jede Schnecke bei sich Zuhause. Im Sinne des Wortes. Wird das Haus von Menschen zertreten, von Hufen zerstampft, von einem herabfallenden Ast erschlagen, ein größeres Loch hinterlässt, muss die Schnecke sterben.
Sie verendet, ungeschützt die inneren Organe trocknet sie regelrecht aus.“ „So ein Haus werde ich einmal bauen Großpapa“ sagte er eines Tages. Zwölf Jahre jung und sehr selbstbewusst. „Aber mit fester Außenhaut aus ich weiß noch nicht, die niemand zerbricht. Darin werde ich hundert Jahre wohnen. Genug Brot, Wurst, Wasser und Wein mitnehmen. Und einen riesengroßen Gugelhupf. Dass alle, die mich besuchen die Augen aufreißen und staunen.“
Eines Sonntagmorgens kletterten sie über bröckelndes Gestein. Oberhalb des Weges, der in eine Senke führt. Da sah Philippe etwas unter dem Moos herausgucken. Ein Stein? Seltsam profilierter Stein. Nicht glatt wie die meisten. Bückte sich, holte ihn hervor und kratzte mit den Fingernägeln die Erde weg. Hielt ihn seinem Grande-père unter die Nase. Schrie so laut, als hätte er eine Goldmünze entdeckt: „Hurra, un escargot par pierre, eine Schnecke aus Stein.“
„Du hast einen seltenen Fund gemacht. Eine versteinerte Schnecke. Sie lebten hier wie auch anderswo vor Jahrmillionen. Die gleichen, die du hier im Wald siehst. Bis sie damals von schmelzendem Eis überrascht wurden. Von den Alpen herunter in solch einem Tempo, dass sie nicht fliehen konnten. Liegen blieben wo sie lagen. Neben Muscheln und Meerestierchen, die unter der Eisschicht lebten im Überallmeer.“
„Das Eiswasser floss nach Norden ab und blieb nur in den Tälern der Alpenregion als See. Und im Mittelmeer. Wo es sich langsam erwärmte. Auf der Erde aber blieb vieles liegen und versteinerte mit der Zeit, wie diese Schnecke. Historiker suchen sie, dem Ende der Eiszeit auf die Spur zu kommen, dem Alter der Erde. Wär das nichts für Dich?“ „Lieber beobachte ich lebendige Tiere, Schnecken zum Beispiel. Will lernen von ihnen, was ich noch nicht weiß. Vielleicht haben Tiere noch ein Geheimnis, das auch Du nicht kennst. M’ excuse Grande-père, m’ excuse.“