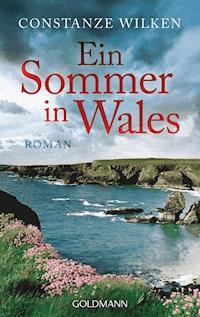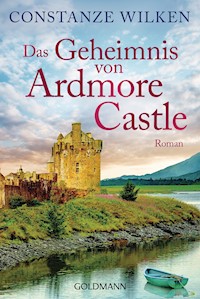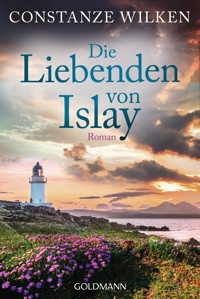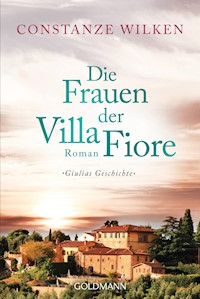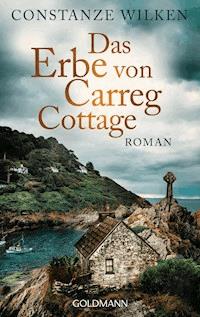1,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine bewegende Liebesgeschichte in Schottland: Der Familiengeheimnisroman »Das Licht von Shenmóray« von Constanze Wilken jetzt als eBook bei dotbooks. Wann immer Catherine an ihre Kindheit und Jugend denkt, erfüllt sie dies mit Wärme und Wehmut – und die Erinnerungen an das kleine Café ihrer Großmutter am Rande des schottischen Loch Fyne. Als sie erfährt, dass Morven spurlos verschwunden ist, zögert Catherine keine Sekunde, und steigt in den nächsten Flieger nach Edinburgh. Als sie in den kleinen Ort an der rauen Küste der Highlands kommt, fühlt es sich an, als wäre sie endlich wieder daheim. Aber wo hält Morven sich verborgen – und was hat es mit den geheimnisvollen Männern auf sich, die hier zuvor noch nie jemand gesehen hat? Bei ihrer Suche nach Antworten kann nur einer Catherine helfen: Finnean McFadden, der ihr vor vielen Jahren das Herz gebrochen hat und den sie niemals wiedersehen wollte … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende Familiengeheimnisroman »Das Licht von Shenmóray« von Constanze Wilken. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wann immer Catherine an ihre Kindheit und Jugend denkt, erfüllt sie dies mit Wärme und Wehmut – und die Erinnerungen an das kleine Café ihrer Großmutter am Rande des schottischen Loch Fyne. Als sie erfährt, dass Morven spurlos verschwunden ist, zögert Catherine keine Sekunde, und steigt in den nächsten Flieger nach Edinburgh. Als sie in den kleinen Ort an der rauen Küste der Highlands kommt, fühlt es sich an, als wäre sie endlich wieder daheim. Aber wo hält Morven sich verborgen – und was hat es mit den geheimnisvollen Männern auf sich, die hier zuvor noch nie jemand gesehen hat? Bei ihrer Suche nach Antworten kann nur einer Catherine helfen: Finnean McFadden, der ihr vor vielen Jahren das Herz gebrochen hat und den sie niemals wiedersehen wollte …
Über die Autorin:
Geboren an der norddeutschen Küste zog es Constanze Wilken nach einem Studium der Kunstgeschichte, Politologie und Literaturwissenschaft für einige Jahre nach England. Im wildromantischen Wales entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben, aber auch für Antiquitäten. Die Forschungen zur Herkunft seltener Stücke und ausgedehnte Reisen der Autorin sind Inspiration und Grundlage für ihre Romane.
Die Website der Autorin: constanze-wilken.de/
Bei dotbooks erschienen bereits folgende Romane:
»Die Frau aus Martinique«
»Was von einem Sommer blieb«
»Die vergessene Sonate«
»Das Geheimnis des Schmetterlings«
»Die Frauen von Casole d’Elsa«
Weiterhin veröffentliche Constanze Wilken bei dotbooks die folgenden Historischen Romane:
»Die Tochter des Tuchhändlers«
»Die Malerin von Fontainebleau«
***
eBook-Neuausgabe Juli 2021
Copyright © der Originalausgabe 2005 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Yuri Fineart
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-328-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Licht von Shenmóray« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Constanze Wilken
Das Licht von Shenmóray
Roman
dotbooks.
Niemand soll und wird es schauen,
Was einander wir vertraut.
Denn auf Schweigen und Vertrauen
Ist der Tempel aufgebaut.
Johann Wolfgang von Goethe
Die Baustelle vom Tempel Salomons
Um 930 v. Chr.
Und er (Hiram) richtete die Säulen auf vorder Vorhalle des Tempels; die er zur rechtenHand setzte, nannte er Jakin, und die erzur linken Hand setzte, nannte er Bohaz.
1. Könige 7, 21
Sie schrieben das Jahr vierhundertachtzig nach dem Auszug Israels aus Ägypten und das vierte Jahr der Herrschaft Salomons über Israel. Hiram wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seine Muskeln schmerzten vom Klopfen der Steine, und seine Augen waren voller Staub. Mit einem feuchten Lappen, den ihm ein kleiner Junge aus einem mit Wasser gefüllten Ledereimer reichte, rieb er sich über Stirn, Augen und Bart und ließ dann den Blick über die riesige Baustelle gleiten. Mit Stolz betrachtete er die jungen Arbeiter, die ohne zu murren mit gleichmäßigen Schlägen die harten Felsbrocken bearbeiteten oder die aus dem Libanon herangebrachten Stämme aus Zedern- und Zypressenholz glätteten und zersägten. Andere stampften den Boden innerhalb der abgesteckten Felder, auf denen der Tempel errichtet werden sollte. Salomon hatte Hirams König, dem Herrscher von Tyrus, die genauen Ausmaße gegeben und ihn mit der Beschaffung der Baumaterialien beauftragt. König Hiram von Tyrus hatte dann ihn, den Architekten Hiram, mit der Überwachung des monumentalen Bauwerks zur Ehrung und Lobpreisung des Herren betraut, und er wollte sich dieser Aufgabe würdig erweisen.
Ein kräftiger junger Mann kam mit einem Winkelmaß in der Hand auf ihn zu. Seine ebenmäßigen Züge und das dichte lockige Haar machten es ihm bei den Frauen leicht, allzu leicht, wie Hiram mehr als einmal hatte feststellen müssen, wenn sich wieder einmal ein erboster Vater bei ihm über seinen jüngsten Gesellen beschwert hatte.
»Was gibt es, Jaflet?«
»Meister, Sallu, der alte Querkopf behauptet, die Vorhalle ist um zwei Ellen zu kurz abgesteckt worden, aber das kann nicht sein, denn ich habe sie ausgemessen und die Winkel bestimmt, wie Ihr es mir aufgetragen habt.« Das Winkelmaß fest in den Händen haltend, sah Jaflet seinen Meister trotzig an.
»Immer wieder Sallu. Er ist älter als du und noch nicht über den Lehrlingsgrad hinaus. Daran ist nur seine Engstirnigkeit schuld.« Hiram legte den Lappen auf einen Stein und ging mit ausgreifenden Schritten über die Baustelle. Jeder der mehr als tausend Arbeiter schien ihn zu kennen, denn wo er vorüberkam, wurde er mit respektvollem Kopfnicken begrüßt. An einem mit Seilen und Holzpflöcken abgesteckten Areal blieb Hiram schließlich stehen.
Ein gedrungen wirkender Mann, dessen muskulöser Körper von jahrelanger harter Arbeit zeugte, erhob sich nur widerwillig, als er Hiram sah. Eine Narbe zog sich über das kantige Gesicht des störrischen Mannes, und Hiram führte das angedeutete Lächeln, das mehr einem hämischen Grinsen glich, auf die Gesichtsverletzung zurück. »Na, Jaflet, bist du gleich wieder zu deinem Meister gerannt?«, kam es betont langsam aus dem Munde Sallus.
»Es bleibt mir nichts anderes übrig wenn die Maße richtig sein sollen«, erwiderte Jaflet und entschuldigte sich sofort bei Hiram. »Ich wollte Euch nicht unnötig bemühen, aber er will einen Fehler begehen und das hier wird das Haus des Herrn …«
»Schon gut, Jaflet.« Mit geübtem Blick schätzte Hiram die Abmessungen ab, prüfte die Länge schließlich mit dem Ellenmaß und stellte sich dann vor Sallu. »Was soll das? Jaflet hat gut gearbeitet. Wir alle tragen unseren Teil zu diesem besonderen Tempel bei. Du solltest deinem Mitbruder die Arbeit nicht unnötig erschweren, und jetzt mach dich an die Arbeit. Vielleicht sollte ich dich wieder zu den Steinmetzen schicken. Sie können noch einen kraftvollen Arm gebrauchen. Geh zu Hodawja und lass dir einen Meißel geben.«
Mit einem letzten zornigen Blick auf Jaflet murmelte Sallu: »Ja, Meister«, wischte sich die Hände an seinem Schurz ab und ging gemächlich davon.
Jaflet schüttelte den Kopf »Ich weiß, dass man nichts Schlechtes über seinen Nächsten sagen soll, aber er hat etwas an sich, das mir Angst macht …«
Gutmütig klopfte Hiram seinem Gesellen auf die Schulter. »Du machst dir zu viele Gedanken. Wirst du endlich heiraten? Das scheint mir ein dringenderes Thema zu sein.«
Ein Strahlen erhellte Jaflets besorgtes Gesicht. »Sie heißt Efrata, und ich werde ihren Vater fragen, sobald die Königin hier war.«
Den Besuch der Königin von Saba hatte Hiram ganz vergessen, und es gab noch so viele Dinge, die er regeln musste. »Das ist gut, das ist gut, Jaflet.« Mit den Gedanken schon bei den Vorbereitungen für den Ehrengast, machte sich Hiram auf den Weg zu seinem Zelt. Die Königin von Saba kam nicht nur, um Salomon zu sprechen, sondern auch, weil sie alle Arbeiter auf der großen Baustelle versammelt sehen wollte. Man hatte ihr von der außergewöhnlichen Ordnung und Disziplin und dem Fehlen der sonst üblichen Strafmaßnahmen berichtet, mit der Hiram die Baustelle leitete, die es in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hatte. Was weder Salomon noch sonst jemand wusste – er kannte das geheime Wort.
Er, Hiram, Sohn des Asrikam, Architekt aus Tyrus, hatte das unaussprechliche Wort, das Enoch vor der Sintflut verborgen hatte, den Schlüssel zum innersten Mysterium der Weisheit entdeckt. Manchmal zweifelte er und fragte sich, ob er nicht aus Versehen auf etwas gestoßen war, das für jemand Würdigeren bestimmt war, und doch glaubte er nicht an Zufälle. Jeder, der beim Transport der Bundeslade half hätte die Bedeutung der Zeichen auf den goldenen Beschlägen erkennen können, aber nur ihm war die Gnade dieser Erkenntnis zuteil geworden. Mit einem tiefen Seufzer neigte Hiram den Kopf und bat seinen Schöpfer um die Kraft, die er brauchte, um seine Aufgabe ausführen zu können. Und hatte er es nicht geschafft, einen Bund zu gründen, in dem sich die Arbeiter als Lehrlinge, Gesellen und Meister bewähren konnten? Funktionierte die Lohnabholung nicht reibungslos, indem sich die Lehrlinge an der mit dem Buchstaben »B« versehenen Säule und die Gesellen sich bei der Säule mit dem »J« einfanden? Die Meister kamen in dem nach Osten gelegenen »mittleren Raum« zusammen, und alle vollzogen ihre eigenen Riten, zu denen ein bestimmter Klopfrhythmus und besondere Losungswörter gehörten. Nur das geheime Wort, das alles zusammenhielt, erfuhren nicht einmal die zum Meistergrad Geweihten, denen Schweigen und absolute Treue abverlangt wurden. Unvermittelt dachte Hiram an Sallu, der ihn mehr als einmal nach dem Wort gefragt hatte. Das Wort bedeutete Macht, und in den falschen Händen …
»Hiram! Das Essen ist fertig!!«, erklang die Stimme seiner Frau aus dem Nachbarzelt.
Seine Besorgnis verschwand, sobald er die helle Stimme Baaras, seines geliebten Weibes, vernahm. Bei aller Arbeit war sie das Zentrum seines Lebens, und ihr Lächeln wärmte sein Herz, als er den Vorhang zum Küchenzelt zurückschlug und in ihre schönen goldenen Augen blickte. In einem Augenblick der Schwäche hatte er ihr das Wort anvertraut, doch er wusste, sie würde eher sterben, bevor sie es verriet.
Die Zeremonie am folgenden Tag verlief zu Hirams Zufriedenheit. Die Königin von Saba applaudierte beeindruckt dem perfekten Schauspiel, in dem Hiram mit einem einzigen Wink tausende Arbeiter dazu brachte, sich ihrem Rang gemäß in exakten Reihen auszurichten und den jeweiligen Grad anzuzeigen. Die Sonne brannte heiß auf die erhitzten Körper der Arbeiter herab, denen die Mühen jedoch nicht anzumerken waren. Am Abend labten sie sich an dem von der Königin ausgegebenen Wein und saßen in Gruppen vor ihren Zelten. Hiram ging zwischen ihnen hindurch und entnahm den Stimmen Entspannung und Zufriedenheit, dennoch konnte er sich des Gefühls der Gefahr nicht erwehren, das ihn schon den ganzen Tag verfolgte und mehr als einmal veranlasst hatte, sich umzublicken.
»Meister!«, rief ihn eine Stimme ins Dunkel zwischen den Zelten, und noch bevor er die Stimme ihrem Träger zuordnen konnte, wusste er, dass er in eine Falle lief.
Der erste Stoß traf ihn in die Schulter, und Hiram war fast froh, dass es endlich geschehen war. Sallu zog den Dolch heraus und hielt die beiden gedungenen Mörder, die wie er dem Lehrlingsgrad entstammten, zurück. »Sag es mir! Sag mir das Wort!«, zischte Sallu dem stöhnenden Hiram ins Ohr.
Der Architekt verzog keine Miene. »Niemals, und das weißt du.«
»Dann stirb!« Mit wutverzerrtem Gesicht stieß Sallu seinem Meister den Dolch zwischen die Rippen.
Hirams brechende Augen sahen die aufblitzenden Klingen der beiden Mörder nicht mehr, denn sein Blick war nach innen gerichtet, auf ein Licht, das ihn die Qualen vergessen ließ und ihm die Gewissheit gab, seine Aufgabe erfüllt zu haben.
Als man Baara den Leichnam ihres Mannes brachte, sah sie zu Jaflet, der weinend an Hirams aufgebahrtem Körper stand und mit geballten Fäusten Rache schwor. Ihre Gesichtszüge wirkten starr und ihr schmaler Körper schien ihr nur noch aufgrund ihres eisernen Willens zu gehorchen. Sie nahm Jaflet am Arm und führte ihn vor das Zelt, wo sich alle Arbeiter versammelt hatten. über das Meer der Männer blickend, die Hiram die Treue geschworen hatten, schwor Baara in der drückenden Stille der klaren Nacht, dass er nicht umsonst gestorben sein durfte.
»Ihr Brüder!«, durchschnitt ihre Stimme laut und beherrscht die trotz der Vielzahl an Menschen atemlose Stille. »Verrat und Mord sind begangen worden, aber Hiram ist nicht tot! Er lebt weiter – in euch, in eurem Werk und in mir. Führt sein Werk fort, denn sein Wort lebt durch euch, ihr Söhne der Witwe!«
Mit erhobenem Haupt schritt sie zurück in das Zelt, wo sie schluchzend über dem Leichnam ihres Mannes zusammenbrach. Doch nur kurz erlaubte sie sich diesen Moment der Schwäche, sie schluckte die Tränen hinunter und richtete sich auf Hiram hatte sie zur Mitwisserin seines Geheimnisses gemacht, und sie würde dafür sorgen, dass es niemals in die falschen Hände geriet.
Kapitel 1
Was wir empfinden, geben wir weiter,Willig oder ungewollt;Was gewesen war, ist was wir wissen,In einer GeschichteDie zu erlernen schmerzhaft war.
Alun Llewelyn-Williams
Das dunkelgrüne Wasser von Loch Fyne warf kleine Wellen, die in regelmäßiger Abfolge auf die Kiesel rollten. Catherine Tannert liebte das leise plätschernde Geräusch der Wellen und den Duft des salzigen Meerwassers, das an der Halbinsel Kintyre vorbei direkt aus dem Atlantik in die Bucht strömte. Sie hatte ihre Schuhe ausgezogen und sich auf den Holzsteg gesetzt, von dem eine Leine zu einem kleinen Motorboot führte, das sanft hin- und her schaukelte. Die klare Luft und die morgendliche Stille zu genießen, war etwas, das sie lange vermisst hatte. Ihre rotbraunen Haare fielen ihr in ungebändigten Naturlocken lose auf den Rücken. Fröstelnd zog sie die Strickjacke fester um ihre Schultern. Es war zwar schon Juni, aber in Schottland konnte es auch im Sommer überraschend kühl sein.
Sie betrachtete die aus dem morgendlichen Nebel aufragenden Berggipfel auf der anderen Seite des Lochs, die aus einem dichten Kiefernwald in den wolkenverhangenen Himmel aufstiegen. Hinter dem Stob an Eas lag der fast neunhundert Meter hohe Beinn an Lochain, und wenn man durch die Glens im Norden fuhr, hatte man das Gefühl, sich in der gewaltigen rauen Natur zu verlieren, obwohl sich die Highlands selten über tausend Meter erhoben. Morven hatte sie oft auf ihre langen Wandertouren mitgenommen und ihr die einzigartige Schönheit der Highlands nahe gebracht. Catherine seufzte. Morven, ihre Großmutter, war ein wunderbarer, aber auch ein sehr komplizierter Mensch. Man wusste nie, was sie als Nächstes tun würde, und ihr plötzliches Verschwinden hatte Catherine nach Schottland geführt. Geräusche drangen aus dem Haus zu ihr herunter. Catherine drehte sich um. Das einstöckige, weiß getünchte Haus mit den Erkerfenstern lag idyllisch zwischen dem alten Nadelbaumbestand auf einer schmalen Landzunge im Loch Fyne.
Mit Claras Hilfe hatte Morven das einstmals abbruchreife Haus mit dem altgälischen Namen »Balarhu« in ein gemütliches Heim mit rustikalem Charme und einem Café verwandelt. Clara war eine begnadete Köchin und hatte ein Talent für den Umgang mit Gästen, während Morven sich um Buchhaltung und Organisation kümmerte. Seit Catherine sie kannte, war Clara McGregor eine Freundin ihrer Großmutter. Sie bewohnte zwei Zimmer im Balarhu und war eine rundliche, stets freundliche, hilfsbereite Frau, deren Alter Catherine auf sechzig Jahre schätzte. Ihre blonden, von grauen Strähnen durchzogenen Haare trug sie kinnlang, was ihrem runden, aber fein geschnittenen Gesicht etwas Madonnenhaftes verlieh.
Ein Reiher stakte durch das seichte Wasser und hielt Ausschau nach Beute. Loch Fyne war ein fruchtbares Revier, in dem sich Lachse und allerlei Schalentiere tummelten. Seit die Regierung auf die Reinhaltung der Gewässer und biologische Fischzucht drängte, hatten sich die Verhältnisse in den Lochs deutlich verbessert. Morven lag der Erhalt der Natur sehr am Herzen, aber ihr vehementer Einsatz für den Umwelt- und Tierschutz hatte sie bei den Einheimischen nicht beliebt gemacht.
»Cathy, Frühstück ist fertig!«, erklang Claras Stimme vom Haus herüber.
»Ich komme!« Die Schuhe in der Hand, lief Catherine über den Steg, der auf einen schmalen Strand mit grobkörnigem Sand führte, zwischen den Bäumen hindurch auf das Haus zu. Sie fühlte sich wie damals, als sie mit zehn Jahren zum ersten Mal nach Inveraray gekommen war, um ihre Großmutter kennen zu lernen. Inzwischen war sie dreiunddreißig, das Leben hatte seine Unbeschwertheit verloren, und ihre Träume waren einer nach dem anderen wie Luftblasen zerplatzt. Der Duft von gebratenen Eiern wehte ihr aus der Küche entgegen, und Clara summte ein gälisches Lied vor sich hin.
»Die Melodie ist wunderschön, Clara. Guten Morgen!« Sie küsste die ältere Frau auf die geröteten Wangen und schaute ihr über die Schulter.
Während Clara die Eier auf zwei Teller verteilte und Toastbrot dazulegte, erklärte sie: »Ein altes Liebeslied, sehr traurig, aber ist das nicht immer so mit der Liebe?« Sie lächelte, schob die schmale Brille auf der Nase hoch und stellte die Teller auf den großen Esstisch, ein massives Eichenholzstück, das Morven bei einer Haushaltsauflösung erstanden hatte.
Catherine stach mit ihrer Gabel in das Eidotter und sah zu, wie es sich über den Teller verteilte. Dann stippte sie ihr Toastbrot hinein und biss genüsslich ab. »Leider. Ich kann dir aus meiner Erfahrung jedenfalls nicht widersprechen. Hat Morven …?«
Doch Claras niedergeschlagene Miene machte eine Antwort überflüssig.
»Was machen wir jetzt, Clara? Sie ist seit zwei Wochen fort, ohne sich gemeldet zu haben. Du hast alle ihre Freunde und Bekannte angerufen. Sollten wir denn nicht eine Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgeben?« Catherine machte sich langsam richtige Sorgen, denn bisher war Morven jedes Mal nach drei oder vier Tagen zurückgekommen. Am Kühlschrank klebten Fotos von Clara, Morven und ihren zahlreichen Freunden. Seufzend stand Catherine auf und nahm eines der Fotos in die Hand, das Morven auf der Terrasse vor dem Haus zeigte. Die langen braunen Haare ihrer Großmutter waren zu einem dicken Zopf geflochten. Einzelne Strähnen umrahmten das scharf geschnittene, ebenmäßige Gesicht mit einem kleinen Mund und wachen dunkelbraunen Augen, denen nichts entging. Es war das schöne Gesicht einer scheinbar alterslosen Frau.
»Wann habt ihr dieses Foto gemacht?«
»Letzten Herbst. Da kam sie gerade von den Hebriden zurück. Sie war so seltsam. Sie sah erholt aus, aber trotzdem schien sie seitdem irgendwie verändert, besorgt, ach, ich weiß auch nicht.« Clara legte ihre Gabel hin.
»Seltsam ist ein Wort, das mir bei Gran sofort einfällt. Sie sieht so jung aus, findest du nicht? Drei Jahre lang war ich nicht hier, und sieh dir dieses Bild an – sie hat sich überhaupt nicht verändert.«
»Oh, wie kann sie uns das nur antun! Diese Ungewissheit! Sie könnte zumindest anrufen!« Clara klang verzweifelt.
In Erinnerung an eine Morven, die lieber Briefe schrieb als zu telefonieren, wenn sie sich überhaupt meldete, und die ein Telefon nur als eine störende Notwendigkeit betrachtete, war es ausgeschlossen, dass es ihr in den Sinn kam, anzurufen. Morven war ein Freigeist, ein Vogel, den man nicht einsperren konnte, einer dieser Falken, die elegant über der Erde schweben und den Boden nur gezwungenermaßen berühren. Catherine lächelte; nein, wenn Morven nicht gefunden werden wollte, dann würde sie auch niemand finden.
»Worüber lächelst du, Cathy?« Hoffnungsvoll sah Clara sie an.
»Wir brauchen die Polizei nicht anzurufen, es hätte keinen Sinn. Lass uns lieber noch einmal die Liste ihrer Bekannten durchgehen. Wäre doch möglich, dass wir jemanden übersehen haben.«
Sofort stand Clara auf, froh, etwas tun zu können. Aus einem der großen Küchenschränke, deren zahlreiche Schubladen und Türen die Geheimnisse zu Claras Kochkünsten bargen, holte sie jetzt ein kleines Büchlein hervor, dessen speckiges Leder von langem Gebrauch zeugte. Sie gab es Catherine und sagte: »Das ist mein Adressbuch. Morven hat keines, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Sie sagt immer, du schreibst die Nummer auf, ja, Clara? Und das mache ich, obwohl sie selten eine zu brauchen scheint, außer für diese Aktionen, mit denen sie den Tieren hilft oder den Naturschützern. Oh Cathy, vielleicht hat einer von diesen Farmern oder Jägern …? Sie hat sich viele Feinde gemacht. Die Leute sind richtig böse gewesen, als man ihnen die Treibjagd hier verbot.«
Catherine legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm. »Wir wollen gar nicht an so etwas denken. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der alte Dougal oder dieser Farmer, wie hieß er noch, Ramsay, es wagen würden, Morven Melville Mackay auch nur ein Haar zu krümmen.«
Erstaunt sah Clara sie an. »So wie du das sagst, nicht. Ich bin sehr froh, dass du hier bist, Cathy. Du hast viel Ähnlichkeit mit deiner Großmutter.«
Seit ihrem letzten Besuch trug sie die Haare länger und durch das Karatetraining hatte sich ihre Haltung verbessert. Oberflächliche Veränderungen, dachte sie, nichts als Äußerlichkeiten, die ihr doch nicht geholfen hatten, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Denn im Grunde war sie auf der Suche, auf der Suche nach der Catherine, die sie irgendwann verloren hatte. Vielleicht war es hier gewesen? Wenn sie einen Moment benennen müsste, in dem sie glücklich war, dann dachte sie an grünes Wasser und den Geruch von blühender Heide und …
»Cathy, alles in Ordnung? Du siehst so abwesend aus.«
»Es gibt so viele Erinnerungen, vieles, das ich sie fragen möchte, und ich vermisse sie.«
Die gutmütigen Augen der älteren Frau blinzelten. »Ja, ich auch. Also, lass uns die Namen gemeinsam durchgehen.«
Nach einigen Minuten hatten sie vier Namen gefunden, die Clara entweder noch nicht angerufen oder nicht erreicht hatte. »Gillian Grant, der Name sagt mir gar nichts. Es muss Jahre her sein, seit ich den Eintrag gemacht habe, und Morven hat sie nie erwähnt.« Clara knetete ihre Unterlippe zwischen den Fingern.
»Dann rufen wir die jetzt an. Das Unwahrscheinlichste ist oft das Richtige.« Catherine griff nach dem Telefon. »Sie lebt auf Mull? Die Insel muss im Sommer mit Touristen überfüllt sein. Ich sehe noch die aus allen Nähten platzenden Fähren in Oban vor mir.« Nachdem sie gewählt hatte, hielt sie den Hörer abwartend ans Ohr. Enttäuschung zeigte sich auf ihrem Gesicht, doch sie sprach langsam und betont deutlich in den Hörer, dass sie um Rückruf bitte, falls Gillian ihre Großmutter in letzter Zeit gesehen hätte.
Clara schüttelte den Kopf. »Warum sollte sie auch nach Mull fahren, besonders jetzt, wo die Leute ganz verrückt danach sind, weil irgendein Fernsehsender eine Kinderserie in Tobermory gedreht hat.«
Sie standen auf, und Catherine begann, das Geschirr abzuräumen, doch Clara hielt sie davon ab. »Nellie kommt gleich und hilft mir. Geh nach draußen und genieß den schönen Tag. Hier weiß man nie, wie lange die Sonne scheint.«
»Danke, Clara. Du bist ein Schatz, aber ich helfe dir später, wenn die Gäste kommen.« Mit einer raschen Umarmung verabschiedete sie sich, hob ihre Schuhe vom Fußboden auf und ging durch die Hintertür wieder hinunter zum Bootssteg.
Die Sonne hatte die Nebelschwaden über den Bergen inzwischen aufgelöst und versprach einen warmen Tag. Ein Stück den Meerarm hinauf glitt langsam ein Boot auf das Wasser hinaus. Einer der Fischer aus Inveraray versuchte sein Glück bei den Lachsen. Der kleine Ort erwachte zum Leben, was sie an dem zwar entfernten, aber doch vernehmbaren Autolärm hörte. Die meisten Leute aus der Umgebung arbeiteten in einem der Hotels oder Restaurants in Inveraray. Eine weitere Möglichkeit waren die vielen Souvenirläden, das historische Gefängnis, das sich einen Namen durch ausgefallene Führungen gemacht hatte, das Tourismusbüro und ein Supermarkt. Welch ein Unterschied bestand zwischen dieser Beschaulichkeit und dem hektischen Verkehrsaufkommen in und um Köln.
Erleichtert ließ sich Catherine wieder auf den von der Sonne erwärmten Holzplanken nieder und berührte mit den Fußspitzen das kalte Wasser. Sie stellte die Hände neben sich und lehnte sich leicht zurück, um das gesamte Naturschauspiel von Loch Fyne in sich aufzunehmen. Gestern Abend war sie mit dem letzten Bus aus Glasgow angekommen. Tom, ihr Chef in der Kölner Werbeagentur, in der sie als Webdesignerin arbeitete, war nicht erfreut gewesen, als sie nach Claras besorgtem Anruf sofortigen unbefristeten Urlaub verlangt hatte. Da sie aber seit drei Jahren weder Urlaub gemacht noch ihre Überstunden abgefeiert hatte, zeigte er sich einsichtig und ließ sie gehen, allerdings unter dem Vorbehalt, dass sie sich jede Woche melden müsse, um ihm zu sagen, wann sie zurückkäme. Eigentlich war Tom ein netter Kerl, doch zu sehr mit seiner Agentur verheiratet, als dass er ein Privatleben führen konnte. Sie waren einige Male ausgegangen, hatten dann aber beschlossen, es bei einer geschäftlichen Beziehung zu belassen, da auch Catherine mehr von Graphiken, Bytes und Pixeln sprach als von Dingen, die man sonst vielleicht in seiner Freizeit tun würde.
Wann sie begonnen hatte, sich richtiggehend unzufrieden zu fühlen, hätte sie nicht sagen können. In all den Jahren, in denen sie an ihrer Karriere gearbeitet hatte, waren ihr nie Zweifel gekommen, dass ihrem Leben etwas fehlen könnte. Sie teilte sich mit Lisa, einem Model, eine geräumige Wohnung in der Innenstadt, und die Wohngemeinschaft funktionierte bestens, weil Lisa die meiste Zeit auf Reisen verbrachte, von denen sie nie ohne ein ausgefallenes Geschenk und Geschichten aus der exzentrischen und bisweilen gnadenlosen Modewelt zurückkam. Da Lisa für ein Shooting nach Mauritius geflogen war, hatte Catherine sich nicht von ihr verabschiedet. Weder von ihr noch von sonst jemandem. Vielleicht sollte sie ihre Eltern in den nächsten Tagen anrufen, denn seit ihrem Umzug nach Köln sah sie sie nur noch selten.
Seufzend stand Catherine auf, zog sich die Schuhe an, sprang vom Steg auf den Sand hinunter und begann, nach Inveraray zu schlendern, das sie in zwanzig Minuten erreichen konnte, nicht in diesem Tempo, aber darauf kam es nicht an, denn sie hatte keinen Termin, den sie einhalten musste. Ein ungewohntes und ein erstaunlich gutes Gefühl. Im Grunde verstand sie sich gut mit ihren Eltern, wäre da nicht die unterschwellig immer spürbare Spannung, wenn es um Morven ging. Nein, wenn sie etwas wollten, konnten sie sie über ihr Mobiltelefon erreichen, und dann war es immer noch früh genug, ihnen zu sagen, wo sie war.
Sie hob einen der flachen Steine auf und warf ihn weit in das Wasser hinaus, wo er nach seinem Eintauchen Kreise auf der Wasseroberfläche entstehen ließ. Der leichte Wellengang, der noch vor knapp zwei Stunden zu sehen gewesen war, hatte sich wie die Wolken verflüchtigt. Die Sonne gewann an Kraft, und Catherine zog die Strickjacke aus. Ein wenig Bräune tat ihrer blassen Städterhaut gut. Eigentlich war es ihr unverständlich, warum Briana, ihre Mutter, und Morven sich nicht verstanden. Beide liebten die Natur. Briana und Johannes, ihr Vater, waren nach Königstein im Taunus gezogen, weil dort die Nähe zu den Bergen und zur nahen Großstadt Frankfurt gegeben war. Während Johannes gemächliche Wandertouren vorzog, hatte Briana sich dem Bergsteigen verschrieben und ihre Tochter früh mit ihrer Leidenschaft angesteckt.
Unbewusst schüttelte Catherine den Kopf. Es käme ihr nie in den Sinn, einem klärenden Gespräch aus dem Weg zu gehen. Diese diplomatische Einstellung hatte sie von ihrem Vater, der, anders als die eigensinnige Briana, jedem Problem in seiner sanften, aber unnachgiebigen Art auf den Grund ging. Wenn Morven sich endlich gemeldet hatte, würde sie mit ihr sprechen, denn so konnten sich zwei erwachsene Frauen nicht verhalten. Catherine kannte den Grund für den jahrelangen Streit zwischen Morven und ihrer Mutter nicht, weil beide sich beharrlich darüber ausschwiegen. Erst mit zehn Jahren hatte sie ihre Großmutter überhaupt kennen gelernt, und das auch nur, weil ihr Vater sie auf eine Geschäftsreise nach Schottland mitgenommen hatte. Ohne Briana davon zu erzählen, waren sie, nachdem der Auftrag in Aberdeen abgewickelt war, nach Inveraray gefahren, und Johannes hatte Catherine ihrer Großmutter vorgestellt.
Sie hatte auf der Terrasse vor dem Haus gestanden, als Catherine sie zum ersten Mal gesehen hatte. Eine zierliche Frau mit langen schimmernden Locken, die ihren sehnigen Körper umspielten, und die auf sie zu warten schien. Johannes sagte nichts. Morven nickte dankbar, ging auf Catherine zu und nahm sie in die Arme. »Kleine Cat, ich freue mich sehr, dich endlich kennen zu lernen.« Sie forderte keine Erklärungen, aber sie gab auch keine. Sofort hatte sich Catherine der ungewöhnlichen Frau verbunden gefühlt, eine Verbundenheit, aus der im Lauf der Jahre ein enges Band aus Freundschaft und Liebe geworden war.
Nur Briana war nicht erfreut gewesen, als sie von Johannes’ eigenmächtigem Handeln erfuhr. Sie hatte Catherine durchdringend angesehen und gesagt: »Ich hätte es nicht immer verhindern können, aber sie wird dich mir nicht wegnehmen …« Mit Tränen in den Augen drückte sie ihre Tochter an sich und murmelte: »Du bist meine Tochter, nicht ihre. Vergiss das nie, hörst du, Cathy?« Unglücklich hatte Catherine ihre Mutter auf die Wangen geküsst und ihr versichert, dass sie niemanden mehr liebe als sie, und ihren Vater natürlich, und Briana hatte sich beruhigt, ihr über die Haare gestrichen und gesagt: »Ist ja gut, mein Kleines, tut mir Leid. Vergiss einfach, was ich gesagt habe.«
Damit war das Thema für lange Zeit erledigt gewesen, und Briana wandte sich nie gegen Catherines Wunsch, Morven in Schottland besuchen zu wollen, nur musste Catherine immer genau berichten, was sie mit ihrer Großmutter unternommen und worüber sie gesprochen hatten. Irgendwann hatte auch das nachgelassen und Catherine lernte, in Gegenwart ihrer Mutter nicht zu viel über Morven zu sprechen und umgekehrt.
Ihren Gedanken nachhängend war Catherine in Inveraray angekommen. Sie stieg über einen Haufen alter Fischernetze auf die flache Kaimauer hinter dem historischen Gefängnis und spazierte die Hauptstraße in Richtung des Piers hinunter.
Einiges schien sich verändert zu haben, seit sie das letzte Mal hier gewesen war. Die Clarks hatten dem alten George Hotel eine neue Fassade gegeben, von einem Besuch sah sie jedoch ab, das würde sie abends tun, wenn der gemütliche Pub unten in dem dreihundert Jahre alten Haus geöffnet hatte, wo sich Einheimische und Touristen gleichermaßen trafen. Der Supermarkt war ausgebaut worden, und sie entdeckte ein neues Geschäft, das sich auf den Verkauf feiner Whiskysorten spezialisiert hatte. Als sie am Pier um die Ecke bog, leuchtete ihr ein Schild mit der Aufschrift »Internetcafé« entgegen, auch das war neu und zeigte, dass die Jugend Inveraray noch nicht ganz verlassen hatte, wie es in vielen Orten Schottlands der Fall war. Da Catherine den Nachmittag nicht am Computer verbringen wollte, ging sie entschlossen an dem Café vorüber und spazierte zur Arctic Penguin, einem 1911 in Dublin vom Stapel gelaufenen Dreimastschoner, der jetzt als Museumsschiff seine Tage fristete. Die Ausstellung zum Thema schottische Seefahrt war ihr bekannt, weshalb sie um die wartenden Touristen herumlief und den Kindern dabei zusah, wie sie Muscheln, die von den Fischern liegen gelassen worden waren, aufsammelten und ihre Trophäen stolz verglichen.
Als Catherine über die Straße ging, um zum Lunch einen Teacake in Rosie’s Tearoom zu essen, wurde sie von einer jungen Frau angesprochen.
»Hey, Cathy, erkennst du alte Bekannte nicht mehr?«
Verdutzt blieb Catherine stehen und suchte in ihrem Gedächtnis nach einem Namen, den sie mit der blassen dünnen Frau in Verbindung bringen konnte, die mit einem Kleinkind, das protestierend neben einem Kinderwagen herging, auf sie zukam. »Bridget?« Nein, das konnte nicht sein, denn die Bridget, die Catherine in Erinnerung hatte, war immer grell geschminkt, auffallend gekleidet und quirlig gewesen. Hier jedoch sah sie eine übermüdete, verhärmte und desillusionierte Mutter vor sich, die der Bridget von damals nicht im Geringsten ähnelte.
Die junge Frau grinste und stemmte eine Hand in die Hüfte. »Tja, hättest du nicht gedacht, oder? In drei Jahren kann sich eine Menge verändern.« Unverfroren und dreist schien Bridget noch immer zu sein, was Catherine schlagartig daran erinnerte, wie wenig sie die einstige Pubbedienung gemocht hatte.
»Dann scheint es dir ja sehr gut zu gehen, Bridget. Wer ist denn der Glückliche, John?« Weitere unangenehme Bilder verbanden sich mit ihrem Gegenüber.
»Von ihm hier.« Sie deutete auf den Jungen, der ständig versuchte, sich von ihr loszureißen, doch sie hielt ihn mit geübtem Griff fest. Mit einem Seitenblick auf das Baby erklärte sie: »Der ist von Fletcher. Wir haben geheiratet, letztes Jahr! Hier, sieh mal!« Unaufgefordert hielt sie Catherine einen schmalen Goldring unter die Nase.
»Das freut mich für dich, schließlich war das ja dein Ziel, oder?« Wie man sich darüber freuen konnte, mit Fletcher Cadell verheiratet zu sein, einem heruntergekommenen Schafzüchter und Säufer, war Catherine zwar rätselhaft, aber Bridget schien am Ziel ihrer Wünsche angelangt zu sein.
Schnippisch warf sie das Kinn hoch. »Du musst mal nicht so tun, Catherine oder Cat, so hat er dich doch immer genannt, stimmt’s? Mich wollte wenigstens jemand heiraten … Na, wir sehen uns sicher noch. Das Kaff ist nicht größer geworden, wie du sicher bemerkt hast. Los, Adie, halt dich an der Karre fest, wir gehen jetzt nach Hause.« Ihren offensichtlichen Treffer genießend drehte sich Bridget um und marschierte mit ihren Kindern in Richtung Bushaltestelle davon.
Den Blick von der schmalen Gestalt in den verwaschenen Kleidern abgewandt ging Catherine langsam auf Rosie’s Tearoom zu, aß dort mit wenig Appetit ihren Teacake und kehrte schließlich zurück zum Wasser, wo sie einige Stufen zum Strand hinunterstieg und sich auf den Rückweg machte. Nur eine Person außer Morven hatte sie je »Cat« genannt – Fin. Bridget hatte zielsicher eine Wunde aufgerissen, die nie verheilt war und die sich vielleicht nie schließen würde. Finnean McFadden war der einzige Mann, der Catherine mehr bedeutet hatte als die Abenteuer und Affären, die danach gekommen waren, und wenn sie an ihn dachte, versetzte es ihr noch immer einen Stich, wofür sie sich hasste. Wenn sie es könnte, hätte sie ihn sich aus dem Herzen gerissen. Wütend stieß sie mit den Füßen in die Kieselsteine. Sie waren so jung und verliebt gewesen, und er war einfach verschwunden. Sie sagte sich zwar, dass er auch seinen Eltern keine Erklärung hinterlassen hatte, bevor er sich über Nacht aus dem Staub gemacht hatte, doch ein wirklicher Trost war das nicht, nicht nach allem, was sie gemeinsam erlebt hatten.
Ungeduldig wischte sich Catherine eine Träne aus dem Auge. Nach all den Jahren hatte sie noch immer keine Kontrolle über ihre Gefühle, wenn es um Fin ging. Morven hatte nie etwas zu ihrer Beziehung mit Fin gesagt, geschweige denn sein Weggehen kommentiert. Vielleicht verstand sie ihn besser als Catherine, weil er ihr in seinem Drang nach Freiheit so ähnlich war. Ein bitteres Lächeln umspielte Catherines Lippen. Genauso wenig, wie Fin sich um die sorgte, denen er mit seinem Weggehen das Herz brach, schien Morven sich Gedanken um ihre Freundin zu machen, die vor Sorge fast verrückt wurde. Vielleicht war das der Preis, den man zahlte, wenn man Zeit mit Menschen wie Morven oder Fin teilen durfte – denn dass er es wert gewesen war, stand außer Frage.
Die Sonne brannte heiß auf die Terrasse und die Gäste drängten sich unter den Sonnenschirmen, die Nellie aufgestellt hatte. Catherine winkte Clara und dem fröhlichen jungen Mädchen zu, das flink zwischen den Tischen hin und her eilte, um schmutziges Geschirr abzuräumen und Bestellungen aufzunehmen.
»Wo braucht ihr mich am dringendsten?« Catherine band sich eine Schürze um.
»Dreimal Scones mit Marmelade und Butter, zwei Applepies und Tee für fünf Personen!«, rief Nellie durch die Küchentür, stellte einen Haufen Geschirr in die Spüle und eilte wieder davon. Clara wollte nach dem Geschirr greifen, doch Catherine hielt sie zurück.
»Ich mach das. Abwaschen ist meine Stärke. Mit den Kuchen kennst du dich besser aus.«
Ein dankbares Lächeln von Clara quittierte Catherines Worte. Dampfende Applepie wanderte nun, von Clara geschickt in exakt gleich große Stücke geschnitten, auf die Teller, während Catherine sich um die Spülmaschine kümmerte. Zwischendurch füllte Catherine die Getränke ein und stellte die Bestellungen für Nellie auf Tabletts zusammen. Nellies australischer Akzent war unüberhörbar und trotz der Arbeit fand sie Momente, um Catherine zu erzählen, dass sie mit ihrem Freund Chris seit einem Jahr eine Weltreise machte und Schottland nach Indien und Thailand die dritte Station war.
Catherine war gerade dabei, einen Stapel Teller in das Regal zurückzustellen, als Nellie in die Küche gestürmt kam. »Da draußen ist so ein komischer Typ.«
»Was will er denn? Schmeckt ihm der Kuchen nicht?«, fragte Catherine.
Clara knetete mit roten Wangen an einem neuen Teig für die Pies, die an diesem Nachmittag reißenden Absatz fanden. »Was ist los? Gibt es ein Problem?«
»Nein, nein«, und zu Catherine gewandt sagte sie leise: »Er will das Bild kaufen oder so. Ich frag noch mal. Der spinnt doch!« Mit einem neuen Tablett in den Händen lief Nellie wieder hinaus.
Mit verschwitztem Gesicht und mehligen Händen kam Clara nach vorn. »Was war denn?«
Catherine zuckte die Schultern. »Da will jemand ein Bild kaufen. Keine Ahnung.«
Es blitzte kurz in Claras Augen auf. »Gib mir ein Handtuch!«
Erstaunt reichte Catherine ihr das Gewünschte, und Clara wischte sich noch im Laufen die Hände ab und rannte so schnell es ihre rundliche Figur zuließ nach draußen. Neugierig geworden folgte Catherine ihr in den Wintergarten, in dem bei dem schönen Wetter keine Gäste saßen.
»Das Bild ist nicht verkäuflich! Wollen Sie das schriftlich?«
Noch nie hatte Catherine die liebenswürdige Clara so aufgebracht erlebt. Mit hochrotem Kopf und in die Hüfte gestemmten Händen stand sie vor einem Mann, der sie um mindestens einen Kopf überragte und auf sie einredete. Ihr Busen wogte unter der frisch gestärkten Schürze, und es war deutlich, dass sie ihre Meinung nicht ändern würde. Der Mann, den Catherine auf Anfang fünfzig schätzte, hatte schütteres rötliches Haar, ein schmales Gesicht mit einer langen schiefen Nase und Hände, die beim Gestikulieren wie Spinnenbeine wirkten.
»Ist alles in Ordnung, Clara?« Beschützend stellte Catherine sich neben sie.
Der Mann ließ sich nicht beirren und musterte Catherine neugierig. »Vielleicht haben Sie mehr Geschäftssinn? Mein Name ist Donaldson, ich bin Antiquitätenhändler aus Edinburgh und möchte dieses Gemälde kaufen.« Aus seiner Tasche holte er eine Visitenkarte hervor, die er Catherine reichte. »Überlegen Sie es sich, mein Angebot steht.«
»Das Bild steht aber nicht zum Verkauf«, antwortete Catherine erbost, nahm die Karte und legte sie neben sich auf einen Tisch.
Clara drückte sanft ihren Arm. »Lass nur. Der Herr wollte gerade gehen, nicht wahr?!«
Mit einem letzten Blick auf das Gemälde, das an der Wand über dem Kamin hing, wandte er sich zum Gehen. »Überlegen Sie es sich. Wenn die Gäste irgendwann ausbleiben, ist eine Nebeneinnahme eine willkommene Hilfe.«
»Jetzt reicht es. Raus!« Mit erhobener Hand wies Clara ihm den Weg zur Tür hinaus.
Als er verschwunden war, überschüttete Catherine sie mit Fragen: »Warum wollte er dieses Bild kaufen? Kennt er Morven und …«
»Oh Cathy, wenn ich auf alles eine Antwort wüsste.« Clara deutete auf das Ölgemälde. »Erst mal steht fest, dass Morven dieses Bild niemals verkaufen würde. Sie hat sich noch nie von irgendeinem ihrer vielen Kunstgegenstände getrennt.«
Catherine betrachtete das Landschaftsgemälde, das eine typische schottische Seenstimmung darstellte. Vor der großartigen Kulisse einiger Berggipfel lag eine Insel mit den Überresten einer Burg oder Kirche inmitten eines Nadelwäldchens, umgeben vom ruhigen Wasser eines Sees oder Meerarmes. Bemerkenswert war höchstens, dass es sich um eine nächtliche Stimmung handelte, die dem Bild etwas Geheimnisvolles verlieh.
»Zweitens kann ich den Kerl nicht leiden, und drittens haben wir gleich ein richtiges Problem, nämlich schmutzige Tellerstapel …« Clara nickte in Richtung Küche, in die Nellie gerade mit einer Ladung Geschirr verschwunden war.
Später am Abend, nachdem die letzten Gäste gegangen, Café und Küche gesäubert waren und Nellie, die mit ihrem Freund in einem nahe gelegenen Caravanpark wohnte, sich verabschiedet hatte, stand Catherine allein in dem nun stillen Wintergarten und betrachtete das Gemälde genauer. Sie war zwar Webdesignerin, doch für die Malerei hatte sie schon immer eine Vorliebe gehabt. Besonders die schottischen Maler William McTaggart, Joseph Farquharson und der modernere James McIntosh Patrick hatten es ihr angetan. Den Stil dieses Malers jedoch konnte sie mit keinem ihr bekannten Künstler in Verbindung bringen und tippte auf eine Datierung im 18. Jahrhundert, wobei sie sich nicht sicher war, ob Anfang oder Mitte. Auf ihre Fragen hatte Clara den Vorfall als nebensächlich abgetan. Sie sei so wütend geworden, weil der Antiquitätenhändler genau wusste, dass Morven nicht da war, und versucht hatte, sie einzuschüchtern.
Welches Loch stellte die nächtliche Szenerie dar? Die Berggipfel verschwanden im Dunst und verhinderten ein Erkennen ihrer Form. Auch die kleine Insel kam Catherine unbekannt vor, aber das musste nichts bedeuten, denn es war unmöglich, sich den Umriss der unzähligen kleinen Inseln in Schottlands Wasserarmen und Seen zu merken. Sie trat dichter an das Bild und strich über den wertvoll aussehenden goldenen Rahmen, dessen aufwendige Verzierungen allein schon sehenswert waren. Üppige florale Schnitzereien waren im äußeren Bereich des zum Bild hin abgestuften Rahmens angebracht, während flachere ornamentale Schnitzarbeiten und Eingravierungen sich direkt um das Bild herum zogen. Catherine bestaunte die seltsam anmutenden Formen, die in ihrer zeichenhaften Regelmäßigkeit einem hieroglyphenartigen Code ähnelten.
»Cathy, was machst du noch hier? Komm, gehen wir schlafen. Der Tag heute war lang genug.« Clara kam, in einem langen Kleid und einen seidenen Schal gewickelt, auf sie zu und legte ihr den Arm um die Schultern. Ihre Bewegungen wirkten plötzlich weniger behäbig, und Catherine begann zu verstehen, dass sie und Morven vielleicht doch nicht so verschieden waren, wie sie immer angenommen hatte.
»Ich bin sehr froh, dass du jetzt hier bist, Catherine. Du hast so viel von deiner Großmutter.« Sie zwinkerte ihr lächelnd zu. »Zum Glück bist du nicht so unberechenbar und sprunghaft wie sie.«
Catherine legte kurz den Kopf an Claras Schulter. »Es ist schön, wieder hier zu sein. Jeden Tag, den ich hier bin, spüre ich mehr, wie sehr ich euch und Schottland vermisst habe. Vielleicht sollte es so sein, dass du mich brauchtest. Ich war so in meinen Alltag verstrickt, dass ich vergessen hatte, was mir wichtig ist.«
»Wir werden Morven aufspüren, Cathy, und ich wünsche dir, dass du hier findest, was dich glücklich macht.« Clara drückte ihr einen Kuss auf die Haare und ging dann mit Catherine durch die Küche in die Wohnräume.
Bevor sie zu Bett ging, schaute Catherine in ihrem Zimmer noch eine Weile auf das dunkle Wasser hinaus, das ruhig im Licht des zunehmenden Mondes lag. Heute, mehr als bei einem ihrer vorherigen Besuche, hatte sie den Eindruck, hierher zu gehören, und das lag nicht nur an der uralten Landschaft, die trotz der Feriengäste nichts von ihrer mystischen Ursprünglichkeit verloren hatte.
Kapitel 2
Der stille Berg, stechginsterzischelnd, brennt,prahlend mit Ginstergold,Hervorgebrochnem Quarz; von jedem Busch,der angerührt, sprüht Tau …
Glyn Jones
Auch an diesem Morgen wurden sie von strahlendem Sonnenschein begrüßt und saßen gerade mit Nellie beim Frühstück auf der Terrasse, als das Telefon klingelte. Nellie, die dem Apparat am nächsten war, nahm ab und reichte den Hörer an Clara weiter. »Eine Gillian Grant.« Sie zuckte mit den Schultern und nahm sich einen dritten Pfannkuchen, den sie dick mit Butter und Marmelade bestrich.
»Gillian?« Clara hörte einige Minuten schweigend zu und gab dann Catherine den Hörer. »Das ist so typisch!« Kopfschüttelnd stand sie auf und räumte ihr Geschirr ab.
»Ja?«, fragte Catherine gespannt in den Hörer, denn sie wartete auf Gillians Antwort, seit sie ihr auf den Anrufbeantworter gesprochen hatte.
»Clara, sind Sie noch dran?«
»Nein, ich bin Catherine.«
»Oh, ja, hören Sie, es tut mir alles sehr Leid, aber Morven hatte mich gebeten, nichts zu sagen. Ich wollte mich nur bei Ihnen für die unnötigen Sorgen entschuldigen, die Sie sich vielleicht gemacht haben.« Sie lachte leise. »Aber wahrscheinlich kennen Sie Ihre Großmutter besser als ich und sind Überraschungen gewohnt. Ja, also, bitte verzeihen Sie mir. Da kommt Morven auch schon. Auf Wiedersehen!«
Catherine schluckte, als sie endlich die vertraute Stimme ihrer Großmutter hörte. »Cat! Oh, ich freue mich ja so, dass du gekommen bist. Es gibt so viel zu erzählen. Geht es dir gut? Clara hat sich um dich gekümmert, nicht wahr?«
»Gran, hör doch mal. Warum hast du dich denn nicht abgemeldet? Wir sind fast verrückt geworden vor Sorgen!«
»Meine arme Kleine. Du weißt doch, um mich muss man sich keine Gedanken machen, Unkraut vergeht nicht. Ich brauchte einfach Ruhe. Auf dem Rückweg von Callanish, das jetzt auch schon so furchtbar überfüllt ist, bin ich nach Mull, um Gillian zu sehen, aber hier ist es mir auch schon zu belebt. Wir haben vor, nach Sandray oder Mingulay zu fahren.«
Das waren kleine unbewohnte Inseln der äußeren Hebriden, mit weiten menschenleeren Stränden. »Aber was willst du denn dort oben? Morven, ich bin hergekommen, um dich zu sehen, um mit dir zu sprechen, und außerdem habe ich einen Job …«, wandte Catherine verzweifelt ein.
»Wärst du gekommen, wenn Clara nicht so einen Aufstand gemacht hätte?«, fragte Morven schlicht.
»Nein, wahrscheinlich nicht, jedenfalls nicht sofort.«
»Du wärst nicht gekommen, weil du gedacht hättest, dass du keinen ausreichenden Grund hast. Jetzt hast du gesehen, dass man auch ohne dich in diesem Kölner Büro auskommt. Vermisst du es oder irgendjemanden?«
»Äh, nein. Aber …« Morvens Argumentation war geradeheraus und nicht zu widerlegen. Innerlich lächelte Catherine.
»Schön. Fühl dich in Balarhu wie zu Hause, Schottland hat dir immer gut getan. Ich komme bald zurück. Bis bald, meine Kleine, und jetzt gib mir Clara, die sicher schmollend in die Küche gegangen ist.«
Die Menschenkenntnis ihrer Großmutter war immer wieder verblüffend. Catherine nahm den Hörer des schnurlosen Telefons und reichte ihn Clara, die tatsächlich mit mürrischer Miene einen Teig energisch auf dem Tisch knetete und eine mehlige Hand nach dem Telefon ausstreckte.
Catherine ließ sie allein und ging wieder hinaus zu Nellie, die sich eine Zigarette angezündet hatte und entspannt auf ihrem Stuhl saß. Den Rauch ausblasend bemerkte sie: »Ich habe noch nicht viel von Morven gesehen, seit ich hier bin, aber sie ist einer der interessantesten Menschen, die mir seit langem begegnet sind, und glaub mir, in Indien haben Chris und ich die abgefahrensten Leute getroffen. Mach dir mal keine Gedanken um Clara, die verzeiht Morven alles und ist der glücklichste Mensch, wenn sie wieder hier ist.«
»Wie lange willst du bleiben, Nellie?«, fragte Catherine die sympathische Australierin.
»Phh, mal sehen, den Sommer auf jeden Fall. Chris hat jetzt einen Job im Pub vom George Hotel gefunden. Hey, komm doch mal abends vorbei. Ich gehe auf jeden Fall hin, sonst sehe ich Chris ja kaum noch. Aber ist schon okay, wir sparen das Geld, und dann fahren wir weiter.«
»Wisst ihr schon wohin?«
»Keine Spur, wird sich ergeben. Ich mag das so.« Sie drückte ihre Zigarette auf dem Teller aus, fuhr sich durch die kurzen blonden Haare, die ein verschmitztes sommersprossiges Gesicht umrahmten, und stand auf. »Na, dann will ich mal lieber anfangen, man soll nicht glauben, was die Leute schon am frühen Vormittag an Kuchen verdrücken!« Schwungvoll stapelte sie das Frühstücksgeschirr auf ihrem kräftigen Unterarm und ging in Richtung Küche, wohin Catherine ihr mit dem Rest des Geschirrs folgte.
Clara schien wieder bestens gelaunt, summte eine Melodie vor sich hin und drückte den Teig in Pieformen. »Cathy, du hast mir so lieb geholfen gestern, mach dir heute einen schönen Tag. Wir schaffen das schon, außerdem kann ich bei Bedarf noch Jean anrufen. Nimm den Geländewagen, wenn du magst, und fahr rauf in die Berge oder nach Crinan, da gibt es einen schönen Strand.«
»Hmm, ja danke, Clara. Aber sag mal, was treibt Morven denn nach Callanish? Das liegt doch auf Lewis und gehört zu den äußeren Hebriden, oder?«
»Wahrscheinlich die Steine. Sie liebt Steinkreise.« Clara füllte Kirschen in die fertigen Teigmulden und verschloss die Pies mit dem ausgeschnittenen Teigdeckel.
»Ja, das stimmt. Hier in der Umgebung gibt es kaum eine Ansammlung mythisch anmutender Steine, die sie mir nicht gezeigt hat. Hat sie dir gesagt, wann genau sie wiederkommt?« Es fiel Catherine schwer, sich mit der Ungewissheit abzufinden und einfach zu warten.
Mit schiefem Lächeln antwortete Clara: »Morven lässt sich nicht gern festlegen. Jetzt genieße einfach deine Zeit hier, bis sie kommt, und dann schaust du weiter.«
Nervös knetete Catherine einige Teigkrümel. »Wahrscheinlich bin ich es nicht mehr gewohnt, ohne Terminkalender zu leben.«
»Na, dann nimm die Zeit hier als eine willkommene Gelegenheit, es wieder zu lernen. Probier mal die Kirschen, habe ich mit Whisky abgeschmeckt.« Clara schob ihr eine Tonschüssel hin, in der die noch dampfenden Kirschen darauf warteten, in die übrigen Pies gefüllt zu werden.
Leichte Bewölkung war aufgezogen, und es war nicht ganz, so warm wie am Vortag, weshalb Catherine sich für eine Fahrt auf die andere Seite von Loch Fyne entschieden hatte, wo sie von St. Catherines durch den Wald hinauf zum Cruach nan Capull, einem der niedrigeren Berge, wandern wollte. Sie verließ Inveraray in östlicher Richtung über die einspurige Brücke, folgte den Ufern von Loch Fyne bis zu dem kleinen Ort mit ihrem Namen, der direkt am Wasser und gegenüber von Inveraray lag. Obwohl die Entfernung auf den Karten nie groß schien, fuhr man über eine Stunde, bis man das andere Ufer des Meerarmes erreichte. Catherine parkte den robusten kleinen Geländewagen an der Straße und machte sich, ausgerüstet mit Rucksack, festen Schuhen, in T-Shirt und Shorts, auf den Weg. Sie hatte eben den Wald erreicht, als ihr Mobiltelefon klingelte. Das Signal war schwach, doch sie erkannte die Stimme ihrer Mutter.
»Wir wollten dich fragen, ob du dich am Wochenende freimachen kannst, um uns zu besuchen. Wir …«
»Ich bin gar nicht in Köln, Ma«, sagte Catherine lauter, damit ihre Mutter sie trotz der schlechten Verbindung hören konnte. »Clara brauchte Hilfe im Café, und ich hatte noch so viel Urlaub übrig, da bin ich spontan hergefahren«, bog sie die Wahrheit hin, damit ihre Mutter sich nicht über Morvens Verhalten aufregte.
»Ach so? Wie lange bleibst du?«
»Weiß ich noch nicht, vielleicht zwei Wochen. Warum kommt ihr nicht her? Es ist wirklich traumhaft schön hier.« Das hätte sie nicht sagen sollen, denn schließlich war Briana hier aufgewachsen und kannte die Gegend besser als sie selbst.
»Danke. Dann melde dich doch, wenn du wieder hier bist. Du fehlst uns. Dein Job frisst dich ja regelrecht auf? Kannst du mich noch hören? Die Verbindung ist so furchtbar.«
Es knackte in der Leitung, und Catherine verabschiedete sich mit dem Versprechen, nach Königstein zu fahren, sobald sie wieder in Deutschland sei. Seufzend steckte sie das Handy in ihren Rucksack. Die betonte Gleichgültigkeit ihrer Mutter gegenüber ihrem Geburtsort und vor allem gegenüber Morven verletzte Catherine, auch wenn das sicher nicht beabsichtigt war. Selbst zu Clara, deren liebenswertes Wesen so einnehmend war, äußerte sich Briana nur knapp, dabei mussten sich die beiden gekannt haben. Mit ausgreifenden Schritten ging sie den weichen Waldboden entlang und lauschte dem Vogelgezwitscher und den surrenden Insekten, die sie noch nicht als potenzielle Nahrungsquelle geortet hatten, weil ihr Insektenschutzmittel wirkte. Johannes hatte sie zwar zu Morven gebracht, über Brianas Vergangenheit jedoch schwieg auch er sich aus, so als bestünde eine stumme Übereinkunft mit seiner Frau. Oft hatte Catherine sich als Kind vorzustellen versucht, wie der hoch gewachsene blonde Deutsche sich in die temperamentvolle dunkelhaarige Briana verliebt hatte. Da Briana ihrem zukünftigen Mann sofort in dessen Heimat gefolgt war, hatte Catherine immer gedacht, alles müsse furchtbar romantisch gewesen sein, nähere Erklärungen von ihren Eltern hatten diese Theorie jedoch nie erhärten können.
Ein vertrauter Geruch nach Kokos stieg in Catherines Nase, und als sie den Hügel hinauf durch den sich lichtenden Wald blickte, sah sie den grellgelben Stechginster, der so typisch für Schottland war. Auf dem offenen Wegstück machte sich ein frischer Wind bemerkbar, und weitere Wolken kündeten einen Wetterwechsel an. Ein Kaninchen duckte sich nicht weit von ihr im Gras, und wenig später rannte ein braunweißes Wiesel über den Weg. Sie wanderte weiter und nahm die schöne vielseitige Vegetation in sich auf. Mehrere kleine Bäche kreuzten ihren Weg und mit zunehmender Höhe wurde der Berg felsiger. Eben wollte sie sich auf einem steinigen Vorsprung niederlassen, um das mitgebrachte Obst zu essen, als sie Motorenlärm hörte, gefolgt vom Zuschlagen einer Autotür.
Erschrocken blieb Catherine stehen und horchte auf die näher kommenden Schritte. Da sie keine Straße und auch keine anderen Wanderer gesehen hatte, war sie überrascht und erwartete einen Ranger, der sie vielleicht auf etwas hinweisen wollte. Da sie dem ausgetretenen Pfad gefolgt war, nahm sie nicht an, dass man sie verwarnen wollte.
»Hey, hallo!«, erklang eine herrische Männerstimme, gefolgt von einem Mann, ungefähr in ihrem Alter, mit rötlichen Haaren in professioneller Rangerkleidung, der sich drohend vor ihr aufbaute.
Catherine stutzte. War es die Stimme oder das arrogante Auftreten, das so gar nicht zum Verhalten eines Rangers passte, das sie störte?
»Was haben Sie hier zu suchen? Gibt es nicht genug Nationalparks? Das hier ist unser Land!« Selbstgefällig steckte sich der Rothaarige eine teure Sonnenbrille in die Haare.
Jetzt konnte sich Catherine ein Grinsen nicht länger verkneifen. »Ich hätte dich fast nicht wiedererkannt, Rory Donachie McLachlan, aber deine charmante Art ist einfach einmalig!«
Jetzt war es an Rory, dessen gälischer Name treffenderweise roter König bedeutet, und wie ein solcher hatte er sich schon immer aufgeführt, überrascht zu sein. »Meine Güte! Catherine? Du hast dich aber verändert, wow, du siehst ja fast aus wie Morven mit den langen Haaren! Tut mir Leid, dass ich dich so angefahren habe, aber du glaubst ja nicht, wie viele Touristen hier herumtrampeln und ihren Müll liegen lassen, und wir können dann alles wieder aufsammeln.« Er lachte entschuldigend und reichte ihr zur Begrüßung die Hand.
Rorys Vater, Dougal Donachie McLachlan, war einer der wohlhabendsten und einflussreichsten Clanoberhäupter auf der südöstlichen Seite von Loch Fyne. Seit Generationen gehörten seiner Familie viele Hektar Land, die er durch seinen Erfolg als Geschäftsmann über die Jahre immer wieder erweitert hatte. So erklärte sich auch, dass Catherine von dem neueren Besitz der McLachlans nichts wissen konnte. Dieser Besuch schien voller Überraschungen zu sein, denn sie hatte Rory seit mindestens acht Jahren nicht gesehen. Aus dem verwöhnten, übergewichtigen Söhnchen war ein kräftiger, nicht unattraktiver Mann geworden. Nur seine angeborene Arroganz, für die seine Mutter Flora verantwortlich war, hatte sich mit den Jahren anscheinend nicht vermindert. Flora McLachlan entstammte einem nicht minder einflussreichen Clan der Ostküste und war in der gesamten Gegend für ihr hochmütiges und unerbittliches Wesen bekannt. Im Vergleich zu seiner Frau gab Dougal sich weltmännisch und charmant, auch wenn jeder wusste, dass er in Geschäftsdingen unnachgiebig und rücksichtslos war.
»Lange her, Rory. Bist du zu Besuch oder hast du dich entschieden, hier zu leben?« Sie deutete auf die Steine hinter sich, auf denen sie sich hatte niederlassen wollen.
Nachdem sie sich gesetzt hatten, schaute Rory sie bewundernd an. »Du bist wirklich schön geworden, Catherine, und das sage ich ganz ohne Hintergedanken.«
Sein leicht verlegenes Lächeln erinnerte sie wieder an den rundlichen Fünfzehnjährigen, der sie auf Sommerfesten oder Tennisturnieren, auf denen sie sich öfter begegnet waren, angehimmelt und mit seinem Namen zu beeindrucken versucht hatte. »Danke«, sagte sie schlicht, immer noch auf eine Antwort wartend.
»Ich lebe seit zwei Jahren hier. Kommt dir sicher komisch vor, nachdem ich immer davon geredet habe, in die Vereinigten Staaten zu gehen und große Geschäfte zu machen.« Er zuckte lakonisch die Schultern. »Ich bin der einzige Sohn, Aileen hat einen McMillan geheiratet und lebt in Glasgow, und Greer ist völlig durchgeknallt. Im Moment ist sie in London und nimmt Gesangsstunden. Sie will Musicalstar werden …« Seine genervte Mimik verriet, dass Greer entweder wenig Talent hatte oder dass das nicht ihr erster Versuch war, sich künstlerisch zu betätigen.
»Armer Rory, dann hast du dich sozusagen für die Familie geopfert?«, neckte sie ihn.
Er stieß hörbar die Luft aus. »Du erinnerst dich vielleicht an meine Mutter, keine einfache Person, aber wir kommen klar, vor allem mit meinem Vater verstehe ich mich sehr gut. Ich habe Forstwirtschaft studiert und kümmere mich jetzt um das Land.« Stolz schwang in seiner Stimme mit, und Catherine konnte sich bildlich vorstellen, wie Rory-Red-King vielleicht vor zweihundert Jahren sein Land abgeschritten, hier und da die Pächter gemaßregelt und ihnen die besten Tiere als Pacht abverlangt hätte.
»Ah, deshalb die professionelle Kleidung.«
Doch Rory ging nicht auf ihre sarkastische Bemerkung ein. »Tja, läuft gut, und bei dir?«
»Werbebranche, ich mache Webdesign, um genau zu sein«, sie sprach ihren Beruf aus und fand, dass er fremd klang, so als hätte sie sich innerlich schon davon distanziert. Tom würde nicht erfreut sein, das zu hören.
»Klingt aufregend. Irgendwelche großen Projekte?«
Sie lenkte ab. »Ich habe Urlaub, lass uns nicht von meiner Arbeit sprechen. Es ist viel zu schön hier, um an Bürostress und Deadlines für Waschpulverreklame zu denken.«
»Na schön. Du trägst keinen Ring, hat man dich noch nicht an die Kette gelegt?« Anscheinend hielt er selbst nicht viel von dem Gedanken.
Catherine lachte. »Ich lasse mich nicht an die Kette legen.«
»Nein, kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Vor allem, nachdem ich dich jetzt gesehen habe. Aber du weißt wahrscheinlich selbst, wie ähnlich du Morven bist.« Sein bewundernder Blick war ihr unangenehm.
»Um ehrlich zu sein, habe ich sie noch nicht gesehen, seit ich hier bin. Sie macht so eine Art Erholungstrip zu den äußeren Hebriden.« Sie nahm einen Apfel aus ihrem Rucksack und bot Rory ebenfalls ein Obststück an.
Er lehnte dankend ab. »Habe geluncht, ausgiebig, mit Geschäftspartnern. Wir …«, er unterbrach sich und fuhr fort: »Es gibt ein fantastisches neues Fischrestaurant, Loch Fyne Oysters – kennst du es?«
»Nein. Das ist erst mein dritter Tag hier.«
»Dann sollten wir da auf jeden Fall hingehen. Du bist selbstverständlich mein Gast. Ich rufe dich an. Wohnst du bei deiner Großmutter?« Er stand auf und klopfte sich den Sand von der beigefarbenen Outdoorhose, die noch keine Gebrauchsspuren zeigte.
»Ja. Wo ist denn dieses Austernrestaurant?«, fragte Catherine.
»Am Fuß von Glen Fyne. Lohnt wirklich einen Besuch, und wir haben uns sicher eine Menge zu erzählen. Also, bis bald!«
Sie nickte. Morven schien jedem ein Begriff zu sein, während niemand die treue Clara erwähnte, die das Café am Laufen hielt und die Seele des Betriebs war. Rory wollte sich umdrehen und gehen.
»Dann werde ich nicht verhaftet, wenn ich denselben Weg wieder zurückgehe?« Sie schulterte ihren Rucksack und grinste.
»Von mir jedenfalls nicht, bei Lennox bin ich mir nicht so sicher …« Damit bog er um den Felsen und war verschwunden.
Sie grübelte darüber nach, ob Lennox ein verrückter Banger oder einer von Dougals raubeinigen Holzarbeitern war, und spazierte den Weg hinunter, den sie gekommen war, nicht ohne ab und an vorsichtig in die Gegend zu horchen.
Am späten Nachmittag fuhr sie mit ihrem geliehenen Geländewagen über die schmalen, teilweise nur einspurigen Straßen um den langen Meerarm herum, der als der längste Schottlands galt, zurück nach Inveraray. Der Parkplatz vor Claras Café war bis auf eine teuer aussehende Luxuslimousine leer. Catherine parkte ihren Wagen neben dem eleganten dunkelgrünen Jaguar, der ein schottisches Nummernschild trug. Neugierig ging sie um das Haus herum und trat, nachdem sie auf der Terrasse niemanden angetroffen hatte, in die Küche.
»Hi!« Nellie trocknete Gläser ab. »Hattest du einen schönen Tag?«
Catherine ließ ihren Rucksack auf den Boden fallen und holte sich eine Flasche Orangensaft aus dem Kühlschrank. »Oh ja, sehr schön und sehr interessant. Ich habe jemanden aus meiner Vergangenheit getroffen.«
Nellie schnalzte mit der Zunge. »So was kann ja manchmal wirklich nett sein …«
Abwinkend stellte Catherine ihr in einem Zug geleertes Glas ab. »Nicht was du denkst. Rory McLachlan hat sich gemausert, aber als ich ihn kannte, war er ein übergewichtiges, arrogantes Söhnchen.«
»Wenn du nach nebenan gehst, kannst du deine Bekanntschaft mit dem holden Rest der Familie erneuern.« Nellie nickte in Richtung des Wintergartens und verzog abfällig den Mund. »Er geht gerade noch, aber sie ist ja wohl ziemlich daneben.«
»Dougal und Flora sind hier? Aber wieso?« Catherine erinnerte sich nur zu gut daran, dass Morven und Dougal mehr als einmal aneinander geraten waren und sich bewusst aus dem Weg gingen.
»Das Bild. Ist schon komisch, oder? Da fragt erst gestern jemand nach dem alten Schinken, und heute kommt dieser Möchtegernhäuptling vorbeigetanzt und meint, er kann das Bild mal so eben mitnehmen.« Ehrlich entrüstet stellte Nellie die trockenen Gläser lautstark in das Regal.
Catherine lachte. »Du hast wohl nichts übrig für den schottischen Adel?«
»Nee, für Titelfetischisten und reiche Säcke hatte ich noch nie was übrig. Die soll’n mal zu uns ins Outback kommen und versuchen, da ein paar Tage zu überleben, ohne ihren ganzen Hightechmist – dann wüssten sie wieder, wo sie hingehören!« Die robuste Australierin sah auf ihre Uhr. »Hier ist alles klar. Ich hau dann jetzt ab. Bis morgen, oder sehen wir uns heute Abend im George?«
»Ja, wenn ich nicht zu müde bin von meiner Tour. Ich bin nichts mehr gewohnt und die Seeluft schon gar nicht.«
»Dann ist es aber höchste Zeit, dass du hergekommen bist. Mach’s gut!«
Nachdem Nellie mit schwingendem Schritt verschwunden war, öffnete Catherine die Tür zum Wintergarten, aus dem sie Claras Stimme hörte. Sie klang nicht erbost, aber doch entschieden, und Catherine hatte das Gefühl, dass sie Verstärkung gebrauchen konnte.
»Guten Tag, alle zusammen!«, wandte sie sich freundlich lächelnd den Gästen und Clara zu. Zuerst küsste sie Clara auf die Wange, die sie dankbar anstrahlte. Dann reichte sie Flora die Hand, die sie mit kühler, irritierter Miene begrüßte.
»Catherine, ich bin Morvens Enkelin. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich hatte heute schon das Vergnügen mit Ihrem Sohn.«