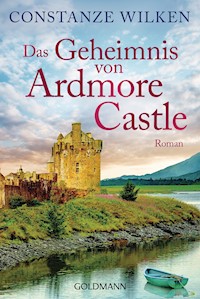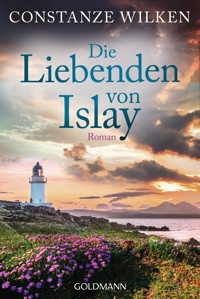Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ihr Talent ist einzigartig – doch ihr Glaube könnte ihr zum Verhängnis werden … Anno Domini 1569: Aus ihrer Heimat vertrieben sucht die junge Hugenottin Jeanne gemeinsam mit ihrem Vater in einem sächsischen Dorf Zuflucht vor ihren Verfolgern. Mit Jeannes Lautenspiel und dem Talent ihres Vaters als Instrumentenmacher versucht sie, sich über Wasser zu halten – doch die Dorfbewohner begegnen den beiden mit Misstrauen. Einzig der Tagelöhner Gerwin will Jeanne helfen. Schon bald entspinnt sich zwischen den beiden ein zartes Band, aber die Standesunterschiede machen ihre Liebe unmöglich. Als Jeannes musikalisches Talent auf der Laute sie schließlich über Dresden bis an den Pariser Königshof führt, wagt sie zum ersten Mal wieder auf ein besseres Leben zu hoffen – bis sie in eine dunkle Intrige verwickelt wird, deren Ausgang sich in der Bartholomäusnacht entscheiden soll … Ein mitreißender historischer Roman der Bestsellerautorin für alle Fans von Sabine Ebert und Peter Dempf. »Constanze Wilkens hat sich mit ihren Büchern zu meiner Lieblingsautorin entwickelt.« Lovelybooks-Leserin »Großes Kopfkino.« Lovelybooks-LeserIn
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Anno Domini 1569: Aus ihrer Heimat vertrieben sucht die junge Hugenottin Jeanne gemeinsam mit ihrem Vater in einem sächsischen Dorf Zuflucht vor ihren Verfolgern. Mit Jeannes Lautenspiel und dem Talent ihres Vaters als Instrumentenmacher versucht sie, sich über Wasser zu halten – doch die Dorfbewohner begegnen den beiden mit Misstrauen. Einzig der Tagelöhner Gerwin will Jeanne helfen. Schon bald entspinnt sich zwischen den beiden ein zartes Band, aber die Standesunterschiede machen ihre Liebe unmöglich. Als Jeannes musikalisches Talent auf der Laute sie schließlich über Dresden bis an den Pariser Königshof führt, wagt sie zum ersten Mal wieder auf ein besseres Leben zu hoffen – bis sie in eine dunkle Intrige verwickelt wird, deren Ausgang sich in der Bartholomäusnacht entscheiden soll …
Über die Autorin:
Geboren an der norddeutschen Küste zog es Constanze Wilken nach einem Studium der Kunstgeschichte, Politologie und Literaturwissenschaft für einige Jahre nach England. Im wildromantischen Wales entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben, aber auch für Antiquitäten. Die Forschungen zur Herkunft seltener Stücke und ausgedehnte Reisen der Autorin sind Inspiration und Grundlage für ihre Romane.
Die Website der Autorin: constanze-wilken.de/
Bei dotbooks erschienen bereits folgende Romane:
»Die Frau aus Martinique«
»Was von einem Sommer blieb«
»Die vergessene Sonate«
»Das Geheimnis des Schmetterlings«
»Die Frauen von Casole d'Elsa«
»Das Licht von Shenmoray«
Weiterhin veröffentliche Constanze Wilken bei dotbooks die folgenden Historischen Romane:
»Die Tochter des Tuchhändlers«
»Die Malerin von Fontainebleau«
»Die Tochter des Steinschneiders«
»Die Lautenspielerin«
***
eBook-Neuausgabe Januar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motivs von © Adobe Stock / Kathy sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-601-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Constanze Wilken
Die Lautenspielerin
Historischer Roman
dotbooks.
Widmung
Für meine Eltern
Motto
drum ist nit alle lieb verloren,
lieb hat oft lieb durch lieb geboren
Im rosenton Hans Sachsen. 9. august 1543
Prolog
Languedoc, Montagne de la SéranneSeptember 1568
Die Sonne senkte sich bereits über den Bergen und tauchte die Landschaft in ein Meer aus Rotorange. Ein älterer Mann und ein junges Mädchen gingen gut gestimmt nebeneinanderher. Der Mann pfiff eine fröhliche Melodie und wechselte den schweren Ledersack von einer Schulter auf die andere.
»O Vater!«, sagte das Mädchen. »Wir hätten nicht so viel einkaufen sollen. Mutter wird uns dafür schelten.« Dabei lachte sie, weil sie natürlich wusste, wie sehr ihre Mutter sich über die Geschenke freuen würde, die sie ihr aus Montpellier mitgebracht hatten.
»Ich hätte auch die goldene Spange noch kaufen sollen, Jeanne! Aber das machen wir, wenn wir dem Apotheker die Theorbe bringen, die er zusätzlich bestellt hat. Welch ein Segen ist dieser großzügige Pillendreher!«
Der Instrumentenbauer Endres Fry war mit dem Ausgang der Verkaufsverhandlungen in Montpellier höchst zufrieden. Im Haus des reichen Apothekers war ein Edelmann zu Gast gewesen, den die erlesene Qualität von Endres’ Handwerkskunst und das Spiel seiner Tochter derart begeistert hatten, dass dieser eine siebenchörige Diskantlaute und eine Theorbe in Auftrag gegeben hatte. Nach schwerer, entbehrungsreicher Zeit schien die Zukunft endlich wieder voller Hoffnung.
Doch die Freude der beiden zerbrach wie die dünne Wand eines Muranoglases in tausend Scherben, als sie an die Weggabelung bei Saint-Guilhem-le-Désert kamen und ihnen Brandgeruch entgegenwehte. Von hier war es nur noch eine kurze Wegstrecke bis zu den Häusern ihrer kleinen hugenottischen Siedlung am Rande der Montagne de la Séranne. Angstvoll sah Jeanne ihren Vater an, der die Stirn runzelte und seinen Schritt beschleunigte. Je näher sie ihrem Heim kamen, desto stechender wurde der Gestank von verbranntem Holz und etwas anderem, Süßlichem, das Jeanne nicht einordnen konnte. Ihr Vater stieß einen gellenden Schrei aus und begann zu rennen. Jeannes Herz setzte einen Schlag aus, und sie fühlte eine nie gekannte, unbeschreibliche Furcht in sich aufsteigen, während sie ihrem Vater folgte, bis ihre Lungen zu bersten drohten.
Und schließlich standen sie am Weg, der in ihren bescheidenen Weiler führte. Welch ein Grauen! Das erste Haus brannte lichterloh, davor lagen die Bewohner: grässlich verstümmelte Leiber, nackt und jeder Würde beraubt. Jeanne schrie und presste sich die Hand vor den Mund, denn der Gestank von Kot und Blut war unerträglich. Selbst den Hund der Familie hatten die Schlächter gemordet, eine Lanze steckte noch in seinem struppigen Körper.
»Christine!«, brüllte ihr Vater wie von Sinnen, warf den Sack auf die Erde und stürzte ans Ende der Häuserreihe, wo sich ihr kleines Gut befand. Jeanne lief hinterher, und ihr Verstand weigerte sich zu begreifen, was sie im Vorbeirennen sah: das Neugeborene ihrer Freundin lag zerteilt neben seiner geschändeten Mutter, das ausgerissene Kinderärmchen neben der mütterlichen Hand, die es noch im Tode greifen wollte. Eine unschuldige Kinderseele konnte weder hugenottisch noch papistisch denken. Welche Bestien waren hier am Werk gewesen? Alles hatten sie verwüstet, als verbreiteten selbst die Tiere den falschen Glauben. Der Eselin des Korbmachers hatten sie den Bauch aufgeschlitzt und das Gedärm herausgezogen, den Korbmacher selbst auf seine Frau gebunden und beide mit einem Spieß durchbohrt.
Endlich gelangten sie zu den Pinien, welche die Grenze ihres Landes markierten, und fanden am stärksten Ast den Knecht erhängt. Ihr Vater rannte auf ihr Haus zu, dessen steinerne Mauern von Ruß geschwärzt waren. Der Dachstuhl war eingestürzt, die Plünderer hatten alles Brauchbare herausgeschleppt, dabei Fenster und Türen zerschlagen und die Stallungen in Brand gesetzt. Die Feuersbrunst musste bis vor kurzem gewütet haben, denn noch rauchte und schwelte es überall. Auch hier hatten die Mörder kein Leben verschont. Die Magd hatten sie geschändet, genau wie die Milchmarie, deren Brüste sich unwirklich weiß von ihrem blutverschmierten Rock abhoben.
»Mutter, o Mutter ...«, flüsterte Jeanne wie ein Gebet und wollte ihrem Vater in die Trümmer ihres Hauses folgen, doch der stieß sie zurück.
»Bleib!«, rief er und verschwand hustend im Rauch.
Weinend stand Jeanne vor den Trümmern ihres glücklichen Lebens und wagte nicht, sich weiter umzusehen. Schließlich kam ihr Vater zurück, das Gesicht versteinert, Kleidung und Haut rußverschmiert. Wie einen kostbaren Edelstein trug er mit beiden Händen einen Haufen Asche vor sich her.
»Gib mir ein Stück Tuch«, sagte er mit heiserer Stimme.
Jeanne hielt ihm ein Taschentuch hin, in welches er die Asche mit zärtlicher Geste gleiten ließ.
»Verwahre sie gut.«
Langsam begriff sie, was er ihr eben in die Hände gegeben hatte, und schluchzte, bis sie keine Tränen mehr hatte, ihr Magen schmerzte und die Augen brannten.
»Gehen wir.« Ohne sich noch einmal umzusehen, ging Endres Fry den steinigen Pfad hinauf zur Straße, sammelte seine Habseligkeiten auf und schlug denselben Weg ein, den sie gekommen waren.
Als sie die Weggabelung hinter sich gelassen hatten, war es bereits dunkel. Er hielt an und drückte seine verzweifelte Tochter lange stumm an sich. Sein Körper wurde von Weinkrämpfen geschüttelt, aber er sagte nichts. Kein Wort des Hasses auf die Mörder kam über seine Lippen.
Sie gingen zurück nach Montpellier und fanden einige Zeit Aufnahme bei dem begüterten Apotheker. Aus edlen Hölzern fertigte Endres ein Kästchen für die Asche seiner Frau. Jeanne spielte stundenlang melancholische Weisen auf ihrer Laute, einem zierlichen Instrument, das auch ihre Mutter beherrscht hatte. Der Tod von Christine Fry, geborener Bergier, hatte alles verändert und die Heiterkeit aus dem Leben derer verbannt, die sie liebten, und wann immer Menschen ihre Religion mit flammender Rede verteidigten, wandte Endres sich ab.
Eines Morgens trat er zu seiner Tochter, die mit ihrer Laute unter einer Pinie saß. »Wir gehen nach Sachsen, Jeanne. Dort lebt mein Ziehvater.«
Teil 1: Helwigsdorff in SachsenIanuarius 1569
Kapitel 1
Langsam holperte der Wagen über den gefrorenen Schlamm. Die erhitzten Körper der Ochsen dampften in der eisigen Januarluft, und aus den Nüstern der bulligen Tiere stieg warmer Atem, der sich sogleich in Eiskristalle verwandelte. Geführt wurde der Karren von einem finster dreinblickenden Mann, der sich ständig den Rotz mit seinem dreckigen Ärmel von Mund und Nase wischte. Auf den groben Händen hatten Kälte und harte Arbeit ihre Spuren hinterlassen. Mit einer kurzen Rute schlug er auf die Ochsen ein, denen der unebene Weg große Mühe bereitete. Die tiefen Spurrinnen hatten sich in scharfkantig gefrorene Hindernisse verwandelt, auf denen die Hufe der Zugtiere kaum Halt fanden.
Auf der anderen Seite des Karrens ging schweigend Endres Fry. Sein sehniger Körper wurde von einem dicken Wollumhang und einer Pelzkappe vor der Kälte geschützt. Nervös nestelte er an seinem Gürtel und warf Jeanne, die regungslos auf dem Wagen hockte, besorgte Blicke zu.
»Dort vorn, Herr.« Der Karrenführer zeigte auf eine Ansammlung niedriger Häuser, die sich entlang des Flusses unter Fichten und den nackten Zweigen einiger Laubbäume zu verstecken schienen.
Plötzlich kam Bewegung in Jeanne, deren ebenmäßiges Gesicht skeptisch aus einer samtverbrämten Kapuze hervorlugte. Mit den Armen hielt sie einen unförmigen Sack auf ihrem Schoß umschlungen. Obwohl ihre Lippen blau von der Kälte waren, konnte niemandem verborgen bleiben, dass sie eine Schönheit war. Große, dunkle Augen schätzten unter fein geschwungenen Brauen die armseligen Behausungen ab. »Das kann nicht sein. Jedes Dorf in Frankreich sieht herrschaftlicher aus als diese Hundehütten!«
»Jeanne!« Scharf mahnte sie ihr Vater.
Das Mädchen senkte den Blick und strich liebevoll über den Sack, dessen langes Ende mit einer Kordel verschlossen war, wobei ihre Lippen verdächtig zitterten.
»Jeanne«, sagte Endres nun sanfter, und der bittende Ton ließ das Mädchen den Kopf wenden. »Es ist nicht für immer, und wir müssen dankbar sein, wenn sie uns überhaupt aufnehmen. Wir haben alles verloren. Ohne meine Werkzeuge und ohne das Holz kann ich keine Instrumente bauen und kein Geld verdienen. Und ohne Geld kann ich ...«
»Kein Holz kaufen«, beendete Jeanne den Satz und brachte ein schwaches Lächeln zustande. »Ich weiß, Vater. Es tut mir leid. Ich will mir Mühe geben, aber ... Ich meine, sieh es dir an!«
Endres seufzte tief. Helwigsdorff an der Freiberger Mulde, so nannte sich das schmale Gewässer unter der Eisdecke, war ein einfaches Waldhufendorf im Kurfürstentum Sachsen. Für jemanden, der im warmen Süden Frankreichs aufgewachsen war, mussten der trübe Winterhimmel und die Braun- und Grautöne, in die Boden, Wiesen und Häuser getaucht waren, trostlos erscheinen.
Der Karrenführer spuckte aus. »Hundehütten! Das trifft es irgendwie. Geht mich ja nichts an, aber warum seid Ihr nicht in Frankreich geblieben? Holz gibt es da doch auch. Ihr seid geflohen, weil Ihr Hugenotten seid!«
Endres runzelte die Stirn. »Halt den Mund und bring uns zum Haus des alten Froehner.« Seit Großhartmannsdorf mussten sie die Gegenwart dieses ungehobelten Friedger Pindus ertragen, dessen einzige Sorge der nächste Schluck Selbstgebrannter war. Im Grunde war es ein Wunder, dass er sie ohne Zwischenfälle die schwierige Wegstrecke hergebracht hatte.
Und doch hatte der einfache Karrenführer recht mit seiner Vermutung. Sie waren Hugenotten, und die politische Lage in Frankreich war brisant. Es herrschte Krieg, Bruderkrieg. In Endres’ Augen die furchtbarste Form von Krieg, wenn ehemalige Freunde, Familien, Menschen einer Nation gespalten wurden durch den Glauben. Niemand konnte sich sicher fühlen, weil unter dem Deckmantel des Glaubenskampfes Bespitzelung, Neid und Verrat die finstersten Abgründe der menschlichen Seele zutage brachten. Ausgerechnet jetzt wurde Frankreich von Karl IX., einem jungen, schwachen Herrscher, und dessen Mutter, der Italienerin Katharina de Medici, regiert. Die Königinmutterbetrieb eine intrigante, machiavellistische Politik, doch die religiöse Spaltung des Landes konnte sie nicht aufhalten. Sie stand zwischen zwei mächtigen Interessengruppen, den katholischen Guisen und den protestantischen Bourbonen. Die von Katharina propagierte relative religiöse Toleranz war 1562 im Edikt von Saint-Germain-en-Laye sanktioniert worden, doch das Massaker von Vassy hatte die Konflikte erneut und mit weit größerer Schärfe als zuvor ausbrechen lassen.
So griffen Katholiken in Troyes, Meaux oder Sens protestantische Gläubige auf dem Weg zu ihren Gottesdiensten an, obwohl offiziell festgelegt worden war, dass protestantische Versammlungen in jeder Landvogtei abgehalten werden durften. Willkürlich wurden Häuser von wohlhabenden Hugenotten geplündert, so dass viele Familien ins lutherische Straßburg flohen. Erschwerend kam hinzu, dass die Hugenotten in zwei Lager gespalten waren: Die Konservativen wollten die strengen Glaubensgrundsätze, die in Genf propagiert wurden, durchsetzen, während die Liberalen darin eine Gefahr für die gesamte Sache sahen.
Endres konnte nur den Kopf schütteln über so fanatische Glaubensbrüder wie die anciens von Troyes, welche auf der Ausgabe einer méreau an fromme Gläubige bestanden. Gläubige, die nicht im Besitz dieser Münze waren, wurden vom Abendmahl ausgeschlossen.
Vor diesem Hintergrund hatte Endres mit seiner Tochter die beschwerliche Reise nach Sachsen unternommen. Im protestantischen Sachsen herrschte Kurfürst August, der dem für seine Toleranz in Konfessionsfragen bekannten Kaiser Maximilian II. nahestand und sich um den Religionsfrieden von Augsburg verdient gemacht hatte. Hier hofften sie auf eine friedliche Zeit.
Friedger schnäuzte auf den Weg, indem er sich ein Nasenloch zuhielt. »Ha! Jetzt weiß ich es! Ihr seid der Ziehsohn des alten Froehner!« Triumphierend knallte er die Rute gegen das Joch der Ochsen.
Endres und Jeanne schwiegen, was den neugierigen Karrenführer nicht störte. »Abgehauen seid Ihr damals. Die Leute haben noch lange darüber gerätselt, was vorgefallen ist zwischen Ulmann und Euch. Einige behaupten ja, Ihr hättet das Land verlassen müssen, weil ...«
»Es reicht! Spar dir deine Lügengeschichten fürs Wirtshaus«, fuhr Endres ihn an.
Doch Friedger Pindus focht das nicht an. »Dann seid Ihr in der Fremde ein reicher Hugenotte geworden, so ist es doch? Das erhöht natürlich die Fahrtkosten.« Er rülpste laut und grinste.
Angewidert schloss Jeanne die Augen und drückte ihre Laute, die sie zum Schutz gegen Kälte und Nässe in Tücher geschlagen hatte, an sich. Von einem Zufluchtsort und einem Neuanfang hatte ihr Vater gesprochen, doch die Ahnung wuchs, dass man sie kaum herzlich willkommen heißen würde. Mit der Zunge fuhr sie sich über die aufgesprungenen Lippen und wischte sich eine Träne von der Wange. Die Haut spannte unter der Kälte, und nicht nur die Angst vor dem Ungewissen ließ sie zittern.
»Jeanne, gleich sind wir da.« Ihr Vater drückte sanft ihren Arm. »Thomas ist ein guter Mann, glaub mir. Er war immer gerecht und wird uns helfen.«
Sie räusperte sich und blinzelte in den kalten Wind, der vom Fluss heraufwehte.
»Habe ich doch recht, dass Ihr den alten Cistermacher kennt«, meinte Friedger und schlug erneut die geschundenen Ochsen. Man hatte den Tieren Ringe durch die Nasen gezogen und daran Seile geknüpft, an denen er gelegentlich riss, obwohl die Tiere keine Anstalten machten auszubrechen. Es schien ihm Freude zu bereiten, die Tiere zu quälen.
Im schwächer werdenden Licht des sich neigenden Tages wirkten die Häuser noch düsterer. Irgendwo bellte ein Hund, ein Kind weinte. Der eisige Wind drang selbst durch die vielen Schichten dichter Wolle und hielt die Menschen in ihren Häusern, deren Fensterläden meist zugeklappt waren. Aus einer niedrigen Kate traten zwei Männer auf die Straße. Der eine hinkte und stützte sich schwer auf einen Gehstock. Der andere, jüngere wandte sich noch einmal um und zog aus einer ledernen Umhängetasche ein kleines Bündel Kräuter und gab es der in der Tür wartenden Frau.
»Fahrende Händler zu dieser Jahreszeit?«, fragte Endres.
»Ph!« Friedger spuckte aus. »Der Alte heißt sich Wundarzt, ist aber nichts weiter als ein Quacksalber. Der andere ist mein Sohn. Der Taugenichts sollte arbeiten, um Geld nach Haus zu bringen, meint aber, er wäre zu was Großem auserkoren. Gelumpe!« Das letzte Wort rief Pindus so laut, dass die beiden Männer es hörten und sich umdrehten.
Jeanne sah, wie der Wundarzt die Hand auf den Arm des Jüngeren legte, der seinem Vater einen Blick zuwarf, in dem Wut, Verachtung und Scham lagen. Als er das Kinn hob, fiel sein Blick auf Jeanne, und ihre Augen trafen sich. Er hatte ein offenes Gesicht mit klaren Zügen. Verwirrt senkte Jeanne die Lider und spürte den Blick des Unbekannten noch in ihrem Rücken, als sie schon längst vorübergefahren waren und einen Platz mit einer riesigen Eiche erreicht hatten. Der knorrige alte Baum behauptete sich stolz vor dem Haus des ältesten Mitglieds der Familie Froehner, die auch im nahen Randeck Werkstätten betrieb.
»So, da wären wir!« Pindus hievte das wenige Gepäck, das aus zwei Ledersäcken bestand, vom Karren.
»Zwanzig Jahre«, murmelte Endres und betrachtete die rissigen Hauswände und das eingedrückte Dach, welches notdürftig mit Stroh geflickt war. Direkt an das einstöckige Wohnhaus grenzte der Stall, aus dem lautes Quieken und Schnattern ertönte.
»Die haben wenigstens noch ein Schwein und Federvieh. Ich weiß nicht, wie ich meine Brut durchkriegen soll. Verfressene Bande, liegen faul rum, während ich zusehen muss, wie ich die Mäuler stopfe«, beschwerte sich Friedger und warf den zweiten Sack auf die Erde, wo er scheppernd zu liegen kam.
»Pass doch auf, Mann!«, fauchte Jeanne und kletterte vom Karren herunter. Ihr Deutsch war fehlerfrei, doch von einem französischen Akzent gefärbt.
Endres holte einige Münzen aus einem kleinen Geldsack und ließ sie in die ausgestreckte Hand des Karrenführers fallen. »Zwanzig Groschen, wie vereinbart.«
»Vierzig, oder ich erzähl’ überall herum, dass Ihr Hugenotten auf der Flucht seid.« Verschlagen hielt er die Hand ausgestreckt.
»Tu, was du nicht lassen kannst. Wir sind keine Katholiken, und wir sind hier nicht in Frankreich«, sagte Endres ruhig und griff nach Jeannes zitternder Hand.
Doch so leicht gab sich Friedger nicht geschlagen. »Nein, in Frankreich sind wir nicht, aber Ihr verkennt die Lage, werter Herr. Der Kurfürst ist kein Mann, der Andersgläubige toleriert, und jeder, der nicht dem Luthertum angehört, ist ein Ketzer!«
»Ach, übertreib doch nicht, Mann! Wir gehören doch quasi zur selben Konfession, sind wir doch auch Reformierte«, erwiderte Endres ungeduldig.
Friedger warf ihm einen verschlagenen Blick zu. »Ihr könnt das natürlich nicht wissen, wart Ihr doch lange fort aus der Heimat. Der gute Kurfürst ist ein sehr gläubiger Mann. In Sachsen gilt ausschließlich das Luthertum, und jeder, der das nicht beherzigt, muss die Folgen spüren.« Der Karrenführer genoss die erschreckten Mienen seiner Zuhörer sichtlich. »Ja, wer sich öffentlich zu den Philippisten oder den Calvinisten bekennt, landet im Gefängnis oder auf der Folterbank.« Friedger legte den Kopf schief und streckte erneut die Hand aus. »Aber was rede und rede ich. Vierzig Groschen sind gewiss nicht zu viel.«
Kommentarlos gab Endres dem Erpresser das Geld. Der grinste zufrieden. »Danke, mein Herr. Ich weiß Eure Großzügigkeit zu schätzen.«
»Hoffentlich«, murmelte Endres, und zu seiner Tochter sagte er: »Na komm, mignonne, es wird schon werden.«
Zweifelnd betrachtete Jeanne die ausgetretenen Stufen, die zu einer roh gezimmerten Holztür hinaufführten. Schaufel, Besen und eine Art Rechen lehnten an der Wand neben einem verwitterten Holzschild, auf dem noch die Umrisse einer Laute zu erkennen waren. Friedger trieb die Ochsen an, und der Wagen rollte bereits davon, als die Tür aufgestoßen wurde und eine alte Frau herausschaute. Ihr Gesicht war von feinen Linien durchzogen, die Augen blickten wach und argwöhnisch.
»Ja, was ist denn nur ...?« Das Kleid der Alten war nicht aus feinstem Stoff, aber sauber und ohne Löcher. Um ihre Schultern lag ein warmes Wolltuch. Aus dem Hausinneren drang der Geruch von Kohl.
Vater und Tochter gingen die Stufen hinauf. Oben nahm Endres seine Mütze ab und neigte den Kopf. »Mutter Agathe, ich bin es, der Endres, und das ist meine Tochter Jeanne.«
Jeanne machte einen höflichen Knicks, wobei sie ihre Laute weiter mit einer Hand festhielt.
Die Alte riss die Augen auf, hielt sich die Hand vor den Mund und drehte sich auf dem Absatz um. »Thomas! Komm her! Komm auf der Stelle her!«, rief die Alte, bevor sie zurückkehrte, die Tür ganz öffnete und die Besucher hereinbat.
Überrascht bemerkte Jeanne, dass der Flur geräumig und mit Schiefer gefliest war. An den Wänden hingen verschiedenste Zupf- und Blasinstrumente, auf einer Truhe stand eine Öllampe, und in einer Ecke war ein großes Fass, das mit Brettern und einem Stein verschlossen war. Dahinter führte eine schmale Treppe in den ersten Stock des Hauses Froehner.
Die Alte nahm Endres’ Hände und zog ihn in eine kleine Wohnstube, die von einem Ofen angenehm warm gehalten wurde. »Dass wir dich noch einmal wiedersehen! Wer hätte das für möglich gehalten!«
Endres ließ sich begutachten, während Jeanne ihren Umhang öffnete und den Lautensack vorsichtig auf den Boden stellte.
»Endres!«, ertönte eine tiefe Bassstimme, und ein hochgewachsener Mann mit schlohweißem Haar trat herein und schloss Endres Fry in seine Arme. »Mein Junge.«
Beide Männer drückten eine Träne fort, räusperten sich, und schließlich klopfte Thomas Froehner seinem Ziehsohn auf die Schultern. »Was bringt dich her? Und wer ist dieses hübsche Kind? Setzt euch und erzählt! Agathe, lass Speis und Trank bringen, wir haben etwas zu feiern!«
Seine Frau verzog keine Miene und verließ den Raum. Jeanne hatte wohl bemerkt, dass die Alte ihren Vater nicht umarmt hatte und sich über das Wiedersehen weit weniger zu freuen schien als der alte Thomas. Jener schob ihnen Lehnstühle hin, nahm Jeanne den Umhang ab und legte ihre Laute wie selbstverständlich auf eine Truhe. Thomas Froehner hatte gütige helle Augen und einen Mund, der stets zu einem Lächeln bereit war. Sie mochte den Alten auf den ersten Blick, und ihre Ängste und Befürchtungen, die sie mit der Ankunft in Sachsen verbunden hatte, wurden etwas gemindert.
»Zwanzig Jahre, Endres. Du bist rumgekommen, hast viel erlebt. Hoffentlich bleibt uns genug Zeit, dass du mir alles erzählen kannst.« Thomas verschränkte die Hände vor seinem Bauch, der sich unter der ledernen Arbeitsschürze abzeichnete. Seine Hände waren feingliedrig und hätten die eines Musikers sein können. Endres hatte seiner Tochter erzählt, dass Thomas in der Tat ein ausgezeichneter Spieler der Laute und auch der Theorbe, einer Basslaute mit verlängertem Hals und nicht abgeknicktem Wirbelkasten, war.
»Meine Tochter Jeanne«, begann Endres.
Jeanne erwiderte Thomas’ Lächeln.
»Sie kommt ganz nach ihrer Mutter«, fügte Endres hinzu.
»Die Schönheit hat sie gewiss nicht von dir«, neckte Thomas. »Dann hast du in Frankreich geheiratet?«
»Christine de Bergier, eine Hugenottin aus dem Languedoc. Ihre Familie ist ...«
Weiter kam Endres nicht, denn die Haustür war lautstark aufgestoßen worden, und jemand brüllte: »Wo ist der Hundsfott?«
»Ulmann, so beruhige dich doch.« Agathe Froehner stellte sich in den Türrahmen, wurde jedoch von einem Mann zur Seite gedrängt, dessen Ähnlichkeit mit Thomas unverkennbar war.
Bevor Ulmann sich auf ihn stürzen konnte, war Endres aufgesprungen und legte eine Hand an den Dolch in seinem Gürtel. »Wage es nicht, Ulmann. Nicht im Haus unseres Vaters!«
Jeanne umklammerte die Stuhllehne. Der Neuankömmling hatte ein zornrotes Gesicht mit tiefen Furchen über der Nasenwurzel, die auf ein jähzorniges Temperament deuteten. Ihr Vater hatte ihr kaum etwas über seine Vergangenheit erzählt, und so wusste sie nichts über den Zwist, den die Jahre offenkundig nicht hatten glätten können.
»Unseres Vaters? Er ist mein Vater! Du bist nur ein Ziehsohn, ein Waise, eine kleine Ratte, die er aus Mitleid durchgefüttert hat und die es ihm mit einem Biss in die Hand vergolten hat!« Ulmann Froehner stierte Endres an und ballte die Fäuste.
»Schämen solltest du dich, Ulmann. Wir haben Gäste, und du benimmst dich wie ein wild gewordener Eber. Unter meinem Dach sind Endres und seine Tochter willkommen«, donnerte Thomas.
Ulmann biss sich auf die Lippen und presste schließlich zwischen ihnen hervor: »Was will er hier?«
Jeanne dämmerte, dass ihre Not größer war, als ihr Vater bisher zugegeben hatte. Sonst hätte er niemals den langen Weg nach Sachsen auf sich genommen, wo ihm solch ein Hass entgegenschlug.
»Ich ...« Endres zögerte. »Für heute Nacht bitten wir um ein Dach über dem Kopf.«
»Darüber müssen wir kein Wort verlieren. Agathe, wo bleibt das Essen?« Thomas schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Jeanne, gib uns das Tablett, das hinter dir auf der Truhe steht.«
Jeanne drehte sich um und hob ein Holzbrett auf den Tisch, auf dem eine verkorkte Tonflasche und sechs winzige Becherlein standen.
»Und warum das ganze Gepäck draußen vor dem Haus?«, hakte Ulmann nach.
»Bring es herein, wenn du es schon bemerkt hast. Oder frag einen deiner trefflichen Söhne. Dabei können sie wenigstens nichts falsch machen.« Der Sarkasmus verfehlte seine Wirkung nicht. Kurz darauf schlug die Haustür zu – und Ulmann war verschwunden.
»Warum kann er dich nicht leiden, Vater?«, fragte Jeanne und umfasste den kleinen Becher, den Thomas ihr zuschob.
»Alte Geschichten. Dein Feuerwasser, Vater?«
Der alte Lautenbauer grinste. »Du sagst es. Das wird euch wärmen. Auf die Heimkehrer!«
Sie leerten die Becher in einem Zug, und die Männer lachten, als Jeanne nach Luft rang. »Was ist das?«
»Äpfel, Trauben, dies und das. Wirst dich dran gewöhnen, Mädel. Ihr bleibt doch länger, nehme ich an?« Und während Thomas das sagte, goss er die Becher erneut voll und lächelte ihnen aufmunternd zu.
Jeanne richtete sich auf, um den schmerzenden Rücken zu strecken. Den ganzen Vormittag hatte sie draußen in der Kälte nach Reisig und Fichtenzapfen gesucht. Zumindest schneite es nicht mehr. Sie hasste die Kälte, die trüben Farben der Hügel, die in der Ferne zum Gebirge aufstiegen, den ewig grauen Himmel und die verstockten Menschen, die ein kaum verständliches Kauderwelsch redeten. Ihrem Vater zuliebe gab sie sich Mühe, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, doch je länger sie in diesem unerfreulichen Landstrich inmitten der Einöde lebte, desto mehr hasste sie alles hier.
»Crétins!«, murmelte sie und zog an den halben Wollhandschuhen, die ihre zarten Hände kaum vor der Kälte schützten. Traurig betrachtete sie die Fingerkuppen, die rot und aufgesprungen waren und ihr das Lautespielen fast unmöglich machten.
Seit zwei Wochen lebten sie nun im Haus von Thomas Froehner, der sie ohne viele Worte für unbestimmte Zeit bei sich aufgenommen hatte. Der alte Froehner war der Einzige, der sie nicht mit Verachtung behandelte, sondern ihren Vater respektierte und schätzte. Und er besaß unendlich viel mehr Verstand und Gespür für den richtigen Klang eines Holzes als seine furchtbaren Söhne, allen voran Ulmann.
Sie warf einen letzten Zapfen in den Korb, hob ihn auf und machte sich auf den Rückweg. Ulmann war ein jähzorniger und kleingeistiger Mensch. Und sein Sohn war kein Deut besser und dazu noch mit der Dummheit und Arroganz seiner Mutter geschlagen. Jeanne schüttelte sich bei dem Gedanken an Franz, der knapp zwei Jahre älter war als sie und ihr dauernd nachstellte.
Unter ihren Tritten knackten die Zweige auf dem gefrorenen Waldboden. Hinter der nächsten Biegung lag das Haus des Dorfbaders, ein wundersamer kleiner Kauz. Meist sah sie ihn in Begleitung seines Gehilfen. Der attraktive junge Mann mit den melancholischen dunklen Augen hatte schon bei ihrer ersten Begegnung ihre Aufmerksamkeit erregt, aber seine Kleidung verriet seine niedrige Herkunft, und er war Friedger Pindus’ Sohn. Sie verdrängte das Bild des Arztgehilfen aus ihren Gedanken.
Wie sehr sie Montpellier und das bunte Treiben in den engen Gassen vermisste! Das Meer war dort spürbar nahe, die Sonne wärmte den fruchtbaren Boden und ließ Weinstöcke und Obstbäume gedeihen, dass es eine Wonne war. Jeannes Lippen wurden schmal. Die Erinnerung verklärte die Bilder, denn ganz so idyllisch war es auch im Süden Frankreichs nicht. Hugenotten und Katholiken lieferten sich seit Jahren blutige Kämpfe, und eine Seite stand der anderen in der Ausübung von Gräueltaten und Abscheulichkeiten nicht nach.
Überall im Land sammelten sich Anhänger der erzkonservativen katholischen Guisen und suchten das Erstarken der Hugenotten zu verhindern. Das Attentat auf François de Guise vor sechs Jahren bei Orleans hatte den Religionskrieg auflodern lassen. Und König Philipp II. von Spanien hetzte mit allen Mitteln gegen die Reformierten, wobei es ihm weniger um den Erhalt des katholischen Glaubens ging. Den Hugenotten war bewusst, dass dies nur ein Vorwand Spaniens war, sich Frankreich einzuverleiben. Doch es blieb eine traurige und unumstößliche Tatsache, dass der Herzog de Guise von Hugenotten hinterrücks ermordet worden war und der Bruder ihrer seligen Mutter daran beteiligt gewesen war. Als die Guisarden herausgefunden hatten, dass einer der Bergiers an der Ermordung ihres Anführers eine Mitschuld trug, war ihr Schicksal besiegelt gewesen, auch wenn ihnen das erst nach jenem schrecklichen Überfall auf ihr Heim bewusst geworden war.
Eine Krähe schrie und flatterte davon. Jeanne zuckte zusammen, stolperte und stürzte zu Boden. Wegen des Korbs konnte sie den Sturz nicht auffangen, und ein scharfer Schmerz durchfuhr ihr rechtes Knie.
»Oh, zum Teufel mit diesem Land!«, fluchte sie und raffte ihre Röcke und den Umhang, um wieder auf die Beine zu kommen. Der Korb lag umgekippt ein Stück entfernt. Sicher schimpften Afra, Ulmanns Frau, und Agathe schon über ihr langes Fortbleiben. Heute war Waschtag, und die Kessel mussten befeuert werden, wozu man nicht das gute Holz nahm, sondern Reisig und Fichtenzapfen. Sie rannte den Waldweg entlang bis zur Straße, auf der Friedger Pindus seinen Ochsenkarren vorantrieb. Zu ab lern Überfluss trat sie in einen dampfenden Fladen, während der Ochse sich sein Hinterteil noch mit dem Schwanz sauber wedelte.
Ihr Umhang war kotverschmutzt, doch daran ließ sich nichts ändern. Sie konnte das Haus der Froehners bereits sehen, vor dem Afra mit in die Hüften gestemmten Händen nach ihr Ausschau hielt. »Wo bleibst du denn nur?« Ulmanns Frau war hager, trug stets eine weiße Haube auf dem streng geknoteten Haar und wachte mit Argusaugen über ihren eigenen Haushalt und den ihrer Schwiegereltern. An ihrem Gürtel hing ein großes Schlüsselbund, das sie als Herrin über die Vorratskammern auszeichnete.
Das Haus von Thomas Froehner war von einem niedrigen Zaun umgeben, der den Garten von der Durchgangsstraße abtrennte. Haus und Umgebung wirkten lieblos und ungepflegt, was an Ulmann und dessen faulen Söhnen lag, die nur das Nötigste taten und sich ansonsten ins Wirtshaus des Nachbardorfes begaben, um den Dirnen nachzustellen.
Keuchend kam sie die Stufen herauf und hielt sich am Pfosten des Überdachs fest. Afras kalte grüne Augen musterten sie, während sie die Nase rümpfte. »Du stinkst! So kannst du nicht ins Waschhaus, die Wäsche ist bereits einmal gesäubert. Du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen.« Mit spitzem Finger zeigte sie auf den Korb. »Das ist alles? Dafür hast du zwei Stunden gebraucht? Bring es nach hinten, dann zieh dich um und komm uns helfen.«
Jeanne machte einen Schritt zur Tür, wurde jedoch von Afra an der Schulter gepackt und zur Seite gestoßen. »Doch nicht durchs Haus. Geh hintenherum, und wenn du durch den Hintereingang trittst, zieh vorher die Schuhe aus. Wo hast du dich rumgetrieben? Bei den Schweinen?«
»Die Pest wünsch’ ich dir an den Hals!«, murmelte Jeanne auf Okzitanisch, der Sprache ihrer Mutter.
»Pass nur auf, mein Mädchen. Ich verstehe zwar nicht, was du sagst, aber es gibt Leute, die solcherart Sprache für Hexerei halten, und mit Hexen macht man hier kurzen Prozess ...«
Wütend brachte Jeanne das Brennmaterial zum Waschhaus, einem Anbau an der Hinterseite. Als sie die Tür öffnete, schlugen ihr nach ranziger Wäsche und Kernseife riechende Dampfschwaden entgegen. In dem kahlen Raum standen zwei hölzerne Waschwannen und ein Waschkessel, der befeuert werden musste. Diese Aufgabe hatte Franz übernommen. An einer Wanne stand Agathe und rührte mit einem Stock die eingeweichten Wäschestücke. Nach dem Weichen wurde die Wäsche in den Kessel geworfen, gekocht, mit einem Stock herausgefischt und auf einem Waschbrett mit Kernseife eingerieben. Nach dem anstrengenden Reiben auf dem Brett, welches man der Magd aufgebürdet hatte, wurde die Wäsche in den zweiten Trog geworfen und in klarem Wasser gespült. Im Sommer breitete man die Wäsche auf den Wiesen am Flussufer zum Trocknen aus. Im Winter wurden die großen Stücke auf Leinen gehängt, bis sie in der Kälte bretthart gefroren waren.
»Komm her, schütte deinen Korb neben dem Kessel aus, und dann kannst du ans Waschbrett. Zilla hat schon den ganzen Vormittag dort geackert«, befahl Agathe.
Doch als Jeanne sich näherte, schrie die alte Froehnerin auf: »Du stinkst wie ein Haufen Kuhdung! Was kommst du so dreckig hier herein, du dummes Ding! Das bringt Unglück, und die Wäsche ruinierst du uns auch. Raus, zieh dich um!«
Wortlos ließ Jeanne den Korb auf den Boden fallen, drehte sich um und warf die Tür lautstark hinter sich zu. Auf dem kleinen Gut ihrer Eltern im Languedoc hätte niemand gewagt, sie derart zu behandeln. Die Bergiers waren nicht reich gewesen, hatten aber nie Not leiden müssen, und niedere Arbeiten waren von Dienern, Mägden und Knechten ausgeführt worden. Ihr Vater hatte die Tochter eines hugenottischen Landadligen geheiratet und war von den Bergiers aufgrund seines hervorragenden Rufes als Lautenbauer respektiert worden.
Jeanne schnürte den Umhang auf und legte ihn über einen Stapel Holz unter dem Überstand am Haus. Sie würde ihn später reinigen. Das einstmals edle Gewebe war durch die Reise stark in Mitleidenschaft gezogen worden, wie auch ihre Kleider, die dringend ausgebessert werden müssten, doch dazu fehlten ihr Zeit, das nötige Geschick und das Material. Seufzend streifte Jeanne ihre Schuhe ab und wollte die Hintertür aufstoßen, als sie jemand packte und gegen die Wand drückte.
Eine Männerhand presste sich ihr auf den Mund, heißer Atem drang an ihren Hals. »Du aufsässige Ziege. Dir werde ich schon noch Manieren beibringen.« Franz’ fauliger Geruch ließ sie würgen, doch er nahm die Hand nicht von ihrem Mund, griff ihr mit der anderen ans Mieder und drängte seinen Körper zwischen ihre Beine.
Mit aller Kraft entwand sie sich seinem Griff und schrie auf Französisch: »Vater! Vater!«
Schnell trat Franz einen Schritt zurück und fuhr sich durch die schmierigen langen Haare. »Irgendwann erwisch’ ich dich, wenn niemand da ist, um dir zu helfen. Merk dir das, Dirne!« Er spuckte aus und ging davon.
Im nächsten Moment kam ihr Vater aus der Werkstatt gestürzt, die in den hinteren Räumen neben der Küche untergebracht war. »Jeanne! Mignonne, was ist passiert?«
Sie warf sich ihrem Vater in die Arme und schluchzte.
»Na, komm herein. Hier draußen ist es viel zu kalt. Da holst du dir noch die Schwindsucht.« Liebevoll legte er den Arm um sie und führte sie in den warmen Korridor.
Jeanne schniefte. »Dieser Franz, oh ... ein fürchterlicher Kerl ...«
Endres Fry nickte und rieb sich den Bart. »Verstehe. Ich werde mit Ulmann sprechen. So kann das nicht weitergehen.«
Jeanne drückte sich an die Brust ihres Vaters, spürte das raue Wams unter ihrer Haut und den vertrauten Duft von Leder, Leim und Harz, der an seiner Kleidung und seiner Schürze haftete. »Ich möchte fort von hier. Bitte, Vater ...«, flüsterte sie leise.
Beruhigend strich er ihr über das Haar. »Ich wäre auch lieber anderswo, aber wir müssen dankbar sein, Jeanne. Gerade heute habe ich mit Thomas gesprochen. Er will mir seine Werkzeuge und ein Klafter besten Holzes überlassen. Damit kann ich gute Instrumente bauen, die uns Geld einbringen.«
Die Tür der Werkstatt schwang auf, und Ulmann trat in den Gang. Die Zornesfurche über seiner Nase war tief, und seine Stimmung schien so düster wie die Farbe seiner Kleidung. Das Kinn ruhte auf einem steifen weißen Kragen, Wams und geschlitzte Kniehosen waren aus braunschwarzem Tuch, die Knöpfe aus geschnitztem Horn. Das ergraute Haupthaar hing ihm ungepflegt bis auf den Kragen. »Dass mit dir nur Schlechtes ins Haus kommt, war mir klar, aber wie schnell du den Alten umgarnt hast, ist doch bewundernswert.«
Endres fuhr herum. »Lass deine Verleumdungen in Gegenwart meiner Tochter, Ulmann. Es macht dich nur kleiner, als du ohnehin schon bist.«
»Klein, ja? Du unverschämter Lump wagst es, mich im Hause meines Vaters zu beleidigen?« Ulmann machte einen Schritt auf Endres zu und hob die Fäuste.
»Reiß dich zusammen, Mann. Wir sind keine Buben mehr. Du hattest zwanzig Jahre Zeit, deinem Vater zu beweisen, dass du der Bessere von uns beiden bist. Anscheinend ist dir das nicht gelungen. Und weißt du, Ulmann, ich glaube, auch vierzig Jahre würden dafür nicht reichen ...« Endres lächelte schief, schob Jeanne hinter sich und machte eine seitliche Drehung, als Ulmann brüllend auf ihn losstürzte.
Wie ein rasender Stier krachte der große Mann gegen den Tisch an der gegenüberliegenden Wand. Bevor die Situation eskalieren konnte, erschien Thomas im Korridor und schüttelte missbilligend den Kopf. »Ulmann!«, fuhr er seinen Sohn an, der immerhin fünfzig Lenze zählte, doch in diesem Augenblick war er nur der Sprössling, der vom Vater gemaßregelt wurde.
Ulmann atmete zweimal tief durch, warf Endres einen hasserfüllten Blick zu und verschwand wieder in der Werkstatt.
Jeanne hatte sich am Wams ihres Vaters festgeklammert und ergriff nun seine Hand. »Woher rührt dieser Hass, Vater?«
Thomas kratzte sich den weißen Bart. »Hast du es ihr immer noch nicht erzählt, Endres?«
»Das ist eine Sache zwischen mir und Ulmann, die niemanden etwas angeht.«
»Nicht mehr, Endres. Sie lebt nun hier im Haus und sollte verstehen, was damals vorgefallen ist, dass zwei Männer, die Brüder sein könnten, sich derart hassen.«
»Ich hasse Ulmann nicht.«
»Nein, du bist anders.« Thomas legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Kommt in die Stube. Wo ist Agathe? Sie soll uns warmen Gewürzwein, Brot und Wurst bringen.«
Rasch bot Jeanne sich an: »Ich kann das übernehmen!« Sie befürchtete, dass Agathe sie sofort wieder ins Waschhaus beordern würde, wenn sie sie müßig in der Stube fände. Doch in der Küche stand Afra bereits an der großen Feuerstelle, über der zwei Kessel hingen. An einem langen Arbeitstisch saß ein Mädchen und hackte Zwiebeln. Die Küchenmagd mochte kaum zwölf Jahre alt sein. Ihre Haare waren zu Zöpfen geflochten, der Kittel schlotterte um ihren knochigen Leib.
»Was willst du hier? Im Waschhaus wirst du gebraucht!«, fauchte Afra und hob den Deckel von einem Holzfass. Mit einem Löffel hob sie eingelegtes Kraut heraus, dessen säuerlicher Geruch Jeanne das Gesicht verziehen ließ.
»Sei froh, dass du überhaupt was zwischen die Zähne bekommst, undankbares Geschöpf. Linser Sauerkraut ist dir nicht gut genug, na, brauchst es nicht zu essen. Wirst dich eben mit den Klößen bescheiden.«
Hungrig von den Stunden in der Kälte, sammelte sich Speichel in Jeannes Mund, und sie schluckte, bevor sie sagte: »Euer Schwiegervater schickt mich, Gewürzwein, Brot, Schmalz und von der guten Wurst in die Stube zu bringen.«
Afra murmelte etwas Unverständliches, zeigte aber auf eine dunkle Wurst, die bereits auf dem Hackbrett lag. »Nimm davon und schneid dünne Scheiben vom dunklen Brot. Den Wein macht Ute warm und bringt ihn hinüber.«
Als der würzige Duft der Wurst in Jeannes Nase stieg, merkte sie erst, wie ausgehungert sie war. Heimlich stopfte sie sich eine Scheibe in den Mund und schluckte sie nahezu unzerkaut hinunter. Die kleine Ute schüttete mit zitternden Händen Wein in einen Topf. Während sie eine Stange Zimt und eine Handvoll zerstoßener Kräuter dazuwarf, schaute sie immer wieder auf die Wurst in Jeannes Hand. Mitleidig schnitt Jeanne eine dicke Scheibe ab und schob sie der Magd zu, doch Afra schien selbst im Rücken Augen zu haben, denn der lange Löffel knallte zwischen ihnen auf den Tisch und traf dann Utes Arm.
»Untersteh dich! Wer hat dir erlaubt, so frei mit meinem Essen umzugehen?« Drei Schläge gab Afra der armen Ute auf den Arm, der sich dunkel färbte, doch die Kleine biss die Zähne zusammen, und kein Ton kam über ihre Lippen.
»Aber es ist doch nur ein Stückchen ...«, verteidigte sich Jeanne.
»Es ist nicht an dir, über meine Vorräte zu verfügen, und diese Magd bekommt Lohn und eine Mahlzeit am Tag. Das ist nach dem Gesetz. Du hast hier keine Sonderstellung, Madamchen, schreib dir das hinter die Ohren. Wenn ich dich beim Stehlen erwische, erhältst du eine Strafe wie jede Magd in meinem Haus!« Kalt musterte sie Jeanne. »Was dich und deinen Vater schützt, ist einzig die Großmut des alten Froehner. Nur ihm habt ihr zu verdanken, dass ihr hier untergekommen seid, und der liebe Herrgott allein weiß, welchen Narren er an Endres gefressen hat ...«
Jeanne verkniff sich einen Kommentar, legte Wurst, Brot und eine Schüssel mit Schmalz auf ein Tablett und verließ die Küche. In der Stube fand sie Thomas vornübergebeugt und stark hustend auf einem Stuhl, ihr Vater saß mit besorgtem Blick daneben. Nachdem Thomas den Anfall überwunden und sich den Mund mit einem Tuch abgewischt hatte, lehnte er sich zurück. »Gib mir eine Scheibe mit Schmalz und Wurst, das bringt die Lebensgeister zurück.«
Jeanne reichte ihm das Gewünschte. »Ute bringt den Wein.«
Nickend machte Thomas eine einladende Geste, doch Endres zögerte. »Dein Husten hört sich böse an, Thomas.«
»Irgendwann klopft der Schnitter bei jedem an die Tür.« Thomas Froehner grinste. »Aber ich habe nicht vor, ihm meine so bald zu öffnen. Und solange mir noch Zeit verbleibt, will ich sie nutzen. Jeanne, dein Vater ist ein begabter Instrumentenbauer. Der Beste, dem ich je begegnet bin, und ich habe viele gute Leute der Zunft kennengelernt – in Dresden, Leipzig und Böhmen.«
Endres räusperte sich, doch Thomas machte eine Handbewegung, und ihr Vater entgegnete nichts, sondern griff nach der Wurst. Jeanne tat es ihm gleich und genoss das Mahl, während sie aufmerksam lauschte, weil ihr zum ersten Mal jemand von Endres’ Zeit in Sachsen berichtete.
Auch Thomas schien es zu genießen, denn er schloss die Augen und versank in der Vergangenheit: »Ich kam von Böhmen, hatte den Wagen voll mit Hölzern, Cistern für die Bergleute und einer Theorbe, die ihresgleichen suchte. Drüben in Böhmen haben sie exzellente Handwerker, nein, Künstler! Deren Instrumente singen von ganz allein. Nun, wir wollten einen Weg hinauf ins Gebirge einschlagen, da kamen wir an einer heruntergebrannten Hütte vorüber. Es müssen arme Waldbauern gewesen sein, die von Gesindel überfallen worden waren. Nur ein Junge hatte überlebt: Endres war vom Körper seiner toten Mutter geschützt worden. Kurzum, ich nahm ihn mit nach Hause, wo er sich gut machte und mir in der Werkstatt nicht mehr von der Seite wich. Er war wie mein Schatten und so gelehrig, wie ich mir meine Söhne gewünscht hätte.« Thomas machte eine Pause, denn Ute brachte den Gewürzwein. Verschämt zog sie den Ärmel wieder herunter, der beim Abstellen des Kruges die dunkel unterlaufene Verletzung entblößte.
»Afra?«, fragte Thomas mit gerunzelter Stirn. Ute senkte den Blick und rannte hinaus.
»Nun«, fuhr er fort, »Agathe war nicht begeistert von meinem böhmischen Mitbringsel und nannte Endres nur ein weiteres Maul, das es zu stopfen gelte. Dabei haben wir nie Hunger leiden müssen. Unsere Instrumente sind weit über die Grenzen Freibergs hinaus bekannt. Hin und wieder kommt jemand aus Dresden vom Hof und bestellt eine Laute oder Theorbe, und an die Bergarbeiter haben wir schon Dutzende Cistern verkauft. Und nicht zuletzt gibt es noch die Adelsfamilien, deren Töchter gern die Laute zupfen.« Thomas nippte an seinem Becher. »Jeanne, hol deine Laute und spiel uns etwas Französisches.«
Während Jeanne ihr Instrument stimmte, fuhr Thomas fort: »Ich schäme mich fast, es zu sagen, aber ich habe deinen Vater vom ersten Tag an, den er in unserem Haus war, mehr geliebt als meine Söhne.«
»Nicht, Thomas, sag das nicht«, murmelte Endres.
»Aber wenn es doch die Wahrheit ist. Ich bin alt, und meine Tage sind gezählt. Es lastet auf meiner Seele. Und ich danke Gott, dass er dich noch einmal zu mir geführt hat. Du hast das Talent, das ich bei meinen Söhnen vergeblich suchte. Und sie haben es von Anfang an gespürt. Ulmann hat in dir sofort den Konkurrenten gesehen. Ich habe keinen vorgezogen, das weiß der Herr, aber es hat an ihnen genagt, dass du alles besser vollbracht hast.« Mit einem tiefen Seufzer schloss Thomas die Augen und lauschte den schönen Tönen, die Jeanne ihrer Laute entlockte.
Kapitel 2
Gerwin saß auf der Bank vor dem offenen Feuer und zupfte die trockenen Blätter von Zweigen. Die kleinen, wohlriechenden Blätter sammelte er in einer Schale, aus der sich Hippolyt diejenigen heraussuchte, die er für seine Tinktur brauchte.
»Hast du es gehört, Hippolyt? Er beschimpft mich vor Fremden auf offener Straße. Was habe ich getan, dass Gott mich mit diesem Vater gestraft hat?«
»Das ist gotteslästerlich. Als guter Christ solltest du dein Schicksal annehmen.« Hippolyt lächelte schief. Sein Schädel war kahl, die Brauen dafür umso buschiger. Viele Jahre unter brennender Sonne hatten seine Gesichtshaut gegerbt und tiefe Falten um Nase und Mund eingegraben. Intelligente hellblaue Augen straften sein Alter Lügen.
»Das sagt jemand, der nicht an Gott glaubt.«
»Nicht so laut. Wir sind zwar in protestantischen Landen, aber das Leugnen Gottes vergelten die uns mit dem selbigen heißen Feuer wie die Papisten. Vergiss das nie, mein Freund!«
»Dich schätzen die Leute doch. Wer sollte dir krumm kommen?«
Hippolyt schob seinem Schüler einen Korb mit getrockneten Wurzeln zu. »Armer Gerwin, du musst noch viel lernen über die Menschen. Wer heute dein Freund ist, der kann dich schon morgen an den Galgen bringen.«
»Das ist nicht recht! Ich würde dich nie verraten!«
»Lass gut sein, Gerwin. Ich will dich nur zur Vorsicht gemahnen, dein Gottvertrauen in allen Ehren. Schau die Wurzeln, erinnerst du dich noch, wie sie heißen?«
Der junge Mann roch daran und rieb sie zwischen den Fingern, wobei ihm dichtes, dunkles Haar ins Gesicht fiel, ein Erbe seiner Mutter. Die Schönheit der Gudrun Waldeck war legendär gewesen, und kaum jemand hatte verstanden, dass sie Friedger Pindus geehelicht hatte, einen Säufer und Taugenichts.
»Alant«, sagte Gerwin.
»Gut. Was machen wir nun mit der Alantwurzel und dem Thymus, den du gerade zupfst?«
Gerwin musste nicht lange nachdenken. Seit vier Jahren verbrachte er jede freie Minute bei Hippolyt und sog auf wie ein Schwamm, was der weitgereiste Wundarzt ihm über das Heilen und die Herstellung von Arzneien vermittelte. Als Friedger entdeckt hatte, was sein Sohn heimlich trieb, hatte er ihn jedes Mal, wenn er ihn mit Hippolyt erwischte, geprügelt und ihm einmal sogar eine Rippe gebrochen. Nachdem Gerwin stärker geworden war als sein brutaler und meist betrunkener Vater, hatte dieser das Prügeln eingestellt und sich auf Drohungen und Pöbeleien beschränkt, wann immer er Gelegenheit dazu fand. Allein seiner jüngeren Geschwister und der Mutter wegen kehrte Gerwin noch nach Hause zurück, doch irgendwann würden sie ohne ihn auskommen müssen. Der Tag würde kommen, an dem Friedger das Fass zum Überlaufen brachte, und an diesem Tag, das fürchtete Gerwin, würde Gott keine Freude an ihm haben.
»Der Alant ist von der warmen und trockenen Art und wird in Wein gelegt, wo er zieht, bis ...«
»Wenn wir aber keinen Wein haben?«, unterbrach Hippolyt ihn.
»Dann geht auch Honigwurz.« Er sah, wie Hippolyt nickte, und fuhr fort: »Der Auszug vom Alant ist wirksam gegen Lungenleiden, weil er die Materie abtreibt, und wird vor oder nach dem Essen eingenommen. Auch ist der Alant schweißtreibend und kann auf leichte Wunden gegeben werden, damit erst keine Materie austritt.« Die Scheite knisterten im Feuer, und Gerwin nahm die vielfältigen Düfte in der winzigen Stube des Heilers in sich auf. »Der Thymus nun ist als Öl bei Krätze und Läusen gut und wirkt gegen Würmer und Muskelzuckungen. Zu gleichen Teilen vermengt mit Alanttinktur hilft ein solcher Trank bei schwerem Husten.«
»Guter Junge! Und diesen Trank wollen wir heute bereiten, um ihn der armen Frau vom Säckler zu geben, die seit drei Monaten hustet und spuckt. Ich kann sie hören, wenn ich unten am Fluss bin. Der Husten scheint sie zu zerreißen.« Hippolyt schüttelte den Kopf. »Wäre sie doch bloß schon zu Beginn des Winters zu mir gekommen, dann hätte Arges abgewendet werden können.«
»Es gibt immer noch viele, die lieber zum Bader in Großhartmannsdorf gehen, obwohl dem vorige Woche schon wieder einer nach einer Extraktion gestorben ist.« Mehr als einmal war Gerwin Zeuge geworden, wie Bader Egbert mit schmutzigen Händen in den Mündern seiner Opfer herumfuhrwerkte und Zähne herausbrach, Furunkel mit einem rostigen Messer aufschnitt, Klistiere setzte und zur Ader ließ und die Leute mit Ratschlägen nach Hause schickte, die nicht selten tödliche Folgen hatten. Aber Egbert hatte eine kurfürstliche Urkunde in seinem Laden mit der zugehörigen Badestube hängen, die ihn als Vertreter seines Standes auswies. Außerdem gab es die Bademägde, die den Frauen rote Schminke aus Brasilholz oder weiße aus gepulvertem Panis porcinus aufschwatzten, und gegen diese exotischen Angebote schienen Hippolyts Heilkünste fade.
»Stultorum infinitus est numerus.1« Hippolyt zuckte nur mit den Schultern und goss ihnen einen Becher Gewürzwein ein.
Gerwin lachte und trank seinem Meister zu, der für ihn weit mehr als ein Lehrer geworden war. Der kluge Mann steckte voller Geschichten, und Gerwins Wissbegier war unersättlich. Vor allem wollte er verstehen, wie der menschliche Körper im Gleichgewicht zu halten war. Universitäten würden ihm auf ewig verschlossen bleiben, denn er hätte ein Studium niemals bezahlen können. Außerdem drängte es ihn nicht nach akademischen Ehren und Würden. Auf den Rang eines Doktors konnte er verzichten, wenn er nur lernen durfte, wie er den Menschen helfen konnte.
Gerwin entzündete eine weitere Lampe, damit sie besseres Licht zum Arbeiten hatten, als es laut an der Tür klopfte. Das schlichte Haus des Wundarztes stand etwas abseits am Dorfausgang, und Hippolyt war stolz auf seinen großen Kräutergarten und den Hang mit den Weinstöcken. Ganz in ihr Gespräch versunken, hatten die beiden Männer den Reiter nicht kommen hören, der vor ihrem Haus von seinem Pferd gestiegen war und nun mit Vehemenz gegen die Haustür schlug. »Heda! Aufmachen!«
»Wer kann das sein?« Gerwin ging zur Tür und kam in Begleitung eines herrschaftlichen Boten zurück. Der Mann trug lange Lederstiefel, ein ebensolches Wams, in dessen Gürtel ein Dolch und ein Kurzschwert steckten, und einen langen Umhang, den er schwungvoll zurückwarf.
»Wer von euch beiden ist der Wundarzt?«, fragte er barsch.
Zweifelnd sah Gerwin zu Hippolyt, doch der blieb gelassen und verschränkte die Arme vor seinem Bauch. »Wer will das wissen?«
»Mein Herr, Ritter Christoph von Alnbeck. Er befiehlt dich sofort auf sein Gut!« Obwohl der Ton des Boten unverschämt war, schwang echte Dringlichkeit darin mit. Er zog einen Umschlag aus einer Gürteltasche und warf ihn vor Hippolyt auf den Tisch. »Lies, wenn du kannst, Alter, und dann sputet euch. Ich nehme euch beide mit!«
»Scher dich zum Teufel, oder besser zu deinem Herrn. Wir lassen uns nichts befehlen«, blaffte Gerwin, doch Hippolyt, der die rasch hingeworfenen Zeilen überflogen hatte, winkte ab.
»Pack unsere Sachen, Gerwin, wir begleiten diesen Mann nach Dörnthal.«
Der Bote des Herrn von Alnbeck hatte geflucht, weil sie nicht über Reittiere verfügten, doch Pferde besaß in Helwigsdorff niemand, nicht einmal der alte Froehner. Gerwin trug die Tasche mit den Arzneien und Instrumenten und warf immer wieder besorgte Blicke auf seinen Meister, der sich schwer auf seinen Gehstock stützte. Wenn sie in diesem Tempo weitergingen, würden sie Dörnthal nicht vor der Dunkelheit erreichen.
»Eh, warum steigst du nicht mal ab und lässt den alten Mann ein Stück reiten? Dann kommen wir schneller zu deinem Herrn«, rief Gerwin dem Boten des Ritters von Alnbeck schließlich zu, der mit mürrischer Miene neben ihnen herritt.
Widerwillig stieg der Mann vom Pferd. »Kannst du überhaupt reiten?«
Hippolyt reichte Gerwin seinen Stock und stieg mit dessen Hilfe auf das Tier, das gutmütig wartete, bis der behäbige Mann im Sattel saß. Als Hippolyt die Zügel in die Hände nahm, glitt ein Lächeln über sein Gesicht. »Frag das den ehemaligen Leibarzt eines Sarazenenfürsten.«
Gerwin lachte, als er das überraschte Gesicht des Boten sah.
»Respekt! Ich hielt Euch für einen Quacksalber und zweifelte bereits am Verstand meines Herrn«, meinte der Bote. »Rainald mein Name«, fügte er deutlich freundlicher hinzu.
»Was genau ist denn mit dem Sohn deines Herrn geschehen? Dem Brief entnahm ich nur, dass er gestürzt sei«, fragte Hippolyt.
»Ein Sturz vom Pferd, einem wilden Biest, das er niemals hätte reiten dürfen!« Grimmig schüttelte er seine Faust. »Schuld hat ein Stallknecht, der es ihm erlaubt hat. Der Junge ist elf Jahre alt und eher schwächlich. Als der Gaul mit ihm durchging, fing er an zu schreien, aber bevor ich ihn einholen konnte, war er schon abgeworfen worden. Er stürzte unglücklich auf einen Stein und brach sich den Arm an mehreren Stellen. Das rechte Bein ist ebenfalls gebrochen, aber schlimmer sieht der Arm aus.«
»Sein Kopf?«
Rainald holte tief Luft. »Eine Beule, weiter nichts. Sagt, Medicus, habt Ihr Erfahrung mit Knochen, die durch die Haut stechen?«
Jetzt war es an Hippolyt, tief durchzuatmen. Er wechselte einen Blick mit Gerwin. »Bei ausgewachsenen Männern, nicht bei Knaben, aber wir werden sehen.«
Der Weg führte sie den Fluss entlang nach Süden, an der Höllermühle vorüber durch den Wolfsgrund und vorbei an Obersaida, bis sie schließlich die Türme des Ritterguts auf einer Anhöhe erblickten. Drei Bauernhöfe lagen dem von wildreichen Wäldern umgebenen herrschaftlichen Anwesen gegenüber. Unterhalb der festungsartigen Anlage schlängelte sich ein Bach durch die Wiesen. Der Ritter musste ein wohlhabender Mann sein.
Der Innenhof des Gutes bestätigte Gerwins Vermutung: Fette Gänse, Hühner und Enten liefen über den Misthaufen. Zwei große Jagdhunde trotteten umher, aus den Stallungen war das Wiehern von Pferden zu hören. Da störte ein Misston das Idyll. Jemand schrie, als würde er gefoltert.
Hippolyt brachte sein Pferd zum Stehen und ließ sich hinuntergleiten. »Wird jemand gezüchtigt?«, fragte er Rainald.
»Der Stallknecht. Wenn er Glück hat, verbleibt noch ein Fetzen Haut auf seinem Rücken, dann dauert das Sterben länger«, meinte der Mann des Ritters lapidar.
Gerwin ahnte, dass ein Stallknecht dem Sohn seines Herrn wohl kaum eine Bitte abschlagen konnte, ohne Gefahr zu laufen, dafür bestraft zu werden. »Ist das nicht zu hart?«
»So ist das Gesetz. Der Herr entscheidet über unsere Leben. Und Ihr solltet nicht säumen, sondern Euch sogleich beim Hausvorsteher Wiklef vorstellen. Dort drüben ist der Eingang.« Rainald zeigte auf eine Holztreppe. Sie führte auf einen Balkon, der den gesamten ersten Stock umlief.
Mit gemischten Gefühlen folgte Gerwin seinem Meister. Sollten sie dem Schwerverletzten nicht helfen können, würde die Situation rasch unangenehm werden. Hippolyt schien ähnliche Gedanken zu hegen, denn er griff nach Gerwins Arm. »Kein Wort! Überlass mir das Reden und tu nur, was ich von dir verlange.«
»Ist gut.«
Hippolyt nickte, straffte den Rücken und stieß den Gehstock mit Wucht auf die Stufen. Kaum hatten sie die Hälfte der Treppe erklommen, als ein kleiner Mann mit langen grauen Haaren und den hektischen Bewegungen eines Wiesels auf sie zugelaufen kam. Sein Gesicht war spitz, die Nase ragte nach oben, und da ein Auge unbeweglich war, wusste man nicht, ob der Hausvorsteher einen ansah oder nicht. »Endlich! Warum habt Ihr so lange gebraucht? Der Herr ist schon in Rage. Kommt, folgt mir!«
Gerwin verdrehte die Augen. »In Rage, o je, o je ...«
»Gerwin!«, zischte Hippolyt. Seite an Seite gingen sie schnellen Schrittes an verschiedenen Türen vorüber, hinter denen Gerwin Geflüster und Getuschel vernahm.
Eine junge Dienerin hielt mit gesenktem Blick an, um sie vorbeizulassen. Der Herr des Gutes schien ein strenges Regiment zu führen, denn die Dienstboten glichen seelenlosen, ängstlichen Schatten. Wenn Ritter von Alnbeck mehr durch Furcht als durch verdienten Respekt seine Leute im Griff hielt, würde das den Behandlungsverlauf möglicherweise schwierig gestalten.
Ruckartig blieb Wiklef vor einer Tür an der Stirnseite des hufeisenförmigen Gutes stehen, klopfte kurz, stieß die Tür auf und hieß sie mit einer tiefen Verbeugung eintreten. Der Gestank von Fäulnis und Ausfluss schlug ihnen entgegen und ließ Schlimmes befürchten. Nachdem ihre Augen sich an das schummrige Licht gewöhnt hatten, machten sie ein Baldachinbett in der Mitte des Schlafgemachs aus. Schwere Brokatvorhänge verdeckten das Fenster, vor dem an einem Tisch zwei Frauen mit sorgenvollen Mienen saßen. Mehrere Teppiche dämpften die Schritte und zeugten vom Reichtum der Alnbecks.
Als sie sich dem Bett näherten, trat aus seinem Schatten ein hochgewachsener Mann. »Wiklef!«, herrschte er den Hausvorsteher an.
»Ja, mein Herr?«, winselte der Mann.
»Nimm die Frauen mit hinaus. Das hier ist nichts für zimperliche Weiber.«
Die ältere der beiden Damen erhob sich, wobei die seidenen Röcke raschelten und ihr Geschmeide glitzerte. Doch ihr Gesicht war sorgenvoll, grau und verhärmt. Nur noch Spuren ihrer einstigen Schönheit waren zu erahnen. Mit gesenktem Kopf flüsterte sie: »Christoph, ich bitte Euch! Ich flehe Euch an, mich bei meinem Sohn zu lassen. Er braucht mich!«
Christoph von Alnbeck musterte seine Gattin kühl. Aus seinen herrischen Zügen sprach die Gewohnheit zu bestimmen. Von Kopf bis Fuß war er der selbstherrliche Gutsbesitzer, der auf seinem Land über Leben und Tod entschied: Sein ausgeprägtes Kinn wurde von einem Spitzbart geziert, über der Oberlippe prangte ein gestutzter Schnurrbart. Dunkle Locken waren hinter die Ohren gestrichen und gaben eine hohe Stirn frei. Wams und Kniehosen saßen tadellos am kräftigen Körper des Ritters, der das vierte Lebensjahrzehnt beendet haben mochte. Als er jedoch anhub zu sprechen, ruhten seine Augen milde auf seiner Frau: »Elisabeth, es ist zu Eurem Wohle und zum Wohle unseres Sohnes. Nehmt Adelia mit und esst etwas, während ich mich mit dem Medicus bespreche.«
Elisabeth von Alnbeck ging zum Krankenlager und beugte sich über den schmalen Jungen, um ihm einen Kuss auf die Stirn zu drücken. Dann verließ sie mit ihrer Zofe den Raum.
Alnbeck wartete, bis die Tür sich hinter den Damen geschlossen hatte. »Es ist nur einem Zufall zu verdanken, dass ich von der Existenz eines so berühmten Medicus erfuhr. Der Freiherr zu Castelnau beehrte mich kürzlich mit seiner Anwesenheit und erwähnte Euch, doch später mehr davon. Bitte, tretet näher. Mein Sohn Leander ist schwer vom Pferd gestürzt.«
Er schlug das Laken zurück, unter dem der blasse Junge mit geschlossenen Augen lag. Sein Atem ging stoßweise, und die Stirn, auf der eine enteneigroße Beule prangte, glänzte vom Fieber. Die Gesichtshaut war so dünn, dass das bläuliche Netz der Adern sich darunter abzeichnete. Gerwin hatte seinem Meister den Umhang abgenommen und auch seinen eigenen auf einen Stuhl gelegt. Nun trat er neben Hippolyt an das Krankenlager, dessen Gestank ihm schier den Atem nahm.
Hippolyt hob ein Tuch, welches den unnatürlich gekrümmten Arm des Jungen bedeckte. »Heilige Mutter Gottes!«, entfuhr es ihm, was ihm einen strafenden Blick des Ritters einbrachte. Das Anrufen von Heiligen oder der Heiligen Jungfrau war papistisch und höchst verpönt.
Doch das Bild, das sich ihnen bot, war erschütternd: Leander musste so unglücklich gestürzt sein, dass mehrere Knochen des Unterarmes gebrochen waren und jetzt die Haut wie ein Nadelkissen durchstachen. Die weißen Knochensplitter ragten aus bereits schwärendem, dunkelrot verfärbtem Fleisch hervor. Gelbliche Materie und schwärzlicher Ausfluss sickerten aus den vielen Wunden und verursachten den Gestank. Das Bein lag geschient und verbunden.
»Wer hat sich den Arm angesehen? War denn kein Arzt in der Nähe?«, fragte Hippolyt und krempelte sich die Hemdsärmel hoch.
Der Junge wimmerte im Schlaf und warf den Kopf hin und her.
»Der Medicus aus Sayda war hier und hat das Bein gerichtet. Auf den Arm hat er eine Tinktur gegeben und gesagt, dass die bösen Säfte zuerst abfließen müssten, bevor er ans Richten gehen könne. Er wollte morgen wiederkommen, aber heute sieht es doch arg aus, und der Medicus war nicht zu erreichen. Nun, da dachte ich an Euch. Also, was ist zu tun?«, fragte Christoph.
»Amputation«, entschied Hippolyt ohne einen Moment des Zögerns.
»Nein!«, rief der Vater. »Leander ist mein einziger Sohn, mein einziges Kind, mein Erbe. Er soll seinen Arm behalten. Ohne Arm ist er ein Krüppel. Niemand wird ihn respektieren!«
»Gut, dann behält er seinen Arm und geht damit ins Grab. Ich gebe ihm noch zwei Tage. Gerwin, wir haben hier nichts weiter verloren.« Hippolyt, der sich über den Jungen gebeugt hatte, erhob sich, ließ sich seinen Gehstock geben und wollte sich abwenden, wurde jedoch von Alnbeck zurückgestoßen.
»Ihr geht, wenn ich es will, und Ihr tut, was ich sage. Dafür werdet Ihr entlohnt. Und ich befehle Euch, meinem Jungen den Arm zu retten. Schneidet ihn auf, holt die Knochensplitter heraus und flickt ihn zusammen, aber rettet seinen Arm!« Alnbecks Augen flackerten, und an seiner Schläfe pochte eine Ader.
Mit einem Streich seines Degens könnte er sie beide töten, und niemand würde sich darum scheren. Es dämmerte Gerwin, dass der andere Medicus die Gefahr erkannt und sich beizeiten aus dem Staub gemacht hatte. Hippolyt jedoch war aus ebenso hartem Holz geschnitzt wie der Edelmann und ließ sich nicht einschüchtern.