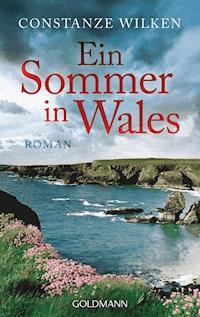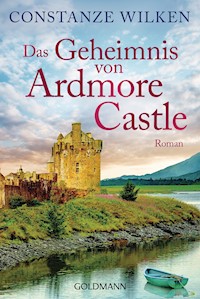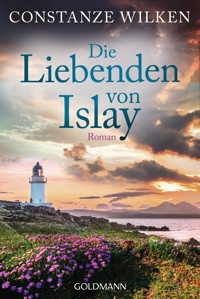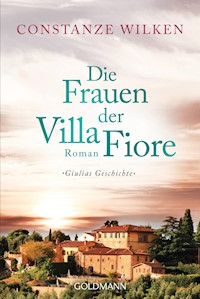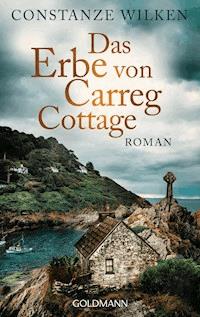5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine berührende Begegnung in der Toskana: der Familiengeheimnisroman »Die Frauen von Casole d'Elsa« von Constanze Wilken jetzt als eBook bei dotbooks. Die junge Oda Bergemann kehrt an einen Ort ihrer Kindheit zurück, der ihr einst so viel bedeutet hat und der sie jetzt mit Wehmut und Trauer empfängt: Das Haus ihres Vaters in der kleinen toskanischen Gemeinde Casole d'Elsa. Nach seinem plötzlichem Tod liegt es an Oda, zu entscheiden, was mit jenem Ort geschieht, mit dem sie so viele Erinnerungen verbindet. Als ihr dort eine alte Fotografie ihrer Großeltern in die Hände fällt, beginnt sie zu ahnen, dass die Vergangenheit ihrer Familie ein Geheimnis umgibt – ein Geheimnis, das auch Odas Leben nicht unberührt gelassen hat. Die tüchtige Nella, deren Familie seit Generationen in Casole d'Elsa lebt, scheint mehr über Odas Familie zu wissen – doch Nella und deren charmanter Enkel, der Rinderzüchter Sandro, blocken ihre Fragen ab … bis die Vergangenheit auch sie einzuholen droht. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Familiengeheimnisroman »Die Frauen von Casole d'Elsa« von Constanze Wilken. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 706
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Die junge Oda Bergemann kehrt an einen Ort ihrer Kindheit zurück, der ihr einst so viel bedeutet hat und der sie jetzt mit Wehmut und Trauer empfängt: Das Haus ihres Vaters in der kleinen toskanischen Gemeinde Casole d’Elsa. Nach seinem plötzlichen Tod liegt es an Oda, zu entscheiden, was mit jenem Ort geschieht, mit dem sie so viele Erinnerungen verbindet. Als ihr dort eine alte Fotografie ihrer Großeltern in die Hände fällt, beginnt sie zu ahnen, dass die Vergangenheit ihrer Familie ein Geheimnis umgibt – ein Geheimnis, das auch Odas Leben nicht unberührt gelassen hat. Die tüchtige Nella, deren Familie seit Generationen in Casole d’Elsa lebt, scheint mehr über Odas Familie zu wissen – doch Nella und deren charmanter Enkel, der Rinderzüchter Sandro, blocken ihre Fragen ab … bis die Vergangenheit auch sie einzuholen droht.
Über die Autorin:
Geboren an der norddeutschen Küste zog es Constanze Wilken nach einem Studium der Kunstgeschichte, Politologie und Literaturwissenschaft für einige Jahre nach England. Im wildromantischen Wales entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben, aber auch für Antiquitäten. Die Forschungen zur Herkunft seltener Stücke und ausgedehnte Reisen der Autorin sind Inspiration und Grundlage für ihre Romane.
Die Website der Autorin: http://constanze-wilken.de/
Bei dotbooks erschienen bereits folgende Romane:
»Die Frau aus Martinique«
»Was von einem Sommer blieb«
»Die vergessene Sonate«
»Das Geheimnis des Schmetterlings«
»Das Licht von Shenmoray«
Weiterhin veröffentliche Constanze Wilken bei dotbooks die folgenden Historischen Romane:
»Die Tochter des Tuchhändlers«
»Die Malerin von Fontainebleau«
***
eBook-Neuausgabe Juli 2021
Dieses Buch erschien bereits 2015 unter dem Titel »Die Fasane der Signora« im Verlag frankly.
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Constanze Wilken
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/Giacomo Ciangottini
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-329-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Frauen von Casole d’Elsa«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Constanze Wilken
Die Frauen von Casole d’Elsa
Roman
dotbooks.
Inhaltsverzeichnis
Teil Eins
Val di Chiana, September 1965
Casole d’Elsa, Mai 2001
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Hamburg, Januar 1933
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Monte San Savino, Mai 2001
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Casole d’Elsa, Mai 2001
Val di Chiana, Oktober 1943
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Teil Zwei
Hamburg, Juni 2001
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Florenz, Dezember 1943
Hamburg, Dezember 1943
Kapitel 1
Kapitel 2
Monte San Savino, Juni 2001
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Casa Gambetti, Januar 1944
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Casa Gambetti, Juni 1944
Kapitel 1
Kapitel 2
Val di Chiana, Juni 2001
Hamburg, Juni 2001
Kapitel 1
Kapitel 2
Casole d’Elsa, September 2001
Nachwort
Lesetipps
»Der Tag wird kommen, an dem die Burschenendlich wieder zurückkehren werden zu ihren Pflügen,und die staubigen Hügel des Orcia-Talswerden wieder blühen wie die Rose.Zerstörung und Tod haben uns heimgesucht,nun aber liegt Hoffnung in der Luft.«
Iris Origo: Toskanisches Tagebuch 1943/44, Kriegsjahre im Val d’Orcia
Teil Eins
Val di Chiana, September 1965
Sein Blick glitt über die dicht bewaldeten Hügel. Pinien, Kastanien und Eichen verströmten ihren unverwechselbaren Duft, den er an jedem Ort der Welt in der Nase hatte, wenn er an sein Tal dachte. Das hier war seine Heimat, sein Land. Bis vor wenigen Jahren hatte sich dichtes Grün bis zum Fluss hinunter erstreckt. Aber Sommergäste hatten die wilde Schönheit des Tales entdeckt, und inzwischen blitzten immer öfter die roten Dächer der Ferienhäuser durch das Blattwerk. Es waren feindliche Fremdkörper, verbunden durch Straßen, die den Wald zerschnitten und tiefe Wunden rissen, die nicht zu heilen waren. Er räusperte sich, strich sich durch die dichten, an den Schläfen leicht ergrauten Haare, und pfiff nach seinem Hund. Ein schlanker rehbrauner Jagdhund kam aus dem Unterholz und schaute ihn aufmerksam an. Der Jäger schulterte sein Gewehr und schnalzte mit der Zunge, worauf der Hund sich an seiner Seite hielt und ihm den Pfad hinauf in die Macchia folgte. In diesem Buschwald hielt sich das Wild auf, welches es heute zu jagen galt.
Der Jäger kniff die Augen zusammen und schritt mit grimmiger Miene zielstrebig voran. Er musste nicht auf den Boden sehen, um Wurzeln oder Unebenheiten im Gelände auszuweichen. Selbst bei Nacht oder blind hätte er seinen Weg gefunden, denn in diesen Hügeln kannte er jeden Baum, jeden Strauch, jeden Wasserlauf und jedes Sumpfloch. Sein Vater hatte ihn das erste Mal mit auf die Jagd genommen als er sechs Jahre alt gewesen war. Er hatte gelernt, die Pflanzen zu unterscheiden, wusste, wo sich Rot- oder Schwarzwild aufhielt und zu welchen Zeiten Rebhühner und Fasane gejagt werden durften. Es war nicht lange her, da hatte jemand einen Wolf gesichtet. Die scheuen Tiere stellten keine Gefahr dar, doch wenn sie die Schafe oder Ziegen der Bauern rissen, würde die Hetzjagd nicht lang auf sich warten lassen.
Der Hund hob die Nase und ging in Vorstehhaltung. Eine nervöse Spannung bemächtigte sich des Jägers. Im Grunde verabscheute er das Töten, doch das Wild, auf das er heute aus war, stellte eine direkte Bedrohung dar. Es bedrohte sein Leben und die Existenz von allem, was er liebte und sich über die Jahre aufgebaut hatte. Das unerhörte Ausmaß der Bedrohung rechtfertigte sein Handeln. Er sah, wie sich die Nackenhaare seines Hundes aufstellten und die Lefzen unter einem leisen Knurren flatterten. Noch konnte er umkehren, noch war nichts geschehen. Sacht setzte er einen Fuß vor den anderen, nahm seinen Hund am Halsband und lenkte ihn durch dichten Farn in den Schutz einer mächtigen Eiche.
Der Schweiß trat ihm auf die Stirn, seine Hände zitterten und er rief sich zur Ruhe. Wenn er jetzt zögerte, würde er nicht wieder die Kraft finden, zu tun, was getan werden musste. Es musste getan werden! Wie ein Gebet wiederholte er den Satz für sich, wieder und wieder, bis sein Herz langsamer schlug und seine Hände ruhig nach dem Gewehr greifen konnten. Es hatte Zeiten gegeben, da hatten sie Seite an Seite gekämpft, sich gegenseitig Feuerschutz gegeben, wenn es darum ging, den verhassten Feind zu vertreiben. Blutige Zeiten voller Verzweiflung und Trauer, Zeiten, die ein halbes Leben zurück lagen.
»Gott hilf mir, warum musste er mir das antun? Warum konnte er nicht schweigen, wie wir alle?«, flüsterte der Jäger und wischte sich eine Träne aus dem Auge, denn es knackte im Unterholz.
Sein Hund wusste, worauf es ankam und duckte sich still neben ihm ins Gras.
»Eh, wo seid ihr denn alle? Ich habe noch kein verfluchtes Rebhuhn gesehen!«, rief plötzlich ein Mann, der in einer Entfernung von dreißig Metern aus dem Dickicht trat und mit seinem Gewehr wedelte. »Merda, ich habe keine Zeit für Versteckspiele! Zeit ist Geld!«, brüllte der Mann und lachte. Seine Kleidung war abgewetzt, seine gesamte Erscheinung zeugte von Nachlässigkeit und sein vorstehender Leib von einer Vorliebe für üppiges Essen und Trinken. An seinem Gürtel baumelte eine Feldflasche, die der Mann, dessen Gesicht aufgedunsen wirkte, losband, öffnete und an die Lippen setzte.
Der Jäger schloss die Augen und atmete tief durch. »Tu mir das nicht an! Sag, dass du nur gescherzt hast und wir schütteln uns die Hände und gehen nach Hause als wäre nichts geschehen.« Aber er wusste, dass der Mann dort vorn auf dem Waldweg keinen Rückzieher machen würde. Dafür kannten sie sich zu lange. Er entsicherte sein Gewehr und legte an.
Als das metallische Klicken erklang, zuckte der Mann zusammen. Die Flasche fiel zu Boden und sein Körper spannte sich. Für einen Moment war er wieder der Partisan, der ständig damit rechnen musste, entdeckt und gerichtet zu werden. Doch die angstvoll geweiteten Augen verengten sich wieder und der Mann hielt sein Gewehr locker im Anschlag. »Das ist nicht mehr witzig! Bist du es? Komm schon, sonst gehe ich und du weißt, was dann passiert.« Der Mann grinste, sah sich aber vorsichtig um.
»Gott vergib mir«, flüsterte der Jäger und zielte auf die Brust des Mannes, der mit ungeduldiger Miene das Blattwerk mit seinem Blick zu durchdringen versuchte.
Casole d’Elsa, Mai 2001
Kapitel 1
Sanft wellten sich die Hügel im Licht der Abendsonne. Frisch gepflügte Äcker grenzten an solche, auf denen bereits Mais und Sonnenblumen zartes Grün zeigten, und liebevoll gepflegte Obstgärten fanden sich in unmittelbarer Nachbarschaft von alten Olivenhainen. Hier und dort waren Weinreben zu sehen, doch die großen Weingüter mit den klangvollen Namen, die in aller Welt bekannt waren, lagen östlich des kleinen Flusses, den Oda Bergemann vor wenigen Minuten mit ihrem Mietwagen überquert hatte. Sie verlangsamte das Tempo ihres Autos. Wie hatte sie nur vergessen können, wie schön es hier war?
Die Elsa war ein Nebenfluss des Arno und der Namensgeber des kleinen Ortes, dessen mittelalterliche Silhouette auf einem Hügel vor ihr aufragte. Die junge Frau seufzte und strich sich eine Strähne ihres halblangen dunkelbraunenn Haares aus der Stirn. Egal wie langsam sie auch fuhr, irgendwann würde sie sich der Wirklichkeit stellen müssen, einer traurigen Realität, für die sie zum Großteil selbst verantwortlich war. Der bohrende Schmerz aus Schuldgefühlen, Verbitterung und Trauer steigerte sich mit jeder Kurve, die sie ihrem Ziel näher brachte. Als sich ihr Wagen durch die letzte steile Kurve vor der Stadtmauer quälte, hoffte sie, dass der Motor aufgeben, der Wagen zurückrollen und sie von hier fortbringen würde. So dachten Kinder, aber Kinder glaubten auch an Märchen mit guten Feen. Die hatte es in ihrem bisherigen Leben nicht gegeben.
Oda biss die Zähne zusammen und trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Mühsam kämpfte sich der Wagen die Steigung bis zum Plateau hinauf, das sich unterhalb der Stadtmauer von Casole d’Elsa erstreckte. Auf dem Parkplatz einer winzigen Tankstelle mit nur einer Zapfsäule stellte Oda den Motor ab und stieg aus. Sie streckte sich und sog die warme Luft ein. Es roch nach Pinien, Lavendel und Essen. Irgendwo wurde ein Fußballspiel im Fernsehen übertragen und Kindergelächter schallte über die Mauer.
Die Nachricht vom plötzlichen Tod ihres Vaters hatte Oda schwer getroffen, obwohl sie über Jahre kaum Kontakt gehabt hatten. Als Oda jetzt auf diesem Parkplatz stand, die Giebelspitze ihres Hauses hinter den Mauern sah und die vertrauten Gerüche wahrnahm, brachen die Tränen aus ihr heraus. Sie schluchzte und schlug mit den Fäusten auf das Autodach. Alles, was sie an guten Erinnerungen hatte, die Wärme und Geborgenheit längst verblasster Kindertage, das verband sie mit diesem Ort.
»Signora, ist alles in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe?« Eine Hand legte sich sanft auf ihre Schulter.
Die melodischen Klänge der Sprache, mit der Oda aufgewachsen war, machten alles noch schlimmer.
»Ist Ihr Wagen kaputt? Da kann ich leider nicht helfen. Und die Werkstatt in Casole ist auch erst morgen wieder geöffnet.« Wer sich so freundlich um sie kümmerte, war eine junge Frau, die ihr ein Papiertaschentuch reichte. Ihre schlanke durchtrainierte Figur kam selbst in dem blauen Arbeitsoverall vorteilhaft zur Geltung. Wie machten italienische Frauen das nur? Sie sahen immer gut aus.
Schniefend nahm Oda das Taschentuch. »Danke. Entschuldigung. Ich habe eine lange Reise hinter mir.«
Die freundliche junge Frau warf ihre dichten braunen Locken zurück und nickte. »Va bene. Das ist meine Tankstelle. Ich schließe jetzt. Brauchen Sie wirklich nichts? Eine Unterkunft? Mein Cousin vermietet ein Haus …«
Energisch schüttelte Oda Bergemann den Kopf. »Nein. Mein Vater hat … Er ist …« Ihr versagte die Stimme. »Ihm gehörte ein Haus.« Oda machte eine vage Bewegung in Richtung der Stadtmauer.
Augenblicklich veränderte sich der Gesichtsausdruck der Tankwartin und Neugier wich ehrlichem Mitgefühl. »Ich bin Marcella. Sie finden mich hier fast jeden Tag.« Ihr Mobiltelefon klingelte, doch bevor sie das Gespräch annahm, drückte sie kurz Odas Hand und nickte ihr zu.
Die Geste war so einfach wie herzlich. Oda sah der drahtigen kleinen Gestalt nach, die auf das Kassenhäuschen zuging. Wie hatte sie all das hier vergessen können? Sie stieg in ihren Wagen und startete den Motor. Ich habe nichts vergessen, dachte Oda, nur verdrängt.
Der kleine Wagen holperte im Schritttempo über das Kopfsteinpflaster der engen Gassen. Oda wich einer Vespa aus, auf der ihr zwei junge Männer in halsbrecherischem Tempo entgegen kamen. Sie winkten und rasten die mindestens vierzig Grad steile S-Kurve hinunter. Die Abendsonne tauchte die Piazza vor der Kirche in warmes goldoranges Licht. Auf einer Bank saßen drei alte Männer und vor ihnen lag ein schlafender Hund auf den Steinen. Der Ort hatte sich verändert. Natürlich war auch hier die Zeit nicht stehen geblieben. Viele Fassaden wirkten neu, aber man hatte darauf geachtet, den historischen Charme zu erhalten.
Eine Katze sprang über die Straße und Oda trat kurz auf die Bremse. Die nächste Straße zu ihrer Linken musste es sein. Sie suchte nach dem Straßenschild. Via San Donato. Der Straßenbelag war brüchig, die Schlaglöcher vom Regen ausgewaschen. Zu beiden Seiten schmiegten sich alte, zum Teil schiefe, ein- oder zweistöckige Häuser aneinander. Wenige Fassaden waren verputzt, die meisten aus dem für die Region typischen sandfarbenen Stein erbaut. Vor den Fenstern hingen Blumenkästen, hier und dort gab es einen schmalen Balkon. Endlich sah sie es. Die blassgelbe Fassade hob sich von den dunkleren Nachbarhäusern ab. Oleander und anderes Buschwerk drückten sich in dem schmalen Grünstreifen vor dem zweistöckigen Haus. Auf den Treppenstufen vor der Haustür standen bepflanzte Terrakotta - Kübel. Oda fuhr in die Einfahrt, stieg aus und erwartete fast, dass sich die Tür öffnete und ihr Vater heraustrat. Er war nie ein Mann vieler Worte gewesen, aber sie erinnerte sich, dass er ihr oft liebevoll über die Haare gestrichen hatte.
Warum hatten sie keinen Weg zueinander gefunden? Es war unausgesprochen geblieben. Und das war das Schlimmste. Oda schluckte und betrachtete die Kübel. Unter dem Kamelienstrauch, hatte der Anwalt geschrieben, sollten die Haustürschlüssel liegen. Signore Matani würde erst übermorgen aus Mailand zurückkommen. Sie kannte weder den Anwalt ihres Vaters noch seine Freunde. Wie hatte Walter Bergemann in den letzten Jahren gelebt? Mit zitternden Fingern schob Oda die Blätter zur Seite und fand den Schlüssel lose in die Erde gedrückt.
»Was machen Sie da? Es ist niemand zu Hause!«, rief jemand von hinten.
Oda drehte sich um und entdeckte einen Mann in ärmellosem Hemd, der sich über den Balkon des gegenüberliegenden Hauses beugte. Er hielt ein halbvolles Weinglas in einer Hand und musterte sie kritisch.
»Ich weiß. Ich habe einen Schlüssel!« Zum Beweis hielt sie den Schlüssel in die Luft. Über zehn Jahre waren seit ihrem letzten Besuch vergangen. Kaum jemand würde sich an sie erinnern.
»Paolo, komm rein. Das Essen ist fertig!«, ertönte es befehlend aus dem Hausinneren.
»Eh, ich hab Sie im Auge.« Der Mann leerte sein Weinglas und verschwand vom Balkon.
Hatte es damals einen Paolo in der Nachbarschaft gegeben? Oda öffnete die Haustür und trat in die offene Diele. Es war genauso wie früher! Die offene Küche, nur durch einen Tresen vom Wohnraum mit dem Kamin getrennt, die rustikalen Möbel mit verschlissenen karierten Bezügen. An den Wänden hingen die Aquarelle, die ihre Mutter gemalt hatte. Roter Klatschmohn, den man am Wegesrand und auf den Feldern fand. Zypressen, die sich wie eine Perlenkette über die Hügel zogen. Oda schaute in die Küche, die aufgeräumt wirkte. Wahrscheinlich hatte der Anwalt dafür gesorgt. Signore Matani war sehr höflich am Telefon gewesen, hatte sich mehrfach für seine Abwesenheit an ihrem Ankunftstag entschuldigt und versichert, dass sie sich um nichts zu kümmern brauchte. Was ihr noch bevorstand, waren die Beerdigung und das Sortieren der persönlichen Dinge ihres Vaters. Davor graute ihr am meisten.
Neben dem Kamin hing ein kleinformatiges Aquarell. Mohnblumen. Im Sommer blühten sie überall. Oda berührte den hellblau lackierten Bilderrahmen. Viele Erinnerungen an ihre Mutter hatte sie nicht. Claudia Bergemann war gestorben als Oda fünf Jahre alt gewesen war. Doch wenn Oda die Augen schloß, sah sie ihre Mutter noch heute mit Farben und Pinseln hantieren. Die Sonne schien durch das Blattwerk der alten Bäume im Garten, warf tanzende Schatten auf die Terrasse und Odas Mutter stand vor einer Staffelei und lächelte ihr zu.
»Schau, kleine Oda, das sind die Waldfeen. Sie tanzen für uns auf den Steinen. Wenn du eine fängst, darfst du dir etwas wünschen.« Ihre Mutter lachte und die grünen Augen blitzten übermütig. Während Oda vergeblich den Schatten nachjagte, huschte der Pinsel ihrer Mutter über den Block auf der Staffelei. Damals wusste Oda nicht, wie krank ihre Mutter war. Doch irgendwann war der Tag gekommen, an dem Claudia nicht mehr aufstehen konnte, ihre Tochter in die Arme nahm und lange an sich drückte. Dann zog sie ein kleines gerahmtes Bild unter ihrem Kopfkissen hervor.
»Das ist deine Waldfee, Oda. Wenn du einen Wunsch hast, wird sie ihn dir erfüllen. Du musst nur ganz fest daran glauben.«
Oda nahm das Bild und schaute es lange an. Ihre Mutter hatte eine kleine geflügelte Fee gemalt, die im offenen Kelch einer Mohnblüte saß. An die genaue Abfolge der dramatischen Ereignisse, die dann folgten, konnte Oda sich nicht erinnern. Mit versteinerter Miene war ihr Vater zu ihr gekommen, um ihr zusagen, dass ihre Mutter sie für immer verlassen hatte und sie nun tapfer sein müssten. Er hatte sich vor sie gekniet, seine Hände auf ihre Schultern gelegt und gesagt: »Mutter wollte nicht, dass wir weinen, Oda. Wir dürfen nicht traurig sein, sonst weint der Himmel.«
Eine Träne tropfte auf das Bilderglas. Oda schluchzte. Sie war ein kleines Mädchen gewesen! Wie hatte sie verstehen sollen, dass ihre Mutter für immer fort war, sie nie wieder küssen und mit ihr lachen würde? Aber sie hatte verstanden, dass es ihrem Vater wichtig war, dass sie nicht weinte. Oda weinte nicht auf der Beerdigung und auch nicht danach. Alle hielten sie für ein seltsames herzloses kleines Mädchen. Doch die Leute wussten nicht, dass sie nächtelang vor dem Aquarell mit der Waldfee saß und sich wünschte, dass ihre Mutter zurückkam.
»Warum hast du das gesagt? Hast du nicht gewusst, dass ein kleines Mädchen daran glauben würde? Dass ich daran verzweifeln musste, weil es nicht funktionierte?«, flüsterte Oda und legte abrupt das Bild ab.
Frische Luft, dachte sie! Die Holzrahmen der Terrassentüren waren rissig, der Griff ließ sich nur schwer betätigen. Quietschend schwangen die Türen nach außen auf. Nachdem Oda ihre Schuhe ausgezogen hatte, setzte sie einen Fuß auf die unregelmäßig verlaufenden Steinplatten. In den aufgebrochenen Fugen machte sich Unkraut breit, doch die Steine fühlten sich an wie damals.
Zwei Rattansessel standen neben einem Holztisch, auf dem sich ein zerbrochenes Windlicht befand. In einem der Sessel lag sorgfältig zusammengefaltet eine Wolldecke. An der Wand war Kaminholz aufgestapelt und auf dem Rasen stand ein Block mit einer Axt. Ihr Vater hatte selbst Holz gehackt, also musste er kräftig und gesund gewesen sein. Sie ging auf den Rasen hinunter, der an der Stirnseite an die Stadtmauer grenzte. Von dort hatte man einen weiten Blick über die Hügel, und bei klarer Sicht zeigte sich am Horizont die markante Silhouette von San Gimignano. Sie stellte sich neben einen Erdbeerbaum, wandte sich dem Haus zu und betrachtete das Dach. Dort oben hatte ihr Vater das Gleichgewicht verloren und war rückwärts von der Leiter gestürzt. Signore Matani hatte sich bei der Beschreibung der Umstände, die zum Tod ihres Vaters geführt hatten, sehr zurückgehalten. Aus gutem Grund. Nicht einmal ansatzweise mochte Oda sich vorstellen, wie ihr Vater stundenlang mit einer Platzwunde und einem gebrochenen Halswirbel hilflos im Garten gelegen hatte.
Seufzend schaute sie zu den Nachbarhäusern auf beiden Seiten. Die Fensterläden waren geschlossen und selbst wenn jemand hinausgesehen hätte, versperrten die Bäume die Sicht auf den Garten. Privatsphäre konnte auch Nachteile haben. Nachdenklich glitt Odas Blick über den verschwiegenen Garten, der für einige wenige Jahre ein Ort der Geborgenheit gewesen war. Die stacheligen Früchte des Erdbeerbaumes waren noch klein. Ihre gelbrote Farbe erhielten sie erst mit zunehmender Reife. Oda ließ die Blätter durch die Finger gleiten und trat an die Mauer. Von unten klangen Gesprächsfetzen herauf. Die Gartenmauer grenzte nicht direkt an die alte Stadtmauer, sondern an einen parallel verlaufenden, schmalen Fußweg. Gelegentlich fuhren Motorroller dort unten vorbei, aber meist nutzten Spaziergänger den mittelalterlichen Wehrgang.
Hinter den Hügeln glomm ein schmaler Streifen orangefarbenen Lichtes auf, bevor sich der abendliche Feuerball senkte, alle Farbe mit sich nahm und Mensch und Tier zur Ruhe mahnte. Und tatsächlich schienen alle Geräusche plötzlich gedämpfter, friedvoller.
»Hast du das auch so empfunden, Vater? Hast du dich abends mit einem Weinglas auf die Terrasse gesetzt und einen der Reiseberichte gelesen, die dir so gefielen? Oder haben dich Freunde besucht? Eine Frau?«, flüsterte sie und ging wieder ins Haus, wo sie das Licht einschaltete und in der Küche den Wasserkocher füllte.
Während Oda wartete, bis das Wasser kochte, suchte sie in den Schränken nach Tee und fand eine Kräutermischung. Mit dem Becher in der Hand begab sie sich in den ersten Stock, wo sich das Elternschlafzimmer befunden hatte. Zögernd legte sie die Hand auf die Türklinke, brachte es jedoch nicht fertig, hineinzusehen und öffnete die nächste Tür. In dem ehemaligen Gästezimmer hatte ihr Vater sein Büro eingerichtet. Heute nicht, heute fehlte ihr die Kraft. Sacht schloss Oda die Tür und stieg die Holztreppe hinauf in den zweiten Stock. Die Stufen knarrten und auf dem Geländer lag eine dicke Staubschicht. Sie verlangsamte ihren Schritt. Dort oben hatte sich ihr Zimmer befunden. Anscheinend war lange niemand hinaufgestiegen. Morgen ist auch noch ein Tag, dachte sie und kehrte wieder um.
Im Erdgeschoß stellte Oda den Becher auf den Tresen. Sie fühlte sich nicht nur von der Reise und den Anspannungen der letzten Tage wie erschlagen. Es war das Haus mit seinen Erinnerungen, die sie plötzlich überrollten, sich auf ihren Brustkorb legten und ihr die Luft nahmen. Sie war lange genug erfolglos vor den Schatten der Vergangenheit davongelaufen. Irgendwann musste damit Schluss sein.
Kapitel 2
Das Schrillen des Telefons riss Oda aus einem unruhigen Schlaf. Sie brauchte einige Sekunden, um festzustellen, wo sie war. Der raue Sofastoff kratzte an ihrer Wange. Kein Traum, dachte sie, als sie die Aquarelle ihrer Mutter sah. Schließlich fand sie das Telefon auf einem Schränkchen neben dem Bücherregal.
»Ja?«, murmelte sie verschlafen.
»Signora Bergemann, buon giorno! Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, nun, so gut wie es eben möglich ist, unter den Umständen. Der Schlüssel lag an seinem Platz, ja? Sehr schön. Ich werde morgen früh pünktlich zur Beerdigung zurück sein. Danach habe ich Zeit und wir können alles besprechen. Wäre das in Ihrem Sinne?«
Wie konnte man so früh am Morgen nur schon so viele Worte so schnell aneinanderreihen. »Ja, Signore Matani. Danke.«
»Gut so, gut so. Ich hoffe, Sie finden sich zurecht. Gehen Sie in den Ort und trinken Sie einen Kaffee bei Gianni. Das wird Ihnen gut tun. Aber was rede ich, Sie werden schon wissen, was Ihnen in so einer Situation … ach wirklich, so ein Jammer … ein Jammer ist das. Mitten aus dem Leben gerissen, der arme Walter.«
Im Hintergrund wurde nach Signore Matani gerufen.
»Entschuldigen Sie mich vielmals, Signora. Bis morgen. Ich hole Sie um halb zehn ab.«
Es klickte in der Leitung und das Gespräch war beendet. Morgen früh. Die Zeit bis dahin wollte Oda nutzen, um sich einen Überblick über den Nachlass zu verschaffen. Damit verbunden waren die Erinnerungen an jene unsäglichen Jahre, die sie nach dem Tod ihrer Mutter in der Bergemannschen Villa verbracht hatte. Am Tag ihrer Volljährigkeit hatte sie allem den Rücken gekehrt und war eingetaucht in eine Welt, von der sie dachte, dass sie ihr mehr zu bieten hätte als die klaustrophobische Atmosphäre des Bergemannschen Familiensitzes. Düster und überheblich thronte die Villa auf einem Hügel am Hamburger Elbufer. Seit Jahrhunderten wälzten sich die grauen Fluten des mächtigen Stromes durch sein Bett und nährten den Reichtum der Kaufmannsstadt. Und sie hockte in ihrer Villa wie der Adler in seinem Horst. Dorle Bergemann, Odas Großmutter. Kaum tauchte ihr strenges, unerbittliches Antlitz vor Odas innerem Auge auf, fröstelte sie.
»Ich brauche einen Kaffee!«, sagte sie laut und führte mit geballten Fäusten einige Scheinschläge aus. Eine Frau, die mittellos und allein durch Asien und den indischen Subkontinent gereist war, sollte sich zu verteidigen wissen. Das Leben war der beste Lehrmeister und der Grausamste.
Anfangs hatte Oda ihrer Großmutter die Schuld für alles gegeben, was in ihrem Leben schief gelaufen war. Ihr Vater hatte gesagt, dass es das Beste für sie sei, wenn sie mit ihm nach Hamburg käme. Im Nachhinein konnte sie seine Verzweiflung sogar verstehen. Der Tod seiner Frau hatte Walter Bergemann vor einen Berg von Problemen gestellt. Eines davon war seine Tochter gewesen. Wie soll man ein traditionsreiches Familienunternehmen leiten, durch die Welt reisen und Stoffe einkaufen und sich gleichzeitig um ein kleines Mädchen kümmern?
Ziellos lief Oda durch den Raum und ließ ihren Gedanken freien Lauf. Zugegeben, sie hatte es ihrem Vater nicht leicht gemacht, hatte sich in ein Schneckenhaus aus Ablehnung, Angst und Trauer verkrochen. Doch sie war fünf Jahre alt gewesen. Ihr Vater hätte sie verstehen müssen! Stattdessen hatte er sie bei seiner Mutter abgeladen. Das sei besser als ein Internat und überhaupt wüchsen viele Kinder bei ihren Großmüttern auf und seien glücklich, hatte er Oda erzählt. Den Tag ihrer Ankunft damals in Hamburg würde sie nie vergessen, denn er war bezeichnend für alles, was danach kam.
Sie waren die ganze Nacht hindurch gefahren. Da die Plätze in den Liegewagen alle ausgebucht waren, teilten Oda und ihr Vater sich ein Viererabteil mit einem älteren Ehepaar. Der Schock der Beerdigung saß tief. Ihre Mutter war auf dem Friedhof mit der kleinen Kapelle vor der Stadtmauer von Casole beigesetzt worden. Während der stundenlangen Fahrt saß Oda aufrecht wie ein kleiner Zinnsoldat neben ihrem Vater. Das monotone Rattern der Räder auf den Gleisen versetzte sie in eine Art Halbschlaf, aus dem sie erschöpft und mit bleiernen Gliedern am nächsten Morgen in Hamburg erwachte. Ihr Vater sah nicht besser aus. Tiefe dunkle Schatten lagen um seine verweinten Augen und seine Lippen waren zu einem schmalen Strich gepresst.
»Hast du das Bild eingepackt, Vater?« Oda legte ihre Hand in seine und sie stiegen hinunter auf den regennassen Bahnsteig.
»Welches Bild?«, fragte er abwesend. »Sei jetzt nicht schwierig, Oda. Es ist furchtbar genug. Für uns alle.«
Sie schwieg und betete, dass er das Bild mit der Waldfee, das sie so sorgfältig eingewickelt hatte, damit es auf der Reise keinen Schaden nahm, zu den Büchern in ihren Koffer gelegt hatte. Sie hatten Casole verlassen als die Felder noch goldfarben in der warmen Herbstsonne gelegen hatten und auf der Piazza vor der Kirche zu Ehren der Ernte gefeiert wurde. Auf dem Hamburger Bahnhof schlug Oda eine feuchte Kälte entgegen und sie versuchte, das Klappern ihrer Zähne zu unterdrücken. Schweigend saßen Vater und Tochter auf der Taxifahrt nach Blankenese nebeneinander. Zwar blätterte Walter Bergemann in einem Aktenordner, doch sah Oda ihn hin und wieder verschämt seine Augenwinkel wischen.
Vor einem hohen schmiedeeisernen Tor hielt das Taxi. Der Fahrer musste aussteigen und das Tor selbst öffnen, nachdem er in die Sprechanlage gesprochen hatte. »Wer so viel Geld hat, sollte sich auch ein automatisches Tor leisten können«, murmelte der Fahrer in seinen Bart.
Auf der gesamten Fahrt hatte es nicht aufgehört zu regnen. Ein leichter Nieselregen nur, doch er wirkte wie ein dünner Vorhang, durch den man gerade eben hindurchsehen, aber nur die Umrisse der Welt um einen herum erkennen konnte. Als sie jetzt vor dem Treppenaufgang zum Haupteingang der Villa Bergemann standen, starrte Oda ängstlich auf die hohen dunklen Fenster, die wie riesige Drachenmäuler wirkten. Steinerne Löwen bewachten den Aufgang und Oda griff unwillkürlich nach der Hand ihres Vaters.
»Hier bin ich aufgewachsen, Oda. Das ist mein zu Hause.« Walter Bergemann zögerte ein wenig, so als fände er nicht die passenden Worte. Sehr viel später verstand sie, dass er die protzige Villa genauso gefürchtet hatte wie sie selbst damals. »Hinter dem Haus ist ein großer Garten, von dem man direkt an die Elbe laufen kann. Das ist sehr schön. Sehr schön …«
Walter schien sich fast selbst davon überzeugen zu müssen, denn als sie vor der Eingangstür standen, spürte Oda, wie ihr Vater erstarrte. Seine Hand erschlaffte und ließ ihre fallen. Oda fühlte sich plötzlich sehr einsam und versteckte die Hände in ihrem blauen Wollmantel. Darunter trug sie ein rotes Kleid mit gelben Blumen. Sie liebte dieses Kleid, weil ihre Mutter es für sie genäht hatte. Und sie hatte geweint und gefleht, dieses Kleid tragen zu dürfen, dass Walter dem Wunsch seiner Tochter nachgegeben hatte. Odas dunkelbraune Haare wurden an einer Seite von einer Spange gehalten. Weil ihre Locken schwer zu zähmen waren, fielen sie ihr immer wieder ins Gesicht und erinnerten sie daran, dass ihre Mutter sie ihr niemals wieder hinter das Ohr streichen würde.
Im Hausinnern waren Schritte zu hören und dann schwang einer der Türflügel auf. Eine Frau undefinierbaren Alters stand in einem grauen Kittelkleid mit ausdruckslosem Gesicht vor den Besuchern. »Die gnädige Frau erwartet sie bereits.«
Aus der Eingangshalle führte eine geschwungene Treppe ins erste Stockwerk. Sie war aus Mahagoni, genau wie die Vertäfelungen an den Wänden und die Türen. Licht fiel durch hohe Fensterschlitze, die mit Buntglas versehen waren. Unzählige Fragen brannten auf Odas Lippen, doch sie wollte nicht schwierig sein und folgte schweigend ihrem Vater.
Der Raum, in dem Dorle Bergemann sie empfing, war in diffuses Licht getaucht. Die Sicht war in etwa so schlecht wie draußen im Nieselregen. Doch in diesem Fall war es blauer Dunst, der in kunstvollen Kringeln zur Decke aufstieg oder sich in dichten Schwaden auf Oda und ihren Vater zu bewegte. Oda begann sofort zu husten, denn an Zigarettenrauch war sie nicht gewöhnt. Je mehr sie hustete, desto stärker wurde der Reiz und schließlich wurde ihr so übel, dass sie würgen und sich die Hand vor den Mund pressen musste.
»Das fängt ja gut an. Um Himmels Willen, Hilla, bringen Sie das Kind hinaus, bevor es sich hier übergibt«, befahl eine heisere Stimme.
Hilla ergriff unsanft Odas Arm und zerrte sie über den Flur in ein Badezimmer. Nachdem sie ihren Magen entleert und sich gewaschen hatte, brachte Hilla sie zurück in das verqualmte Zimmer.
»Komm her, Oda.« Ihr Vater winkte sie zu sich. Er saß in einem knarrenden Ledersessel. Sein Gesicht war kreidebleich und er strich sich nervös die Haare aus der Stirn. »Armes Mädchen. Geht es wieder?«
»Ja, es geht schon. Das war der stinkende Rauch, der …« Als sie das Entsetzen in den Augen ihres Vaters sah, war es bereits zu spät.
»Gestank? Hat man dir keine Manieren beigebracht? Aber nein, woher denn!« Ihnen gegenüber stand ein Ohrensessel, aus dem sich eine schmale Gestalt vorbeugte und Oda mit blauen Augen abschätzig musterte. Gegen die Kälte dieser blauen Augen war ein Gletschersee eine Thermalquelle.
Dorle Bergemann stand auf, in der einen Hand hielt sie ein glühendes Zigarillo. Sie war klein und sehnig und trug ein helles Twinset zu beigen Hosen. Ihr kurzes Haar schimmerte silbrig und violett. Später erfuhr Oda, dass ihre Großmutter eine Tönung benutzte, die diesen Effekt hervorrief. Aber jetzt starrte sie die unnatürliche Erscheinung ihrer Großmutter einfach nur an.
»Hab doch ein wenig Verständnis. Sie hat gerade erst ihre Mutter verloren«, versuchte Walter Bergemann die Situation zu entschärfen.
Dorle Bergemann hob eine Braue und streckte eine beringte Hand nach ihrer Enkelin aus. Mit spitzen Fingern hob sie eine Haarsträhne an. »Sie sieht aus wie eins von diesen Straßenkindern. Und dieses bunte Kleid. Das ist pietätlos. Hilla wird ihr etwas in gedeckten Farben machen lassen.«
Oda strich über das geliebte Blumenkleid. »Das hat meine Mutter mir genäht. Das ziehe ich nicht aus!«, sagte sie trotzig.
»Ach ja …« Es lag soviel Verachtung in diesen zwei Silben, dass es Oda das Herz zerriss, obwohl sie die Ablehnung nicht verstehen konnte. Ihr Vater war sichtlich um seine Beherrschung bemüht und knetete seine Hände.
Wütend starrte Oda ihre Großmutter an, weinte aber nicht, obwohl ihre Lippen bereits zitterten. In diesem Moment wusste Oda, dass sie den Fehdehandschuh aufgehoben hatte, den Dorle Bergemann ihr ins Gesicht geschlagen hatte. Doch damals waren sie ungleiche Gegner und Odas Ausgangsbasis war denkbar schlecht.
»Dann wollen wir alles tun, damit du dich schnell einlebst, Oda.«
Dorle Bergemann verlor nie ein Wort über Odas Mutter und fragte nie nach dem Ort, an dem sie aufwachsen war. Sobald ein Gespräch die Toskana berührte, wechselte Dorle das Thema.
Oda war noch heute davon überzeugt, dass es vollkommen irrational war, einen Landstrich abzulehnen, den man nie gesehen hatte. Doch was wusste sie schon über ihre Familie? Ihr Vater hat ihr stets versichert, dass seine Ehe nicht der Grund für Dorles Ablehnung der Toskana war. Immerhin bezog er Stoffe aus Mailand und Florenz für das Hamburger Kontor. Weitere Erklärungen gab er nicht. Oda lernte, das sensible Thema auszuklammern und hakte es als Dorles Geheimnis ab. Denn dass ihre Großmutter ein Geheimnis hütete, war ihr von Anfang an klar.
Kapitel 3
Als Oda am späten Vormittag auf die Straße trat, schaute sie zu dem Balkon hoch, von dem aus sie gestern so misstrauisch beobachtet wurde, doch außer einer Wäschespinne war niemand zu sehen. Auf ihrem Weg zur Piazza, dem Zentrum von Casole d’Elsa, begegneten ihr Mütter, die ihre Kinder zur Schule brachten, ältere Frauen mit Einkaufskörben und sie wurde von zwei knatternden Motorrollern überholt. Vor Giannis Bar standen Stühle und Tische, die von einem jungen Mann abgewischt wurden.
Oda grüßte und ging in die geräumige Bar, an deren Wänden ihr Gemälde der Region ins Auge fielen. Vor einer Nebellandschaft mit irritierenden Durchbrüchen in knalligen Rottönen blieb sie stehen.
»Gefällt es Ihnen?« Ein junger Mann mit raspelkurzen Haaren und einem sympathischen Lächeln, stellte sich neben sie. »Es ist zu verkaufen.«
Jetzt entdeckte sie das winzige Preisschild am unteren Bildrand. »Das Bild gefällt mir ausgesprochen gut, der Preis weniger.«
Er lachte und streckte ihr eine Hand entgegen, die sie schüttelte. »Gianni. Das ist meine Bar und die Künstlerin, die fast alle Bilder hier gemalt hat, ist meine Freundin, Piera. Also, wenn Sie ernsthaft interessiert sind, können wir über den Preis verhandeln.«
»Ich heiße Oda Bergemann. Das ist sehr freundlich, aber …« Oda machte eine ausgreifende Handbewegung. »Ein Cappuccino und eins von diesen Hörnchen dort, das wäre ein guter Anfang.«
Gianni runzelte die Brauen. »Bergemann. Ah, Walter! Er kam jeden Morgen zum Kaffeetrinken her. Das tut mir sehr leid. So ein schrecklicher Unfall. Sie sind, du bist seine Tochter?«
Oda seufzte. »Ja, und ich habe meinen Vater viel zu lange nicht gesehen, nicht …«
»Nein, nein, so etwas passiert. Wir leben und vergessen, dass es jede Sekunde zu Ende sein kann. So ist das! Setz dich nach draußen. Ich bringe dir dein Frühstück.« Gianni hantierte geschickt hinter dem Tresen und nach wenigen Augenblicken zog der Duft von frisch gemahlenen Bohnen hinaus auf die Terrasse.
Als er mit einem Tablett an den Tisch kam, standen zwei Tassen und ein Teller mit verschiedenen Kuchen darauf. »Du erlaubst?«
»Gern.«
An einem der Nebentische saß ein älterer Herr und las die Morgenzeitung. »Das ist Walters Tochter, Federico«, sagte Gianni, bevor er sich setzte.
Der Angesprochene faltete kurz die Zeitung zusammen und nickte ihr zu. »Mein Beileid, Signorina. Ich kannte Ihren Vater und schätzte ihn sehr.«
»Danke.« Es tat gut, zu hören, dass ihr Vater nicht einsam gewesen war.
»Du hast dich an genau den Tisch gesetzt, den Walter immer gewählt hat.« Gianni nahm sich ein Croissant und schob Oda den Teller zu. »Dein Italienisch ist besser als seins.«
»Meine Mutter war Italienerin. Sie ist gestorben als ich fünf war, aber ich war immer in den Ferien hier und ihre Sprache war für mich eine Verbindung zu ihr …« Oda löffelte den Cappuccinoschaum und griff nach einem Butterhörnchen.
Gianni schwieg eine Weile, um dann in leichtem Ton zu sagen: »Ich habe die Bar vor sechs Jahren übernommen. Eigentlich komme ich aus Arezzo.«
Eine Gruppe Radfahrer näherte sich und Gianni grinste. »Das Geschäft ruft. Wie lange bleibst du?«
»Ich weiß noch nicht. Kommt darauf an …«
»Schau auf jeden Fall noch mal rein, bevor du fährst. Vielleicht ist Piera dann da und macht dir einen Sonderpreis.«
Die Radfahrer stellten ihre Räder ab und überfielen die Bar. Oda beobachtete die Piazza, sah einen kleinen grauhaarigen Mann mit Spitzbart und wehendem bunten Mantel vorbeischlendern und nahm an, dass es sich um den englischen Bildhauer handelte, der hinter der Kirche eine Kunstakademie leitete. Ihre Mutter hatte sie manchmal dorthin mitgenommen. Irgendwann würde sie die Akademie besuchen.
Irgendwann. Oda seufzte. Sie hatte sich keine Gedanken über die Länge ihres Aufenthaltes hier gemacht, sondern war nach Erhalt der schrecklichen Nachricht einfach losgefahren. Ihre Arbeit erlaubte ihr gewisse Freiheiten. In die Schmuckherstellung war sie auf abenteuerlichen Umwegen eingestiegen. Eine Ausbildung im klassischen Sinne konnte sie nicht vorweisen, aber sie hatte das Goldschmiedehandwerk bei einem Meister seines Faches erlernt. Max Friedrich war ein reizender älterer Herr, der in zweiter Generation einen kleinen Juwelierladen im Hamburger Grindelviertel betrieb. Friedrichs Vater hatte das kleine Geschäft in den zwanziger Jahren aufgebaut. Max betrieb den Laden nur noch aus Liebhaberei, wie er gern betonte, doch sie hatte erfahren, dass er kaum Rentenansprüche hatte und auf die Einkünfte angewiesen war. Als sie damals verzweifelt und am Boden eines tiefen schwarzen Lochs angekommen war, hatte Max ihr eine Chance gegeben, und das würde sie ihm nie vergessen.
Sie griff nach ihrem Handy. Als Frühaufsteher war er bereits im Laden. »Hallo Max, ich bin es, Oda.«
»Guten Morgen, meine Liebe. Wie geht es Ihnen? Ich habe auch an Sie gedacht. Ist das nicht ein Zufall? Wann ist die Beerdigung?«
»Morgen Vormittag.« Oda schluckte. »Der Anwalt will mich abholen.«
»Es handelt sich um eine Einäscherung, nicht wahr?«
»Ja. Ganz diskret. Mein Vater hat anscheinend genaue Anweisungen hinterlassen. Es ist so unwirklich, Max. Wissen Sie, ich war so lange nicht hier und jetzt stürzen all die Erinnerungen an meine Mutter auf mich ein und, ach …« Oda kämpfte mit den Tränen. Es tat gut, die vertraute Stimme eines Menschen zu hören, von dem sie wusste, dass er sie verstand und mit ihr fühlte.
»Ich wäre gern mit Ihnen gekommen, Oda. Aber Sie sind eine starke junge Frau. Sie haben viel erreicht in Ihrem Leben. Ich bin stolz auf Sie und Ihr Vater wäre es auch gewesen.« Er räusperte sich und Oda stellte sich den gedrungenen weißhaarigen Herrn mit den gütigen Augen hinter seiner runden Brille vor. Er war stets korrekt gekleidet. Sie hatte ihn nie anders als im grauen Flanell und mit Fliege gesehen. »Versprechen Sie mir nur, dass Sie sich keine Vorwürfe machen. Niemand kann wissen, was morgen ist. Wir sind nicht vollkommen.«
»Nein, nein, Sie haben Recht. Ich denke nur immer, wenn ich ihn doch nur früher angerufen hätte!«
»Wenn ist ein teuflisches Wort. Wir leben jetzt, egal, ob wir an gestern oder morgen denken. Und gerade jetzt betritt eine viel versprechende Kundin meinen Laden.« Im Hintergrund ertönte das melodische Klingeln der Türglocke. »Rufen Sie mich jederzeit an, Oda. Und lassen Sie sich Zeit. Ich komme hier gut zurecht.«
»Ich danke Ihnen, Max, das ist sehr lieb. Aber ich werde trotzdem bald zurück sein.« Die Steuererklärung für den Juwelier hatte sie vorbereitet. Es fehlten nur die Rechnungen für den Einkauf der letzten Steine. »Die Belege für die …«
»Suche ich nachher heraus. Ich habe alles im Griff. Nehmen Sie sich Zeit, Oda. Das tut Ihnen gut. Bis bald.«
»Bis bald.« Sie klappte das Handy zusammen. Beim Verlassen der Bar nickte sie Federico zu, der jedoch in seine Zeitung vertieft war und sie kaum wahrnahm. Als Oda in die Via San Donato einbog, sah sie Paolo schon von weitem auf dem Balkon stehen. Seine Silhouette war unverkennbar. Er trug dasselbe ärmellose Hemd und zog an einer Zigarette.
Die Straße war eng und einen Gehweg gab es nur auf einer Seite. Es hätte keinen Sinn gemacht, ihn zu ignorieren und so nahm Oda demonstrativ ihren Schlüssel aus der Tasche und schwenkte ihn in der Luft. Doch der nachbarschaftliche Informationsfluss funktionierte anscheinend tadellos. Paolo beugte sich über das Balkongitter. »Ciao, Signorina Bergemann. Tut uns sehr leid. Hätten Sie ja sagen können, dass das dort drüben Ihr Vater war.«
»Sind Sie bei der Polizei, oder was?«, erwiderte sie abweisend.
»Behalten Sie das Haus? Ich kenne jemanden, der es kaufen würde.«
Der Kerl war wirklich unverfroren. »Kümmern Sie sich um Ihren Kram!« Sie drehte ihm den Rücken zu und knallte die Haustür hinter sich zu.
Sie warf Schlüssel und Handtasche auf den Küchentisch und ging nach oben, um dort zu beginnen, wo sie gestern noch gezögert hatte. Was würde sie hinter den Türen erwarten? Was würde sie über ihren Vater erfahren? Würde sie überhaupt etwas finden, das erklärte, warum ihr Vater sie bei seiner herzlosen Mutter abgeladen hatte?
Kapitel 4
Auf dem Gang vor ihrem ehemaligen Kinderzimmer stand eine Bodenvase mit trockenen Gräsern, auf denen eine dicke Staubschicht lag. Vorsichtig schob Oda die Tür auf und blinzelte in den Strahl der morgendlichen Sonne, der direkt auf das Bett unter dem Fenster fiel. Sie erkannte die gestreifte Bettwäsche wieder. Bis zu ihrer Volljährigkeit hatte sie die Ferien bei ihrem Vater verbracht. Ihr kleiner Schreibtisch sah aus als wäre sie gestern und nicht vor zehn Jahren das letzte Mal hier gewesen. Und sie hatte gedacht, dass sie ihm egal gewesen war. Oda ertrug den Raum, der eine einzige Anklage darstellte, nicht länger und flüchtete nach unten. Das Arbeitszimmer ihres Vaters lag zum Garten hinaus. Die Sprossentüren öffneten sich auf einen Balkon, der sich über die gesamte Hausfront erstreckte.
Oda öffnete die Türen und ließ den Duft des Gartens hineinwehen. Oleander, Lavendel und das Summen der Insekten. Sie trat an den antiken Schreibtisch, den ihr Vater in Verona erworben hatte. Der Stuhl mit den Schnitzereien an Lehnen und Füßen war mit verblasstem blauem Seidendamast bezogen. Man hätte meinen können, dass jemand, der mit Stoffen handelte, sein Haus mit edlen Tüchern ausstaffieren würde. Doch darauf hatte Walter Bergemann keinen Wert gelegt. Je länger Oda sich umsah, umso klarer wurde ihr, dass ihr Vater mit dem Tod seiner Frau aufgehört hatte, am Leben teilzunehmen. Er hatte existiert, seine Arbeit gemacht und seine Pflichten erfüllt. Und dabei hatte er vergessen, dass seine Tochter ihn gebraucht hätte.
»Stattdessen hast du mich bei ihr abgeladen ….«, murmelte sie.
Nacheinander zog Oda die kleinen Schubfächer des Schreibtisches auf. Sie fand einen weißen Kiesel, nahm den pflaumengroßen Stein heraus und wog ihn in der Hand. Er hatte ihn nicht weggeworfen! Oda wusste noch genau, wo sie den Stein gefunden hatte – am Strand von Cecina del Mare. Als sie das erste Mal von Hamburg wieder nach Hause durfte, war ihr Vater mit ihr nach Cecina ans Meer gefahren. Der Strand dort war mit Kieselsteinen übersät und diesen einen hatte sie ihrem Vater geschenkt. Sorgfältig legte Oda den Stein in die Schublade zurück und hielt sich an der Sessellehne fest. Dabei fiel ihr Blick auf eine Kiste, die unter dem Schreibtisch hervorlugte.
Neugierig zog sie die flache Blechkiste hervor, in der sich einmal Stoffmuster befunden hatten, wie die Aufkleber verrieten. Doch als Oda den Deckel öffnete, fand sie keine Muster, sondern Fotografien, Aquarelle und Zeichnungen ihrer Mutter. Diese Sachen hatte sie noch nie gesehen und stellte ihren Fund auf den Schreibtisch. Neben unzähligen Familienfotos fand Oda zwei vergilbte Schwarzweißfotografien. Die eine kam ihr bekannt vor und sie hielt das Bild ins Licht. Der gezackte Schmuckrand zeigte das Alter der Fotografie an. Ein junger Mann in Uniform lächelte verhalten in die Kamera, obwohl er Grund zu mehr Freude gehabt hätte. Flankiert wurde er von zwei hübschen jungen Frauen.
Die Frau mit den dunklen Haaren und dem Pagenschnitt war niemand anderes als Odas Großmutter. Der junge Offizier hieß Victor Bergemann und war ihr Großvater, und die zarte Blondine zu seiner Rechten war Thesi, die beste Freundin ihrer Großmutter. Dieses Foto stand auch in Dorle Bergemanns Salon. Oda hatte es viele Male angesehen und nach Ähnlichkeiten zwischen ihrem Vater und Victor gesucht. Irgendeine Gemeinsamkeit musste es geben. Und sie bildete sich ein, dass es die Augen waren, der traurige, nach innen gerichtete Blick.
Das andere Bild jedoch fand Oda weitaus interessanter, denn es zeigte den jungen Victor herzlich lachend und in mitten einer Schar Italiener!
Bei genauerem Hinsehen war im Hintergrund ein toskanisch anmutendes Gutshaus im Schatten von Zypressen und Pinien zu erkennen. Auf dem staubigen Hof tummelten sich Hühner und in einem Verschlag hockten Fasane. Victor trug eine Wehrmachtsuniform und hatte einen Arm um ein Mädchen gelegt, den anderen um die Schultern eines Italieners. Das Bild war verblichen, doch Oda konnte deutlich die Patronengurte der jungen Italiener und ein Gewehr erkennen. Waren das Partisanen? Das wäre bemerkenswert! Ein deutscher Wehrmachtssoldat im Kreis einer Partisanentruppe? Sprach Dorle deshalb nicht über ihren Mann? War Victor übergelaufen? Nachdenklich rieb Oda sich die Stirn. Damals mochte so ein Überlaufen als Verrat gewertet worden sein, doch nach dem Krieg hätte Dorle stolz auf ihren Mann sein können.
Oda wendete die Fotografie. Auf der Rückseite war flüchtig etwas mit Bleistift notiert worden: Toskana, Casa Gambetti, Sommer 1944. Weder ihr Vater, der dieses Foto immerhin aufbewahrt hatte, noch ihre Großmutter hatten je ein Sterbenswort über Victors Aufenthalt in der Toskana verloren. Alles, was Oda über ihren Großvater wusste, war, dass er im vorletzten Kriegsjahr verschollen war.
Odas Mobiltelefon meldete sich mit einem summenden Vibrieren.
»Ja, bitte?«
»Oda, es tut mir so schrecklich leid! Warum hast du denn nichts gesagt? Ich wäre doch mitgekommen und hätte dir beigestanden …«
Das hatte ihr noch gefehlt! Ihr Exfreund, der kurz vor der Hochzeit kalte Füße bekommen hatte. Eike gehörte zu jenen Menschen, die sie für sehr lange Zeit nicht wieder zu sehen wünschte. »Was willst du?«
»Sei doch nicht so abweisend. Herrgott, es tut mir leid! Alles tut mir leid!«
»Woher weißt du überhaupt, dass mein Vater gestorben ist?« Die Beziehung hatte drei Jahre gedauert. Eike hatte sich oft beklagt, dass er sie nicht erreichen konnte und sie konnte ihm nicht widersprechen. Über die Jahre hatte Oda sich einen Panzer zugelegt, an dem abprallte, was sie nicht hören wollte, weil es sie verletzen könnte. Dieser Schutzpanzer war nichts anderes als ein ausgeklügeltes Filtersystem. Alles und jeder, der Oda nahe kam, wurde automatisch auf ein mögliches Angriff- und Verletzungspotential geprüft und eliminiert. Sie würde das nicht neurotisch nennen, obwohl das nach Jahren des Zusammenlebens mit Dorle Bergemann verständlich wäre. Aber Oda hatte eine Überlebensstrategie für sich gefunden, die ihr zwar nicht immer gut getan hatte … Aber sie hatte überlebt! Narben auf der Seele hatte doch jeder Mensch. Es kam auf die Tiefe der Schnitte an.
Eike hatte etwas gesagt, das Oda überhört hatte. »Was?«
»Du hörst wieder nicht zu! Oda, verdammt, ich habe gerade erklärt, dass mir noch immer viel an dir liegt. Ich war bei Friedrich. Er hat mir gesagt, was passiert ist. Es tut mir leid! Alles tut mir leid!«
»Das ist typisch für dich! Du machst dich kurz vor der Hochzeit aus dem Staub. Das war doch deine Idee! Soll ich dir noch mal sagen, wie nett es war, die Geschenke zurückzuschicken, die Reservierungen abzusagen …!«
»Dafür habe ich mich entschuldigt. Kannst du nicht über deinen Schatten springen und mir verzeihen?«
»Oh, ich habe dir verziehen, Eike. Meinen Segen für ein glückliches Leben hast du.«
»Aber ich komme darin nicht mehr vor.«
»Nein.«
»Mehr hast du nicht dazu zu sagen?«
»Nein.« Aufsteigende Tränen schnürten ihr die Kehle zu und sie wollte schreien, dass er sich zum Teufel scheren sollte. Aber Oda beherrschte sich. Selbstbeherrschung gehörte zu ihren Stärken. Vielleicht war es ihre einzige Stärke, doch sie würde sich nicht von der falschen Reue eines selbstverliebten Mannes täuschen lassen. Eine Bekannte hatte ihn mit einer Frau gesehen. Die Situation war eindeutig gewesen. Anscheinend hatte es nicht funktioniert und jetzt klopfte er bei seiner Verflossenen an. Aber er hatte die falsche Tür gewählt.
Sie konnte förmlich zusehen, wie er die Stirn runzelte, sich die Brauen rieb und dabei den Sitz seiner Frisur kontrollierte. Mit den flachsblonden Haaren und den blauen Augen wurde er für einen Skandinavier gehalten. Es war leicht, sich in den lebenslustigen Sporttherapeuten zu verlieben. Seine fröhliche und unkomplizierte Art hatte Odas Leben eine Leichtigkeit verliehen, die sie vermisst hatte. Zumindest hatte sie das gedacht. Bei zuviel Leichtigkeit verliert man allerdings die Bodenhaftung.
Seine Stimme nahm einen sanften mitfühlenden Ton an. »Ist gut, Oda. Ich will dich nicht bedrängen, dich nur wissen lassen, dass ich immer ein offenes Ohr für dich habe. Weißt du schon, was du mit dem Haus machen willst?«
»Nein. Ciao.« Sie legte auf.
Als es kurz darauf erneut klingelte, wies sie den Anruf ab und stellte das Telefon aus. Nervös trommelte Oda mit den Fingern auf der Schreibtischplatte und betrachtete die Fotografien. Irgendein intelligenter Mensch hatte einmal gesagt, dass die Schlüssel zur Gegenwart in der Vergangenheit liegen. Der Tod ihres Vaters hatte sie wachgerüttelt, herausgeschleudert aus ihrem Kokon, in den sie sich vergraben hatte. Das Aufschlagen war schmerzhaft, die Erkenntnis, dass sie nichts über den eigenen Vater, seine Gefühle, Sehnsüchte und Hoffnungen gewusst hatte, unerträglich.
Oda nahm Victors Foto, presste es gegen ihre Brust und sank weinend gegen die Sessellehne. Warum hatte sie nie versucht, ihren Vater besser zu verstehen? Immer war sie das trotzige Kind geblieben, dabei hatte sie eine Mutter gehabt, die sie geliebt hatte. Das Bewusstsein um die bedingungslose mütterliche Liebe war Odas Schatz, der Funken, der ihr Herz wärmte, wenn es zu zerbrechen drohte. Ihr Vater hatte nicht einmal das gehabt. Über Dorle hat er zwar immer mit Respekt, aber nie ohne Verbitterung gesprochen. Seine Kindheit beschrieb er einmal als ein Dasein im Karzer. Als Junge musste er sich nach einer liebevollen Vaterfigur gesehnt haben. Vielleicht hatte ihr Vater dieses Foto von Victor schon als Kind bei sich gehabt und sich vorgestellt, dass Victor ihn vor Dorles Strenge in Schutz genommen hätte.
Die einzige Person, die Oda Auskunft geben könnte, würde sie ihr verweigern. Dorle würde es genießen, sie im Ungewissen zu lassen. Selbst wenn sie gar nichts wusste, würde Dorle an ihrem stinkenden Zigarillo ziehen, blaue Kringel in die Luft blasen und sie zappeln lassen wie einen Fisch auf dem Trockenen. Entschlossen suchte Oda nach einem Umschlag und legte die beiden Schwarzweißfotografien hinein. Sie verschloss die Kiste mit den Fotografien und stellte sie auf einen kleinen Tisch neben dem Fenster. Für heute hatte sie genug gesehen.
Durch das Fenster strömte der Geruch des beginnenden Sommers herein. Die Sonne stand hoch am wolkenlosen blauen Himmel und Oda schloss für einen Moment die Augen und stellte sich vor, sie wäre noch einmal fünf Jahre alt. Die kostbare Illusion vollkommenen Glücks dauerte nur wenige Sekunden und Oda verließ fluchtartig das Zimmer. Unten griff sie nach ihrer Handtasche und den Autoschlüsseln, ließ die Haustür ins Schloss fallen und setzte sich in ihr Auto.
Ziellos folgte sie stundenlang den kurvigen Straßen durch die toskanischen Hügel. Sie fuhr an Pinien und steinalten Olivenbäumen vorbei, kam durch Dörfer mit halbverfallenen Steinhäusern und sah Industriegebiete mit hässlichen Lagerhallen und Berge rostigen Stahlmülls, die vom modernen toskanischen Leben zeugten. Eine sentimentale Erleichterung überkam Oda als sie zwischen Zypressen einen Madonnenschrein entdeckte. Vor dem Schrein befand sich eine Parkbucht, in der sie parkte und ausstieg, um sich die Beine zu vertreten. Die Zypressen warfen bereits lange Schatten. Unterwegs hatte sie Schilder nach Montalcino und Siena gesehen, sich jedoch immer für die kleinen Nebenstraßen und Schotterwege entschieden. Oda hatte sich von ihrem Instinkt, den vertrauten Bildern der Erinnerung leiten lassen und stand nun am Fuße eines unbebauten Feldes. Dahinter jedoch erhob sich ein bewaldeter Hügel. Aus Pinien und Eichen ragte ein runder Kuppelbau mit einem zierlichen offenen Glockenturm hervor. Ein Sandweg schimmerte hell zwischen den Bäumen.
Kurz entschlossen schritt sie über das von Gräsern und Wildkräutern bewachsene Feld auf den Sandweg zu. Dieser führte nach einer Biegung an einem Weinberg vorbei, und danach durch den Wald zur Kapelle hinauf. Plötzliches lautes Summen ließ Oda vor einer Reihe von Bienenstöcken stehenbleiben. Ein verwittertes Holzschild neben den Kästen erklärte, dass die Mönche der Abbazia di San Galgano sich um die Bienenvölker kümmerten und den Honig in ihrem Laden verkauften. Oda hob den Blick zum Hügel, auf dem zwischen den Bäumen der rot weiß gebänderte Rundbau, das Oratorium der Abtei, zu sehen war. Wie friedvoll es hier war! Über eine steile Steintreppe gelangte sie in den Kuppelraum und war überwältigt von der schlichten Schönheit des fast tausendjährigen Baus. Alles hier drinnen war rund, sanft, gedämpft. Nur hoch oben drang durch kleine Fensterschlitze das Licht, das sich hundertfach brach. Oda legte den Kopf in den Nacken und drehte sich langsam im Kreis, bis das weißrote Streifenmuster der Wände verschwamm.
»San Galgano war ein junger Ritter, kleine Oda. Siehst du, hier steckt sein Schwert noch im Boden. Der Erzengel Gabriel hat den Ritter auf den Montesiepi geführt und ihm gesagt, dass er hier eine Einsiedelei bauen soll. Schau nach oben, Oda, da tanzen die Elfen auf Sonnenstrahlen«, hörte sie ihre Mutter sagen.
Oda starrte nach oben, wo die Staubpartikel gemächlich im Licht wirbelten. Als die Stimme ihrer Mutter verklang, blieb nur eine traurige Leere in ihrem Innern. Wie seltsam, dachte Oda, mein Vater ist gestorben, doch nicht an ihn erinnere ich mich, sondern an sie, die mich vor so langer Zeit verlassen hatte. Vor dem kleinen Altar warf Oda eine Münze in die Kassette und zündete eine Kerze für ihre Eltern an. Seit langem dachte sie zum ersten Mal an beide, ohne ihrem Vater zu grollen. Auf eine verzweifelte, hoffnungsvolle Weise wünschte sie sich Versöhnung, mit ihm, mit sich selbst, mit ihrer Großmutter. Doch bis dahin war es sicherlich noch ein langer steiniger Weg. Nachdenklich und mit einem Gefühl tiefer Trauer verließ sie die Kapelle.
Kapitel 5
Am nächsten Morgen klatschten dicke Tropfen auf die Terrasse. Die mit Efeu und Weinlaub überwucherte Pergola hielt nur wenig Niederschlag ab. Müde und nervös fingerte Oda an den Knöpfen ihrer schwarzen Bluse. Sie hatte kaum geschlafen in dieser Nacht und wünschte sich, dass die Beerdigung schnell vorüber ginge. Von leeren Zeremonien hatte Oda noch nie etwas gehalten. Eine Kerze anzuzünden war eine Sache, an eine Institution zu glauben, eine andere. Die Türglocke läutete. Signore Matani war pünktlich. Oda fuhr mit ihrer Hand durch die widerspenstigen halblangen Locken und zog die Bluse gerade. Es hätte nicht geschadet, sie zu bügeln, aber nun musste es so gehen.
»Signorina, mi dispiace …« Der grauhaarige Anwalt wurde von einem Hauch teuren Rasierwassers umgeben und wirkte in seinem schwarzen Maßanzug sehr elegant. Er nahm sie in den Arm und küsste sie auf beide Wangen.
Dann betrachtete er sie und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Augen und Nase haben Sie von Ihrem Vater. Die Schönheit von Ihrer Mutter, die ich leider nur von Fotografien kenne. Signorina …«
»Oda, bitte.«
»Useppe, piacere.« Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr und nickte. »Uns bleibt noch etwas Zeit. Wollen wir uns kurz setzen?«
»Ich würde Ihnen gern einen Kaffee anbieten …«
»Ah, keine Umstände. Oda, ich möchte Ihnen gern etwas über Ihren Vater erzählen.« Er faltete die Hände und legte die Fingerspitzen an sein Kinn. Goldene Krawattenknöpfe glänzten an seinen Manschetten.
»Wir haben uns vor zehn Jahren in Mailand kennen gelernt. Er kam auf Empfehlung zu mir. Es ging um ein geschäftliches Problem, aber das ist unwichtig. Was ich sagen möchte ist, dass ich in Walter einen Freund fand.« Useppe Matani räusperte sich und richtete den Blick in eine unbestimmte Ferne. »Er war keiner dieser typischen deutschen Geschäftsleute, die überheblich und ohne Sinn für das wirklich Wichtige im Leben sind. Nein, nein, er war anders und ich verstand ihn besser als ich erfuhr, dass er mit einer Italienerin verheiratet gewesen war. Er liebte dieses Land, dieses Haus.« Hier machte Useppe eine Pause und blickte Oda mit fragenden Augen an.
»Wenn Sie darauf anspielen, ob ich das Haus verkaufen will … Ich weiß es noch nicht.« Oda machte eine vage Bewegung mit den Händen.
Matani lächelte. »Nein, darauf wollte ich nicht hinaus, obwohl Sie sich das gut überlegen sollten. Aber das wissen Sie selbst am besten. Walter war ein zwiegespaltener Mann. Verschlossen, einsam, so kam er mir immer vor. Nur einmal, nachdem wir eine halbe Flasche Grappa geleert hatten, offenbarte er mir ein Stück seines Herzens. Er hat immer von Ihnen gesprochen, Oda. Sie waren längere Zeit in Indien, nicht wahr?«
Sie schluckte. »Ja, aber …«
»Als er damals von Ihrem Unglück erfuhr, war er drauf und dran, zu Ihnen zu fliegen. Er hat mir erzählt, dass Sie ihn nicht sehen wollten und mich gefragt, was ich an seiner Stelle tun würde. Ich habe ihm geraten, trotzdem zu Ihnen zu fliegen.« Useppe machte eine kurze Pause. »Er hat Ihren Wunsch respektiert, aber es hat ihn umgetrieben, ihn gequält. So traurig habe ich ihn nie wieder erlebt.«
»Oh nein …« So viele Fehler, so viel Unausgesprochenes.
»Er hat lange mit sich gerungen, sich ein Ticket bestellt und es wieder storniert.« Useppe Matani holte tief Luft und beugte sich vor. »Ich wollte Ihnen damit nur sagen, dass er immer Anteil an Ihrem Leben genommen hat. Ich wusste, dass sie beide zerstritten waren. Den genauen Grund habe ich nicht erfahren. Es tat mir nur immer schrecklich weh, ihn so leiden zu sehen. Er konnte einfach nicht aus seiner Haut. Ich möchte ihn nicht entschuldigen. Das nicht! Aber vielleicht hilft es Ihnen zu wissen, dass Ihr Vater Sie sehr geliebt hat.«
»Das ist sehr nett von Ihnen, Useppe. Ich …« Odas Stimme wurde brüchig und sie musste aufstehen und einige Schritte machen. Als sie sich wieder gesammelt hatte, sagte sie: »Ich habe ihn auch geliebt, aber er hat mich allein gelassen als ich ihn am meisten gebraucht hätte. Als meine Mutter starb, hat er mich bei meiner Großmutter abgeladen.«
»Er hat es sicher gut gemeint«, wandte Useppe vorsichtig ein.
Oda schüttelte vehement den Kopf. »Er wusste, was für ein Mensch sie ist. Er wusste genau, wem er mich ausliefert …«
Der Anwalt stand ebenfalls auf und sagte langsam: »Es hat ihm immer leid getan, dass Sie sich nicht wohl fühlten bei seiner Mutter, aber er hielt es für das Beste. Er dachte, eine Frau könnte sich besser in ein kleines Mädchen hineinfühlen.«
»Ihnen hat er das gesagt. Warum nicht mir?«
»Es fiel ihm sehr schwer, überhaupt darüber zu sprechen, über sich, den Tod seiner Frau. Ich habe immer geglaubt, Walter wünschte sich insgeheim, dass seine Mutter sich Ihnen zuwendet, weil er das vermisst hat.« Matani lächelte voller Wärme. »Ich frage noch heute meine Mutter um Rat. Wie hat Ihre Großmutter die Nachricht aufgenommen?«
Vollkommen entgeistert erstarrte sie. »Sie weiß es noch nicht?«
»Nein. Sie sind der einzige Mensch, den er im Falle eines Unfalles zu benachrichtigen wünschte.«