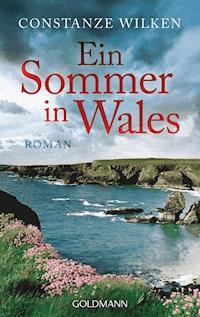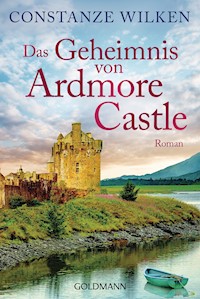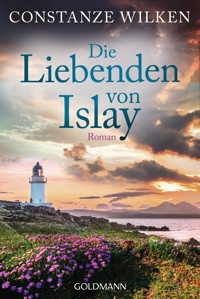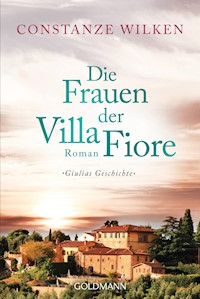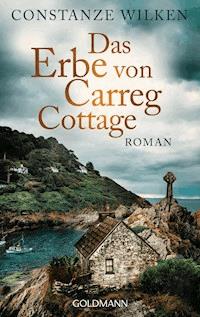2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nur wer auf die Liebe vertraut, kann sie gewinnen: Der Historische Roman »Die Malerin von Fontainebleau« von Constanze Wilken als eBook bei dotbooks. Frankreich 1537: Die junge Malerin Luisa Paserini arbeitet unerkannt als Mann im Schloss Fontainebleau. Hier, am prachtvollen Hof des französischen Königs Franz I., lernt sie eine Welt kennen, zu der sie als Frau sonst niemals Zutritt bekäme. Unter den Fittichen des Hofmalers Rosso Fiorentino wird sie bald zu einer der begabtesten Freskenmalerinnen seiner Werkstatt – und als er ihr Geheimnis entdeckt, finden sie die Liebe füreinander. Doch während für die beiden eine Zeit voller Romantik und Wunder beginnt, wächst der Einfluss der Inquisition bei Hofe. Schon bald muss Luisa feststellen, dass diese farbenfrohe Welt ihre Schattenseiten hat – und ein falsches Wort den Untergang bedeuten kann … »Constanze Wilken versteht es, die Geschehnisse bildhaft und lebendig darzustellen. Sie baut von der ersten Seite an einen Spannungsbogen auf, der den Leser fesselt.« Heider Anzeiger Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde historische Roman »Die Malerin von Fontainebleau« von Bestsellerautorin Constanze Wilken. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 888
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Frankreich 1537: Die junge Malerin Luisa Paserini arbeitet unerkannt als Mann im Schloss Fontainebleau. Hier, am prachtvollen Hof des französischen Königs Franz I., lernt sie eine Welt kennen, zu der sie als Frau sonst niemals Zutritt bekäme. Unter den Fittichen des Hofmalers Rosso Fiorentino wird sie bald zu einer der begabtesten Freskenmalerinnen seiner Werkstatt – und als er ihr Geheimnis entdeckt, finden sie die Liebe füreinander. Doch während für die beiden eine Zeit voller Romantik und Wunder beginnt, wächst der Einfluss der Inquisition bei Hofe. Schon bald muss Luisa feststellen, dass diese farbenfrohe Welt ihre Schattenseiten hat – und ein falsches Wort den Untergang bedeuten kann …
»Constanze Wilken versteht es, die Geschehnisse bildhaft und lebendig darzustellen. Sie baut von der ersten Seite an einen Spannungsbogen auf, der den Leser fesselt.« Heider Anzeiger
Über die Autorin:
Geboren an der norddeutschen Küste zog es Constanze Wilken nach einem Studium der Kunstgeschichte, Politologie und Literaturwissenschaft für einige Jahre nach England. Im wildromantischen Wales entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben, aber auch für Antiquitäten. Die Forschungen zur Herkunft seltener Stücke und ausgedehnte Reisen der Autorin sind Inspiration und Grundlage für ihre Romane.
Die Website der Autorin: constanze-wilken.de/
Bei dotbooks erschienen bereits folgende Romane:
»Die Frau aus Martinique«
»Was von einem Sommer blieb«
»Die vergessene Sonate«
»Das Geheimnis des Schmetterlings«
»Die Frauen von Casole d’Elsa«
»Das Licht von Shenmoray«
Weiterhin veröffentliche Constanze Wilken bei dotbooks den folgenden historischen Roman:
»Die Tochter des Tuchhändlers«
***
eBook-Neuausgabe August 2021
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/spillikin, Richard Semik, N Hart, Kathy SG
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-330-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Malerin von Fontainebleau« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Constanze Wilken
Die Malerin von Fontainebleau
Roman
dotbooks.
Non hauria Ulysse o qualunqu’altro mai
Piu accorto fù, da quel diuino aspetto
Pien di gratie, d’honor e di rispetto
Sperato qual i sento affani e guai.
Odysseus hätte nicht, noch irgendwer,
Der klüger war, von diesem Götterbild,
Das Würde, Grazie und Ernst erfüllt,
Jemals geglaubt, es quäle mich so sehr.
Sonett von Louise Labé
(Um 1524–1565)
Fontainebleau
Oktober 1547
Der Dianengarten von Fontainebleau lag still in der Abenddämmerung. Vertraut und doch so fremd ragten die Umrisse des Schlosses vor ihr auf. Die Frau in dem schlichten Reisekleid zupfte nervös an der Kapuze ihres Umhangs. In weniger als einer Stunde würde es dunkel sein, und sie wollte die Galerie sehen, wenn zumindest noch etwas Tageslicht durch die Fenster fiel. Die Farben strahlten nur bei Tageslicht in voller Pracht. Den jungen Stallburschen neben sich hatte sie bestochen. »Ich brauche ein Licht, wenn ich herauskomme«, sagte sie leise.
»Kein Licht, Madame. Ich werde am Eingang auf Euch warten.«
Er schien den Weg auch blind finden zu können, so sicher bewegte er sich zwischen Bäumen, Sträuchern und Kübeln hindurch auf den Trakt zu, der das alte Schloss mit dem neuen verband. Sie vertraute nicht ihm, sondern dem Goldscudo, den sie ihm gegeben hatte. Menschen zu vertrauen war ein Risiko, das sie schon lange nicht mehr einging. Nur ein paar Schritte über den freien Platz trennten sie noch von dem Treppenaufgang, der zur Galerie hinaufführte. Sie meinte die Küchen riechen zu können, die sich im Kellergeschoss befanden. Darüber lagen die Bäder und im ersten Stock die Galerie. »Und es ist wirklich niemand dort?«
»Nein, Madame. Der König kommt erst morgen, und Meister Primaticcio will nicht, dass die Hofleute allein durch die Galerie gehen.«
Sie huschten über den Kies. Die kleinen Steine knirschten unter ihren Schuhen, und sie meinte, das Geräusch müsste das gesamte Schloss alarmieren, doch alles blieb ruhig. Im Schatten des Treppenaufgangs drückte der Stallbursche ihr einen Schlüssel in die Hand. »Hier, und jetzt beeilt Euch. Sie sind alle beim Essen.«
»Woher hast du den?«, fragte sie, doch der Bursche schubste sie ungeduldig zur Treppe.
»Geht schon, geht!«
Sie würde keine zweite Gelegenheit erhalten. Also nahm sie all ihren Mut zusammen und rannte die Stufen hinauf, bis sie mit klopfendem Herzen vor den Flügeltüren stand. So viele Jahre waren vergangen, seit sie hier an seiner Seite gestanden hatte. So viel war seither geschehen. König Franz I. war im Frühjahr verstorben, und sein Sohn Henri war nun Herrscher von Frankreich. Vor vier Monaten war Matteo nach Siena gekommen und hatte ihr das Unglaubliche erzählt. Die Galerie. Ängstlich sah sie sich um, während sie den Schlüssel vorsichtig im Schloss drehte, bis es klickte und die Tür knarrend aufschwang. Rasch schob sie sich hindurch.
Ihre Reisegefährten hatten aufgeregt erzählt, dass der König nach Fontainebleau käme. Ein König, der niemals den Thron hätte besteigen sollen. Henri hatte Fontainebleau nie so geliebt wie sein Vater, und das war einer der Gründe, weshalb sie gekommen war. Sie wollte das Schloss sehen, wie Franz es geschaffen hatte. Fontainebleau war sein Kunstwerk, das Lebenswerk eines Mannes, der einen Traum von Italien gehabt hatte. Ein König mit dem Herzen eines Ritters, der Seele eines Künstlers und dem Geist eines Gelehrten, ein König, dessen Zeitalter Vergangenheit war. Henri II. würde dem Schloss seinen eigenen Stempel aufdrücken wollen. Er würde verändern oder zerstören, was ihm nicht gefiel. Frankreich sah schweren Zeiten entgegen.
Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das diffuse Licht der Dämmerung, das noch durch die hohen Fenster hereinschien. Sie hielt den Atem an. Der Fußboden! Scibec konnte stolz sein auf seine Arbeit. Die hölzernen Intarsien entsprachen dem komplizierten Muster der Decke. Und dann fiel ihr Blick auf die Wände, an denen sich Figuren und Früchte, Säulen und Baldachine aus weißem Stuck um farbenprächtige Bilder rankten. Tränen liefen ihr über die Wangen.
»Giovanni«, flüsterte sie. Alle Gefühle, die sie stets tief in sich verborgen hatte, brachen auf, als sie das gewaltige Kunstwerk sah, das Rosso Fiorentino in Fontainebleau geschaffen hatte.
Die Gerüste waren fort, und der langgestreckte Raum wirkte nun in seiner ganzen Größe. Sie schloss die Augen und meinte die Stimmen der Künstler, der Maler, Stuckateure und Arbeiter zu hören: Thiry mit seinem niederländischen Akzent und Matteo, der hübsche Florentiner, der ihr das Geheimnis der Herstellung des azzurro oltramarino verraten hatte. Sie ging ans östliche Ende der Galerie zum Fresko der Venus. Mit den Händen fuhr sie die Vertäfelung entlang. Sie kletterte auf die hölzerne Bank mit den kunstvoll geschnitzten Armlehnen und griff nach den schlanken Fesseln der weiblichen Figur, die das Fresko rechts flankierte. Hier hatte alles angefangen. Zärtlich fuhr sie über die glatte Oberfläche der weiblichen Karyatide, deren weißer Stuck hell im Licht schimmerte.
»Es tut mir so leid, Armido, aber ich werde ihn finden, das habe ich dir versprochen«, flüsterte sie und lehnte ihre Wange an den kühlen Stuck. Sich von den Erinnerungen losreißend, drehte sie sich um und betrachtete die Sammlung antiker Büsten und Skulpturen, die in der Galerie aufgestellt worden war.
Unter Franz I. war Meister Primaticcio auf der Suche nach seltenen Kunstobjekten der Antike häufig in Italien gewesen und hatte den Grundstein für die königliche Sammlung gelegt. Primaticcio, der Bologneser. Sie fuhr zusammen, als sie hörte, wie die Tür am anderen Ende der Galerie geöffnet wurde und sich Stimmen und Schritte näherten. Nein!, schrie alles in ihr. Ich gehe nicht fort, ohne es gesehen zu haben. Die Galerie war so lang, dass die schlechten Lichtverhältnisse und die Statuen es ihr ermöglichen würden, unbemerkt bis zur Mitte zu gelangen. Dort befanden sich die königlichen Kabinette. Eines davon musste sie sehen.
Leise sprang sie von der Bank und huschte im Schutz der Büsten und antiken Figurengruppen weiter. Gleich hier musste der Durchgang sein. Mit einem Satz sprang sie hinter einer Hermesstatue hervor und direkt durch den Bogen in das Kabinett.
»Heda!«, rief eine männliche Stimme von hinten. Eine Stimme, die ihr nicht unbekannt war.
Atemlos kauerte sie in der Fensternische gegenüber dem Kamin. Die Kapuze ihres Umhangs war nach hinten gerutscht, und einige Strähnen ihres langen Haares hatten sich aus der aufgesteckten Frisur gelöst. Doch davon bemerkte sie nichts, denn sie starrte wie gebannt auf das Bild über dem Kamin.
»He! Wer seid Ihr? Was tut Ihr hier?«, riss die Stimme sie aus ihren Träumereien.
Sie sprang auf und vergaß vollkommen, wer sie war. »Meister Primaticcio, verzeiht, ich …« Aber da war es bereits zu spät.
Meister Primaticcio sah sie verwundert an. Die Jahre waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Ein grauer Bart und tiefe Furchen auf der Stirn ließen ihn grimmig aussehen. Er war nicht allein. Eine schlanke Frau, deren schwarzweißes Kleid nach spanischer Mode geschnitten war, war neben ihn getreten. Diane de Poitiers schien noch hochmütiger, und ihre Augen blickten noch kälter als damals. Diese Augen kannten keine Gnade, und wehe dem, der sich ihr in den Weg stellte. In Dianes Begleitung waren zwei junge Hofdamen und ein Mann, bei dessen Anblick die Frau am Fenster erschauerte.
Jean de Mallêt lächelte charmant. Er war alt geworden, doch seiner Wirkung auf Frauen schien er sich noch immer gewiss. »Eine schöne Unbekannte. Was für eine entzückende Überraschung. Verratet Ihr uns Euren Namen, Madame?«
Im Gegensatz zu Primaticcio, der sie verärgert musterte und noch zu überlegen schien, reichte Mallêt ihr seinen Arm. Zaghaft legte sie die Finger auf das Wams des verhassten Mannes und antwortete: »Montecatini, mein Name ist Leonora Montecatini.«
»Ah, Meister Primaticcio, eine Landsmännin von Euch. Was bringt Euch in unser Land?«, flötete Mallêt, wurde jedoch rüde von Diane de Poitiers unterbrochen.
»Lasst das, Mallêt. Zu Euch kommen wir gleich, Madame. Meister Primaticcio, Ihr wolltet uns etwas erläutern, bevor wir von dieser Person gestört wurden. Bitte.«
Primaticcio räusperte sich. »Wie ich schon sagte, würde ich bei einem Umbau der Galerie dieses Kabinett abreißen lassen.« Verunsichert warf er wieder einen Blick auf die Unbekannte.
»Und das Fresko?«, wandte Madame de Poitiers ein und zeigte mit spitzem Finger auf das farbenprächtige Bild über dem Kamin. »Meister Rosso wäre damit sicher nicht einverstanden.«
Abreißen! Sie trat einen Schritt zurück, wo sie die Nische und ein Fenster wusste. Ihr Kabinett! Sie blickte auf das Fresko und erstarrte. Wie hatte sie das nicht sofort erkennen können! Sie presste eine Hand an die Lippen und unterdrückte ein Schluchzen. Matteo hatte es angedeutet, doch niemand außer ihr würde je wissen, was die Semele wirklich verbarg, und da zog ein Lächeln über ihr Gesicht.
»Was ist mit Euch?« Mallêt betrachtete sie nachdenklich.
Madame de Poitiers sah ungeduldig auf das Bild. »Was stellt es überhaupt dar, Meister Primaticcio? Ich gestehe meine mangelnde Bildung.«
»Semele und Jupiter«, flüsterte sie. Keiner der Anwesenden bemerkte es. Keiner sah es. Ihre Knie zitterten so stark, dass sie meinte, sie würden jeden Augenblick unter ihr einbrechen, doch sie zwang sich zur Selbstbeherrschung. Primaticcio sagte etwas, das sie nicht verstand. In ihren Ohren rauschte es, und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass diese Leute endlich gingen und sie allein ließen.
Doch sie gingen nicht. Meister Primaticcios Miene wurde immer düsterer, und Diane de Poitiers musterte sie mit gerunzelter Stirn. Am beunruhigendsten aber war der tückische Ausdruck auf dem Gesicht Jean de Mallêts, als er plötzlich leise sagte: »Euer Name und das Kleid haben mich verwirrt. Aber ich vergesse nie ein Gesicht.«
Todesangst kroch kalt und langsam ihre Glieder hinauf. Es war genau wie damals. Nur gab es nun weder Rosso noch sonst jemanden, der ihr beistehen würde. Sie waren alle fort oder tot. Jemand rief nach der Wache. Sie straffte die Schultern und sah auf den Ring an ihrer Hand. Und doch gab es einen Menschen, auf dessen Hilfe sie hoffen durfte. Entschlossen hob sie den Kopf und sah Mallêt herausfordernd an.
Kapitel IDie Stukkadorwerkstatt der Paserini in Siena
1537
Das Hämmern und Rufen der Steinmetze und Handwerker drang vom Hof weit bis auf die Via di Fontebranda. In der Werkstatt der Paserini herrschte Hochbetrieb, denn Andrea di Antonio Piccolomini hatte einen Großauftrag für seine Villa in Asciano erteilt.
Ein Ochsenkarren ratterte über die Pflastersteine, deren Unregelmäßigkeit das mit Fässern und Kisten schwer beladene Gefährt bedenklich ins Schwanken brachte. Fluchend stemmte sich der Mann, den der muskulöse Oberkörper und ein mit Werkzeugen gespickter Ledergürtel als Steinmetzen auswiesen, gegen das Gefährt.
»Brauchst du Hilfe?«
Für einen Moment sah der Steinmetz auf. Ihm gegenüber stand ein Dominikanermönch, dessen ausgefranste Kutte über den nackten Knöcheln endete.
»Nein, ich komme allein zurecht.« Der Steinmetz ging auf die andere Seite des Wagens, dessen Räder zwischen den Pflastersteinen feststeckten, und hob den Wagen unter großer Kraftanstrengung an.
Es ging auf die Mittagszeit zu, und die Sonne brannte von einem wolkenlosen Julihimmel herab. Ein Schwein lief grunzend umher, und eine alte Frau saß auf einem Stuhl vor ihrem Hauseingang und pulte Bohnen. Der Dominikanermönch trollte sich seines Weges durch den Unrat der Straße. Als die Alte ihn sah, bekreuzigte sie sich rasch und murmelte etwas.
Der Steinmetz spuckte demonstrativ aus und murmelte: »Domini canes …« Hunde des Herrn wurden die Dominikaner genannt, weil jeder wusste, dass sie sich mit Überzeugung für die Durchsetzung der Inquisition einsetzten. Dann wischte sich der Steinmetz den Schweiß aus dem Gesicht und lächelte, als ein junger Mann aus dem Torbogen trat, der zur Stukkadorwerkstatt führte. Mit Kennermiene ließ der Junge den Sand aus einem der Fässer durch die Finger gleiten. »Guter Kalksand, Giuffredo.«
»Dreieinhalb Jahre alt, nass gelöscht und eingesumpft, beste Qualität.« Der Steinmetz blinzelte.
Guter Kalk war das Hauptarbeitsmaterial der Stukkadore, und die Herstellung war eine Wissenschaft für sich. Zuerst musste Kalkstein in speziellen Öfen gebrannt werden. Luisa, denn der Junge war niemand anderer als die in Männerkleidung arbeitende Luisa Paserini, hatte Giuffredo oft begleitet, um neuen Kalksand zu holen, und wusste um jeden Arbeitsschritt bei der Herstellung des kostbaren Materials. Der Kalkbrenner musste das Feuer eines Ofens vier Tage und Nächte in Gang halten und brauchte für eine Ladung Kalkstein eine doppelte Menge an Fichtenscheiten. Über Generationen wurde das Wissen um das komplizierte Brennverfahren innerhalb der Kalkbrennerfamilien weitergegeben. Der gebrannte Kalk oder Stückkalk wurde dann gelöscht. Für einfache Maurerarbeiten reichte das Trockenlöschen, bei dem nur so viel Wasser zugeführt wurde, dass der Kalk nass glänzte. Besser und bei den Stukkadoren beliebter war der eingesumpfte Kalk. Staunend hatte Luisa bei ihrem ersten Besuch in der Kalkbrennerei die flachen Erdmulden gesehen, die über einen Ablauf mit einer tieferen Grube, dem Sumpf, verbunden waren. In einem eineinhalb mal drei Meter langen Kasten wurde dann der Kalk im Verhältnis eins zu zwei mit Wasser vermengt. Dabei begann das Wasser zu kochen, und man musste Sorge tragen, dass der Kalk nicht verbrannte. Luisa lernte, dass auch nicht zu wenig Kalk verwendet werden durfte, weil der Kalk sonst zu nass und ebenfalls unbrauchbar wurde.
Luisa Paserini nestelte an ihrer Kappe, unter der sie dichte lange Haare verbarg, und half Giuffredo, den Wagen durch das Tor zu lotsen. Seit Pietros Unfall vor fünf Jahren trat sie in der Werkstatt als Junge auf, und bisher hatte sich niemand daran gestört, denn sie arbeitete besser als die meisten Gesellen, auch wenn sie den Männern physisch unterlegen war. Ihre Entwürfe waren originell, und sie hatte ein sicheres Stilempfinden, was ihr bei der Zusammenstellung der Stuckelemente zugute kam. Erst heute Morgen war sie von Signor Piccolominis Verwalter für ihren Entwurf zur Gestaltung der Gesimse gelobt worden. Natürlich wusste der Mann nicht, dass er einer Frau zugehört hatte, denn in einer Stukkadorwerkstatt hatten Frauen nichts verloren. Armer Pietro, aber ohne seinen Unfall hätte man ihr nie erlaubt zu helfen, und jetzt gehörte sie genauso zur Werkstatt wie Giuffredo und die anderen Gesellen und Lehrlinge. Sie entdeckte ihren Bruder im Eingang zur Werkstatt, wo er auf seinen Stock gestützt stand und die Arbeit überwachte. »Pietro! Sieh nur, Giuffredo hat die neue Lieferung gebracht.«
Pietro war mit knapp dreißig Jahren der älteste der Paserini-Geschwister, zu denen neben Luisa ihr Lieblingsbruder Armido, der zurzeit in Rom weilte, sowie zwei weitere Schwestern zählten. Simonetta war seit fünf Jahren mit Tomaso, dem leitenden Bildhauer der Werkstatt, verheiratet und hatte vor einem Monat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. In wenigen Wochen würde auch Francesca niederkommen, die ihr erstes Kind erwartete. Mit der nur ein Jahr älteren Francesca hatte Luisa sich nie verstanden und war froh, dass diese einen Schriftgießer in Florenz geehelicht hatte. Solange Luisa denken konnte, war Pietro das Oberhaupt der Familie gewesen, denn ihre Eltern waren vor vielen Jahren bei einem Fuhrwerkunfall ums Leben gekommen. Pietro hatte die Werkstatt geleitet und mit seiner Fröhlichkeit und Tatkraft alle mitgerissen, doch der Unfall hatte alles verändert. In einem Moment der Unachtsamkeit war er auf der Baustelle des Palazzo Petrucci vom Gerüst gestürzt und hatte sich zahlreiche Knochenbrüche im linken Bein, der Schulter und den Händen zugezogen. Wochenlang hatten ihn die Verletzungen ans Bett gefesselt, und niemand hatte geglaubt, dass er überleben würde.
Wenn Luisa ihn manchmal ansah, fragte sie sich, ob er es bedauerte, dass der Sturz nicht tödlich verlaufen war. Pietro war ein Krüppel, der sich mit seinem Gehstock mühsam durch die Werkstatt schleppte und dessen linke Hand nahezu gebrauchsunfähig war. Doch wenn er sie anlächelte, während sie zeichnete, und sie für die gelungene Ausführung eines Entwurfs lobte, dann schämte sie sich ihrer Gedanken. Pietro war die Seele der Werkstatt, und alle respektierten ihn, selbst der arrogante Tomaso zollte ihm Achtung für seine Fachkenntnisse.
»Ah, sehr schön …« Pietro hielt inne und sah nicht auf sie oder den Karren, sondern auf etwas hinter ihr.
Luisa drehte sich um. Ihr Herz machte einen Satz. »Armido!«
Ein großer dunkelhaariger Mann, dem die Ähnlichkeit mit seiner Schwester und Pietro ins Gesicht geschrieben stand, trat in den Hof.
»Luisa! Ich hätte gedacht, dass du langsam zu alt für diese Maskerade wirst.« Liebevoll drückte er Luisa an sich, die sich in seine Arme geworfen hatte.
»Dass du zurück bist! Warum hast du nicht geschrieben? Schau dich nur an, Armido, ein großer Herr bist du!« Sie zupfte an seinem Hemd, das aus gutem Leinen gefertigt war, und auch seine Lederstiefel waren solide gearbeitet. »Wie ist Rom, groß und herrlich, nicht wahr? Giuffredo, das ist mein Bruder, Signor Armido, der mit maestro Michelangelo gearbeitet hat!«
Ergriffen neigte Giuffredo den Kopf. »Signore, es ist mir eine Ehre. Ich kümmere mich um die Ladung.«
Armido schulterte seinen Lederbeutel und legte seiner Schwester den Arm um die Schultern. Die Ähnlichkeit war unverkennbar, beide hatten gerade geschnittene Nasen und einen schön geschwungenen Mund in einem ovalen Gesicht.
Gemeinsam gingen sie über den Hof, in dessen Mitte der Ochsenkarren von mehreren Männern entladen wurde. Überall lagen Bretter und Steine. Kisten mit Kalksand und Tonkrüge mit verschiedenen Flüssigkeiten standen an den Wänden neben halbfertigen Gesimsteilen, Gussformen und Arbeitstischen, an denen gesägt und gehämmert wurde.
Armido fragte leise: »Wie geht es ihm?«
»Er wird noch oft von Schmerzen geplagt, auch wenn er es nicht zugibt, und er hasst es, wenn ihm Dinge aus der Hand fallen. Erst gestern hat er zwei fertige Muscheln zerbrochen und sich furchtbar geärgert. Aber erwähne das nicht …«
Pietro lehnte im Türrahmen und streckte seine gesunde Rechte nach ihnen aus. »Mein Bruder!«, rief Pietro laut, und das Hämmern in der Werkstatt verstummte. Neugierige Gesichter tauchten hinter Pietro auf. Einige Gesellen und vor allem die Lehrlinge waren noch nicht lange bei den Paserini und kannten Armido, der drei Jahre in Rom gewesen war, nur aus den Erzählungen seiner Geschwister.
Luisa spürte, wie ein Ruck durch Armido ging, der sich verschämt räusperte, bevor er seinen älteren Bruder in die Arme schloss.
Stolz klopfte Pietro ihm auf die Schulter. »Seht her, das ist Signor Armido. Er kommt aus Rom, wo er mit maestro Michelangelo gearbeitet hat! Wir alle können viel von ihm lernen!«
Obwohl Tomaso halb hinter einer Säule verborgen stand, konnte Luisa die Missbilligung auf seinem Gesicht sehen. Ihr Schwager war klein und von unregelmäßigem Wuchs, die Arme waren muskulös, der knorrige Körper von der harten Steinbildnerei gestählt. Seine grauen Augen verengten sich, während er den Neuankömmling musterte. Er fürchtete dessen Konkurrenz, denn sicherlich würde von nun an Armido die Leitung der Auftragsgestaltung übernehmen.
Ein anerkennendes Raunen ging durch die Werkstatt, doch Armido hob abwehrend die Hände. »Es tut mir leid, aber ich bin nur auf der Durchreise!«
Pietro war die Enttäuschung anzusehen, während Tomaso triumphierend schnaufte und sich abwandte.
»Na los, es gibt nichts zu sehen. Macht euch wieder an die Arbeit!«, scheuchte Pietro seine Leute zurück und legte dann Armido eine Hand auf den Arm. »Komm mit und erzähl, was dich zu uns bringt. Simonetta wird etwas zu essen bereithalten.«
Armido wollte seinem Bruder die Stufen in den Hof hinunterhelfen, doch Pietro machte eine energische Handbewegung und wandte sich dem Karren zu, von dem Giuffredo gerade eine Kiste auf seine Schultern hob. »Hast du den Sand geprüft? Ist er fein und gut durchgesumpft?«
»Ja, maestro.« Der kräftige Steinmetz grinste. »Deshalb schickt Ihr mich doch. Die hauen mich nicht übers Ohr. Einmal haben sie es versucht, aber meine Fäuste haben ihnen schon klargemacht, dass das keine gute Idee war …« Mit geübtem Griff klemmte er einen kleinen Krug unter den freien Arm und ging ins Haus.
»Guter Mann, ich bin froh, dass ich ihn habe. Tomaso hat drei Steinmetze mitgebracht, die mir nicht gefallen. Aber was soll ich machen …« Armido schlug mit seinem Stock gegen den Karren. »Ich bin ein Krüppel. Letzten Endes bin ich auf Hilfe angewiesen.«
Der bittere Tonfall traf Luisa bis ins Mark. »O Bruder, sprich nicht so. Alle haben dich gern, und ohne dich würde die Werkstatt nicht funktionieren! Das weißt du ganz genau!«
»Leistet Tomaso denn wenigstens gute Arbeit?«, fragte Armido, während sie quer über den Hof auf ein Nebengebäude zugingen, aus dem ihnen Düfte von Gebratenem entgegenwehten.
Die Werkstatt der Paserini bestand seit vielen Generationen, und die Gebäude waren über die Jahre mitgewachsen, was sich in den nach und nach angestückten Wohnräumen zeigte. Das Kernstück war die Werkstatt, flankiert von zwei wenig ansehnlichen, aber zweckmäßigen einstöckigen Gebäuden. Auf der linken Seite lebten Pietro, Luisa und Simonetta mit Tomaso und den Kindern. Gegenüber waren der Stall, ein Lager und kleine Schlafräume für die Lehrlinge. Giuffredo wohnte zwei Straßen weiter mit seiner Frau, deren Eltern und fünf Kindern.
Luisa machte eine vage Handbewegung. »Seine Entwürfe sind solide, aber nicht originell.«
Sie standen vor der offenen Tür zum Wohnhaus der Paserini. Luisa nahm die Kappe ab und steckte sie in ihren Hosenbund. Über den weiten Hosen und einem unförmigen Hemd und Weste trug sie eine lange Lederschürze, die jegliche weibliche Form vor neugierigen Blicken verbarg. Simonetta rümpfte ständig die Nase über Luisas Verkleidung, und Tomaso ignorierte sie, soweit es möglich war. Augenblicke wie heute Morgen, als Piccolominis Verwalter ihre Entwürfe gelobt hatte, machten Luisa glücklich und ließen sie die missgünstigen Blicke ihres Schwagers und Frotzeleien seiner Gesellen ertragen, die sie fast täglich über sich ergehen lassen musste.
Aus dem schmalen Korridor vor ihnen ertönte Kindergeschrei, gefolgt von Fußgetrappel auf der Holztreppe. »Kommt sofort zurück, wir sind noch nicht fertig!«
Luisa hörte den Ärger in Simonettas Stimme, die so kurz nach der Entbindung noch gereizter als gewöhnlich war. Die Ankunft Armidos würde eine willkommene Abwechslung sein. »Simonetta!«, rief sie nach oben. »Wir haben Besuch!«
»Geht in die Küche. Ich bin gleich unten.«
Über einen ausgetretenen Steinfußboden gelangten sie in Pietros ufficio, wie er den kleinen Raum mit dem Schreibtisch, einer Truhe und zwei großen Regalen nannte, in denen sich Papiere und Kassenbücher stapelten.
Armido sah sich kurz um. »Es hat sich nichts verändert … Hast du immer noch niemanden, der sich um die Bücher kümmert?«
»Eh, was ist da schon groß zu tun … Jetzt komm weiter. Das riecht nach Fleischeintopf.« Pietro schnupperte, stieß die gegenüberliegende Tür mit seinem Stock auf und humpelte vor ihnen durch ein Vorratslager in die Küche.
Luisa band die schwere Lederschürze ab und hängte sie auf einen Haken neben dem Eingang. Über dem offenen Feuer hing ein Topf, in dem die Köchin Gulasch zubereitete. Giuseppa war seit zehn Jahren bei ihnen und kochte nicht nur für die Familie, sondern auch für die Lehrlinge und Gesellen, die mittags nicht nach Hause gingen. Sie war launisch, aber ihr Essen war köstlich. Selbst aus den einfachsten Zutaten machte sie etwas Schmackhaftes. Zwei Mägde und ein Küchenjunge gingen ihr zur Hand. Luisa sah, wie der Junge, ein schmutziger kleiner Bengel, sich gerade eine Feige in den Mund stopfte. Die Köchin hatte es auch gesehen und gab dem Jungen eine so heftige Ohrfeige, dass seine Wange feuerrot anlief, er sich verschluckte und jammernd und hustend dastand wie ein Häufchen Elend. Erst jetzt bemerkte Giuseppa die Geschwister. »Oh, Signori, oh …!« Sie wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab und machte eine Art Knicks. »Bitte, nehmt Platz. Signor Armido, welche Ehre!«
Luisa setzte sich mit ihren Brüdern an den großen Esstisch, der in der Mitte der Küche stand. Giuseppa rief eine der Mägde, und kurz darauf standen Becher, Schüsseln mit Oliven und Kapern und ein Laib Roggenbrot auf dem Tisch. Pietro goss Wein aus einem Tonkrug ein.
Armido hob seinen Becher. »Zum Wohle! Und nun will ich euch sagen, warum ich nicht bleiben kann.« Er machte eine bedeutsame Pause und steckte sich eine Olive in den Mund.
Es schien eine Ewigkeit zu dauern, bis er die Frucht gegessen und den Kern ausgespuckt hatte. Luisa starrte ihm gebannt auf die Lippen.
»Man hat mich nach Fontainebleau gerufen. Maestro Primaticcio hat nach mir und einigen anderen Stukkadoren, mit denen er damals in Mantua gearbeitet hat, gesandt, ihm bei den Arbeiten im Schloss des Königs zu helfen.« Genüsslich nahm er sich eine weitere Olive und kostete das Staunen seiner Geschwister aus.
»Frankreich …«, flüsterte Luisa ehrfürchtig.
»Arbeitest du dann für Primaticcio oder für maestro Rosso?«, fragte Pietro.
»Für Primaticcio, denke ich. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber du hast recht – maestro Rosso ist der erste Künstler am Hof von Franz I.« Armido fuhr mit der Hand durch die Luft. »Ich weiß, was ich kann. Domenico del Barbiere ist auch dort, soviel ich weiß. Selbst der ist Rosso unterstellt, und ich habe gehört, dass Luca Penni ebenfalls nach Fontainebleau kommt.«
Luisa atmete tief ein. Luca Penni war ein Bruder von Giovan Francesco Penni, ein Schüler des viel gerühmten Raffael in Rom. Was für ein Glück für ihren Bruder, mit solchen Meistern arbeiten zu dürfen. Wie gern würde sie selbst wenigstens ein Mal nach Rom oder Venedig reisen, um die Werke Michelangelos oder Tizians zu sehen. Noch nicht einmal in Florenz war sie gewesen, um Sandro Botticellis wundervolles »Primavera« oder die »Venus« zu sehen, geschweige denn Werke von Bronzino oder Pontormo. Und gar Rosso! Sie war vierzehn Jahre alt gewesen, als Armido sie mit nach Volterra genommen hatte. Nie würde sie vergessen, wie sie die Kapelle der Compagnia della Croce di Giorno in San Francesco betreten hatte. Ihr Bruder hatte ihr von diesem exzentrischen Maler erzählt, der die Kreuzabnahme auf eine vollkommen neue Art dargestellt hatte. Aber was sie erwartete, übertraf alle ihre Vorstellungen. Diese leuchtenden Farben! Diese wunderbaren Figuren, die sich in dramatischer Weise, fast wie in einer griechischen Tragödie, voller Schmerz wanden und den Körper Christi hielten. Die Frauen, deren schöne Gewänder nicht ablenkten von ihrem Schmerz, sondern deren Bewegungen sich einfügten in die Komposition und aus dem bekannten Motiv eine Szene menschlicher Schicksale, erhöht durch die geniale Kunst Rosso Fiorentinos, machten. Niemand konnte sich der Faszination dieser Kreuzabnahme entziehen. Luisa hatte gesehen, wie Frauen und Männer, die das Gemälde zum ersten Mal sahen, sich ehrfürchtig bekreuzigten, staunend stehen blieben und dann die Darstellung zu diskutieren begannen.
»Ich komme mit. Ich will auch nach Frankreich!« Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund, doch es war zu spät.
Verärgert runzelte Pietro die Stirn. Armido lächelte, er wusste, was sie bewegte. »Schwesterchen, was willst du im kalten Frankreich? Dein Platz ist hier bei deiner Familie. Was würde Pietro ohne dich anfangen? Du weißt, dass Tomasos Entwürfe nicht gut genug sind.«
»Schlag dir den Unsinn aus dem Kopf, Luisa. Du hast mehr Freiheiten als die meisten Frauen«, knurrte Pietro.
»Ja, aber ich habe auch mehr Talent als die meisten Frauen!«
»Genug!« Pietro stieß seinen Stock auf den Boden.
Sie kannte das Funkeln in seinen Augen gut genug, um zu wissen, dass es nun klüger war, den Mund zu halten.
»Ich werde dir schreiben, wie es am Hof von Fontainebleau zugeht. Der König ist ein großer Förderer der Künste, und er soll die Frauen lieben.« Armido lachte. »Ein Mann ganz nach meinem Geschmack!«
Kindergelächter und die energische Stimme ihrer Schwester kündigten Simonetta an. Zuerst liefen ein fünfjähriger Junge und ein dreijähriges Mädchen in die Küche, wobei sie fast die Magd, die eine Schüssel mit zuppa di farro trug, zu Fall gebracht hätten. Die Suppe wurde aus Dinkelkörnern gemacht, eine einfache nahrhafte Speise, die fast vor jedem Mahl aufgetragen wurde.
Mit dem kritischen Blick der Hausherrin inspizierte Simonetta die Küche, bevor sie sich ihrem Bruder zuwandte. Simonetta war etwas größer als Luisa und hatte nach drei Geburten deutlich an Gewicht zugelegt. Unter ihren Augen zeigten sich dunkle Ränder, doch ihre vollen Lippen lächelten gerne und machten Simonetta zu einer anziehenden Frau. Herzlich begrüßte sie Armido, der den Kindern zärtlich über die Haare strich, und setzte sich zu ihnen an den Tisch. »Wo ist Tomaso? Wollte er nicht mit uns essen?«
Luisa vermisste ihren Schwager nicht und verzog den Mund, als Simonetta ihren Sohn in die Werkstatt schickte, um den Vater zu holen. »Muss er denn immer …«
»Er ist mein Mann, Luisa. Iss deine Suppe.« Simonetta gab jedem eine Schöpfkelle voll in eine Schale und trank selbst einen Schluck Wein. »Armido, was verschlägt dich hierher? Hast du keine Aufträge mehr in Rom?«
Immer sah Simonetta zuerst das Negative. Luisa hatte sich deshalb schon oft mit ihr gestritten. »Er geht nach Frankreich und soll mit maestro Rosso arbeiten!«, antwortete Luisa anstelle ihres Bruders.
Erstaunt hob Simonetta die Augenbrauen. »Frankreich?«
»Ja, Primaticcio hat mich und vier weitere Stukkadore zu sich nach Fontainebleau gerufen. Der französische König will aus seinem Schloss das prächtigste in Frankreich machen. Und er soll gesagt haben, dass die besten Künstler aus Italien kommen.«
»Ach ja? Das macht er doch alles nur, um Kaiser Karl zu beeindrucken«, kam es abfällig von Tomaso, der eben durch die Tür getreten war, sich einen Stuhl heranzog und den Becher Wein, den seine Frau ihm reichte, in einem Zug leerte.
»Du willst doch wohl nicht bestreiten, dass wir die großartigsten Künstler hervorgebracht haben?« Pietro schob seine Suppenschale von sich und fixierte seinen Schwager.
»Das nicht, aber ob alles, was aus Italien kommt, so großartig ist …« Er machte eine vielsagende Pause.
Luisa schluckte. Sie wusste genau, dass der eifersüchtige Tomaso nichts anderes bezweckte, als Armido zu verärgern.
»Du Wurm! Bist hier in unserem Haus, teilst das Bett mit meiner Schwester und wagst es, mich zu beleidigen?!« Wütend sprang Armido auf und wollte seinen Degen ziehen, doch Pietro schlug mit seinem Stock auf den Tisch.
»Hört auf! Genug! Wir alle profitieren von Armidos Auftrag. Es wird sich herumsprechen und uns mehr Arbeit bescheren, und das ist für alle wichtig.«
Tomaso murmelte etwas, knetete die Hände, dass es knackte, und goss sich Wein nach. Seine grimmige Miene ließ keinen Zweifel daran, was er von Armidos Auftrag hielt. »Franzosenpack«, zischte er.
Doch Armido hatte sich wieder beruhigt. »Es waren aber nicht die Franzosen, die Rom vor zehn Jahren dem Erdboden gleichgemacht haben. Hast du das schon vergessen?«
1527 war als das dunkelste Jahr in die Geschichte der Stadt am Tiber eingegangen, denn im Mai hatten die Truppen Karls V. Rom mit unvorstellbarer Grausamkeit erstürmt, geplündert und niedergebrannt. Noch immer waren nicht alle Gebäude aus den Trümmern wieder erstanden, und der Schock des Sacco di Roma saß tief.
»Vielleicht nicht, aber sie hätten es sicher genauso gern getan, wenn sie die Gelegenheit dazu gehabt hätten«, blaffte Tomaso zurück.
»Unsinn! Du weißt doch gar nicht, worüber du sprichst. König Franz liebt Italien. Zwar meint er, einen Anspruch auf Mailand und Savoyen zu haben, aber niemals hätte er die Verwüstung Roms zugelassen, niemals!«, widersprach Armido.
Simonetta seufzte. »Könnt ihr das zu anderer Zeit austragen? Wie lange bleibst du?«
»Morgen mache ich mich auf den Weg, um die anderen in Pisa zu treffen. Dort wartet eine Gruppe französischer Kaufleute auf uns, mit denen wir nach Fontainebleau reisen. Unter ihnen ist auch einer der königlichen Agenten, die regelmäßig Kunstwerke in Rom kaufen. Allein deswegen werden wir uns um unsere Sicherheit keine Sorgen machen müssen.« Rasch löffelte Armido seine Schüssel leer, denn die Köchin stellte einen Topf mit dampfendem Wildschweingulasch auf den Tisch.
»Was denn für Agenten?« Luisa wusste kaum etwas über Frankreich. Was man sich über König Franz erzählte, waren Geschichten über seinen Hofstaat und seine Touren durch Frankreich. Einmal hatte sie gehört, dass der König mit zwanzigtausend Pferden durch die Lande zog, begleitet von einem fast ebenso großen Gefolge. Das war unvorstellbar!
»Köstlich, Giuseppa!« Pietro hatte das Fleisch gekostet und fuhr sich genießerisch mit der Zunge über die Lippen. Die Köchin strahlte und ging wieder zur Feuerstelle, wo der Küchenjunge mit rotem Gesicht Holz nachlegte.
»Jetzt lass ihn doch essen, Luisa!«, ermahnte Simonetta sie.
Doch Armido nickte lächelnd. »Genaues weiß ich auch nicht, nur, dass der König regelmäßig seine Leute nach Italien schickt, wo sie alles, was von besonderem Wert ist, aufkaufen. Diese Agenten laden auch die Künstler an den Hof. Michelangelo soll sich geweigert haben, und deshalb hat er maestro Rosso geholt.«
»Er wollte maestro Michelangelo nach Frankreich holen? Gott, niemand kann einen solchen Mann bezahlen!«, staunte Luisa.
»Der französische König schon. Er hat sogar Leonardo da Vinci bis zu dessen Tod bei sich gehabt.«
»Da war der maestro schon alt und hat keine Bilder mehr gemalt«, sagte Tomaso und steckte eine Gabel Fleisch in den Mund.
»Eigentlich ist es zwecklos, jemanden belehren zu wollen, der so ignorant ist wie du. Maestro Leonardo hat wissenschaftliche Traktate verfasst und an Maschinen gearbeitet, die sich dein erbsengroßes Gehirn nicht einmal vorstellen kann. Der König hat ihn oft im Schloss von Amboise besucht, wo der maestro mit seinen Lieblingsbildern, der Mona Lisa, der Anna Selbdritt und dem Johannes der Täufer lebte. So große Stücke hielt König Franz auf den maestro, dass er in der Stunde seines Todes bei ihm war. Solch ein Mann ist der französische König!«
Tomaso sagte nichts mehr, und Luisa freute sich im Stillen, dass ihm endlich jemand den Kopf zurechtsetzte. Aber Armido würde schon morgen wieder fort sein!
Rastlos lief Luisa den Rest des Tages durch die Werkstatt und wartete nur darauf, ihren Bruder allein sprechen zu können. Diese Gelegenheit ergab sich erst spät am Abend nach dem Essen. Simonetta hatte die Kinder zu Bett gebracht und sich mit Tomaso zur Ruhe begeben. Auch Pietro hatte sich bereits zurückgezogen, denn die Verletzungen machten ihm mehr zu schaffen, als er zugegeben hätte. Der Hof lag im Dunkeln. Nur aus der Werkstatt schien noch Licht, und vor den Stallungen brannte eine Laterne. Giuffredo deckte eine der Kisten mit Kalksand ab und streckte sich.
»Gute Nacht, Luisa!«
»Geh nach Hause, Giuffredo, deine Frau und deine Kinder warten. Ist Armido noch drinnen?« Sie nickte in Richtung Werkstatt.
»Ja.« Der Steinmetz machte sich auf den Heimweg, und Luisa ging die Stufen hinauf.
Sie hatte sich umgezogen und trug jetzt ein schlichtes dunkelgrünes Kleid über dem weißen Unterhemd. Da sie den ganzen Tag in Hosen und Arbeitsschürze herumlief, fühlte sie sich in den Frauenkleidern unwohl und schutzlos, aber Simonetta und Pietro bestanden darauf, dass sie zumindest außerhalb der Werkstatt wie eine anständige Frau auftrat. Unter ihren Nägeln klebte noch immer Steinstaub, aber es lohnte sich kaum, sich gründlich zu säubern, denn schon morgen früh würde sie erneut Zierleisten und Vorzeichnungen anfertigen. Die Piccolomini sollten so beeindruckt von ihren Arbeiten sein, dass sie keiner anderen Stukkadorwerkstatt je wieder einen Auftrag geben würden.
Vorsichtig öffnete sie die Tür, darauf bedacht, nicht doch auf Tomaso zu treffen, aber nein, nur ihr Bruder stand vor einem der Musterschränke und begutachtete die Leisten und Dekorationen.
»Die Fruchtstäbe habe ich entworfen«, sagte Luisa leise.
Ihr Bruder drehte sich überrascht um. »Ich habe dich nicht kommen hören. Du?« Anerkennung schwang in seiner Stimme mit und machte Luisa stolz auf ihre Arbeit.
»Ich will die Rahmungen in der Piccolomini-Villa damit ausschmücken.« Der Verwalter war sich noch nicht sicher gewesen, ob es Fresken an den Wänden und den Decken geben würde, doch die Rahmungen für etwaige Bildfelder wurden in jedem Fall benötigt.
»Mir gefallen die gedrehten Blattornamente mit den Perlen, oder sollen das Beeren sein?« Interessiert strich er über die Musterstäbe, die erst vor wenigen Tagen gegossen worden waren.
»Beeren, aber das ist eigentlich nicht wichtig. Ich wollte etwas mehr Lebendigkeit in die statische Leiste bringen.« Sie räusperte sich und stellte sich so, dass ihr Bruder sie ansehen musste.
Amüsiert hob er eine Augenbraue. Die Jahre in Rom hatten Spuren in seinem Gesicht hinterlassen, die Falten um die Augen und die Linie über der Nase waren tiefer geworden. Aber sie fühlte sich ihm so nahe wie damals, als er sie mit nach Volterra genommen hatte. Er war ihr Vertrauter, der Einzige, der verstand, was ihr die Kunst bedeutete, und es nicht als die Grille eines jungen Mädchens abtat, das gerne in Hosen herumlief.
»Was hast du auf dem Herzen, Schwesterchen?« Liebevoll strich er ihr eine Strähne aus der Stirn.
»Weißt du noch, wie du mir maestro Rossos Kreuzabnahme gezeigt hast?«
Er nahm eine der Rosetten in die Hände und begutachtete sie. »In Volterra? Aber ja. Du warst ganz besessen von dem Bild und hast wochenlang über nichts anderes gesprochen. Diese hier ist fehlerhaft.« Unsanft ließ er das schadhafte Stück auf den Tisch fallen.
»Ich möchte mit nach Frankreich. Ich möchte den maestro sehen und mit ihm arbeiten!«
Armido warf den Kopf in den Nacken und lachte. »Du bist wirklich verrückt! Erstens arbeitet er nicht mit Frauen, ich meine, niemand tut das – und zweitens kannst du einfach nicht mitkommen, weil du nicht eingeladen wurdest.«
Flehentlich nahm sie seine Hand. »Aber du könntest mich mitnehmen, als deinen Gehilfen. Niemand würde wissen, dass ich eine Frau bin. Der Verwalter der Piccolomini hat es auch nicht gemerkt, keiner der Kunden hier hat das!«
»Schlag es dir aus dem Kopf, Luisa. Hier in Siena, in unserer Werkstatt, ist das etwas anderes. Hier bist du inmitten der Familie, unter Freunden, aber in Frankreich … O Gott!« Er raufte sich die Haare. »Wir sind in Fontainebleau am königlichen Hof. Du weißt ja gar nicht, was das heißt! Da sind Hunderte von Leuten, die nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig zu bespitzeln und Intrigen zu spinnen, um sich beim König einzuschmeicheln. Rom war schon schlimm genug. Die päpstlichen Schmeichler, die alles tun würden, um sich Vorteile zu verschaffen. Die gehen über Leichen! Luisa, ich könnte dich nicht beschützen. Ich bin nur ein Stukkador, ein Gehilfe ohne Einfluss. Wenn sie herausfinden, wer du bist, wärest du verloren!«
»Warum?« Ihre Augen wurden feucht, und eine Träne lief ihr die Wange herunter. »Du hast doch selbst gesagt, dass der König Frauen liebt. Vielleicht findet er Gefallen an einer Künstlerin!«
»Willst du vielleicht in seinem Bett landen? Wahrscheinlicher ist es, dass einer dieser Höflinge … Nein! Sieh doch nur, was du hier tun kannst. Deine Arbeit wird geschätzt, und Pietro braucht dich.«
Sie schluchzte, als sie erkannte, dass er nicht zu erweichen war. Niemals würde sie Rosso Fiorentino kennenlernen, von dem sich die Leute erzählten, dass er den Beinamen Rosso wegen seiner Haarfarbe erhalten hatte. Er war nicht nur ein exzentrischer Künstler, sondern darüber hinaus ein schöner Mann, ähnlich wie einst Leonardo, hieß es. »Armido, ich will malen wie der maestro«, flüsterte sie mit tränenerstickter Stimme.
Mitfühlend nahm Armido sie in die Arme und drückte sie an sich. »Kleine verrückte Luisa. Warum kannst du dich nicht mit dem zufrieden geben, was du hast? Mehr kann dir niemand geben.« Er küsste sie auf die Stirn und hielt sie auf Armeslänge. »Alles, was möglich ist, hast du hier.«
Sie blinzelte die Tränen fort. Alles, was möglich war. Vielleicht.
Kapitel IIAuf der Via Francigena
Die Wellen schlugen wütend gegen das schwankende Gefährt, das jeden Moment umzukippen drohte. Niemand hatte diesen Sturm vorhergesehen, obwohl das steigende Wasser des Flusses Warnung genug hätte sein müssen. Luisa klammerte sich an ihr Bündel und versuchte, nicht nach draußen zu sehen, wo die Männer gegen die entfesselten Naturgewalten kämpften. Neben ihr saßen zwei kleine Mädchen, weinten und riefen ständig nach ihrer Mutter, die jedoch nicht hier war, sondern in Lucca auf sie wartete. Ihr gegenüber saßen die Großeltern der Mädchen, denen der Kutschwagen gehörte. Der Wind peitschte das Wasser durch die ungeschützten Fensteröffnungen. Unwillkürlich griff Luisa nach ihrem Hut. Den Zopf hatte sie zwar abgeschnitten und die Locken auf Kinnlänge gestutzt, doch sie befürchtete noch immer, dass ihre weichen Gesichtszüge sie verraten könnten.
In der heimischen Werkstatt war sie Kunden sicher in ihrer Hosenrolle gegenübergetreten, doch im Fall einer Entdeckung hätte ihre Familie sie beschützt. Hier draußen dagegen war sie auf sich allein gestellt, konnte niemandem trauen, musste sich entlegene Plätze zum Verrichten ihrer Notdurft suchen und immer auf der Hut sein. Eine Unachtsamkeit, und die Knechte oder Soldaten würden über sie herfallen, aber solch furchtbare Gedanken verdrängte sie sofort wieder.
Im Gasthaus von Castelfiorentino war sie auf die Vettorini getroffen, die sich gegen ein geringes Entgelt bereit erklärt hatten, sie mitzunehmen. Wahrscheinlich hatten sie auf ein kräftiges Paar Hände mehr gehofft. Signor Vettorini, ein Kornhändler aus dem Elsatal, warf ihr nun einen vorwurfsvollen Blick zu. Erschrocken sprang sie auf und stolperte in das Unwetter hinaus. »Verflucht, was habe ich mir nur aufgehalst«, murmelte sie und warf sich dem Wind entgegen.
Es dämmerte, und das Ufer der überfluteten Elsa war kaum auszumachen. Zwei Knechte hielten die scheuenden Maultiere, und drei Männer versuchten, den Wagen aus dem Morast zu ziehen, in den die Hinterräder immer tiefer versanken. In einiger Entfernung entdeckte sie einen Mast, von dem ein Seil über den Fluss führte. Die dazugehörige Fähre jedoch sah sie nicht. Bei diesem Sturm war an ein Übersetzen ohnehin nicht zu denken.
»Eh!«, rief sie einem der Knechte zu. »Warum bleiben wir nicht hier? Hat doch keinen Sinn, auf die Fähre zu warten!«
Das Wasser lief dem Mann, der die Maultiere zu beruhigen versuchte, in Kragen und Hemd. Er war völlig durchnässt, und seine Miene verhieß nichts Gutes. »Bist ’n ganz Schlauer, was? Hättest den Kopf mal zum Fenster raushalten sollen während der letzten Stunden. Alle Straßen sind überflutet. Wir können nicht mehr zurück. Wenn die verdammte Fähre nicht kommt, ersaufen wir hier! Na los, pack mit an!«
Er hatte recht. Jetzt erkannte sie, dass auch auf der anderen Straßenseite alles unter Wasser stand. Einzig die befestigte Uferstraße hatte der Flut etwas länger standgehalten, doch auch damit war es nun vorbei, wie der einsinkende Wagen zeigte.
»Eins, zwei und drei!«, schrien die Männer von hinten, und sie stemmte sich bei drei mit gegen den Wagen, der schließlich ächzend und quietschend nach vorn rollte.
Sie ging Richtung Fährmast und spähte in die Dämmerung. Schemenhaft machte sie auf der anderen Seite einen Turm und Gebäude aus, und plötzlich entdeckte sie in der Flussmitte die Fähre, die so stark hin- und herschaukelte, dass sie jeden Augenblick zu kentern drohte. Nacheinander gesellten sich die Knechte zu ihr und brüllten dem Fährmann aufmunternde Rufe zu. Einer schwenkte eine Laterne, und nach bangen Minuten blinkte es von der Fähre zurück.
»Bravo! Das heißt doch, er ist außer Gefahr, nicht wahr?« Ängstlich wandte sich Luisa an den Burschen neben ihr.
»Mann, du bist aber noch grün hinter den Ohren!« Er gab ihr einen Klaps gegen den Hinterkopf. »Machst dir gleich in die Hosen!« Sein raues Lachen unterschied sich kaum vom Geheul des Windes.
Luisa zog den Hut in die Stirn und hielt von jetzt an den Mund. Wenn Armido auch nur die leiseste Ahnung hätte, wo sie war – er würde sie sofort nach Hause schicken lassen. Pietro machte sich wahrscheinlich große Sorgen, aber sobald sie die Alpen erreicht hatte, würde sie eine Nachricht schicken. Vorher nicht, sonst würde er sie zurückholen lassen. Nur das nicht! Nach Armidos Abreise hatte sie fieberhaft überlegt, wie sie nach Frankreich gelangen konnte. Dass sie Geld brauchte, war die erste Hürde, und sie hatte wochenlang mit sich gerungen, aber es gab keine andere Möglichkeit – sie musste ihre eigene Familie bestehlen. Von da an hatte sie jede Gelegenheit genutzt, sich in Pietros ufficio zu schleichen und einen oder zwei Scudi aus seiner Schatulle zu nehmen. Sie wusste, dass Pietro es nicht sofort bemerken würde, denn seine Buchführung war ein einziges Durcheinander, was ihre Gewissensbisse jedoch nicht minderte. Vielleicht hatte er inzwischen das Fehlen des Geldes bemerkt, es mit ihrem Verschwinden in Verbindung gebracht und war wütend auf sie. Was Simonetta und Tomaso sagten, wollte sie sich gar nicht erst ausmalen.
Aber sie hatte keine andere Lösung gesehen. Ihre Familie hätte ihr niemals erlaubt zu reisen, und über eigenes Geld verfügte sie nicht. »Lieber Gott«, flüsterte sie, »Vergib mir. Nur du allein weißt, was die Kunst mir bedeutet. Hättest du nicht gewollt, dass ich male, hättest du mir kein Talent schenken dürfen!« Sie ballte die Fäuste und starrte in die zunehmende Dunkelheit hinaus. Den Regen, der ihr hart ins Gesicht schlug, spürte sie nicht.
»Betest du schon für die Überfahrt, Bürschlein?« Der Knecht stieß sie unsanft in die Rippen und schwenkte die Laterne. »Da kommt die Fähre!« Er drehte sich um und winkte den anderen, die im Schutz des Wagens warteten.
Es bedurfte einiger Überredung und Signor Vettorinis Versprechen auf die Verdopplung des Fährgelds bei Ankunft, bis der Fährmann sich mürrisch wieder auf seinen wenig vertrauenerweckenden Kahn begab. Bei dem Versuch, auf die Fähre zu rollen, wären die Maultiere samt Wagen fast in die aufgewühlten Fluten gerissen worden, doch die Knechte brüllten und rissen die armen Tiere mit aller Kraft an den Halftern, bis sie auf den schwankenden Planken standen. Mit Schaum vor den angstgeweiteten Nüstern standen die Maultiere zitternd an Bord, doch außer Luisa schien das niemanden zu kümmern.
»Ist ja gut.« Beruhigend strich sie den Maultieren über die Köpfe. Die Wärme der Tierkörper war tröstlich und lenkte sie von der schwankenden Fähre ab. Die Vettorini saßen in ihrem Wagen, einem schlecht gefederten, aber solide gezimmerten Gefährt. Während der Fahrt hatte Signora Vettorini den Mädchen aus der Bibel vorgelesen. Wenn diese gottesfürchtigen Leute entdeckten, dass sie eine Frau war, würden sie sie sofort der Blasphemie bezichtigen und dem nächsten Kirchengericht, schlimmer noch, der Inquisition ausliefern. Luisa schauderte. Allein das Wort war furchterregend. Zu viele Unschuldige waren bereits auf den Scheiterhaufen gestorben, und ein Ende des Alptraums schien nicht in Sicht. Schuld war der neu ernannte Kardinal Gian Pietro Carafa, der Papst Paul III. ständig mit neuen Forderungen nach strengerer Verfolgung der Ketzer in den Ohren lag. In Frankreich war alles anders, musste es besser sein. Marguerite d’Angoulême, die Schwester des Königs, stand den reformistischen Kreisen nahe und sympathisierte sogar mit dem ketzerischen Luther.
»Träumst du? Los, pack mit an, Bursche. Wir sind gleich da!« Einer der Männer, die zu Vettorinis Reisegruppe gehörten, klopfte den Maultieren auf die Flanken und deutete in die nun fast undurchdringliche Dunkelheit. Wind und Regen schienen eher zu- als abzunehmen, und Luisa musste die Augen zusammenkneifen, um das Licht am anderen Ufer ausmachen zu können. Das Wasser hing in dicken Tropfen an ihren Wimpern, und ihre Kleidung war vollständig durchweicht. Die Angst vor dem Ertrinken wich der Kälte, die ihre Glieder emporkroch und ihre Zähne klappern ließ.
Das Gefährt von der Fähre herunterzulotsen war deutlich einfacher als das Auffahren, denn sobald die Maultiere das sichere Ufer witterten, hatten sie kein anderes Ziel, als den schwankenden Kahn zu verlassen.
»Gibt es hier ein Gasthaus?«, fragte sie den Fährmann, der sich den versprochenen Lohn von Signor Vettorini auszahlen ließ.
»Da drüben. Ob die euch noch aufmachen, weiß ich allerdings nicht.« Der mürrische Mann zog den gewachsten Umhang, an dem das meiste Wasser abperlte, enger um die Schultern und machte sich mit seinem Gehilfen daran, das Fährboot sicher zu vertäuen.
Auf dieser Seite schlugen die Fluten der Elsa zwar ebenso heftig gegen das Ufer, doch gab es hier eine befestigte Kaimauer, die wesentlich höher war als auf der anderen Flussseite. Unförmige Schatten ließen Gebäude erahnen. Der Turm, den sie von drüben gesehen hatte, musste einer von ihnen sein. Luisas Zähne klapperten so heftig, dass sie sich ernsthafte Sorgen um ihre Gesundheit zu machen begann. Bisher hatte sie Glück gehabt. Der Herbst war warm und trocken gewesen, doch seit einer Woche war das Wetter umgeschlagen und hatte seinen vorläufigen Höhepunkt in diesem Sturm erreicht.
Niemand schien von ihr Notiz zu nehmen. Zwei der Knechte halfen den Vettorini mit dem Gepäck und hielten Decken über sie, um sie notdürftig vor dem Regen zu schützen. Die anderen Männer befreiten die Maultiere aus dem Geschirr und führten die entkräfteten Tiere zu den Ställen des Gasthauses. Anscheinend ging Signor Vettorini davon aus, dass man ihnen Unterkunft geben würde. Luisa holte ihr Bündel aus dem Wagen, den die Männer hinter einen Verschlag am Kai geschoben hatten. Dann folgte sie der kleinen Gruppe, wobei ihre Stiefel knöcheltief im Matsch versanken.
Der Turm, den sie als Silhouette ausgemacht hatte, war Teil einer ehemaligen Stadtmauer. Die beiden halbverwesten Leichname, welche der Sturm gegen die Mauer schlug, machten die Siedlung nicht einladender. Was auch immer die Männer verbrochen hatten, jetzt dienten sie nur noch der Abschreckung von Gesindel. Luisa wich dem Fuß eines Gehenkten aus, der ihr vor das Gesicht geweht wurde.
Im Windschatten der Mauer duckte sich das Gasthaus, das seinen Namen kaum verdiente, denn es war nicht mehr als ein stinkender Schankraum, in dem in den Ecken Stroh aufgeschüttet war. Der Lehmboden war stellenweise feucht, und Luisa starrte angeekelt auf die schnarchenden Gestalten, die sich in Lumpen gehüllt bereits zum Schlafen niedergelegt hatten.
Signor Vettorini holte eine Münze hervor und zeigte sie dem Wirt, der sie mit gierigen Händen ergreifen wollte. »Nein, zuerst zeigst du uns eine Kammer. Für mich und meine Familie.« Der toskanische Kornhändler war alt, aber noch immer eine Ehrfurcht gebietende Erscheinung.
Grinsend hob der Wirt die Hände. Seine schwulstige rote Nase und die zahnlose Mundhöhle, der ein fauliger Gestank entwich, ließen Vettorini zurücktreten. »Ich habe keine Gästekammer. Müsst schon hier liegen wie die anderen auch.« Erneut griff er nach der Münze.
Doch Signor Vettorini ließ sich nicht abweisen. »Dann gib uns deine Kammer!«
Die Mädchen wimmerten und versteckten sich hinter ihrer Großmutter. Die Gier des Wirtes siegte, und die Vettorini zogen in dessen Kammer, aus der nun eine schlechtgelaunte Frau und drei Kleinkinder kamen, die sich sofort auf eines der Strohlager legten. Da Luisa kaum genug Geld für ihre Reise hatte, musste sie sich mit dem Einfachsten zufriedengeben, was in diesem Fall wahrlich einer Strafe gleichkam. Überall an den Wänden und auf dem Boden schien es sich zu bewegen, und sie war davon überzeugt, dass die Wanzen nur darauf warteten, sich auf sie stürzen, sobald das Licht erloschen war. Es gab noch zwei Ecken mit Strohhaufen, auf denen sich drei der Knechte bereits niederließen. Die beiden anderen verkündeten, lieber bei den Tieren zu nächtigen.
»Ich komme mit euch!«, sagte sie rasch und ging wieder in den Regen hinaus.
Der Stall war zugig und bot kaum genügend Raum für die vier Maultiere und drei Pferde, doch Luisa kauerte sich an einem Pfosten auf eine Kiste und legte die Arme um die angezogenen Beine. Ihre nassen Sachen konnte sie nicht ausziehen, und es gab auch kein Feuer, an dem sie sich hätte trocknen können. »Madonna, lass mich nicht schon auf diesem ersten Stück meiner Reise scheitern«, murmelte sie, drückte ihr Bündel mit den Werkzeugen und Zeichnungen an sich und driftete in einen Zustand zwischen Wachen und Träumen, aus dem sie erwachte, weil etwas sie berührte.
»Was …?«
Einer der Knechte kniete neben ihr und versuchte offensichtlich, ihr den Lederbeutel zu entwenden. »Verdammt! Hau ab!« Wütend trat sie nach dem Burschen, dessen Blick nichts Gutes verhieß.
Er hatte kurze Haare, eine schiefe Nase, und eine Narbe zog sich quer über seine Stirn. Ihre Tritte bewirkten, dass er umso fester zupackte. »Gib schon her. Du fährst doch nach Frankreich, habe ich gehört. Dann hast du bestimmt auch Geld dabei.«
Gegen seine rohe Gewalt hatte sie kaum eine Chance, und Tränen der Wut liefen ihr über die Wangen, während sie verzweifelt ihren Beutel verteidigte. »Das ist alles, was ich habe! Versteh das doch!« Ihre Stimme wurde höher und schriller und weckte den zweiten Knecht auf, der im Heu hinter den Pferden gelegen hatte.
»He, gebt Ruhe! Fosco, lass den Jungen zufrieden. Der ist doch noch ein halbes Kind.«
Fosco ließ den Beutel los, spuckte aus und stieß Luisa zurück. »Hast Glück gehabt, aber sieh dich vor, noch sind wir nicht in Lucca …« Dann trollte er sich zu den Maultieren.
Für den Rest der Nacht machte Luisa kein Auge mehr zu und erhob sich, sobald es hell wurde. Ihr ganzer Körper schien zu schmerzen, und ihr war heiß. Wahrscheinlich hatte sie Fieber. Der Umhang war noch immer feucht. Sie warf einen vorsichtigen Blick zu den Knechten, die beide noch schliefen. So leise, wie es ihr möglich war, stieg sie über Halfter und Kisten und drückte die Stalltür auf. Die Tiere schnaubten und stapften unruhig hin und her.
Der Sturm hatte sich gelegt und der Regen aufgehört. Die Wege waren noch immer aufgeweicht, doch zumindest sichtbar. Luisa war sich darüber im Klaren, dass sie zu Fuß wesentlich länger brauchen würde, doch wenn der hinterhältige Fosco ihr den Beutel stahl, wäre ihre Reise zu Ende, noch ehe sie richtig begonnen hatte. Es war nicht nur das Geld, sondern vor allem ihre Zeichnungen und die Gussformen, die sie mitgenommen hatte und wie einen Schatz hütete. Im Grunde genommen waren es ihre Formen, in Pietros Werkstatt von ihr hergestellt. Sie biss sich auf die Lippen. Natürlich würde Pietro die Formen vermissen, aber er konnte neue machen. Sie brauchte die Stücke. Allein mit diesen Beweisen ihrer Kunstfertigkeit würde sie Zugang zu Rossos Werkstatt finden. Sie wusste nicht, wie Armido reagieren würde, aber wenn sie Meister Rosso ihre Arbeit zeigte und der sie akzeptierte, dann konnte selbst ihr Bruder nichts dagegen sagen, wenn sie in Frankreich blieb.
Frankreich! Ein Lächeln glitt über Luisas Gesicht, während sie tapfer durch den Schlamm schritt, immer auf der Hut vor dem Wagen der Vettorini. Zwei Tage hielt sie ihren Fußmarsch nach Lucca durch, wo sie für eine Nacht Zuflucht in einem Kloster fand. Auf der Via Aurelia ging sie weiter Richtung Massa, doch am vierten Tag wehrte sich ihr Körper gegen die Strapazen der Reise mit völliger Entkräftung und Fieber. Ihre Knie versagten ihr beinahe den Dienst, als sie kurz vor Sonnenuntergang Hundegebell und Kinderstimmen hörte. Zu ihrer Linken lag irgendwo das Tyrrhenische Meer, und rechts von ihr begannen die Apuanischen Alpen, doch während sie noch darüber nachdachte, ob sie vielleicht ein Schiff nach Marseille hätte nehmen sollen, verließen ihre Kräfte sie endgültig, und sie sank besinnungslos zu Boden.
Etwas Feuchtes wischte ihr über das Gesicht und brachte sie wieder zu Bewusstsein. Sie schlug die Augen auf und sah eine Hundeschnauze vor sich.
»Beppo, was machst du da? Komm her!« Eine energische Jungenstimme rief den zotteligen Hund zurück.
Später erinnerte Luisa sich nur noch daran, dass man sie auf einen Wagen gelegt und in einem Heuschober warm zugedeckt hatte. Es war noch dunkel, als sie die Augen öffnete. Zuerst griff sie nach ihrem Filzhut, der sich während der Reise in ein unförmiges Gebilde verwandelt hatte, und dann nach ihrem Beutel. Beides lag neben ihr im Heu. Milchkühe und Ziegen drängten sich dicht neben ihrem Heuboden und ließen den Stall auch in der Nacht nicht auskühlen. Sie hörte das Scharren der Tiere und wollte aufstehen, doch der Kopf schmerzte ebenso wie die Glieder, und sie sank erneut in tiefen Schlaf.
»Signorina, aufwachen.« Jemand rüttelte sanft an ihrer Schulter.
Das Licht blendete sie. Blinzelnd schaute sie in eine Laterne, die jemand vor ihr in die Höhe hielt. Plötzlich durchfuhr sie die Erkenntnis, dass dieser jemand hinter dem Licht sie als Frau erkannt hatte, und Angst schnürte ihr die Kehle zu. »Ich …«, stotterte sie hilflos und griff nach ihren Sachen.
»Mein Sohn hat Euch gefunden, völlig entkräftet. Ihr habt drei Tage und Nächte geschlafen.«
Ihre Nervosität legte sich etwas. Vor ihr kniete eine Frau und hielt die Laterne so, dass Luisa ihr Gesicht erkennen konnte. Es war ein freundliches Gesicht mit sanften Augen. »Wie, ich meine, warum habt Ihr mich hierher …?«
Die Frau lächelte und legte eine kräftige Hand auf die Luisas. »Ihr seid eine Frau in Not, und ich habe Euch geholfen. Aber heute kommt mein Mann zurück. Ihr müsst gehen. Hier.« Sie reichte Luisa einen Korb. »Brot, Käse und etwas Schinken. Davon könnt Ihr drei bis vier Tage essen.«
Luisa erhob sich mit Hilfe ihrer unerwarteten Retterin und stieg hinter ihr die Stiege in den Stall hinunter. Ihr Kopf schmerzte kaum noch, die Glieder fühlten sich steif an, doch der Schwindel und das Fieber schienen verflogen. »Ich danke Euch. Wie kann ich mich …?«
Die Bäuerin drehte sich zu ihr um. »Helft einer anderen, wenn Ihr könnt, und sagt mir doch, nur wenn es Euch möglich ist, warum verkleidet Ihr Euch als Mann?« Kaum hörbar setzte sie hinzu: »Gehört Ihr zu den Armen Christi, die man die Waldenser nennt?«
Im flackernden Licht der Laterne versuchte Luisa, Arglist in den Zügen der Frau zu entdecken, doch diese sah sie nur neugierig an. »Nein, ich will zu meinem Bruder nach Frankreich. Ich bin eine Künstlerin.«
»Dann sind das Eure Zeichnungen in dem Beutel? Eine Frau, die malt, ist nicht weniger eine Ketzerin als eine, die dem neuen Glauben anhängt. Nehmt Euch in Acht.«
Eine Ziege meckerte, und die Kühe wurden unruhig, denn es wurde langsam hell. »Wer sind die Waldenser?« Sie wusste kaum etwas über diese Gruppe, die den Reformisten nahestand, aber es hieß, sie gehörten zu den schlimmsten Ketzern und würden alle im Höllenfeuer brennen.
Die Bäuerin löschte die Laterne. »Kommt jetzt. Mein Mann würde mich zu Tode prügeln, wenn er erführe, dass ich überhaupt davon gesprochen habe.«
Vorsichtig drückte die Bäuerin die Tür auf, spähte in das morgendliche Zwielicht und deutete auf eine dunkle Masse in der Ferne. »Hinter dem Wald liegt die Straße nach Pontremoli, dann seid Ihr schon fast am Apennin. Gott mit Euch!«
Luisa stülpte ihren Hut über und schulterte ihren Beutel. Den Korb nahm sie in eine Hand. »Danke! Gott möge es Euch vergelten!«