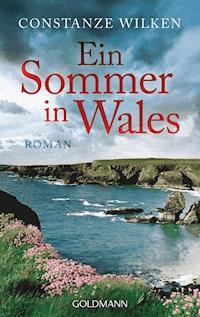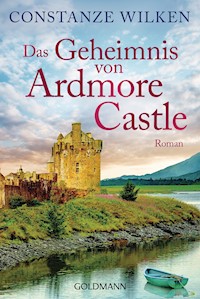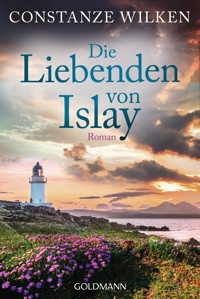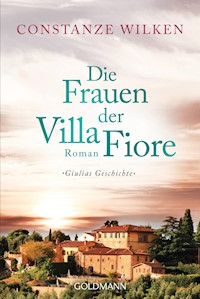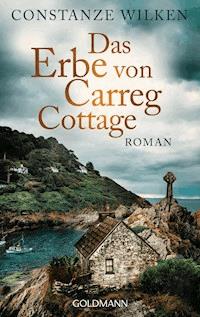6,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
So spannend wie einfühlsam, eine Geschichte von Liebe, Macht und Verrat: »Die Tochter des Tuchhändlers« von Constanze Wilken als eBook bei dotbooks. Lucca, 1525: Ein dunkles Omen überschattet die Ehe von Beatrice Rimortelli und Federico Buornardi, als am Vorabend ihrer Hochzeit ein päpstlicher Gesandter im Dom der Stadt ermordet wird. Und tatsächlich wird die frisch vermählte Beatrice von ihrem Gatten nur mit grausamer Verachtung behandelt, während er sich mit undurchsichtigen Geschäftspartnern einlässt. In dem kalten, goldenen Käfig ihrer Ehe ist Beatrices einziger Lichtblick ausgerechnet Mateo, ihr Schwager. Bald schon erwächst aus ihrer Freundschaft eine zarte Liebe, von der nie jemand etwas erfahren darf. Doch als Beatrice einer Verschwörung auf die Schliche kommt, die nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre Heimatstadt zerstören könnte, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen: Ganz allein begibt sie sich auf eine gefährliche Reise nach Rom … »Constanze Wilken versteht es, die Geschehnisse bildhaft und lebendig darzustellen. Sie baut von der ersten Seite an einen Spannungsbogen auf, der den Leser fesselt.« Heider Anzeiger »Der lebendige, spannende Schreibstil macht es dem Leser schwer, die Romane aus der Hand zu legen.« Dithmarscher Landeszeitung Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde historische Roman »Die Tochter des Tuchhändlers« von Constanze Wilken. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Lucca, 1525: Ein dunkles Omen überschattet die Ehe von Beatrice Rimortelli und Federico Buornardi, als am Vorabend ihrer Hochzeit ein päpstlicher Gesandter im Dom der Stadt ermordet wird. Und tatsächlich wird die frisch vermählte Beatrice von ihrem Gatten nur mit grausamer Verachtung behandelt, während er sich mit undurchsichtigen Geschäftspartnern einlässt. In dem kalten, goldenen Käfig ihrer Ehe ist Beatrices einziger Lichtblick ausgerechnet Mateo, ihr Schwager. Bald schon erwächst aus ihrer Freundschaft eine zarte Liebe, von der nie jemand etwas erfahren darf. Doch als Beatrice einer Verschwörung auf die Schliche kommt, die nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre Heimatstadt zerstören könnte, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen: Ganz allein begibt sie sich auf eine gefährliche Reise nach Rom…
»Constanze Wilken versteht es, die Geschehnisse bildhaft und lebendig darzustellen. Sie baut von der ersten Seite an einen Spannungsbogen auf, der den Leser fesselt.« Heider Anzeiger
»Der lebendige, spannende Schreibstil macht es dem Leser schwer, die Romane aus der Hand zu legen.« Dithmarscher Landeszeitung
Über die Autorin:
Geboren an der norddeutschen Küste zog es Constanze Wilken nach einem Studium der Kunstgeschichte, Politologie und Literaturwissenschaft für einige Jahre nach England. Im wildromantischen Wales entdeckte sie ihre Leidenschaft für das Schreiben, aber auch für Antiquitäten. Die Forschungen zur Herkunft seltener Stücke und ausgedehnte Reisen der Autorin sind Inspiration und Grundlage für ihre Romane.
Die Website der Autorin: constanze-wilken.de
Bei dotbooks erschienen bereits folgende Romane:
»Die Frau aus Martinique«
»Was von einem Sommer blieb«
»Die vergessene Sonate«
»Das Geheimnis des Schmetterlings«
»Die Frauen von Casole d'Elsa«
»Das Licht von Shenmoray«
Weiterhin veröffentliche Constanze Wilken bei dotbooks den folgenden historischen Roman:
»Die Malerin von Fontainebleau«
***
eBook-Neuausgabe Mai 2021
Copyright © der Originalausgabe 2007 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/faestock, Morphart Creations, Everett - Art
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-327-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Tochter des Tuchhändlers« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Constanze Wilken
Die Tochter des Tuchhändlers
Roman
dotbooks.
O che lieve è inganar chi s'assecura!
Que' duo bei lumi assai più che 'l sol chiari
Chi pensó mai veder far terra oscura?
Wie leicht ist's, den zu täuschen, der sich sicher fühlt!
Die beiden Lichter, heller als die Sonne,
wer dachte je, dass sie zu dunkler Erde würden?
(Francesco Petrarca: Canzoniere)
Vorbemerkung
Das frühe sechzehnte Jahrhundert war für Italien eine Zeit der Kriege, bestimmt vor allem durch die Fremdherrschaft der mächtigen Staaten Frankreich und Spanien. 1512 zwangen die Schweizer die Franzosen zurück über die Alpen, doch bereits 1515 triumphierte Franz I. erneut auf italienischem Boden. Erst dem Habsburger Karl V. gelang es 1525 in der Schlacht bei Pavia, die Franzosen für zwei Jahrhunderte aus Italien zu vertreiben. Aber auch Karl hatte Probleme, seine Herrschaft über die spanischen Erblande, die Niederlande und das Habsburger Territorium zu behaupten. Der ausbrechende Religionskonflikt, der in Luthers Thesen und schließlich in der Aufspaltung der Kirche gipfelte, und das zu den Bauernkriegen führende Aufbegehren gegen die Feudalherrschaft zerrütteten die deutschen Lande, und die andauernde Bedrohung Europas durch das Osmanische Reich verschlang Unsummen an Kriegskosten.
Vor diesem Hintergrund kommt es zum Konflikt zwischen Karl V. und Papst Clemens VII., denn Karl V will das römische Weltreich unter weltlicher Vorherrschaft wiederauferstehen lassen. Clemens VII., eigentlich Giulio de' Medici, ist der illegitime Sohn Giuliano de' Medicis und der zweite Medici, der den päpstlichen Thron bestieg. Entscheidend dafür war die Protektion Karls V Die Erwartungen an Clemens sind hoch, man spricht bereits von einem neuen mediceischen Goldenen Zeitalter, in dem die Künste und Wissenschaften, von seinem unbeliebten Vorgänger Hadrian VI. vernachlässigt, wieder gefördert werden. Doch Clemens wird als unseligste Papstgestalt in die Geschichte eingehen. Sein Streben nach Macht und seine undurchsichtige Bündnispolitik stürzen nicht nur Rom ins Verderben, sondern auch die kleine toskanische Stadt Lucca.
Italien ist seit langem in zwei Lager gespalten: Guelfen (Papstanhänger) und Ghibellinen (Kaisertreue). Lucca steht unter kaiserlicher Protektion, doch es gibt auch dort Unzufriedene, die bereit sind, mit dem Papst zu paktieren und ihre Stadt der eigenen Gier nach Macht und Geld zu opfern.
Durch eine perfide Intrige von Clemens wird die unabhängige Republik Lucca, die ihren Reichtum dem Seidenhandel verdankt, in einen Strudel verheerender Ereignisse gezogen ...
IDom San Martino, 11. Januar 1525
Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten,
aber der Gottlosen Weg vergeht.
(Psalter I, 1,6)
Ein sternenklarer Nachthimmel lag über Lucca und den toskanischen Hügeln. Der Nachtwächter blies zur zwölften Stunde, danach störte nur noch das Jaulen eines streunenden Hundes die friedliche Stille.
In der Sakristei des Domes San Martino wurde eine Kerze entzündet, und jemand rüttelte das Kohlebecken, um die Hitze der Glut neu zu entfachen. Hüstelnd zog der Mann einen Schlüssel aus seinem pelzverbrämten Umhang und schloss umständlich einen Wandschrank auf. Er klappte die Türen zurück und entnahm dem dunklen Schrankinnern nach einigem Suchen eine Karaffe und zwei silberne Kelche. Während er Rotwein eingoss, blinkte im flackernden Kerzenlicht ein prächtiger Ring an seiner rechten Hand auf. Agnello Agozzini ließ sich auf einen gepolsterten Stuhl sinken, seufzte zufrieden und hob einen der Kelche an seine vollen Lippen.
Genüsslich kostete er das reiche Bouquet des sizilianischen Rotweins, der auf den Gütern seines Gastgebers, Francesco Sforza de Riario, Bischof von Lucca, angebaut wurde. Lucca war nicht Rom, aber für einen zielstrebigen Mann wie den Bischof eine wichtige Station auf dem Weg zum Kardinalshut. Agozzini bleckte die Zähne und wischte sich die Schweißperlen von der Oberlippe. Rom! Wie sehr er das ausschweifende Leben in der Ewigen Stadt liebte. Nun, er würde nicht lange hierbleiben müssen. Wie es den Anschein hatte, würde sich sein Auftrag einfacher ausführen lassen, als er zu hoffen gewagt hatte, und wenn Flamini, der Geheimsekretär von Clemens VII., zufrieden war, würde Seine Heiligkeit sich dessen erinnern, was man ihm versprochen hatte, falls der Plan erfolgreich ausgeführt wurde. Dieser skrupellose und heimtückische Verrat war typisch für die päpstliche Politik. Allerdings hatte der Plan seine Schwachstellen, aber das musste man bei einem Unternehmen dieser Größenordnung in Kauf nehmen. Mit kleinen, unbedeutenden Intrigen gab er sich nicht ab. Ihn reizte die Herausforderung, denn er war ein Mann mit Visionen. Agozzini lächelte. Morgen Nacht würde er sich an einen geheimen Ort begeben und den Mann treffen, für den er ein Schreiben Flaminis mit dem päpstlichen Siegel bei sich trug.
Aber die heutige Nacht gehörte ihm und jenem schönen Jüngling, auf den er hier mit wachsender Nervosität wartete. Er hatte schon befürchtet, sich im provinziellen Lucca zu langweilen. Wie man sich täuschen konnte! Die Luccheser waren anders als die Römer, sie gaben sich zurückhaltend und verschlossen, zumindest Fremden gegenüber. Dass sie aber genauso lasterhaft und verschlagen waren wie jeder andere Italiener auch, hatte er schnell gemerkt. Er schnippte mit zwei Fingern gegen die Karaffe. Letztlich waren sie nur Kaufleute, und womit errang man am einfachsten das Herz eines Kaufmanns? Mit Geld.
Agozzini leerte den Kelch in einem Zug, um ihn gleich wieder zu füllen. Nein, er tat den Lucchesern Unrecht – es gab etwas, das sie genauso sehr liebten wie ihren Wohlstand: ihre Republik. Vielleicht hatten sie auch nur Angst um ihren Reichtum und zahlten deshalb seit Jahren enorme Summen an Kaiser Karl V, der ihnen im Gegenzug seine Protektion und den Erhalt der Republik garantierte. Auf die eine oder andere Art bestand eben immer eine Abhängigkeit.
Seine Beine kribbelten unangenehm. Er beugte sich vor und rieb die Waden, deren weiße Haut fleckig aussah. Der lästige Ausschlag zog sich von den Fußsohlen aufwärts. Egal, welchen Quacksalber er bisher gefragt hatte, keiner hatte ihm helfen können. Bevor er erneut nach dem Kelch griff, zog er seine Beinkleider wieder herunter. Der kühle Seidenstoff war angenehm auf der Haut. Mit großer Sorgfalt hatte er sich heute Abend gekleidet. Ohne Übertreibung konnte er von sich behaupten, noch immer ein gutaussehender Mann zu sein. Das Leben hatte zwar Spuren in seinem Gesicht hinterlassen, doch Erfahrenheit und Macht wogen in den Augen der Jugend oft mehr als unschuldige, blasse Schönheit.
In gespannter Erwartung horchte er in das Kirchenschiff. Würde er kommen? Agozzini leckte sich die Lippen und rückte bei dem Gedanken an das ebenmäßige Gesicht des Jünglings und dessen geschmeidigen Körper seinen Hosenbund zurecht. Für frisches, weiches Fleisch unter seinen erfahrenen Händen und den Anblick eines wohlgeformten männlichen Körpers hätte er seine Seele verkauft. Der junge Mann war ihm auf der Piazza vor dem Dom aufgefallen, wo er in Begleitung einiger Edler und Kaufleute gestanden hatte. Wie zufällig hatten sich ihre Blicke getroffen. Agozzini schloss seine Lider in Erinnerung an die dunklen Augen unter langen, dichten Wimpern, die ihm eine unmissverständliche Botschaft gesandt hatten.
Das Zuschlagen einer Tür ließ den päpstlichen Gesandten aus seinen Träumereien auffahren. Nervös zupfte er an seinem Mantel. Verhaltene Schritte näherten sich aus dem Hauptschiff. Am Klang der unterschiedlichen Bodenbeläge hörte er, wie sich der Besucher näherte. Durch die Seitentür, die Agozzini unverschlossen gelassen hatte, war der Besucher eingetreten, an der Figurengruppe des heiligen Martin vorbei durch das Mittelschiff gegangen und passierte jetzt den Tempietto del Volto Santo von Civitali. Eine lose Marmorfliese verriet ihn. Agozzinis Herz begann schneller zu schlagen, und er umklammerte die Stuhllehne, als die Tür zur Sakristei langsam aufschwang und ein schlanker Jüngling eintrat.
»Du bist gekommen ...«, murmelte Agozzini.
Der Mann vor ihm verkörperte das Abbild göttlicher Vollkommenheit und ließ ihn erschauern, wie er dort lässig im Türrahmen stand, die langen Haare aus dem Gesicht streichend, dessen gerade Nase zu den perfekt geschwungenen Lippen und dem Kinn mit einem zarten Grübchen passte. Allein der Anblick dieses Mannes war jedes Risiko wert, denn dass er ein nicht unbeträchtliches Wagnis einging, indem er sich allein und zu nächtlicher Stunde hier mit einem Fremden verabredete, war Agozzini bewusst. Aber er befand sich im Dom des Bischofs, und welcher Luccheser würde es wagen, sich an ihm zu vergreifen? Er, Agnello Agozzini, stand unter dem Schutz Seiner Heiligkeit Papst Clemens VII.
»Euer Exzellenz.« Der Jüngling ließ seinen wollenen Umhang auf den Boden gleiten und machte einen Schritt auf den Gesandten zu. Plötzlich fiel er vor ihm auf die Knie und ergriff Agozzinis Hand, um seine Lippen auf den Ring zu pressen.
Wie elektrisiert von der Berührung des Jünglings beugte sich Agozzini vor und legte seine Hand auf dessen dunkle Haare. Als er kühle Hände auf seinen Oberschenkeln spürte, schoss alles Blut in seine Lenden, er spreizte schwer atmend die Beine und hielt überrascht inne, als der junge Mann flüsterte: »Segnet mich, Vater, denn ich habe gesündigt.«
»Wie kann ein so vollkommenes Geschöpf sündigen? Hat nicht Gott uns unseren Körper geschenkt, damit wir ihn ehren?« Wollte er diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen, musste er sich zu mehr Geduld anhalten. Vielleicht war dieser Junge noch unschuldig? Umso süßer würde die Lust sein, die sie gemeinsam kosten würden. Agozzini hob sacht das Kinn des Jünglings an. »Du musst nicht vor mir knien. Ich bin es, der vor dir im Staub liegen sollte, weil du mehr in mir siehst als nur einen kirchlichen Würdenträger. Komm, steh auf und trink mit mir.«
Lautlos und mit der Wendigkeit einer Katze erhob sich der Jüngling und nahm den angebotenen Kelch. Während er ihn an den Mund setzte, suchte er Agozzinis Augen. In einem Zug leerte er den Kelch und stellte ihn wieder auf den Tisch.
Aus einer Tasche seines weiten Mantels zog Agozzini ein schmales Päckchen und reichte es dem Besucher. »Du hast schöne Hände, und diese Handschuhe werden sie wärmen, bitte. Sie sind aus feinstem Hirschleder.«
Lächelnd entfernte der junge Mann Kordel und Seidenpapier und streifte die edlen Handschuhe über. »Sie sitzen, als wären sie für mich gemacht.«
»Das sind sie, mein schöner junger Freund. Und ich hoffe sehr, dass ich dir noch viele kostbare Geschenke machen darf.« Ein Geräusch im Kirchenschiff ließ ihn aufhorchen.
»Ratten. Sie sind überall.«
Etwas im Tonfall seines Gastes ließ ihn Verdacht schöpfen. Mit flackernden Lidern musterte Agozzini sein Gegenüber und fand auf einmal Abscheu in den Augen, in denen er eben noch Bewunderung gesehen zu haben glaubte. Seine Erregung wich nervöser Anspannung. Mit zitternden Händen nahm er die Karaffe und goss erneut Wein in den Kelch seines Besuchers. Aus der Dunkelheit des Seitenschiffs drangen nun deutlich Schritte und leise Stimmen zu ihnen herein, doch der Jüngling rührte sich nicht, sondern musterte ihn kalt. Langsam zog er die Handschuhe aus und steckte sie in seinen Gürtel.
»Danke, ich werde an Euch denken, wenn ich sie trage.« Mit schnellen Schritten stellte er sich hinter den Stuhl des Gesandten und rief zur Tür: »Herein!«
Als dort drei Männer erschienen, wusste Agozzini, dass seine Todesstunde gekommen war. »Ich dummer alter Narr. Dass mir die Gunst eines solchen Lieblings der Götter geschenkt werden sollte, hätte mich stutzig machen sollen ...« Er schüttelte den Kopf.
»Wir alle haben unsere Schwächen, Euer Gnaden.« Einer der Männer trat aus der Dunkelheit auf ihn zu. Seine Stimme ließ ihn aufhorchen.
»Ihr?« Agozzini rief sich die Begegnung auf der Piazza ins Gedächtnis und erkannte plötzlich seinen Fehler. Der Jüngling hatte ihn in eine Falle gelockt. Er war der Diener dieses Mannes und nicht, wie er angenommen hatte, des Kaufmanns. Die Gesichter der anderen beiden kamen ihm bekannt vor, aber er wusste nicht, woher. Einer war kräftig und hatte das Auftreten eines Soldaten. Seine Überlegungen wurden jäh unterbrochen.
»Wen wolltet Ihr hier treffen, Agozzini, und wie lautet Euer Auftrag?«, fragte der Herr des Jünglings und stellte sich dicht vor ihn, während seine Begleiter sich in der Sakristei umsahen.
Angstschweiß lief ihm den Körper hinunter und sammelte sich am Hosenbund und in den Kniekehlen. Fieberhaft suchte er sich an den Namen des Wortführers zu erinnern, denn der Bischof hatte ihm die Männer auf der Piazza vorgestellt. »Ich bin Gast des Bischofs. Wir sind alte Freunde, und das solltet Ihr bedenken und Euch nicht zu etwas hinreißen lassen, das Euch schlecht bekommen könnte.«
Der Mann lachte leise, doch seine Augen musterten ihn kalt. »Der Einzige, der sich Sorgen machen sollte, seid Ihr. Ich frage noch einmal – wer ist Euer Verbündeter hier in Lucca?«
»Wie kommt Ihr überhaupt auf die Idee, ich hätte hier Verbündete? Mein Aufenthalt hier ist rein privater Natur.« Er sah sich um, fühlte jedoch im selben Augenblick den kalten Stahl eines Dolches an seinem Nacken.
»Versucht nicht zu schreien, Agozzini. Ihr könnt Euer Leben nur retten, wenn Ihr die Verräter hier in Lucca preisgebt.«
Sie konnten nichts wissen. Außer ihm und Flamini wusste niemand von dem Plan. Ihr Verbündeter hatte sich sehr geheimnisvoll gegeben und selbst ihm und Flamini seine Identität noch nicht verraten. Woher Flamini seine Überzeugung nahm, dass dieser es ehrlich meinte, wusste Agozzini nicht, aber der Geheimsekretär des Papstes war kein Trottel und erfahren im Einfädeln von Intrigen und politischen Ränkespielen. Flamini hatte den Brief in seinem Beisein verfasst und den Sekretär vorher hinausgeschickt. Die Erkenntnis traf ihn mit voller Wucht, dass er keuchend zusammensackte. »Dieser Wurm ...«, entfuhr es ihm. Mari, der Sekretär, musste gelauscht haben, anders konnte sich Agozzini nicht erklären, woher diese Männer von seinem Auftrag wussten.
»Nun?«
Der Mann, den er für einen Soldaten hielt, packte ihn an den Schultern. »Welchen stinkenden Verräter deckst du? Im Feld machen wir mit nichtsnutzigen Kreaturen wie dir kurzen Prozess ...«
Ein scharfer Schmerz durchfuhr Agozzinis Nacken, und warmes Blut rann die Haut herunter. »Ihr werdet mich töten, ob ich zum Verräter werde oder nicht.« Er fasste sich an den Hals, sah das Blut an seiner Hand und entschied sich für einen ehrenhaften Tod. Sein Leben hatte der Kirche gehört. Er war krank und wusste um die Qualen, die ihm die Franzosenkrankheit noch bescheren würde. Bedauerlich war nur, dass er nicht in den Genuss dieser Liebesnacht gekommen war, und in Gedanken daran umspielte ein zynisches Lächeln seine Lippen.
»Er wird nichts sagen.« Der dritte Mann hatte eine weiche Stimme. Unter seinem dunklen Umhang schimmerte ein silberbeschlagener Gürtel, in dem Dolch und Degen steckten. »Fast tut er mir leid.«
Der schöne Jüngling spuckte verächtlich auf den Boden. »Mir nicht. Ihm geht es nur um seine Lust. Dafür würde er Hunderte von Menschen opfern, seinen Gott um Verzeihung bitten und sich ruhig schlafen legen.«
Der große, schlanke Mann mit den aristokratischen Gesichtszügen musterte Agozzini eingehend. »Durchsucht ihn. Vielleicht trägt er ein Schreiben bei sich.«
Agozzini wurde auf die Füße gezogen und von dem Jüngling und dem Mann mit der angenehmen Stimme seines Mantels entledigt und durchsucht. Wenn sie den Brief fanden, würden sie ihn sofort töten. Er öffnete den Mund, um zu schreien, doch dazu kam er nicht mehr. Als hätten sie es geahnt, packten sie ihn, jemand presste ihm eine Hand auf seinen Mund und erstickte den Schrei in seiner Kehle. Mit weit aufgerissenen Augen sah er blinkenden Stahl aufblitzen und spürte kurz darauf einen brennenden Schmerz in seiner Brust. Noch wenige Male schlug sein Herz mit letzter Kraft, dann umklammerten Eisenzwingen seine Lungen, pressten ihm die Rippen zusammen, und röchelnd schnappte er wie ein verendender Fisch nach Luft. Das Letzte, was seine brechenden Augen sahen, war das Gesicht eines Engels, der lächelnd auf ihn herabsah, während eine dunkle Strähne das vollkommene Antlitz umspielte.
»Herr, in deine Obhut befehle ich mich ...« Agnello Agozzini, der päpstliche Legat, war tot.
IIHochzeit in Lucca, 12. Januar 1525
Der eisige Ostwind brachte Schnee. Beatrice wandte den Blick in Richtung des Apennin, dessen Ausläufer sie in der Ferne wusste. Die Glocken von San Frediano riefen zur Frühmesse. Sie hob den Blick zum Himmel, um die morgendliche Dunkelheit zu durchdringen. Eine Schneeflocke traf ihre Stirn. Sie schloss die Augen und fühlte, wie dicke Flocken ihre Haut berührten. Ein weißer Flaum bedeckte in kurzer Zeit Haare und Kleid, auf Gesicht und Dekolleté schmolzen die Flocken. Die absurdesten Gedanken zogen ihr durch den Kopf. Fühlte sich so das Paradies an? So sanft und kühl stellte sie sich den Himmel vor – oder den Tod. Vielleicht starb sie an Schwindsucht, und die Hochzeit würde abgesagt. Wie lange dauerte es, bis einen das Fieber packte? Clarice, die Tochter von Messer Vecoli, war im vergangenen Winter in die eiskalten Wasser des Serchio gestiegen und, obwohl man sie sofort herausgezogen hatte, innerhalb von drei Tagen gestorben.
Clarice war ihre Freundin gewesen, die einzige wirkliche Freundin, die sie je hier in Lucca gehabt hatte. Beatrice Rimortelli atmete die kalte Januarluft ein, die Hunderten kleiner Messerklingen gleich in ihre Lungen schnitt. Warum hatten sie aus Nürnberg fortziehen müssen? Die glücklichsten Jahre ihrer Kindheit hatte sie in der fränkischen Stadt verbracht, und obwohl sie als Fünfjährige nach Lucca gekommen war, erinnerte sie sich gut an ihren Onkel, die freundliche Tante und die vielen Nichten und Neffen, mit denen sie mancherlei Schabernack getrieben hatte. Hier in Lucca war sie immer eine Fremde geblieben.
Sie legte die Hände auf die verschneite Balustrade und beugte sich vor.
»Bei allen Heiligen! Seid Ihr ganz von Sinnen?« Ines, ihre Kammerzofe, kam außer Atem die Treppe heraufgestiegen, legte ihr einen Umhang um die Schultern und zog sie sanft an die Hausmauer zurück. »Ich suche seit einer Stunde nach Euch! Wie sollen wir Euch bis zum Empfang herrichten, wenn Ihr Euch hier oben versteckt?«
Ines wischte den Schnee von den Schultern ihrer Herrin und legte Beatrices lange, goldblonde Locken sorgsam über den Umhang. »Er ist ein guter Mann. Jedenfalls hat mir das Rosalba gesagt, und die muss es wissen, denn ihr Sohn arbeitet für Ser Buornardi. Pietro hat als Botenjunge angefangen, und jetzt ist er in der Schreibstube. Ja, der Signore hat ihn das Lesen und Schreiben lernen lassen und ...«
»Ines, bitte!« Beatrice ergriff die fleißigen, geröteten Hände ihrer Dienerin.
»Ihr weint ...«, flüsterte Ines bestürzt und wollte nach einem Tuch suchen, doch Beatrice hielt ihre Hände fest.
Ihre sonst so blassen Wangen waren von der Kälte gerötet. »Heute werde ich mein Elternhaus verlassen und zu einem Mann ziehen, den ich kaum kenne, von dem ich nur weiß, dass er genug Geld hat, um meine Mitgift zu bezahlen. Was werde ich für ihn sein? Eine Investition, die Sicherung seiner Nachkommenschaft ...« Bei dem Gedanken an das, was sie erwartete, erstarb ihre Stimme.
»Ich ... es tut mir leid, ich wollte Euch doch nur Mut machen ...« Umständlich zog Ines ein sauberes Tuch aus ihrer Schürze und tupfte damit die tränennassen Wangen ihrer Herrin trocken. Ines war einen halben Kopf kleiner als Beatrice, hatte eine kräftige Statur, schwarze Haare, die unter ihrer Haube hervorschauten, und sanfte, dunkle Augen, die Beatrice voller Mitleid betrachteten. »So ist das mit uns Frauen. Wir alle weinen vor der Hochzeit, aber nachher ist alles nur halb so schlimm.« Sie zwinkerte ihr zu. »Ihr habt ihn doch gesehen!
Ein stattlicher Mann. Was sind zehn Jahre? Immerhin ist er nicht alt, bucklig und zahnlos, und Ihr seid eine Schönheit! Welcher Mann könnte Euch widerstehen? Er wird Euch die Toskana zu Füßen legen, Euch mit Seide, Perlen und Pelzen überhäufen ... Allein der Verlobungsring muss ihn ein Vermögen gekostet haben.« Ines' Blick fiel bewundernd auf den großen Rubin an Beatrices Hand.
Angesichts des verzückten Gesichtsausdrucks ihrer Dienerin zwang sich Beatrice zu einem Lächeln. »Ich weiß, du meinst es gut, aber ich ...« Ihr Lächeln verschwand, und sie zog den Umhang enger um ihre Schultern.
»Oh, das wird Euch ablenken!« Ines' Gesicht hellte sich auf. »Heute früh ist in der Sakristei des Domes ein Toter gefunden worden!«
»Ein Messdiener?«
»Viel schlimmer!« Ines senkte die Stimme, anscheinend war das, was sie erzählen wollte, von anstößiger Natur. »Jemand hat den Gast des Bischofs ermordet, erstochen, heißt es, und er soll dort mit heruntergelassenen Hosen gelegen haben ...« Sie räusperte sich. »Und er soll gar nicht gesund ausgesehen haben.«
»Kein Wunder, er war tot«, bemerkte Beatrice trocken.
»Nicht doch, er soll die Franzosenkrankheit gehabt haben!«, schloss Ines triumphierend.
»Wie bitte?«
»Er hatte den Ausschlag! Untenherum soll er mit wässrigen Pusteln und Knoten bedeckt gewesen sein. Was treibt so ein vornehmer Signore nachts in der Sakristei? Warum ist er nicht zu den Huren gegangen oder hat sich eine mit auf sein Zimmer genommen? Dann wäre ihm das vielleicht nicht passiert.«
»Wenn er aber nicht an Frauen interessiert war, Ines?«
»Ihr denkt von den Priestern immer das Schlimmste.«
»Ich bitte dich, Ines. Zeig mir nur einen Priester, der nach den Regeln der Kirche lebt.«
»Pater Aniani!«, kam es spontan.
»Pater Aniani ist eine Ausnahme.« Der Priester lebte im Konvent von San Frediano und hatte sich durch seine Güte und vor allem durch seine erfolgreiche Lehrtätigkeit an der dortigen Armenschule einen Namen gemacht.
»Das mag sein, aber es gibt ihn. Madonna, ich verstehe Euch ja, aber seid ein wenig vorsichtiger mit dem, was Ihr über die Kirche sagt. Ich weiß, Ihr habt ein gutes Herz, und mich geht es nichts an, wenn Ihr Schriften von diesem Luther lest, aber Ihr seid nicht in deutschen Landen.« Ines hob seufzend die Schultern. »Hier herrscht der Papst. Allein wegen Eurer Herkunft wird man Euch mit Argwohn begegnen. Gebt ihnen keinen Anlass, Euch wehzutun.« Besorgt griff Ines nach der Hand ihrer Herrin.
Beatrice erwiderte den Druck. »Ich weiß schon, warum ich dich mitnehmen will. Du passt auf mich auf Aber jetzt geh und sag meiner Mutter, dass ich gleich komme.«
Nachdem die klappernden Schritte ihrer Zofe auf der Treppe verhallt waren, betrachtete Beatrice nachdenklich den Ring, der sie täglich an ihre Zukunft erinnerte. Selbst ohne direktes Licht schimmerte der Stein tiefrot und zeugte von seiner Herkunft aus Mogok in Asien, wo die schönsten Steine gefunden wurden. Gefasst war er in schlichtem Gold, was seine Wirkung erhöhte und für den erlesenen Geschmack ihres Bräutigams sprach.
Beatrice trat an die Brüstung des Turmes. Wie die meisten Palazzi wohlhabender Luccheser hatte auch der Palazzo ihrer Eltern einen hoch über den Häusern der Stadt aufragenden Turm, der den Stand ihrer Familie anzeigte. Der höchste Turm gehörte den Guinigis, eine der mächtigsten Familien der Stadt. Im vierzehnten Jahrhundert hatte Paolo Guinigi Lucca für einige Jahre regiert. Seitdem war die Stadt eine freie und stolze Republik. Freiheit, dachte Beatrice, ist nur für den von Bedeutung, der sie auch leben darf. Sehnsüchtig glitt ihr Blick zu den Bergen. Dahinter war die Welt. Dahinter lagen Mailand und Venedig. Von dort fuhren Schiffe in den Osten, von wo sie die kostbaren Güter mitbrachten, die Lucca reich gemacht hatten. Hinter den Alpen lag Nürnberg, ihre Heimat.
»Madonna!« Beatrice ballte ihre Hände auf der verschneiten Brüstung. »Gib mir Kraft ... gib mir Kraft ...«, flüsterte sie, warf einen letzten Blick über die Stadtmauer, drehte sich um und schritt langsam die Treppe hinunter.
Vertraute Gerüche schlugen ihr aus dem Hausinnern entgegen und vergrößerten ihre Wehmut, diesen Ort heute verlassen zu müssen. Sie hörte Ines eines der jungen Mädchen schelten, die sich um die Wäsche kümmerten. Überall eilten die Dienstboten in höchster Aufregung hin und her, Türen gingen auf und klappten zu. Aus dem Innenhof drangen die Stimmen der Knechte und das Klappern der Pferdehufe auf dem Pflaster zu ihr herauf. Darauf bedacht, ihrer Mutter nicht zu begegnen, die sie sofort zum Umkleiden gedrängt hätte, huschte Beatrice die Treppe hinunter, ließ die Küche hinter sich und eilte über den Hof zu den Zimmern, die zur Straße hin lagen. Hier befanden sich einige Verkaufs- und Lagerräume und das Kontor ihres Vaters, Messer Jacopino Rimortelli.
Leicht außer Atem schloss sie die massive Holztür hinter sich. Den Kopf über seine Kontobücher geneigt, stand Messer Rimortelli an einem der vielen Pulte aus dunklem Holz. Die Wände des langgestreckten Raumes waren von Regalen bedeckt, in denen sich Schriftrollen, unzählige Bündel Papier, sorgsam abgeheftete Dokumente und Reihen von hochformatigen Kontobüchern scheinbar ungeordnet aneinanderdrängten. Doch Beatrice wusste es besser. Alles hatte seinen Platz. Jahrelang hatte sie viele Stunden an der Seite ihres Vaters damit verbracht, Warenein- und -ausgänge zu notieren, Verträge in Bücher zu kopieren, Schriftwechsel mit den Partnergesellschaften in Konstantinopel oder Alexandria zu führen und Rechnungen zu prüfen. Zärtlich strich sie über die blanke Oberfläche eines Pults und nahm eine der Federn auf, die neben einem Tintenfass lag.
»Willst du etwa heute arbeiten?« Messer Jacopino hob den Kopf.
Sie erwiderte stumm seinen Blick, woraufhin ihr der Vater liebevoll eine Hand unter das Kinn legte. »Du würdest lieber hier mit mir über den Büchern stehen, habe ich recht?« Er schüttelte den Kopf und küsste sie auf die Wange. »Das hier ist nicht dein Weg.«
»Warum nicht, Vater? Warum kann ich nicht hierbleiben und dir helfen? All die Jahre war ich mehr als eine Sekretärin für dich. Ich kann rechnen, besser als ...«
»Beatrice«, unterbrach Messer Jacopino sie sanft, »du bist zu schön und zu jung, um hier zwischen den Papieren zu vertrocknen, während das Leben draußen vorüberzieht.«
»Aber ich liebe die Arbeit hier!« Trotzig sah sie ihn an, wohl wissend, dass es sinnlos war zu widersprechen.
»Du bist eine Frau, Beatrice, du bist mein einziges Kind, und ich möchte dich wohlversorgt sehen. Die Gesetze verbieten mir, dir den Handel zu übertragen. Ich habe sie nicht gemacht.« Messer Jacopino Rimortelli runzelte die Stirn und fuhr sich durch die grauen Haare, die widerspenstig von seinem Kopf abstanden.
In seinem Festtagswams aus blauem Samt sah er aus wie ein Aristokrat, was sie ihm nicht sagen durfte, denn er verabscheute den Adel, der für ihn die Zecke im Pelz des Schafes war. Schlimmer waren höchstens noch die Kleriker, allen voran der Papst, dessen selbstsüchtige Politik sie alle in den Ruin trieb. Clemens VII. war nicht nur ein Medici, sondern zudem ein hoffnungsloser Taktierer, dem jede Geradlinigkeit fehlte. Durch endloses Hinhalten hatte er sich das Vertrauen vieler Verbündeter verspielt. Obwohl Clemens ohne die Protektion von Karl V nie den Papstthron bestiegen hätte, zeigte er ihm gegenüber keine Loyalität, was sich ohne Zweifel irgendwann rächen würde. »Nein, Vater, ich weiß.« Sie legte ihm versöhnlich eine Hand auf den Arm.
Der Rubin funkelte im Licht, das durch die farbigen Fenster fiel. »Ein weniger kostbarer Ring hätte es auch getan. Mit diesem Geschenk bezeugt er seinen Willen, dich standesgemäß zu versorgen.«
»Nach einem Jahr wird er ihn verkaufen«, sagte Beatrice abfällig. Es war nicht unüblich, dass die Ehemänner teure Kleider und Schmuckstücke nach dem ersten Ehejahr veräußerten. Die prachtvollen Geschenke dienten meist nur dem Einführen des Brautpaars in die Gesellschaft. War dies geschehen, konnte der Ehemann alles, was er mit seinem Geld bezahlt hatte, wieder verkaufen.
Messer Jacopino winkte ab, holte eine eiserne Schatulle unter seinem Pult hervor und schloss sie auf In ihr bewahrte er Urkunden, Verträge und Papiere auf, die seine Besitzungen bezeugten. Er nahm eine Schriftrolle heraus. »Das ist mir wohlbekannt. Aber was auch immer dein Mann verkaufen wird oder nicht, und auch, wenn er dich nach seinem Tod unversorgt zurücklassen sollte – du musst niemals Not leiden. Dafür habe ich gesorgt. Ich darf dir zwar nicht den Großteil unseres Besitzes und das gesamte Land vermachen, aber die Villa in Gragnano wird dir gehören und auch ein beträchtlicher Anteil an Barvermögen. Es steht alles hier drin!« Er wog die Rolle in seiner Hand und legte sie zurück in die Schatulle.
»Danke, Vater«, flüsterte sie und wollte ihn umarmen, doch er wehrte ab.
»Du bist noch nicht umgekleidet. Deine Mutter wird dich suchen und das gesamte Haus in Aufruhr versetzen. Geh schon! Es wird alles gut werden ...« Er wandte sich ab und nestelte am Schloss der Kassette herum. Das Licht der Morgensonne fiel auf sein Gesicht und machte die vielen Linien sichtbar, die seine gütigen Augen umrandeten und seine Stirn durchzogen. Das Alter hatte Spuren hinterlassen, Spuren, die Beatrice so vertraut geworden waren, dass sie sie bis zu diesem Tag nicht bemerkt hatte.
»Du wirst mir fehlen ...«, sagte sie so leise, dass ihr Vater es nicht hörte. Beim Hinausgehen zog sie die Tür hinter sich zu und sah nicht, wie eine Träne auf die Kassette fiel.
Es hatte aufgehört zu schneien, und die Wolken waren aufgerissen. Die dünne Schneedecke im Innenhof war von Fußspuren übersät. Frische Pferdeäpfel dampften in der Kälte, Knechte waren mit dem Herrichten der Sänften beschäftigt, Diener trugen Kisten und Truhen aus dem Haus, und ein Junge warf einen Stapel Feuerholz vor die Küchentür. Beatrice zog den Umhang von ihren Schultern und ging durch die Halle hinauf in die Wohnräume des ersten Stocks. Kaum hatte sie sich gefragt, wo ihre Mutter wohl zu finden sei, als sich die Türen zu ihrer Linken öffneten und Margareta Rimortelli mit einem roten Kleid auf den Armen auf sie zueilte.
Selbst im fortgeschrittenen Alter und in einem Zustand höchster Nervosität, der sich in roten Flecken auf ihren Wangen ausdrückte, war Monna Rimortelli eine beeindruckende Erscheinung. Sie war größer als die durchschnittliche Italienerin, von kräftiger Statur und bewegte sich mit überraschender Geschmeidigkeit. Am auffälligsten jedoch waren ihre klaren blauen Augen, die sich nun auf ihre Tochter hefteten. »Liebes Kind, wo steckst du nur? Rasch jetzt. Zieh dein Hochzeitskleid an. Dann müssen wir deine Haare richten, das Gesicht und ...« Sie drückte Beatrice das Kleid in die Arme und schob sie vor sich her in ein Ankleidezimmer.
Unglücklich stand Beatrice vor dem Spiegel und warf das kostbare Kleid achtlos auf einen Stuhl. Ihre Mutter stellte sich hinter sie, nahm eine Bürste von einem Toilettentisch und begann, ihrer Tochter die Haare zu bürsten. »Ich weiß, wie du dich fühlst, mein Kind.« Wenn sie allein waren, sprachen sie Deutsch miteinander.
»Bitte nicht, Ines hat schon versucht, mich von den Vorzügen der Ehe zu überzeugen.« Sie zog eine Grimasse und wollte ihrer Mutter die Bürste aus der Hand nehmen, doch diese ließ sich nicht abhalten. Ihre Augen trafen sich im Spiegel.
»Ines hat nicht so unrecht, aber darum ging es mir nicht. Du bist mir so ähnlich! Genauso habe ich ausgesehen, als ich neunzehn Jahre alt war.« Liebevoll fuhr Monna Margareta mit den Händen durch die blonden Locken ihrer Tochter.
»Zumindest äußerlich sind wir uns ähnlich. Du bist viel klüger als ich. Das hast du von deinem Vater. Ich möchte, dass du nie vergisst, wer du bist, Beatrice. Du kannst stolz auf deine Wurzeln sein, was auch immer man über uns sagen mag. Wir sind ehrbare Kaufleute und haben es zu verdientem Wohlstand gebracht. Seit vierzehn Jahren leben wir schon hier. Wir sprechen ihre Sprache. Ich nicht so perfekt, doch was macht das? Sie behandeln mich noch immer wie eine Fremde. Aber du hast keinen Grund, dich deiner Herkunft zu schämen. Du bist jung, schön und klug, und jetzt heiratest du in eine der angesehensten Luccheser Familien. Du solltest dir keine Sorgen machen, mein Liebling.«
Beatrice drehte sich um und küsste ihre Mutter auf beide Wangen. »Ich habe mich meiner Herkunft nie geschämt. Außerdem stehen die Truppen des Kaisers im Norden. Sie werden Franz und sein Heer aus Mailand vertreiben, und bald wird Italien ein Teil des Reiches sein, genau wie Spanien, die deutschen Lande und Habsburg.«
Dieser unselige Streit zwischen Karl und Franz! Und das alles nur, weil die Kurfürsten Karl zum Kaiser gewählt hatten und nicht Franz. Dadurch hatte sich das instabile europäische Kräfteverhältnis zugunsten Spaniens und der Habsburger verschoben. Frankreich, bislang militärisch stärkste Macht auf dem europäischen Festland, kämpfte nun noch erbitterter um seine Vormachtstellung. Margareta schüttelte den Kopf. »Der französische König wird diese Schmach nie verwinden, und dazu kommt seine Besessenheit mit Italien. Seine Agenten sind überall im Land und kaufen die besten Werke italienischer Künstler. Freiwillig gibt dieser Franz Mailand nicht auf, und das bedeutet weitere Kriege.«
Margaretas Familie stammte aus altem deutschem Adel und stand den Habsburgern seit Generationen nahe, genau wie die Rimortellis, die wie die meisten Luccheser zu den Ghibellinen, der Partei des Kaisers, zählten.
»Mailand scheint auf ewig ein Zankapfel zwischen Frankreich und den Habsburgern zu sein. Selbst wenn es Karl gelingt, die Franzosen zu vertreiben, wird es nicht lange dauern, bis sie die Stadt zurückerobern werden«, fuhr Margareta nachdenklich fort. »Im Osten besetzen die Türken Ungarn und Rhodos. Wie soll unser Kaiser alle Grenzen gleichzeitig verteidigen?«
»Diese ewigen Kriege ...«, seufzte Beatrice. »Ich bedaure vor allem, dass die Familie aus Nürnberg deswegen nicht kommen kann.«
Ihr Onkel, Hartmann von Altkirch, war einer von Frundsbergs Heerführern. Georg von Frundsberg hatte als Feldherr schon unter Maximilian I. gedient und später seinem Enkel Karl V. bei der Eroberung der Picardie und jetzt der Lombardei geholfen.
»Hartmanns Frau hat es schwer genug. Ihre ältesten Söhne sind mit dem Vater im Feld. Nur Michael ist noch im Geschäft in Nürnberg und hält dort alles zusammen.«
Beatrice hatte ihren Cousin als schmächtigen Knaben in Erinnerung. »Er ist so alt wie ich. Wie er wohl aussehen mag?«
»Susanna schreibt, er kommt ganz nach Hartmann. Du würdest ihn kaum wiedererkennen. Aus dem Jungen ist ein kräftiger Bursche geworden. Dein Vater und ich werden noch in diesem Frühjahr reisen, Beatrice.«
»O nein!«, entfuhr es ihr.
»Wir wollten es dir erst nach der Hochzeit sagen, aber nun ist es heraus. Geplant ist es schon lange. Die Zeit drängt, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten.«
»Sag so etwas nicht, Mutter.« Beatrice fiel ihrer Mutter um den Hals und drückte sie fest an sich. »Ich wünschte mir, ich könnte mit euch kommen und die Heimat sehen ...«
»Deine Heimat ist jetzt hier in Italien, bei deinem Mann. Aber irgendwann einmal kannst du ihn sicher auf einer Reise in den Norden begleiten.« Monna Margareta nahm das Kleid vom Stuhl und reichte es ihrer Tochter. »In einer Stunde müssen wir an der Kirche sein. Ich bin froh, dass eure Trauung in San Michele stattfindet. Der Mord wirbelt viel zu viel Staub auf und gibt den Papstanhängern, diesen verfluchten Guelfen, nur weiteren Auftrieb.«
»Was interessiert mich ein toter Pfaffe ...«
»Nicht irgendeiner, Beatrice«, tadelte ihre Mutter. »Der Tote war Gast des Bischofs und ein päpstlicher Legat.«
»Und was macht das für einen Unterschied?«
»Bitte, Beatrice, stell dich nicht dumm! Der Mord an einem hohen kirchlichen Würdenträger bedeutet Ärger, Untersuchungen und Aufruhr. Im Großen Rat von Lucca sitzen genug Anhänger des Papstes, die nur darauf warten, der Gegenpartei, der wir angehören, etwas anzuhängen. Und das versuchen sie zuerst bei Ausländern.« Mit sorgenvoller Miene fasste Margareta ihre Tochter an den Schultern. »Gerade jetzt ist es gut, dass du einen Luccheser heiratest.«
Die Republik Lucca wurde von den anziani, dem Ältestenrat, und dessen Vorsitzendem, dem gonfaloniere, regiert. Die Mitglieder des Rates waren ausnahmslos reiche Luccheser Kaufleute und Adlige, die fast alle Ghibellinen waren. Doch der Bischof von Lucca, ein Adliger aus dem Hause Sforza de Riario, hatte seit seinem Amtsantritt großen Einfluss in der Stadt gewonnen, und die Gerüchte, dass Mitglieder des Rates mit den Guelfen, der Papstpartei, sympathisierten, wurden lauter.
»Und mach nicht so ein Gesicht. Du gehst schließlich nicht aufs Schafott ...«, sagte ihre Mutter.
Widerwillig griff Beatrice nach dem Kleid und ließ sich schweigend in das kostbare Gewand kleiden, dessen blutrote, golddurchwirkte Damast- und Seidenstoffe ihre helle Haut noch durchscheinender wirken ließen.
Als Beatrice am Arm von Federico Buornardi San Michele in Foro verließ, wurden sie von einer lärmenden Menge empfangen. Der Jubel überwog, doch Beatrice nahm auch die Schmährufe wahr, in denen sie als Lutheranerhure beschimpft wurde. Der weiße Marmor von San Michele strahlte an diesem kalten Januarmorgen in seiner ganzen erhabenen Pracht, und über ihnen breitete der Erzengel Michael kämpferisch seine Schwingen aus. San Michele war das Gotteshaus der Bürger, der Dom San Martino dagegen Bischofssitz. An der unpopulären Stadtrandlage San Martinos hatte die Erhöhung Luccas zum Bischofssitz nichts ändern können, und auch die Tatsache, dass ein Großteil der wohlhabenden Luccheser San Michele den Vorzug gab, fand nicht das Wohlwollen der Geistlichkeit. Und zu allem Übel war nun ein päpstlicher Legat im Dom ermordet worden. Diese Tat würde weite Kreise ziehen.
Beatrice registrierte die lauten Beifallsbekundungen der Wartenden, gemischt mit zotigen Bemerkungen und derben Späßen, wie durch einen Nebel. Seit sie das Hochzeitsgewand angelegt hatte, war sie einer Marionette gleich den Anweisungen ihrer Eltern gefolgt. Vor dem Priester hatte sie mit brüchiger Stimme ein kaum hörbares »Ja« herausgebracht, mit dem sie ihr Schicksal besiegelte. Ein junger Geck tanzte vor ihnen her und sang ein zweideutiges Lied, das Beatrice die Röte in die Wangen trieb. Ihre spitzen Schuhe mit dünner Ledersohle rutschten auf den mit einer leichten Schneeschicht überzogenen Platten der Piazza, und sie wäre gestürzt, hätte Federico sie nicht mit kräftigem Griff davor bewahrt.
»Geht es Euch gut?«
»Danke.« Sie vermied es, ihn anzusehen, und bemühte sich um eine würdevolle Haltung, wobei sie das Klappern ihrer Zähne kaum unterdrücken konnte. Ihr Kleid hatte gemäß der herrschenden Mode einen tiefen Ausschnitt, der Dekolleté und Schultern freilegte.
Ser Federico Buornardi winkte die Sänftenträger herbei. »Der Ostwind ist um diese Jahreszeit besonders kalt. Würdet Ihr so gütig sein, mit mir in der Sänfte Platz zu nehmen?« Seine Miene war freundlich und duldete keinen Widerspruch.
Sie nahm die dargebotene Hand und setzte sich ihm gegenüber in die schmale Sänfte, die von vier Dienern der Buornardis getragen wurde. Zum ersten Mal hatte sie Gelegenheit, ihren Ehemann genauer zu betrachten, denn er sah an ihr vorbei aus dem Fenster und grüßte höflich die Luccheser, die sich eingefunden hatten, um der Verbindung zweier wohlhabender Kaufmannsfamilien beizuwohnen. Natürlich hofften die Arbeiter, Tagelöhner, Bettler, armen Frauen und Kinder, die bei solchen Anlässen stets anzutreffen waren, auf Almosen oder Nahrungsmittel, die in die Menge geworfen wurden.
Zumindest war er nicht geizig, dachte Beatrice, als sie ihn Kupfermünzen in die Menge werfen sah. Dunkle Haare fielen ihm glatt auf die Schultern und betonten seine scharfgeschnittenen Züge. Von seiner rechten Braue verlief seitlich bis in den Haaransatz eine Narbe, über deren Ursache Beatrice nachdachte, als er seine Augen auf sie richtete. Verlegen senkte sie den Blick.
»Euer Vater war sehr großzügig. Was immer Ihr wünscht, es soll Euch an nichts mangeln.« Kein Lächeln. Er betrachtete sie prüfend, wie man eine neu erworbene Ware einschätzt.
Beatrice schwieg.
»Was ist mit Euch? Hat es Euch die Sprache verschlagen?« Seine Lippen verzogen sich zu einem schiefen Lächeln.
»Seid Ihr zufrieden mit dem, was Ihr gekauft habt?«, erwiderte sie kühl.
Er runzelte kurz die Stirn. »Wir sollten diese Ehe nicht mit einem Streit beginnen. Aber ja, wenn ich Euch ansehe, die Mitgift in Betracht ziehe – ja, ich bin zufrieden. Ich bin Kaufmann, wie Ihr wisst.« Wieder das schiefe Lächeln.
Die Sänfte schwankte und wurde mit einem leichten Ruck abgesetzt. Sie stiegen aus, und Federico reichte seiner Frau auf der Straße den Arm, um sie über den Treppenaufgang in den Palazzo seiner Familie zu geleiten.
Man hatte die Via Santa Giustina vor den Mauern des dreistöckigen Palazzo mit Girlanden aus weißer Seide und Buchsblättern geschmückt. Das Volk drängte sich um Diener, die kleine Brotlaibe und Dörrfleisch verteilten. Beatrice betrat die Eingangshalle, in der sie von Federicos Eltern, Lorenza und Baldofare Buornardi, erwartet wurde. Die Buornardis hatten zwei Töchter und drei Söhne. Federico war mit neunundzwanzig Jahren der Älteste, gefolgt von Alessandro und Torneo. Ginevra, die ältere Tochter, hatte vorteilhaft in eine Seitenlinie der einflussreichen Familie Gonzaga aus Mantua eingeheiratet, Eleonora lebte in einem Kloster bei Rom. Federicos Vater stützte sich auf einen Stock und sah etwas unsicher zu ihr herüber. Als er die Augen auf sie richtete, entdeckte sie, dass eines von einem milchigen Schleier überzogen war.
Federico ging zu seinem Vater, nahm dessen Hand und legte sie in Beatrices Rechte. »Darf ich Euch meine Frau vorstellen, Signore?«
Ein Lächeln glitt über Baldofare Buornardis Gesicht, als er ihre Hand drückte und sanft tätschelte. Über seinem Leibrock trug er einen dunklen Überrock aus kostbarem Brokat. Beatrice mochte den alten Mann auf Anhieb. Er strömte Wärme und Herzlichkeit aus, als er sie begrüßte: »Obwohl meine Sehkraft mich im Stich gelassen hat, erkenne ich, dass mir eine schöne Frau gegenübersteht. Seid willkommen in unserem Hause, liebste Beatrice. Ich hoffe sehr, Ihr werdet hier glücklich und füllt dieses allzu stille Gemäuer bald mit dem Geschrei prächtiger, gesunder Enkelkinder.«
Verlegen schlug Beatrice die Augen nieder. »Nun, ich ... ich werde mich bemühen ...«
Der alte Buornardi lachte. »Lasst nur gut sein. Mein Sohn, zeigt Eurer Braut die Gemächer, damit sie sich für das Fest umkleiden kann, denn heute wollen wir feiern! Lorenza, bringt mich in den Festsaal, damit ich die Weine begutachten kann.« Energisch klopfte er mit seinem Gehstock, in dessen goldenem Handknauf ein Edelstein blitzte, auf den Boden.
Seine Frau war von fülliger Statur, und ein gewichtiges Collier schmückte ihr Dekolleté. Ohne ein Wort an Beatrice nahm sie den Arm ihres Mannes, um ihn in die gewünschte Richtung zu führen. Mit Lorenza würde es Schwierigkeiten geben, dachte Beatrice und blickte mit einem unguten Gefühl der rundlichen Gestalt nach, deren vorgestrecktes Kinn Hochmut und Stolz ausdrückte. Eine Meute von fünf kleinen Hunden stob plötzlich aus dem Treppenhaus herunter und rannte hinter Lorenza her. Beatrice bückte sich, um eines der drahtigen kleinen Tiere zu streicheln, doch sie wurde angeknurrt, und ein braun-weiß gefleckter Hund schnappte sogar nach ihr.
»Das würde ich lassen. Sie sind ganz auf meine Mutter fixiert. Ich habe Eure Truhen und was sonst noch Euch gehört in Eure Gemächer bringen lassen. Sie befinden sich im ersten Stock«, sagte Federico neben ihr.
»Ja«, brachte Beatrice leise hervor. Ihre Sachen waren hier. Es gab kein Zurück. Dies war ihr neues Heim. Die Schritte der hin und her eilenden Dienstboten hallten auf den Terrakottafliesen, und hinter ihr erklangen die gut gelaunten Stimmen neu eintreffender Gäste.
Federico räusperte sich, und sie folgte ihm durch die ovale Halle, in der das Wappen der Buornardis über dem Türbogen zum Wohntrakt prangte. Ein Banner, auf dem ein Maulbeerbaum abgebildet war, neben zwei gekreuzten Schwertern repräsentierte die Familie, die wie die meisten alteingesessenen Luccheser durch die Seidenherstellung reich geworden war. Nachdem das Monopol für die Herstellung und Verarbeitung von Seide durch die Erschließung der Sümpfe im Umland und dadurch gewonnene Verkehrsanbindungen an Florenz verloren gegangen war, hatten die Luccheser wirtschaftlich schwere Zeiten erlebt. Viele Handwerker waren ausgewandert und hatten die Produktionsgeheimnisse verraten, doch mittlerweile hatten die Kaufleute in Lucca neue Märkte erschlossen und so sich und ihre Stadt als unabhängige Republik behaupten können. Der Palazzo der Buornardis spiegelte das kaufmännische Geschick seiner Bewohner in Form von edlem Mobiliar, flämischen Wandteppichen, Gemälden, chinesischen Vasen und anderen wertvollen Stücken wider, stellte Beatrice fest, während sie neben Federico durch die Flure schritt.
Schließlich öffnete er eine der Türen. »Euer Ankleidezimmer. Wie ich sehe, hat Eure Zofe schon einiges ausgepackt.«
Beatrice entfuhr ein glücklicher Aufschrei, als sie Ines zwischen den offenen Truhen entdeckte. »Oh, du bist schon hier!«
Ines verneigte sich. »Monna Beatrice, Ser Buornardi.«
»Hast du das dunkelblaue Kleid gesehen? Ich ...«, wollte Beatrice fragen, wurde jedoch von Federico unterbrochen.
»Spart Euch das für später auf. Zuerst zeige ich Euch die übrigen Räume, damit Ihr Euch zurechtfindet.« Er zog die Tür wieder zu und ging in den benachbarten Raum, in dem ein großes Baldachinbett stand. Die Wände waren mit blauen Tapeten bespannt, und blau-goldene Vorhänge schmückten das Bett.
Sie verschlang die Hände ineinander und atmete tief durch. »Unser ...«
»Euer Schlafgemach, Beatrice. Meines liegt am Ende des Ganges.« Er stand vor ihr und nahm zum ersten Mal an diesem Tag ihre Hände in seine. Seine dunklen Augen musterten sie aufmerksam, und sie glaubte, so etwas wie Anteilnahme in seinem Lächeln zu entdecken. »Ihr seht aus wie ein Reh, dem kein Fluchtweg bleibt. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben.«
Sie wollte ihm gerne glauben, doch seine Nähe und die Berührung seiner Hände beunruhigten sie mehr, als sie zugegeben hätte. Erleichtert atmete sie auf, als er sie losließ und ein schmales Holzkästchen von einem Schrank nahm.
Mit schlanken Fingern brachte er ein Collier zum Vorschein, dessen Diamanten wie ein Wasserfall von Tautropfen glitzerten. Federico trat hinter sie, schob ihre offenen Haare zur Seite und legte ihr das Schmuckstück an. Seine Hände ruhten auf ihren Schultern, als seine Lippen sanft ihren Hals berührten. »Willkommen in meinem Haus, Beatrice.«
Sie berührte den kostbaren Schmuck mit den Fingerspitzen und betrachtete sich in einem Spiegel, der über einer Kommode hing. Die Steine waren von erlesener Qualität. »Ich danke Euch. Das ist ein sehr schönes Stück.« Im Spiegel trafen sich ihre Blicke, und sie meinte mehr als bloße Bewunderung in seinen Augen zu erkennen.
Ein energisches Klopfen an der Tür durchbrach die angespannte Atmosphäre. »Herein!«, rief Federico, woraufhin ein junger Diener mit einem Brief in den Händen hereinkam.
»Entschuldigt, der Bote sagte, es sei wichtig, und wartet auf Antwort.« Der junge Mann hatte glänzende Locken, schöne, offene Gesichtszüge und ein selbstsicheres Auftreten. Lässig stand er mit zurückgenommenen Schultern im Türrahmen. Er ignorierte Beatrice, überhaupt schien er das besondere Vertrauen seines Herrn zu genießen.
»Lass ihm zu essen geben, während ich die Antwort aufsetze, Andrea. Ist Torneo schon zurück?«
Andrea schüttelte den Kopf. »Er wollte aber zum Essen hier sein.« Er schien mehr sagen zu wollen, doch Federico hob die Hand.
»Danke, Andrea.« Nachdem der junge Mann gegangen war, riss Federico den Brief auf und überflog ihn. »Von Alessandro aus Antwerpen. Mein Bruder ... Nun, wir sehen uns beim Festessen.« Mit der rechten Hand strich er sich über die Narbe an seiner Stirn und ging, die Augen auf den Brief geheftet, hinaus.
Es gibt viel zu lernen, dachte Beatrice und versuchte sich an das zu erinnern, was sie über die Familie Buornardi wusste. Alessandro leitete die Geschäfte der Handelsniederlassung in Antwerpen. Ihr Vater hatte von weit gestreuten Anteilen der Familie in den unterschiedlichsten Branchen gesprochen. Von Verbindungen zu den Fuggern war die Rede gewesen. Seufzend nahm Beatrice den Schmuckkasten und ging zu ihrer Zofe, die ihr blaues Kleid bereits auf einen Sessel gelegt hatte.
»Oh, Madonna! Was für eine wunderschöne Kette Ihr da tragt!« Ines kam zu ihr und begutachtete das Collier. Sie schien sich in die neue Umgebung ohne weiteres einzufinden.
»Ser Buornardi, hmm, mein Mann hat sie mir eben geschenkt.«
»Und ...?« Ines sah sie neugierig an, holte ein Paar Schuhe aus einer Kiste und zeigte sie Beatrice, die zustimmend nickte.
»Hast du seine Mutter gesehen? Sein Vater scheint mir ein recht netter Mann zu sein, aber sie hat mich mit keinem Wort begrüßt.« Beatrice hob ihre Haare, um aus dem Überkleid zu steigen.
»Mit den Schwiegermüttern ist das immer so eine Sache, aber das meine ich nicht. Wie ist er zu Euch? Was haltet Ihr von ihm?«
»Auf dem Weg hierher hatte ich den Eindruck, er wäre arrogant und kaltherzig, aber eben schien er ... Ach, ich weiß nicht.« Sie zog das blaue Kleid aus Seidenbrokat über das dünne Unterkleid und strich die Falten glatt. »Ich möchte ihm eine gute Frau sein, Ines, aber ich weiß nicht, was er erwartet.«
»Macht Euch nicht zu viele Gedanken. Jetzt geht Ihr auf das Fest und werdet alle mit Eurem Charme bezaubern. Ja, das werdet Ihr, seid einfach Ihr selbst, und alles wird gut!« Ines sprach mit dem Brustton der Überzeugung, zupfte an den geschlitzten Ärmeln des Überkleids, richtete die Haare ihrer Herrin und betrachtete zufrieden das Ergebnis.
Lange blonde Locken ergossen sich in sorgfältig gelegten Strähnen über ihren Rücken, und um die Hüften band Beatrice einen bestickten Gürtel, der ihrer Mutter gehört hatte. »Ich bin froh, dass du hier bist, Ines.« Vielleicht war es nicht richtig, zu vertraut mit seiner Zofe umzugehen, doch Ines war immer mehr als eine Dienerin für sie gewesen und hatte sie nie enttäuscht.
»Natürlich bin ich hier. Wo sollte ich sonst sein? Jemand muss sich doch um Euch kümmern!« Verlegen drehte Ines sich um und wühlte in einer der Kisten.
Wenig später wurde Beatrice von Pietro Farini, dem maestro di casa der Buornardis, aufgesucht Farini schien sich seiner leitenden Stellung im Palazzo wohl bewusst zu sein, denn sein langes Gesicht mit tiefliegenden Augen drückte Herablassung aus, während er näselnd erklärte: »Es ist meine Aufgabe, Euch nun in den Saal zu führen. Die Gäste sind versammelt.« Er erläuterte ihr das Prozedere, zu dem zahlreiche Reden, musikalische Darbietungen, ein kleines Theaterstück, die üblichen Possenreißer und natürlich das mehrstündige Festessen gehörten. »Habt Ihr das verstanden?«
Beatrice hob eine Augenbraue und wandte sich zur Tür. »Gehen wir, maestro, oder hast du noch etwas zu sagen?«
Den Zeremonienstab in der Hand, marschierte der Haushofmeister in gezierter Manier vor ihr her. Beatrice fand sein Auftreten lächerlich und für einen Palazzo von der Größe der Buornardis völlig unangemessen. Wahrscheinlich bestand Lorenza auf diesem Firlefanz in der Hoffnung, ihr Palazzo käme damit einem Fürstenhof gleich. Das Haus ihrer Familie war kleiner, doch Beatrice wusste sehr wohl einzuschätzen, wann sie sich unter Menschen von wirklicher grandezza befand.
Farini schritt mit gewichtiger Miene durch die weit geöffneten Türen des Festsaals im Erdgeschoss und kündigte sie an. Musik spielte, und bunt ausstaffierte Kinder warfen Blumen, während Federico Buornardi ihr entgegenkam, um sie ans Ende der Tafel zu führen, die hufeisenförmig in einer Hälfte des Saales angeordnet war. In den folgenden Stunden begrüßte Beatrice bekannte und unbekannte Gesichter, bemühte sich vergeblich, alle Namen im Gedächtnis zu behalten, und nahm höflich Glückwünsche und Geschenke, die in einem gesonderten Raum aufgebaut wurden, entgegen. Unter den illustren Gästen fanden sich Vertreter der führenden Luccheser Familien, und sogar der Marchese Gadino del Connucci gab sich die Ehre.
Der Marchese hatte den Ruf eines Lebemanns, Kunstkenners und politischen Rebellen, denn er und seine Anhänger sprachen sich in letzter Zeit öffentlich für ein unabhängiges und selbstbestimmtes Italien aus. Dahinter stand der Wunsch, sich vom Einfluss der Habsburger und Franzosen zu befreien. Mit dieser Politik stießen der Marchese und seine Freunde zwangsläufig auf den Widerstand von Ghibellinen und Guelfen, die den teuer erkauften Schutz von Kaiser und Papst nicht aufgeben wollten. Aber der Marchese war auch ein Mann, der gern im Mittelpunkt des Interesses stand, und kontroverse Diskussionen gaben dazu einen guten Anlass. Connucci verneigte sich elegant vor Beatrice und reichte ihr eine weiße Rose. Gewelltes Haar fiel ihm weich in die Stirn, die eng anliegenden Hosen und ein kurzes, modisches Wams schmeichelten seiner Figur. Als exzellenter Fechter und Reiter hatte er sich einen Ruf erworben, der über Luccas Grenzen hinausging.
»Selbst diese Blume verblasst neben Eurer Schönheit, edle Beatrice. Euer Gatte ist zu beneiden und wird Euch hoffentlich nicht in diesen Mauern verstecken. Ich gebe im Frühjahr eine kleine Festivität, bei der ich Euch nur zu gerne begrüßen würde. Die offizielle Einladung wird Euch selbstverständlich noch zugestellt werden.«
»Wie freundlich von Euch, Marchese.« Beatrice sah sich hilfesuchend nach Federico um, der jedoch in ein Gespräch mit dem gonfaloniere Ser Cenami, dem Vorsitzenden der anziani, des Ältestenrats der Stadt, vertieft war.
Connucci bemerkte ihre Unsicherheit. »Federico wird kaum ablehnen, so wie ich ihn kenne.« Er lachte. »Wir haben eine bewegte gemeinsame Vergangenheit, aber vielleicht erzählt er Euch in stillen Stunden davon. Oder ich tue das ...« In seinem Lächeln lag etwas Begehrliches.
Beatrice atmete schneller und drehte die Rose in ihren Händen. Bildete sie sich das nur ein, oder warfen einige der jüngeren Frauen ihr neidische Blicke zu? Connucci war einer der attraktivsten Männer Luccas, doch sie war eine verheiratete Frau und hatte nicht vor, ihre Ehe oder sich selbst durch eine Affäre zu gefährden. Vor wenigen Wochen erst hatte sie von der florentinischen Contessina Lucrezia gehört, die von ihrem Mann in einem Eifersuchtsanfall erwürgt worden war. Der Mann hatte den Mord als Unfall dargestellt und war ungeschoren davongekommen, und seine Tat war kein Einzelfall. Sie sah erneut zu ihrem Gatten und fing seinen Blick auf, doch er machte keine Anstalten, seine Unterhaltung zu beenden. »Wir danken Euch für die Einladung, doch ich glaube, ich sollte mich auch den anderen Gästen widmen, die geduldig warten.«
»Wie ungehörig von mir, doch man wird mir sicher verzeihen?« Connucci wandte sich mit gewinnendem Lächeln an die hinter ihm Wartenden.
Monna Vecoli trat in Begleitung ihres Mannes und ihres Sohnes Eredi vor. Zum äußeren Zeichen ihrer Trauer über den unglücklichen Tod ihrer Tochter Clarice trug sie noch immer einen schwarzen Schleier. Falten tiefen Grams hatten sich auf ihrem Gesicht eingegraben. Eredi stand beschützend neben ihr, bereit, sie aufzufangen, sollte sie einen Schwächeanfall erleiden. Er gehörte zum Kreis von Federicos Freunden, wie Clarice ihr erzählt hatte. Als sie ihn erblickte, wurde ihr der Tod seiner Schwester einmal mehr schmerzlich vor Augen geführt.
»Monna Vecoli, habt Dank für Euer Kommen. Ich hätte es verstanden, wenn Ihr Euch entschuldigt hättet.«
Mit gesenktem Haupt sagte Monna Vecoli: »Ihr seid eine der wenigen, die weiß, warum meine Tochter den Tod wählte und sich so an unserem Herrn versündigte.«
Beatrice beugte sich vor, so dass nur Monna Vecoli sie hören konnte. »Wäre sie nicht heute noch am Leben, wenn Ihr Clarice nicht die Ehe mit Paolo Ori aufgezwungen hättet?«
»Es war ihre Pflicht! Als gute Tochter hatte sie den Wünschen ihrer Eltern zu gehorchen!«, entfuhr es Monna Vecoli.
»Nun ist sie tot.«
Die Frau nahm ihre Hand. »Ich bitte Euch, bewahrt Schweigen, um das Andenken an meine Tochter nicht zu beschmutzen. Hier, das hat ihr gehört.« Sie legte zwei Ohrgehänge aus Perlen in Beatrices Hand. »Ich wünsche Euch Glück, Monna Beatrice. Wenn Ihr eines Tages selbst eine Tochter habt, werdet Ihr vielleicht an mich denken.«
Überrascht schaute Beatrice auf die Ohrringe, deren tropfenförmige Perlen wie Tränen aussahen. Bevor sie antworten konnte, verabschiedete sich Monna Vecoli und verließ mit ihrem Mann den Saal. Tränen des Meeres hatte Clarice diese Perlen genannt. Tränen der Seele, dachte Beatrice und umschloss den Schmuck mit ihrer Hand.
Eredi beobachtete sie. »Clarice hat Euch geliebt wie eine Schwester.« Er hatte eine angenehme Stimme und war ein exzellenter Sänger. Sie hatte ihn oft bei den Vecolis gehört und heimlich bewundert.
»Werdet Ihr für mich singen, Eredi?«
»Wann immer Ihr wollt, Madonna.« Er machte eine galante Verbeugung.
Federico gesellte sich zu ihnen. »Eredi, was habt Ihr mit meiner Braut gemacht? Sie sieht völlig verstört aus!« Seine Wangen waren vom Wein gerötet.
»Nichts, mein Freund.« Eredi schlug ihm auf die Schulter. »Wir sprachen über meine Schwester.«
»Eredi versprach, für mich zu singen. Erlaubt Ihr das, Federico?«
Mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen betrachtete er sie und die Faust, mit der sie noch immer die Ohrringe umfasste. »Alles, was meiner schönen Braut Freude macht, soll geschehen.«
Während Eredi zum Kapellmeister ging und ihm erklärte, welche musikalische Begleitung er benötigte, wies Federico ihr einen Stuhl an, setzte sich neben sie und nickte den immer noch wartenden Gratulanten zu, seinem Beispiel zu folgen. Beatrice spürte seine prüfenden Seitenblicke, während sie ihre Aufmerksamkeit der kleinen Bühne zuwandte.
Eredi hatte sein Wams abgelegt, und die weiten Ärmel seines Hemdes unterstrichen die Bewegungen seiner Arme, als er zu singen begann. Die Festgäste lauschten gebannt der schlichten Melodie und den ergreifenden Worten Petrarcas.
»Ich sah auf Erden ein so engelsgleiches Wesen,so himmlisch eine Schönheit, auf der Welt so einzig,dass das Erinnern mich zugleich beglückt und schmerzt,weil alles, was ich seh, Traum, Schatten scheint und Rauch.«
Sie konnte die Tränen nicht zurückhalten und senkte den Kopf, als Federico ihr ein Tuch reichte.
»Ich hätte ihm nicht erlauben sollen zu singen.«
»Es geht schon wieder. Clarice war wirklich ein Engel. Rein, zart und unschuldig.« Ihr einziger Wunsch war es gewesen, in ein Kloster eintreten zu dürfen, doch ihre Eltern hatten andere Pläne mit ihr gehabt. Sie hatten nicht verstanden, dass Clarice nur eine Braut Christi sein wollte. Mit ihren großen, verträumten Augen hatte sie mit Beatrice im Oktober dem fallenden Laub zugesehen und davon gesprochen, wie sehr sie sich nach Ruhe und Frieden sehnte. »Sie wollte nur ihren Frieden, nur ihren Frieden ...«, flüsterte Beatrice mehr zu sich selbst.
»Muss ich Euch von Türmen und tiefen Gewässern fernhalten, Beatrice?« Es hätte wie ein Scherz geklungen, wenn Federico sich nicht zu ihr geneigt und ihre Hand ergriffen hätte.
»Ich bin nicht Clarice, und ich bin bereit für das zu kämpfen, was ich vom Leben erwarte.«
»Bravo! Eine Frau mit Kampfgeist. Aber genauso habe ich Euch eingeschätzt«, stellte er fest.
Sie hob eine Augenbraue.
»Das Leben ist zu verlockend und voller süßer Trauben, die zu kosten es sich lohnt.« Er hob ihre Hand an seine Lippen und berührte sie leicht.
Eredi beendete sein Lied, und die Gäste klatschten. Rufe nach heiterer Tanzmusik wurden laut, und Federico stand auf und gab den Musikern einen Wink. Sie begannen, eine beschwingte Volta zu spielen. Beatrice steckte die Ohrringe in ein Täschchen an ihrem Gürtel und ließ sich von ihrem Mann zum Tanz führen.
Die Hochzeitsgesellschaft bildete einen Kreis um das tanzende Brautpaar, bevor auch andere den Klängen der Musik folgten. Die Volta zählte zu den lebhafteren Tänzen, bei denen der Mann seine Tänzerin drehen und am Ende sogar auf sein Knie setzen durfte. Federico bewegte sich elegant zur Musik und ließ sie keine Sekunde aus den Augen. Sie spürte seinen Atem an ihrem Gesicht, wenn sie an ihm vorbeischritt, und seine Hand auf ihrer Hüfte, als sie erhitzt nach den letzten Drehungen auf seinem Knie zu sitzen kam.
»Ihr raubt mir den Verstand ...«, flüsterte er ihr ins Ohr.
Benommen von der Musik und dem Rausch der Bewegung machte Beatrice sich los und fächelte sich mit einer Hand Luft zu. »Mir ist nicht wohl. Würdet Ihr mir ein Glas Wasser holen?«
»Natürlich.« Er schien mehr sagen zu wollen, zog jedoch stattdessen die geschlitzten Hängeärmel seiner Jacke in Form und führte sie zu einem Sessel an der Wand, wo sie sich niederließ.
Kurz darauf traten ihre Eltern zu ihr. Beatrice erhob sich und wurde von ihrem Vater auf beide Wangen geküsst.