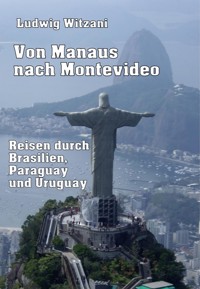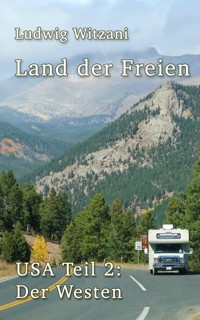Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mit Bussen, Fähren und Motorrädern durchreiste der Autor die gesamte Weite der indonesischen Inselwelt. Er war bei den Orang-Utans auf Sumatra und besuchte die letzten Drachen von Komodo. Er erkundete die Molukken, die noch immer unter den Nachwirkungen des Bürgerkrieges der Jahrtausendwende leiden und war wochenlang in Bali unterwegs, um den schönsten Tempel der Insel zu finden. Ob auf dem Bromo-Vulkan in Ostjava, in den Knochenhöhlen der Toraja auf Sulawesi, ob bei den Steinzeitstämmen im Hochland von Papua-Neuguinea - immer versucht der Autor darum, seine aktuellen Erlebnisse und Wahrnehmungen mit einer geschichtlichen und kulturellen Tiefendimension anzureichern. Dass Witzani dem Land und seinen Menschen mit großer Sympathie begegnet, führt nicht dazu, dass er vor bedenklichen Entwicklungen wie dem Vormarsch des orthodoxen Islams, der Umweltbelastung oder der Korruption die Augen verschließt. Indonesien, so das Fazit, mag ein Land im Umbruch sein, aber noch immer ist es eines der interessantesten und vielfältigsten Reiseländer der Erde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Witzani
Der asiatische Archipel
Indonesische Reisen zwischen Sumatra und Papua
Impressum
Der asiatische Archipel
Ludwig Witzani
published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Copyright: © 2018 Der asiatische Archipel Lektorat: Tina Wolf Konvertierung: Sabine Abels | www.e-book-erstellung.de
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Start in Singapur
Stipppvisite in einer properen Stadt
JAVA
Zentrifuge der Millionen
In Jakarta
Drei Dolche müssen es schon sein
Lazy days in Yogjakarta
Shiva und Buddha im Schatten der Vulkane
Eine Reise zum Dieng Plateau, zum Borobodur und zu der Tempelanlage von Prambanan
Tod auf Java
Kleiner Versuch über das Heimweh
Ein Ausflug in den ersten Schöpfungstag
Am Bromo-Vulkan in Ost-Java
BALI
Barong und Rangda und das Gleichgewicht der Welt
Lovina, Candidasa und Ubud
Der Großvater Ist wieder da!
In Bali ist die Religion allgegenwärtig
Die Allgegenwart des Unvorhersehbaren
Mit dem Motorrad unterwegs in Bali
SUMATRA
Der ferne Vetter
Bei den Orang-Utans von Bukit Lawang
Wenn der Begu kommt
Bei den Batak am Toba-See
Verbrechen auf hoher See
Der Untergang der Van Imhoff vor der Ostküste Sumatras
BORNEO
Die schwimmenden Märkte Von Banjarmarsin
Tage in Südborneo
Die Dayaks wohnen jetzt lieber für sich
Ein Ausflug nach Loksado
SULAWESI
Am Grab des Diponegoro
Zwischenstopp in Makassar
Tau Tau bewachen die Reise nach Puya
Sieben Tage im Torajaland
NUSA TENGGARA
Die MS Kelimutu kommt bestimmt
Mit der Pelni-Fähre von Sulawesi nach Sumbawa
Der Tod lauert im Unterholz
Bei den Riesenwaranen von Komodo
MOLUKKEN
Zwei Inseln am Ende der Welt
Wo sich Schönheit und Geschichte treffen: auf Ternate und Tidore
Jagd auf die Belanda Hitam
Der Bürgerkrieg auf den Molukken 1999-2002
So gnädig war Pattimura
Impressionen aus Ambon, der Hauptstadt der Molukken
WESTPAPUA
Die Entdeckung der zwei Geschwindigkeiten
Die Bucht von Sorong
Stadt der vielen Namen
Jayapura
Ein Ohrläppchen ist genug
Das Kuriose und das Bizarre im Baliem-Tal
Jakarta, 17. August 2017
Der indonesische Unabhängigkeitstag
Glossar
Reisehinweise
Literaturnachweise und Anmerkungen
Weitere Veröffentlichungen von Ludwig Witzani
Einleitung
Eine Echse kriecht über den Strand von Komodo. Wenn sie dich erwischt, frisst sie dich bei lebendigem Leib. Ein Vater ist gestorben und wird verbrannt, damit sich seine Seele neu inkarnieren kann. Über dem Bromo-Vulkan geht die Sonne auf und beleuchtet eine Szene wie am ersten Schöpfungstag. Ein Orang Utan wartet auf Sozialunterstützung am Bohorok River im Dschungel von Sumatra. Pattimura schwingt seine Riesenmachete auf den Molukken. Auf einer langen Prozession wandelt der Besucher am Borobodur die Ebenen des Seins entlang bis zur Stufe der höchsten Erkenntnis. In den Wäldern von Londa blicken die Abbilder der Toten von ihren Balkonen auf dich herab. Und im Baliem Valley schwingen die Dani ihre Speere wie in alten kannibalischen Zeiten.
Das sind nur einige der Facetten, die ein Land von geradezu kontinentalen Ausmaßen für den Reisenden bereithält: Indonesien. Sieben bis acht Flugstunden trennen Banda Aceh im äußersten Westen Indonesiens von Jayapura, der Hauptstadt Westpapuas im äußersten Osten des Landes. Dazwischen liegen 17000 Inseln, darunter einige der größten der Welt, allen voran Java, die Weltinsel, auf der nicht weniger als 140 Millionen Menschen in einem fruchtbaren Garten leben, wie es ihn auf der Welt kein zweites Mal gibt. Aber auch Sumatra, Borneo, Sulawesi, Bali und Papua sind jede für sich eine eigene Reise wert. Das wären dann schon sechs Reisen, und man hätte immer noch nicht alles gesehen. Die Vielfalt Indonesiens übersteigt die Fassungskraft eines Menschenlebens.
Dass Indonesien als Reiseland die Fassungskraft übersteigt, hat aber auch seine Vorteile. Der Reisende kann immer wieder zurückkommen und wird noch etwas Neues finden. Ihm wird aber auch Vertrautes wieder begegnen, und zwar umso vertrauter, je öfter er das Land bereist. Für mich sind es vor allem vier vertraute Phänomene, die in ihrer Gesamtheit das Land wenigstens ansatzweise umreißen.
Zunächst die Inseln und das Meer. Indonesien ist ein Inselreich, der größte Archipel der Welt, eine Seelandschaft, die die Menschen verzaubert hat, seitdem sie sie entdeckt haben. So gierig die ersten Weltumsegler nach den Gewürzinseln suchten, so bestürzt waren sie von der Schönheit dessen, was sie am Ende ihrer Reise entdeckten.
Sodann Vulkane. Wo immer man sich in Indonesien aufhält, spürt man die Tätigkeit gewaltiger Kräfte aus dem Innern der Erde, entweder aktuell als drohender Ausbruch oder als geronnene Natur. Seinen Vulkanen verdankt das Land seine immense Fruchtbarkeit, aber auch unendliches Leid bei den oft unvorhergesehenen Vulkanausbrüchen.
Schließlich Religion. Kaum ein westlicher Reisender, der aus den kalten, entzauberten Regionen des Nordens nach Indonesien kommt, kann sich der Magie der Götter und Geister entziehen, die wie eine zweite Einwohnerschaft das Inselreich bewohnen. Nirgendwo in der Welt verzaubert eine Religion das Alltagsleben der Menschen derart wie der Hinduismus auf Bali. Nirgendwo in der Welt zeigt der Islam ein so freundliches Gesicht wie in Indonesien, auch wenn sich im Zuge der religiösen Renaissance des Islam die Verhältnisse langsam ändern.
Indonesiens größter Schatz aber sind nicht seine Inseln, Vulkane oder Religionen, sondern seine Menschen. Auch wenn der zunehmende Tourismus bereits hier und da die Sitten verdorben hat, beherbergt das Land noch immer eine überaus gastfreundliche und hilfsbereite Bevölkerung. Gäbe es einen Preis für die freundlichste Bevölkerung der Welt, Indonesien wäre zweifellos ein Kandidat für einen Spitzenplatz. Die Menschen sind aber nicht nur auf eine herzerwärmende Art freundlich, sondern auch unglaublich fleißig. Indonesiens Bevölkerung hat sich in den letzten vierzig Jahren fast verdoppelt, und trotzdem gibt es keinen Hunger und langsam sogar einen bescheidenen Lebensstandard bei der Durchschnittsbevölkerung.
Soweit die Superlative, denen natürlich auch Schattenseiten gegenüberstehen. Überall, wo Menschen leben, existieren Gewalt, Korruption, neuerdings auch Terror. Man denke nur an die schrecklichen Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem kommunistischen Putsch der Sechziger Jahre. Mittlerweile hat die junge indonesische Demokratie, wenngleich nicht ohne Blessuren, auch die Erschütterungen der Jahrtausendwende überstanden.
Ich selbst habe Indonesien im Laufe von gut zwanzig Jahren vier Mal bereist. Jedes Mal erkannte ich die liebenswerten Züge wieder, die ich oben beschrieben habe, jedes Mal aber auch etwas Neues, das sich in eine Richtung entwickelte, die noch offen war. Und jedes Mal dachte ich schon bei meinem Abschied daran, bald wiederzukommen.
Gereist bin ich vom ersten und bis zum letzten Tag selbstorgansiert, als „Backpacker“ oder „Traveller“, wie es unter Individualreisenden heißt, später als schon etwas arrivierterer als Einzelreisender mit einem ausgeprägten Interesse an der Geschichte. Alles, was mir widerfuhr, habe ich in vier eng beschriebenen Reisetagebüchern festgehalten, getreu dem Diktum von Ernst Jünger, dass das, was nicht nur erlebt, sondern auch beschrieben wird, tiefer in der Seele haftet. Manche unmittelbaren Eindrücke habe ich ungefiltert aus meinen Reisetagebüchern in den Text übernommen, das eine oder andere Faktum habe ich später genauer recherchiert und gegebenenfalls ergänzt. Die meisten Namen (nicht alle) habe ich aus Gründen der Diskretion verändert, auch bei Hotels bin ich ähnlich verfahren. Alle Urteile dieses Buches sind nur auf meinem Mist gewachsen. Sollte ich mich geirrt haben, gelobe ich Besserung, habe ich jemanden unwissentlich verletzt, bitte ich um Vergebung. Ebenso wie für den einen oder andern Fehler, der sich ganz sicher wieder in den Text eingeschlichen haben wird.
Damit ist zugleich gesagt, dass dieses Reisebuch (wie alle Reisebücher) durch und durch subjektiv ist. Alle Beschreibungen von Menschen, Tempeln, Tieren oder Vulkanen, die sich in diesem Buch finden, sind nicht in erster Linie Darstellungen dessen „was ist“, sondern Spiegelungen dessen, was ich erlebte, angereichert mit meinen persönlichen Sichtweisen, meinen Werten, meinen Schwächen und Interessen, meiner Ungeduld oder Neugierde.
Sollte irgendjemand dadurch affiziert werden, sich nach Indonesien aufzumachen, hätte ich mein Ziel erreicht.
Start in Singapur
Stipppvisite in einer properen Stadt
Die Zukunft der Welt lässt sich heute schon anhand der großen Städte besichtigen. Da gibt es zunächst das durchkriminalisierte Modell „Gotham City“, auf das sich Caracas und Johannesburg zubewegen, dann ausufernde Riesenstädte wie Casablanca oder Karachi, in denen Kriminalität und religiöser Fundamentalismus eine beunruhigende Verbindung eingehen. Es gibt desaströs-endzeitliche Varianten wie Kalkutta oder Lagos und multikulturelle Städte am Rande der Regierbarkeit wie London, Berlin oder Brüssel. Neben ihnen stehen strikt autoritär geführte Städte wie Dubai oder Singapur, in denen das Leben auf eine ganz andere Weise funktioniert, als es der westliche Mensch gewohnt ist – mit mehr Kontrolle und Ordnung, klaren Regeln und genau definierten Grenzen des Privatbereiches.
Unter westlichen Intellektuellen haben Dubai und vor allem Singapur gerade deswegen eine schlechte Presse. Dass man in der Öffentlichkeit nicht ungehindert die Sau rauslassen darf, dass Verschmutzung und Vandalismus streng bestraft werden, stört das eigene Freiheitsverständnis. Dass es in diesen Städten fast keine Kriminalität gibt, fällt demgegenüber merkwürdigerweise kaum ins Gewicht. Im Falle Dubais kommt die berechtigte Kritik an der Ausbeutung der südasiatischen Arbeitskräfte hinzu. Aber was gibt es an Singapur zu meckern?
Aus eigener Anschauung wusste ich das nicht mehr, weil mein letzter Besuch in Singapur schon so lange zurücklag, dass ich mir kein Urteil mehr erlauben konnte. Ich erinnerte mich nur noch an eine wenig beeindruckende Chinesenstadt, an ein internationales Geschäftszentrum ohne besonderes Flair, das man wegen seiner gut funktionierenden Infrastruktur schätzte, in dem man sich aber nicht über Gebühr lange aufhielt.
Einer meiner ehemaligen Schüler, Fabian Purps, der inzwischen als Schiffsmakler in Singapur lebte, hatte mich eingeladen, ihn auf meinem Weg nach Indonesien in Singapur zu besuchen. „Ich fühle mich in der Tradition dankbarer Schülerschaft“, hatte er mir per Mail verkündet. „In Japan zum Beispiel rechnet es sich der Schüler zur Ehre an, seinen Lehrer zu beherbergen. Sie sind also willkommen!“
Das hörte sich gut an, wer aber war Fabian Purps? Fabian, der vor einem Jahrzehnt auf dem Mataré Gymnasium in Meerbusch-Büderich das Abitur abgelegt hatte, war als Gymnasiast das gewesen, was man einen intelligenten Filou nannte. Er war ein umtriebiger, sportlicher, gut aussehender, aber nicht besonders fleißiger Schüler, dem es immer gelungen war, seine schulischen Ziele mit dem geringstmöglichen Aufwand zu erreichen. Weil er es sich dabei mit einer Reihe von Lehrern verscherzte, hatte es Disziplinarkonferenzen gegeben, bei denen ich mich für ihn mächtig ins Zeug gelegt hatte. Ich wusste zwar schon damals um seine Finessen, schätzte aber seine Schlagfertigkeit und seinen Humor. Auch der Umstand, dass er bei aller Flapsigkeit bestimmte Grenzen nicht übertrat, nahm mich für ihn ein. Mit einem Wort: Er war ein Schüler, der immer für eine Überraschung gut gewesen war und den ich gerade deswegen besonders geschätzt hatte.
Mit der Überraschung, die mich am Flughafen von Singapur erwartete, hatte ich jedoch nicht gerechnet. Fabian Purps, der mich abholen wollte, war nicht da, und als ich ihn auf dem Handy in seinem Büro erreichte, gab er sich überrascht. „Ach, schon so spät? Ich wollte gerade zum Flughafen rausfahren. Aber jetzt, wo du schon da bist, kannst du auch mit dem Taxi zu mir kommen, das kostet nur eine Kleinigkeit.“
Eine Kleinigkeit war es nicht, weil ich bei meiner Fahrt in die Stadt an einen der wenigen Taxifahrer-Gauner geriet, der in einer Korruptionsnische des Singapurer Nahverkehrswesens überlebt hatte. Ein in das Korruptionsgefüge wahrscheinlich eingeweihter alter Chinese, der am Flughafenausgang die Taxizuteilung überwachte, wies mir anstelle einer der zahlreichen hellblauen Taxen einen großen weißen Wagen zu. Diese große weiße Limousine wurde von einem Chinesen gefahren, von dem weder Name noch Lizenznummer im Wageninnern verzeichnet waren. Er war eine hagere Erscheinung mit Altersflecken im Gesicht, der meine Fragen nach Namen und Lizenz mit herrischem Gehabe überging. Stattdessen fuhr er drei überflüssige Schleifen in der Stadt, um mir am Ende noch zehn Singapur Dollar „Flughafentax“ extra auf die Rechnung aufzuschlagen. Alles in allem zahlte ich auf diese Weise über vierzig Singapur Dollar, den doppelten Preis einer normalen Taxifahrt in die Stadt.
Sofort erschien Fabian, kaum dass mich der Taxifahrer-Gauner abgesetzt hatte, am Fuße seiner Residenz am Oxford Rise und begrüßte mich wie einen alten, lange vermissten Freund. Er war inzwischen einen halben Kopf größer geworden als ich, ein breitschultriger junger Mann in den späten Zwanzigern mit sportlichen Shorts, in denen seine kräftigen braungebrannten Beine gut zur Geltung kamen. Sein kurz geschnittener Bart und die inzwischen ausgeprägtere, leicht gebogene Nase verliehen seinem Gesicht etwas Verwegenes, das sich aber sofort verlor, wenn er lachte. Das „du“, das ehemaligen Schülern bei ihren Lehrern immer etwas schwer fällt, ging ihm locker von den Lippen. Er schlug mir vertrauensvoll auf die Schulter, fragte wie ich mich fühlte und trug meinen Koffer zum Aufzug, der uns in seine Wohnung in den elften Stock brachte. Sein Apartment besaß einen großen Wohnraum, zwei Bäder, ein Schlafzimmer, eine kleine Küche und ein Gästezimmer, in dem ich einquartiert wurde. Nach einer ersten, etwas abwartenden Phase wurde das Gespräch schnell vertrauter. Klatsch und Tratsch aus Meerbusch wurde ausgetauscht, die letzten Informationen über diesen und jenen wurden aufgefrischt, Kaffee wurde gekocht, während draußen bereits die Dämmerung hereinbrach. Fabian hatte nach seinem Abitur eine Lehre als Schifffahrtskaufmann absolviert, danach als Speditionskaufmann ein Jahr in London, fünf Jahre in Hamburg und drei Jahre in Rio gearbeitet. Zurzeit leitete er das Büro einer brasilianischen Schiffsmaklergesellschaft in Singapur und war mit einem kleinen Stab von Mitarbeitern dafür zuständig, auf dem chaotischen Markt der südostasiatischen Containerschifffahrt möglichst viele Transportkontrakte und den dafür benötigten Schiffsraum an Land zu ziehen. Für sein Alter bekleidete er also bereits eine beachtliche Position. Auch privat gab es keinen Grund zum Klagen. Fabian war mit der Brasilianerin Roberta liiert, die ihm bei seinem Umzug von Rio nach Singapur gefolgt war. Auf dem Sideboard sah ich das Bild einer jungen, bildschönen Frau.
„Aber wo ist Roberta jetzt?“ fragte ich.
„Sie befindet sich zurzeit auf Studienurlaub in Europa“, antwortete Fabian. „Sie absolviert dort einen Studiengang für Menschenrechte, der auf den Erfahrungen und Lebensweisheiten der Bhutanesen aufbaut.“
Als ich fragte, warum ausgerechnet der Bhutanesen, wunderte sich Fabian darüber, dass ich als Weltreisender nicht wüsste, dass die Bhutanesen die glücklichsten Menschen des Planeten seien und somit dem Rest der Weltbevölkerung Vieles mitzuteilen hätten. Leider könne er selbst nicht so glücklich leben wie die Bhutanesen, denn sein Job stresse ihn derart, dass er nachts kaum schlafen könne. Tatsächlich klingelte während unseres Gespräches das Telefon mindestens ein halbes dutzendmal. Offenbar waren reichlich Transportvolumina, für die Schiffspassagen gesucht wurden.
Am Abend fuhren wir in die Innenstadt zum Hafenbecken des Singapur Rivers. Es handelte sich um einen breiten Mündungssee unmittelbar neben der Marina Bay, an dessen Ufern sich Promenaden, Geschäftshäuser und eine ganze Straße mit hochpreisigen Speiselokalen befanden. Ohne zu zögern bestellte Fabian bei einem Edelitaliener einen Nero d´ Avola, zu einem exorbitanten Preis, der ihm sehr gut schmeckte. Als ich ihn als Dank für seine Gastfreundschaft zu dieser Flasche Rotwein einlud, bestellte er gleich noch eine zweite Flasche, die ich inklusive des Abendessens auch noch bezahlte. Immerhin war ja auch der japanische Lehrer seinem Schüler etwas schuldig.
Aber es war gut angelegtes Geld, denn das Gespräch brachte viel Aufschlussreiches über Singapur zu Tage. Einen Wagen besitze er selbstverständlich nicht, erklärte Fabian, denn wenn man den Anschaffungspreis und die Lizenzgebühr für ein Fahrzeug, die in Singapur praktisch einen zweiten Kaufpreis ausmache, zusammenaddiere, könne man bis zum Lebensende U-Bahn fahren. Die drakonischen Strafen für Vandalismus und Vermüllung fand er voll in Ordnung, denn jeder wisse um diese Strafen, und wer sich den Luxus leiste, sie zu ignorieren, solle auch bezahlen. Das war der Fabian Purps, wie ich ihn kannte, ein konservatives Kraftpaket, dem man kein x für ein u vormachen konnte. Dass er sich gleich nach dem Abitur als Wehrpflichtiger freiwillig zu den Gebirgsjägern gemeldet hatte und in seiner Freizeit asiatischen Kampfsport betrieb, rundete das Gesamtbild ab. Diese robusten Basisdaten wurden mittlerweile allerdings durch zartere Ansichten ergänzt, in denen sich der veredelnde Einfluss seiner schönen Menschenrechts-Freundin bemerkbar machte. Sein Umweltenthusiasmus und seine Warnungen vor den die Gefahren des Klimawandels wirkten neben seinen sonstigen Ansichten, als hätte man von einem scharf gewürzten Gericht die Peperoni entfernt. Kein Zweifel, Fabian Purps befand sich nach zwei Flaschen Nero d´Avola im Einklang mit der Welt und genoss es sichtlich, seinem ehemaligen Lehrer die Welt zu erklären.
Am nächsten Tag war ich von morgens bis abends in Singapur unterwegs. Ich wunderte mich über die optimale Organisation des U-Bahn-Verkehrs, über die Sauberkeit auf den Gleisen und die zurückhaltende Höflichkeit der Menschen, wenngleich mir auffiel, dass sie nicht eigentlich fröhlich daherkamen. In Bangkok und mehr noch in Delhi oder Bombay war es erheblich dreckiger, trotzdem schien die Laune der Menschen viel besser zu sein als in dieser wie blankgeleckten Stadt. Sich immer nur an die Regeln zu halten, die zugleich eisern überwacht wurden, war gut für das Niveau der öffentlichen Ordnung, machte aber offenbar individuell wenig Freude.
Das erste, was ich von Singapur sah, als ich aus der U- Bahn stieg, war das Denkmal für die Toten des Zweiten Weltkrieges: ein schmuckloser Obelisk, der von den ihn umgebenden Hochhäusern überragt wurde. Besser konnte man die Bedeutungslosigkeit solcher Denkmäler kaum darstellen. Die implizite Nachricht lautete: So schlimm konnte der Krieg ja wohl nicht gewesen sein, wenn schon eine Generation später neu erbaute Wolkenkratzer seine Denkmäler turmhoch überragten.
An diesem Vormittag lag ein wolkenfreier Himmel über Singapur, und obwohl es noch lange nicht Mittag war, entfaltete die Sonne bereits ihre Kraft. Wer hatte gesagt, dass das exakte Entfernungsmaß zwischen zwei Punkten in Singapur die Menge Schweiß sei, die man auf dem Weg von A nach B vergoss? So gut ich konnte, wich ich ins gekühlte Unterirdische aus. Geführt von einem indischstämmigen Straßenkehrer lief ich fast einen ganzen Kilometer durch schlauchartige U-Bahn-Zubringer und Malls, bis ich kurz vor der Marina Bay wieder das Licht des Tages erreichte. Mein zufälliger Führer hieß Ramin und war ein Tamile, der als junger Mann nach Singapur gekommen war. Er hatte in der Nachtschicht diverse U-Bahnhöfe gereinigt und befand sich nun auf dem Heimweg in die Vorstadt, wo er mit seiner Frau und vier Kindern lebte. Zweimal kamen wir auf unserem langen Weg durch die unterirdischen Verbindungsstraßen an schlafenden Obdachlosen vorüber, die es inzwischen also auch in Singapur gab. „Lange werden sie dort nicht liegenbleiben“, meinte Ramin. „Bald wird die Polizei kommen und sie wegjagen.“
Als ich kurz vor der Marina Bay die unterirdischen Tunnel verließ, traf mich der Anblick des umgestalteten Stadtzentrums wie ein Schock. Rund um eine direkt mit dem Meer verbundene Bucht war in den letzten 15 Jahren ein städtebauliches Ensemble der Sonderklasse entstanden, das in Asien seinesgleichen suchte. An der meereszugewandten Seite erhob sich das Bay Sands Hotel mit seinen drei fünfundfünfzigstöckigen Hochhäusern. Auf deren Dächern war über alle drei Häuser hinweg ein über hundert Meter langes steinernes Boot positioniert worden war, eine Arche Noah der Postmoderne, die auf dem Untergrund hypermoderner Architektur in eine ungewisse Zukunft steuerte. Ein neues Traumbild der Urbanität war geboren worden, eine überdimensionale Weltbarke, die in ihrem mittleren Teil von einem palmengesäumten Swimmingpool aus einen Blick über die gesamte Sechsmillionenstadt und das Meer erlaubte. Unterhalb des Bay Sands Hotels befand sich eine Mall und das Museum für Moderne Kunst, ein echter Augenöffner, denn es war als eine steinerne, sich entfaltende Blüte gestaltet, die sich hochhausgroß über dem Wasser der Bay erhob.
Beim Anblick der Marina Bay wurde mir klar, dass es ein Ausmaß an Stadtveränderung gab, dass alle früheren Besuche hinfällig machte. Aber hatte sich Singapur nicht schon immer permanent verwandelt, vielleicht nicht unbedingt ins Schönere, aber auf jeden Fall ins Effektivere? Singapur die „Löwenstadt“, war der Legende nach schon im 14. Jahrhundert gegründet worden. In Wirklichkeit aber hatte die relevante Geschichte der Stadt erst in dem Augenblick begonnen, als der britische Kolonialbeamte Stanford Raffles im Jahre 1811 seinen Fuß auf die unbedeutende Insel vor der malaiischen Stadt Johore gesetzt hatte. Raffles erkannte die exzellente strategische Lage der Insel und sorgte dafür, dass sie zu einem britischen Stützpunkt wurde, genauer gesagt: zu einem der Sprungbretter, von dem aus die Briten im 19. Jahrhundert Schritt für Schritt die Vorherrschaft und Kontrolle über die malaiische Halbinsel gewannen. Unter britischer Kolonialverwaltung erbauten Chinesen, Malaien und Inder eine staunenswerte Metropole, nicht Asien und nicht Europa, sondern ein drittes, das sein Anderssein bis in die Gegenwart erhalten sollte. Nach der Unabhängigkeit im Jahre 1963 war Singapur schon im Jahre 1965 aus der malaysischen Konföderation ausgetreten, um sich in einer damals scheinbar aussichtslosen Kleinstaatlichkeit einzurichten. Doch dieser Kleinstaat gedieh gegen alle Wahrscheinlichkeit. Singapur wurde als Drehkreuz des Welthandels zu einem der asiatischen Tigerstaaten und hat inzwischen längst einen Großteil der europäischen Konkurrenten hinter sich gelassen. Der „Vater“ dieses staunenswerten Wirtschaftswunders, der Chinese Lee Yuan Kew, war im Jahre 2015 gestorben. Seine „asiatischen Werte“, d. h. die Verbindung von extremer Leistungsbereitschaft und Meritokratie, verbunden mit einer notfalls staatlich erzwungenen Gemeinwohlorientierung, hatten Singapur zu einer der wohlhabendsten Städte der Welt aufsteigen lassen. Nun hatte die Stadt das Stadium der bloßen Effektivität verlassen und war auch noch attraktiv geworden.
So nahe und plastisch der Gesamtanblick der Marina Bay mir an diesem Vormittag vor Augen stand, so kostete es mich einen langen Fußmarsch und beträchtliche Mengen Schweiß, ehe ich hinter dem Museum für Moderne Kunst den Eingang zum Bay Sands Hotel erreichte. Die gute Nachricht war, dass die Kosten für eine Übernachtung in diesem Hotel keineswegs so astronomisch hoch waren, wie ich erwartet hatte. Im Rahmen von Spezialangeboten war eine Übernachtung mitunter schon für etwa 200 Dollar zu buchen. Die schlechte Nachricht war, dass jeder Besucher, der nicht im Hotel logierte, für das Betreten des Oberdecks die stolze Summe von 25 Singapur Dollar berappen musste.
Wie erwartet war das Observation-Deck bewusst schmucklos und ohne Schatten konzipiert, damit sich die Besucher nicht zu lange auf dem Aussichtsdach aufhielten. Der Einzigartigkeit der Aussicht tat das jedoch keinen Abbruch. Nach Süden hin sah man eine unübersehbare Anzahl von Schiffen, die auf ihre Abfertigung im Hafen von Singapur warteten. Die Umrisse des Hafens waren im Westen nur undeutlich zu erkennen, nur daran, dass er riesig war, konnte auch aus der Entfernung kein Zweifel bestehen. Neben Shanghai und Hongkong gehörte der Hafen von Singapur zu den größten Häfen der Welt. Gemessen am Frachtgutumschlag war er über viermal so groß wie der der Hamburger Hafen.
Gleich unterhalb des Bay Sands Hotels befand sich meerwärts der „Garden of the Bay“, ein in den letzten Jahren neu eingerichteter Ökopark, der Singapurs Ruf als „grüne Stadt“ begrün(d)en sollte. Seine Hauptattraktionen waren die sogenannten „Superbäume“ aus Stahl und Beton, die in einer Größe von über 25 Metern nicht nur als vertikale Gärten sondern auch als Regenwasserspeicher und Standort für Solarzellen dienten. Gleich neben den Superbäumen befanden sich zwei futuristisch anmutende Gewächshäuser, in denen Pflanzenarten aus allen Kontinenten gepflegt wurden.
Stadteinwärts wanderte der Blick über die Marina Bay hinweg auf die andere, urbane Seite der Bucht zum „Merlion“, dem wasserspeienden Steinlöwen vor dem Fullterton Hotel und der Skyline der City von Singapur. Halb im Dunst des Gegenlichts verschwammen die Hochhauswälder an der Peripherie der Stadt, die Heimat des größten Teils der fast sechs Millionen Menschen, die auf der gerade mal siebenhundert Quadratkilometer großen Insel lebten. Mag Singapur auch eine der dereguliertesten und somit dynamischsten Volkswirtschaften der Welt sein, so ist der Wohnungsmarkt in Singapur fest in staatlicher Hand. Über achtzig Prozent der Einwohner Singapurs bewohnen staatlich subventionierten Wohnraum, der regelmäßig erneuert und umwelttechnisch optimiert wird.
Den Rest des Tages setzte ich mich in Busse und U-Bahnen und fuhr kreuz und quer durch Singapur. Zuerst vom Süden nach Norden, dann soweit es mir möglich war, die Stadtränder entlang. Denn der zivilisatorische Rang einer Stadt erweist sich nicht so sehr in ihrem Zentrum als an ihrer Peripherie. Am Rande der urbanen Gebilde lösen sich die Formen auf, als besäßen die Regeln, die das Zentrum der Stadt beherrschen, an ihren Rändern keine Geltung mehr. Nicht so in Singapur. An den Stadträndern waren die Straßen ebenso sauber wie im Zentrum. Die Hochhäuser waren weiß getüncht, nirgendwo sah ich Graffitis oder Müll. Nur einmal erblickte ich einige Balkone, auf denen Wäsche über die Brüstung hing. Die Bewohner würden sicher bald Besuch vom Hausmeister erhalten. Singapur war eine „fine City“, eine „feine Stadt“ mit intakter Ordnung, in der jeder, der sich an dieser Ordnung verging mit Strafen (englisch „fine“) rechnen musste. Undenkbar etwa, dass in einem Stadtpark in Singapur nigerianische Drogenhändler unbedrängt und in aller Öffentlichkeit ihre Geschäfte abwickeln würden. „Null Toleranz“ beherrschte als urbanes Strafprinzip die Stadt. Auf Drogenhandel stand der Tod und auf Vandalismus eine Reihe schmerzhafter Züchtigungsstrafen.
Nach der Statistik waren drei Viertel der Bevölkerung von Singapur ethnische Chinesen, 14 % waren Malaien und etwa 8 % Inder. Die wenigen Westeuropäer und Amerikaner fielen optisch kaum ins Gewicht. Allerdings waren die Passagiere, die neben mir in Bus und U-Bahn saßen, äußerlich nicht unbedingt als Chinesen, Malaien oder Inder zu erkennen. Eine einheitliche Geschäftskleidung machte die Menschen äußerlich gleich, und selbstverständlich gehörte es bei allen Ethnien zum guten Ton, sich unauffällig zu verhalten. Was ihnen darüber hinaus gemeinsam war, war der permanente Handygebrauch. Die Fahrgäste in U-Bahn und Bussen schauten nicht rechts und nicht links, nahmen ihre Umgebung nur wie durch einen Schleier wahr und starten unablässig auf ihr Display. Wenn sich der Mensch unterwegs immer schon in zwei Realitäten bewegte, in der Außenwelt und seinem inneren Bewusstseinsstrom, hatte der Siegeszug des Handys diese Balance ins extrem Solipsistische verschoben. Das allerdings war in Singapur genauso wie in Tokyo oder Berlin.
Am Abend traf ich Fabian am „Merlion“ zur Sound und Light Show. Fabian erschien im Business-Dress, sah extrem gesund und präsent aus, ein Athlet, der in Sekundenschnelle den Gesichtsausdruck vom Harmlosen ins Entschlossene ändern konnte. Wieder bimmelte unablässig sein Handy. Im Augenblick verfolge er sechs oder sieben Projekte, von denen sich, wenn er Glück habe, vielleicht eines würde realisieren lassen. Dann aber, so Fabian, würde die Kasse klingeln, dass es eine Freude sei. Während wir auf den Stufen zu Füßen des Merlions saßen, begann die Sound und Light Show. Das Bay Sands Hotel und das Museum für Moderne Kunst wurden in flackerndes Licht getaucht. Festlich beleuchtete Ausflugsboote durchquerten die Bucht. Nichts, was einen vom Hocker warf, eher etwas für einen beiläufigen Blick.
Zum Abendessen fuhr Fabian mit mir zum „Newton Food Stall“, einem der angesagtesten Food Stalls im Norden Singapurs. Es handelte sich um einen großen Platz mit Tischen und Stühlen, der komplett von kleinen Garküchen umgeben war, an denen man seine Bestellung aufgeben konnte. Krabben, Fisch, Rind, Schwein, Nudeln, Reis und alle Arten von Gemüse standen für kleines Geld im Angebot. Lecker präsentiert und gut gewürzt wurden die Speisen in Windeseile an den Tisch gebracht. Wir wurden satt zu einem Bruchteil des Preises, den wir am Vorabend bezahlt hatten, und diesmal lud Fabian mich ein.
Als wir in Fabians Wohnung zurückkehrten kam in den Nachrichten eine Meldung, nach der auf einer der vorgelagerten Inseln, die zu Indonesien gehörte, eine islamistische Terrororganisation ausgehoben worden war. Sie hatte kurz davor gestanden, mit bereits fest installierten Raketenwerfern den Bay Sands Bezirk zu beschießen. „Diese Muslime haben einen Knall“, meinte Fabian, „aber gottlob ist es nur eine Minderheit, die derart durchdreht.“
Am Morgen meiner Abreise aus Singapur gab es wieder ein echtes Fabian Purps-Erlebnis. „Ok“, hatte er am Vorabend verkündet. „Bevor du morgen gehst, mache ich dir ein deftiges Omelett als Grundlage für den Tag.“ Das hörte sich gut an, doch als ich um acht Uhr in der Frühe erwachte, befand sich Fabian noch im Tiefschlaf. Möglicherweise hatte er in der Nacht um Kontrakte kämpfen müssen und holte nun den versäumten Schlaf nach. Da wollte ich natürlich nicht stören. Nachdem ich einen Kaffee getrunken hatte, verließ ich leise gegen neun Uhr die Wohnung und fuhr mit der U-Bahn zum Flughafen.
JAVA
Java ist unvergleichlich. Im Großen wie im Kleinen. Eine Insel, wie es keine zweite gibt. Eine Aufwühlung, die niemanden kalt lässt. Java ist so groß wie Griechenland und hat mit über 140 Millionen Einwohner mehr Einwohner als jede andere Insel der Welt (den Kontinent Australien eingeschlossen). Die Javaner leben an palmengesäumten Küsten ebenso wie in unübersehbaren Millionenstädten, vor allem aber in einem üppigen Garten der Fruchtbarkeit, in dem alles wächst, das der Mensch anpflanzen mag.
Und Java ist schön. Wer durch Java zwischen Bandung und Yogjakarta fährt, glaubt seinen Augen nicht zu trauen, so perfekt sind die Ansichten, die am Zugfenster vorüberziehen: Reisterrassen unter pyramidal zulaufenden Vulkankegeln, mattengedeckte Häuser, Tempel und Moscheen, die perfekte Staffage für eine der großen Bühnen des asiatischen Lebens. Und überall Menschen, Menschen, Menschen. Unübersehbar viele, und doch jeder Einzelne ein Unikat. Die Grazilität der Menschen ist ebenso irritierend wie ihre Ausdauer, ihre Schönheit ist genauso beunruhigend wie ihre Treue zur Tradition, und ihre unverstellte Freundlichkeit beschämt den Besucher immer wieder aufs Neue.
Soweit der erste Eindruck, der zugegeben etwas enthusiastisch ist. Wie aber steht es mit der Geschichte? Die unterschiedlichsten Kulturen haben ihre Spuren auf Java hinterlassen, hunderte (!) Sprachen und Dialekte werden auf der großen Insel gesprochen, tausende Götter wurden im Laufe der Geschichte auf Java verehrt. Das größte buddhistische Bauwerk der Welt, der Borobodur, und einer der größten Hindutempel der Erde, der Prambanan, befinden sich nicht weit voneinander entfernt in Zentraljava. Die vielleicht imposanteste Vulkanlandschaft, die unser Planet zu bieten hat, die Caldera des Tenggervulkans und den Kraterrand des Bromo, kann der Besucher im Osten Javas besteigen. Wenn es einen Ort auf unserem Planeten gibt, der ein Maximum an kulturellen, geschichtlichen und ästhetischen Attraktionen in sich vereinigt, dann ist es Java. Java ist eine Weltinsel.
Meine Reise durch diese Weltinsel dauerte mehrere Wochen, dabei habe ich nur das Naheliegendste gesehen: Jakarta und Umgebung, Yogjakarta, das Dieng Plateau, den Borobodur und den Prambanan und schließlich das Tenggergebiet und den Bromo Vulkan. Gereist bin ich überwiegend entlang der „Hauptschlagader der menschlichen Fortbewegung“ (Carl Hoffmann), d. h. mit den Fortbewegungsmitteln der Einheimischen, was immer die interessanteste, aber nie die bequemste Methode des Reisens ist.
Zentrifuge der Millionen
In Jakarta
Während des Anfluges auf Jakarta las ich in der englischsprachigen „Jakarta Post“ einen Leitartikel, in dem darauf hingewiesen wurde, dass der internationale Sukarno –Hatta-Airport schon seit längerer Zeit oberhalb seiner maximalen Kapazitätsgrenze arbeite. Ein Luftfahrtexperte wurde zitiert, der behauptete, dass die tägliche Anzahl der Starts und Landungen nur noch mit drastischen Einbußen an Sicherheit abgewickelt werden könnte, konkreter gesagt: mit einer gefährlichen Unterschreitung der Zeitintervalle startender und landender Flugzeuge. Das waren keine guten Nachrichten, aber die Passagiere der Garuda Maschine aus Singapur schien das nicht zu beunruhigen. Sie sahen Filme oder dösten mit glasigen Augen vor sich hin, als die Maschine ihren Landeanflug begann. Ganz ähnlich wie in Mexiko City oder andern Megastädten der Welt hatte der wuchernde städtische Ballungsraum längst den Flughafen erreicht und umzingelt. Ein unübersehbarer Häuserteppich erstreckte sich bis zum Horizont, während sich die Maschine dem Rollfeld näherte. Die Landung war butterweich, aber kaum ausgerollt, musste die Maschine zwischen zwei parallelen Landebahnen stoppen, weil auf beiden Rollfeldern gerade Maschinen starteten und landeten. Es war so viel los auf dem Airport, dass an ein normales Ausrollen nicht zu denken war. Ich traute meinen Augen nicht, als eine Boeing heran raßte, uns in einem Abstand von wenigen Dutzend Metern passierte und sich in die Luft erhob. Unsere Maschine bebte, und alle zeigten betroffene Gesichter. Mit einem Wort, ich war froh, als ich das Flugzeug verlassen konnte.
Es gab aber auch gute Nachrichten. Die Fahrt vom Flughafen in die Stadt dauerte auf der neu errichteten Schnellstraße gerade mal eine Stunde. Das hatte ich bei meinen früheren Aufenthalten noch ganz anders erlebt. Ich wohnte im Ashley Hotel an der Jalan Wahid Aysin direkt in der Innenstadt. Durch die großen Fenster meines Zimmers sah ich die Hochhäuser der unmittelbaren Umgebung, eine Skyline wie ein großes, schadhaftes Gebiss, denn die Front der Wolkenkratzer wurde von flachen Häusern, Höfen und kleinen Moscheen unterbrochen. Weltstadt und Dorf in einem Blick, das war Jakarta.
Als ich das Hotel verließ, empfing mich die Hitze wie ein Schlag ins Gesicht. Nur wenige Meter zu Fuß auf der überfüllten Straße, und ich war schweißgebadet. Daran hatte sich seit meinen früheren Aufenthalten nichts geändert. Auch das ohrenbetäubende Geknatter der Motorräder, die in unglaublichen Mengen durch die Straßen kurvten, war das gleiche geblieben. Es roch nach Kerosin, Schweiß, Staub und einem winziger Hauch von Durian. Auch das kam mir bekannt vor.
Nur wenige Meter von meinem Hotel entfernt befand sich die Jalan Jaksa, die ehemalige Traveller-Enklave von Jakarta. Hier hatte ich vor vielen Jahren übernachtet, während ich auf einen Reisepartner wartete. Damals war die Jalan Jaksa eine Art Khao San Road gewesen, nur viel dreckiger und billiger. Sehr viele Hostels der Low Budget Klasse hatten Tür an Tür um Gäste geworben. In Hinterhofbiergärten hatten die Backpacker auf das Bier und die Mücken auf das Blut der Backpacker gewartet. Das Zimmer, das ich damals in der Jalan Jaksa bewohnt hatte, war sieben Quadratmeter groß gewesen und hatte nur aus einem einzigen Bett ohne Bettwäsche bestanden. Kein Stuhl, eine schmale Dusche im Flur und ein Moskitogitter vor dem Fenster. Die Traveller jener frühen Jahre hatten Vaganten geglichen, die es liebten, im slow motion Modus von Ort zu Ort zu reisen und im großen asiatischen Fotoalbum möglichst kräftesparend herumzudösen. Wo sie schliefen und ihr Bier tranken, war ihnen egal. Manchmal schäkerten sie mit den leichten Mädchen, die sich in der Jalan Jaksa herumtrieben, schliefen aber nur selten mit ihnen, weil sie einen Igel in der Tasche hatten. Nachts tranken sie Gin oder Whiskey, weil sie sonst nicht durch die Schwüle kamen. Auf der anderen Seite war mir auch eine andere Empfindung aus diesen Jahren gegenwärtig geblieben: das Bewusstsein, ganz am Anfang eines Reiselebens zu stehen und das Gefühl, dass die Geheimnisse und Abenteuer der Welt wie ein großer Gabentisch vor mir lagen und man nur die Decke wegziehen musste, um sie zu sehen.
Ein Lebensalter später schlenderte ich nun wieder durch die Jalan Jaksa, eine kleine Seitenstraße, deren aktuelle Mickrigkeit mich verblüffte. Hier und da erkannte ich einige der bunten Fassaden wieder, doch die meisten Hostels waren verschwunden. Einem sentimentalen Impuls folgend suchte ich das Hostel, in dem ich vor 27 Jahren logiert hatte, fand aber nur einen umgitterten Parkplatz. Ich ging die Straße herauf und herunter und zählte am Ende gerade mal ein halbes Dutzend jugendlicher Backpacker, die ihre knappe Reisekasse in diese Straße geführt hatte. Wie es aussah, gehörte die Jalan Jaksa als zentrale Anlaufstelle der Backpackerszene der Vergangenheit an. Die jugendlichen Reisenden der Achtziger und Neunziger Jahre waren inzwischen arriviert und konnten sich bessere Hotels leisten. Ihre Kinder, die neue Generation, schien ganz anders zu reisen, jedenfalls nicht mehr entlang der Backpackerrouten „on a shoestring“ wie in den altvorderen Tagen.
Fünf Möglichkeiten gibt es, in Jakarta, die Innenstadt zu erkunden. Eine theoretische (das Fahrrad) und vier praktische: nämlich das Zufußgehen, die Anmietung eines Ojeks, den Taxitransport und das Busfahren. Diese Möglichkeiten habe ich erprobt, und hier ist meine Bericht.
Die Erkundung Jakartas zu Fuß ist ein Ding der Unmöglichkeit, nicht nur, weil die Stadt so groß, sondern weil sie ganz und gar nicht fußgängergerecht ist. Was nicht ausschließt, das zu jeder Stunde des Tages Millionen Fußgänger in Jakarta unterwegs sind. Aber sie bewegen sich, ökologisch gesprochen, in einer nicht artgerechten Umwelt – angerempelt, gestoßen, auf schadhaftem Trottoir stolpernd, von parkenden Autos oder Auslagen auf die Straßen abgedrängt, auf denen die Fahrzeuge wie Geschosse an ihnen vorüberrasen. Zu der Enge kommt die Hitze. Für den normalen Mitteleuropäer reichen wenige Minuten Jakarta-Fußmarsch, bis sein Hemd durchgeschwitzt ist und er sich nach einer Dusche sehnt. Das gleiche gilt übrigens auch für das Thema Fahrradfahren. Obwohl einige Oberschlaue diese Art der Fortbewegung für Jakarta auf Reiseforen allen Ernstes empfehlen, habe ich in der gesamten Innenstadt von Jakarta nicht einen Fahrradfahrer gesehen. Und das aus gutem Grund: einen schnelleren Weg zum öffentlichen Selbstmord würde man in der Welt lange suchen müssen.
Da also die Fortbewegung zu Fuß oder per Fahrrad ausfielen, entwickelte ich einen neuen Plan. Ich begriff, dass die Stadt nichts Freundliches an sich hatte, dass sie den Reisenden nicht einlud, sie anzusehen, sondern, dass sie einem bedrohlichen Wesen aus Blechund Stein glich, das den Reisenden in seinem Innenstadthotel gefangen hielt. Deswegen musste man die Stadt auch wie ein Belagerter erkunden. Von meinem aircongekühlten Zimmer im achten Stock des Ashley Hotels wollte ich gut geplante und zeitlich limitierte Ausfälle zu den Sehenswürdigkeiten unternehmen, um dann gerade noch rechtzeitig vor dem Beginn der nervlichen Zerrüttung zurückzukehren. Wenn ich dieses Konzept mit ausreichenden Ruhepausen durchzog, hätte ich eine gute Chance, Jakarta ohne bleibende Gesundheitsschäden kennenzulernen. So dachte ich, bevor ich mein erstes Ojek bestieg.
Ojeks sind Mietmotorräder, die in Indonesien ebenso zum Straßenbild gehören wie die mobilen Garküchen. Besonders gekennzeichnet sind diese Okjeks nicht. Man erkennt sie daran, dass einer oder mehrere Motorradfahrer kretekzigarettenrauchend neben ihren Maschinen am Straßenrand stehen. Ojekfahrer sind immer Männer, meist jung, extravertiert und furchtlos, die dem Fahrgast auf Augenhöhe entgegentreten. Ihr Gehabe ist weder schleimig noch herrisch sondern gleicht dem Verhalten einer Fachkraft, die weiß, was ihre Dienstleistungen wert sind. War der Preis der Fuhre im Voraus ausgehandelt (Das allerding durfte man nicht versäumen), dann hielten sich die Fahrer an die Vereinbarung und fuhren ihren Klienten schnurstracks zum anvisierten Ziel. Der Hauptvorteil des Ojeks bestand in der Schnelligkeit, mit der man an allen Staus vorbei sein Ziel erreichte. Auch über die Unterhaltsamkeit einer Ojekfahrt brauchte man kein Wort zu verlieren. Man sah auch viel mehr vom Straßenverkehr, falls der Helm einem nicht dauernd über die Augen rutschte. Das Festhalten an Schulter oder Rumpf des Fahrers schuf Nähe zur einheimischen Bevölkerung. Wie sich der Ojekfahrer in den beständig fließenden dichten Verkehr einfädelte, wie robust er den Spurwechsel vollzog oder wie beherzt er in Überholungslücken hineinstieß, die sich jederzeit wieder schließen konnten, gehört rückblickend zu den bleibenden Erinnerungen meiner Indonesienreisen. Alles in allem kann ich die Anmietung eines Ojeks Jakartabesuchern mit Gottvertrauen und guten Nerven also durchaus empfehlen, Herzkranken und Ängstlichen rate ich allerdings von der Benutzung des Ojeks ab.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich die ganze Stadt mit dem Ojek erforscht. Leider zeigte sich, dass der normale Ojekfahrer ein ortsgebundenes Wesen ist. Ungern fuhr er Ziele an, die mehr als drei oder vier Kilometer von seinem Standort entfernt lagen. Möglich, dass die Ojekgruppen die Viertel der Stadt untereinander aufgeteilt haben, vielleicht aber hatten die Fahrer auch einfach keine Lust, sich so weit von ihren Kumpels zu entfernen. So blieb mir nichts anderes übrig, als für längere Exkursionen ein Taxi zu nehmen.
Taxifahren in Jakarta ist ein Erlebnis der besonderen Art. Es beginnt mit guten Nachrichten und endet unweigerlich im Stau. Die gute Nachricht ist, dass die Taxifahrer in Jakarta unter Androhung empfindlicher Strafen dazu verpflichtet sind, innerhalb des Stadtgebietes ihre Taxameter anzustellen. Das ist bitter für die Taxifahrer, denn die Fahrtpreise, die sie auf diese Weise abkassieren, gehören zu den niedrigsten in ganz Asien. Außerdem müssen der Name des Fahrers samt seinem Konterfei und der Nummer eines Beschwerdetelefons stets gut sichtbar im Innern des Fahrzeuges erkennbar sein. Waren die Taxifahrer auf diese Weise strengen Regulierungen unterworfen, konnte man das vom Verkehr nicht behaupten. Jeden Tag bewegen sich Millionen Pendler auf dem Weg zur Arbeitsstätte und zurück durch den Großraum Jakarta, und das umso konzentrierter, je mehr weiter man in die Innenstadt vordringt. Es war die pure Menge der Fahrzeuge, die einen fließenden Verkehr nahezu unmöglich machte. An jeder Kreuzung bildeten sich Staus, weil bei den Grünphasen die Fahrzeuge aus den Querstraßen die Kreuzung blockierten. Maßnahmen, die dieses Verkehrschaos abmildern sollten, waren in ihr Gegenteil umgeschlagen. So hatte man im August 2016 verfügt, dass an geraden Tagen des Monats nur Fahrzeuge mit geraden Kennzeichennummern in die Stadt fahren durften und an ungeraden nur Autos mit ungeraden Nummernschildern. Eine unerwartete Folge dieser Verordnung bestand darin, dass sich die wohlhabenderen Einwohner Jakartas einen Zweitwagen mit dem passenden Nummernschild anschafften, so dass sich die Zahl der Fahrzeuge nur noch erhöhte. Das neuartige Korridor-Bussystem erleichterte zwar den Bussen die Passage der Innenstadt, verkleinerte aber die Straßenfläche für den Restverkehr, so dass der Stresspegel weiter stieg.
Dieser ausweglosen Straßenüberfüllung konnten die Taxifahrer nur durch immer riskantere Fahrweisen begegnen, nicht nur, was die Schnelligkeit, sondern auch, was die Abstände zum Nachbarauto betraf. Indianern in den USA sagte man nach, sie seien in erstaunlichem Maße schwindelfrei, so dass man sie gut bei Hochbauarbeiten einsetzen könnte. Wie ich feststellen konnte, besaßen die Taxifahrer von Jakarta eine andere Spezialbegabung, nämlich eine unglaubliche Verlässlichkeit in der Abschätzung auch minimalster Abstände im Straßenverkehr. Wo bei uns ein Verkehrsfluss nur auf zwei parallelen Spuren funktionieren würde, ermöglichte diese Spezialbegabung drei, manchmal auch vier Fahrzeuge nebeneinander. Immer wieder bewunderte ich die Eleganz und den Wagemut, mit der sich die Taxifahrer schlangengleich durch das Verkehrsgewühl wanden, doch weil das alle taten, wurde das Chaos dadurch nicht gemildert, sondern nur auf eine neue Stufe gehoben.
Unter diesen Umständen grenzte es natürlich an Masochismus einen Nahverkehrsbus zu besteigen. Ein normaler Bus in Jakarta gleicht einem fußkranken Tier, das sich langsam durch enge Straßen schleicht, während es von Tausenden Autos und Motorrädern überholt, behindert und geschnitten wird. Anders verhält es sich allerdings mit den sogenannten Korridor-Bussen, die ich schon kurz erwähnt habe. Um Jakartas ultimativen Verkehrskollaps wenigstens etwas hinauszuzögern, war man auf die Idee verfallen, die existierenden Durchgangsstraßen in der Innenstadt einfach um eine separate Busspur zu beschneiden, auf denen nur die sogenannten „Korridorbusse“ und keine anderen Fahrzeuge fahren durften. Wohlgemerkt, es wurden keine neuen Straßen gebaut, sondern bestehende Straßen wurden einfach verkleinert und die Ein- und Ausstiegsstationen für diese neuen Buslinien als abenteuerliche Konstruktionen oberhalb der Straßen hinzugefügt. Tatsächlich war es nun den Einwohnern Jakartas möglich, die Innenstadt mit den diversen Korridor-Bussen auf den freigehaltenen Straßen relativ zügig zu durchqueren. Das Nachsehen hatten die normalen Autofahrer, die sich auf den reduzierten Reststraßenflächen mit noch mehr Staus herumschlagen mussten. Das nahm man in Kauf und empfahl den Gelackmeierten ganz einfach, den Bus zu nehmen – ungeachtet der Tatsache, dass ja nur ein winziger Teil des Großraums von Jakarta durch Korridorbusse erschlossen war.
Soweit, so semi-positiv. Auch meine Erfahrungen mit dem neuen Bus-System waren durchwachsen. Mein erster Versuch, einen Korridorbus in der Nähe von Alt-Batavia zu besteigen, misslang, denn der Bus war voll. Eine fröhliche Horde indonesischer Pfadfinder und eine Soldateneinheit auf Stadtexkursion hatten den Bus belegt. Doch da kam schon der nächste Bus. Er war herrlich leer, aber hinein kam ich trotzdem nicht, denn er war nur für Frauen reserviert. Die Hälfte der begehrten Sitzplätze war frei, auf der anderen Hälfte saßen junge und alte Damen und nickten mir aufmunternd zu, als wollten sie sagen: Warte nur, der nächste Bus voller Kerle ist nicht weit. So war es auch, der nächste Bus kam, und ich stieg ein. Doch nirgendwo konnte ich eine Fahrkarte kaufen, so dass ich an der nächsten Haltestelle wieder aussteigen musste, um ein Ticket an einem Automaten zu ziehen. Allerdings konnte man diese Tickets nur im Dutzend kaufen, auch wenn man nur zwei oder drei davon benötigte. Kein Wunder, dass sich in mir der Outlaw regte und ich allen Ernstes an Schwarzfahren dachte. Wer allerdings in Jakarta ohne einen gültigen Fahrschein erwischt wurde, hatte nichts zu lachen. Da die Scharia für solche Verfehlungen keinerlei Vorgaben machte, war schwer abzuschätzen, was mit einem westlichen Schwarzfahrer geschehen würde. Von der sofortigen Verhaftung bis zur schulterklopfenden Aushändigung eines kostenlosen Fahrscheins war bei der Breite des sundanesischen Wesens alles möglich. Deswegen ließ ich es und kaufte die Tickets im Dutzend.
„Merdeka“ bedeutet Freiheit. Was lag da näher, als nach der Ausrufung der indonesischen Unabhängigkeit einen Freiheitsplatz mitten in Jakarta zu errichten? So jedenfalls dachte Präsident Sukarno und befahl im Jahre 1961 die Anlage eines weiträumigen quadratischen Parks genau im Zentrum von Jakarta. Bei der Anlage dieses Merdekaplatzes wurden weder Kosten noch Mühen gescheut, denn der Präsident wollte, dass sich das Volk an seiner neugewonnenen Freiheit auch hinreichend ergötze. Mitten im Park, im Fluchtpunkt von vier großen Zufahrtswegen, entstand deswegen das Monas, das indonesische Unabhängigkeitsdenkmal, ein riesiger Obelisk, der sich von seinem Sockel aus nicht weniger als 132 Meter hoch in den Himmel erhob. Der sich nach oben verjüngende Obelisk wurde nicht nur mit einer Aussichtsplattform auf 111 Metern Höhe, sondern auf seiner Spitze mit einer stilisierten vergoldeten Flamme versehen. So prachtvoll gebärdete sich die Freiheit nach ihrem Sieg.
In Wahrheit hatte sich die Begeisterung der Bevölkerung von Anfang an in Grenzen gehalten. Zu unindonesisch, zu bombastisch, zu erratisch erschien das Monument, das bald hinter vorgehaltener Hand als „Sukarnos letzte Erektion“ verspottet wurde. Um zu verhindern, dass Bettler und Herumtreiber die Gloriole von Park und Monument beeinträchtigten, hatte man schon bald das ganze Gelände mit einem Zaun gesichert und nur einen schmalen Zugang gelassen, der von der Armee kontrolliert wurde. Auch die Freiheit benötigte schließlich einen Sicherheitsabstand zum einfachen Volk.
Ich passierte den Eingang des Merdekaplatzes, und setzte mich in den Schatten einer Palme. In hinreichender Entfernung vom Nationalmonument erschloss sich mir das klassische Jakarta Foto: in der Mitte des Bildes das Nationalmonument vor einem leeren Himmel, dann am unteren Bildrand auf der Höhe seiner Basis viel kleiner und entfernter die Skyline der Hochhäuser, die den Merdekaplatz umgaben. Unmittelbar vor mir erhob sich auf einem meterhohen Sockel eine überlebensgroße Reiterskulptur in extrem dramatischer Pose. Fatahilla, der sagenhafte Gründer Jakartas, zügelte sein sich spektakulär aufbäumendes Ross. Wer aber war Fatahillah? Glaubte man der geschichtlichen Überlieferung, dann handelte es sich um einen moslemischen Prinzen, der im Jahre 1527 den Hafen Sunda Kelapa erobert und an seiner Stelle die Stadt „Jayakarta“, die „Stadt des großen Sieges“, gegründet hatte. Die Nachricht dieses Monumentes war klar: Jakarta besaß einen moslemischen Ursprung und sah seinem 500. Stadtgeburtstag entgegen.
Soweit das offizielle Geschichtsbild. In Wahrheit hatte die Geschichte Jakartas als einer nationalen Metropole erst mit der Ankunft der Holländer begonnen. Sie hatten sich am Anfang des 17. Jahrhunderts in Westjava festgesetzt und im Jahre 1619 die Kolonialstadt Batavia gegründet. Der Ort war schlecht gewählt, denn die zahlreichen Kanäle, die die Stadt durchflossen, verwandelten sich schnell in Brutstätten der Malaria. Unzählige holländische Amtsträger samt ihrer Familien fanden auf diese Weise den Tod in den Tropen. Doch Batavia gedieh trotzdem, wuchs über die Hafengegend hinaus bis hin zum heutigen Stadtzentrum, an dem sich der Merdekaplatz ausbreitete.
Was war von Batavia geblieben? In der Hauptsache nur der Name und ein einziger restaurierter Platz im Norden der Stadt, der auch noch den Namen „Fatahillah Square“ trug. Dieser Platz war ein Kuriosum, ein blankgeputztes Holland in den Tropen, denn er bestand aus nichts weiter als aus einem guten Dutzend weißer Kolonialhäuser mit einer großen Kanone in der Mitte, eben jener Kanone, die die Holländer nach der Eroberung Malakkas im Jahre 1641 als Siegestrophäe nach Batavia gebracht hatten. Das auffälligste Gebäude des Fatahilla Squares war der Palast des Gouverneurs, ein weißes Gebäude mit rotem Ziegeldach und Kuppelturm, das man sich problemlos auch in den Niederlanden hätte vorstellen können. Die touristische Finesse dieses Platzes bestand im Angebot von mietbaren Hollandrädern, auf denen Touristinnen aus Korea und Japan, drapiert mit Damenhüten im Stil der Kolonialzeit, jauchzend herumfuhren. Auch im Café Batavia an der Nordseite des Platzes, wurden die alten Zeiten beschworen. Die Wände waren mit eingerahmten Schwarzweißfotografien bedeckt, auf denen lauter Kolonialbeamte mit ihren Familien zu sehen waren, wie sie von ergeben dreinblickenden Eingeborenen bedient wurden. An den Decken drehten sich die Ventilatoren, an den Tischen saßen die jugendlichen Nachfahren der europäischen Kolonisatoren und tranken Batavia-Punsch zum Klang verhaltener Jazzmusik. Alles war in ein trübes, nostalgisches Dämmerlicht getaucht, farbliche Akzente setzten nur die zierlichen Kellnerinnen, die wie kleine Püppchen zwischen den Tischen der Orang Blanda hin- und herhuschten.
Das Viertel nördlich des Fatahilla Squares bestand aus verschmutzen Kanälen, die in den Reiseführern allen Ernstes mit den Grachten Amsterdams verglichen wurden. Sie waren überspannt von baufälligen Steinbrücken und eingezäunt von Baustellen und Gerüsten, die nach Urin stanken. Die Behausungen wirkten verfallen und waren ineinander verschachtelt wie die Hütten eines Flüchtlingscamps. Manche Häuser standen gleich neben den Eisenbahnschienen, die das Gebäudegewirr wie ein Messer durchtrennten. Andere waren am Ufer der stinkenden Kanäle auf Stelzen errichtet worden. Ihre Bewohner saßen auf Emporen, rauchten, schliefen oder und fischten im trüben Gewässer nach ihrem Abendessen. Von den prachtvollen Makassar Schonern, von denen es hieß, sie würden noch immer Holz und Gewürze über die Sunda-See transportieren, habe ich nichts gesehen. Entweder waren sie alle unterwegs oder längst abgeschafft.
Auf der Rückreise machte ich in dem Chinesenviertel Glodok Station. Hier waren das Gedränge auf den Bürgersteigen und die Staus auf den Durchgangsstraßen noch katastrophaler als in anderen Teilen der Stadt. Was war alt, was neu, in diesem Gewirr aus eingeschlagenen Fenstern, Garküchen, Reisebüros, Wettbuden, Malls und Märkten rechts und links der verstopften Straßen? Die Reklameflächen verdeckten ganze Häuserfassaden, die Bürgersteige waren durch Auslagen oder parkende Fahrzeuge verstopft. Obwohl eine ganze Kohorte Straßenfeger damit beschäftigt war, den Müll einzusammeln, wurde der Abfall nicht weniger. So schnell konnten sich die Müllmänner gar nicht bücken, wie Papier, Essensreste oder Plastik auf die Straße geworfen wurden.
Obwohl der größte Teil der Chinesen von Glodok keineswegs der reichen chinesischen Oberschicht angehörte, hatten die Plünderungen und Ausschreitungen des Jahres 1998 hier in ganz besonderer Weise gewütet. Über zwölfhundert Menschen sollen bei den Pogromen am 13. und 14. Mai 1998 ums Leben gekommen sein. Die Zahl der Vergewaltigungen war unbekannt. Obwohl ein Teil dieser Ausschreitungen von politischen Akteuren organsiert worden waren, hatte eine strafrechtliche Aufarbeitung bis heute nicht stattgefunden. Zigtausende Chinesen hatten nach den Pogromen das Land verlassen, der Rest, der geblieben war, schwieg. Undenkbar, dass sich die chinesische Minderheit in Indonesien vergleichbar deutlich zu Wort melden würde wie die moslemischen Minderheiten in den europäischen Gesellschaften. Schikanen und Repressalien wären die Folge gewesen. Die traurige Wahrheit aber war: die weit überwiegende Mehrheit der Chinesen war einfach zu tüchtig, um bei der Mehrheit der indonesischen Bevölkerung beliebt zu sein. Dass viele Chinesen zudem als Christen in den Augen der moslemischen Mehrheitsbevölkerung „Ungläubige“ waren, machte die Ressentiments noch giftiger.
Ich setzte mich in eine Garküche und aß einige Geflügelspieße mit Reis und Erdnussbutter. Obwohl mich ein unbeschreibliches Chaos umgab, waren die Stühle und Tische sauber, der Verschluss der Wasserflasche war intakt und das Essen vorzüglich. Der Inhaber war natürlich ein Chinese, und wie die meisten Chinesen war er schnell, kompetent und nicht besonders freundlich. Als ich ihn über seinem Grill hantieren sah, fragte ich mich, wieviel Pogrome er bereits hinter sich hatte und wie viele noch auf ihn warten würden.
Unter den strenggläubigen Muslimen in Nordsumatra oder Zentraljava galt Jakarta als eine gottlose Stadt, obwohl auch hier wie im ganzen Land der Muezzin fünfmal am Tag zum Gebet rief und die meisten Frauen Kopftücher trugen. Was die orthodoxen Muslime störte, war zweierlei: die vermeintliche Sittenlosigkeit der nichtmuslimischen Minderheiten und, mehr noch, die „Laxheit“ der eigenen Glaubensbrüder, die es mit den Geboten des Koran nicht so genau nahmen.
Diese sogenannte Laxheit hatte eine lange Geschichte. Die Anreicherung des indonesischen Islams mit Ahnenkulten und Geisterglauben aus hinduistischen Quellen hatte einen sehr elastischen Alltagsislam entstehen lassen, in dem die unterschiedlichsten Glaubensinhalte rumpelten wie in einer zu vollen Kiste. Religiöse Puristen mochten das beklagen, in Wirklichkeit aber war es gerade diese Vermischung der Werte, die ihnen ihre Schärfe nahm und sie in multireligiösen Gesellschaften alltagskompatibel machte. Die Durchsetzung des indonesischen Volksislams mit Riten und Mythen aus anderen Religionen nahm ihm das Unbedingte und Kompromisslose, das ihn im Nahen Osten oder in den Parallelgesellschaften des Westens so kämpferisch und unverträglich machte.
Soweit, so abstrakt. Wie aber sah das konkret aus? Der junge Moslem, der während des Frühstücks im Ashley Hotel am Nebentisch sein Rührei aß, besaß nur einen zarten Flaum am Kinn, während seine hübsche Gattin ein locker geschürztes buntes Kopftuch trug. Sie repräsentierten den modischen Standard des indonesischen Alltagsislams. Ein mittelalter Indonesier mit bemerkenswertem Salafistenbart scheppte sich am Buffet tüchtig den Teller voll, sein wuchtiges Weib war bis auf einen Seeschlitz in der Burka schwarz verhüllt. War das die Zukunft? Demgegenüber wirkten der glattrasierte Chinese und seine offenherzig gekleidete Freundin merkwürdig unzüchtig wie Wesen aus einer anderen Galaxie. Alle drei Paare saßen nebeneinander im gleichen Frühstücksraum und repräsentierten ein Ausmaß an Verschiedenheit, das man je nach Standpunkt als Bereicherung oder Gefahr ansehen konnte.
Die Istiqlal Moschee in der Nähe des Merdekaplatzes war die Hauptmoschee Jakartas, ein riesiger Bau, der mit seinen geraden, vertikalen Pfeilern fast an ein Flughafengebäude erinnerte. Der Innenraum der Istiqlal Moschee gehört zu den größten Gebetshallen der muslimischen Ökumene, er war komplett mit Teppichen ausgelegt und von vier Etagen gesäumt. Ob wirklich 120.000 Menschen in dieser Moschee Platz fanden, konnte ich nicht abschätzen, denn als ich die Moschee besuchte, waren nur einige hundert Menschen anwesend, die sich zudem in den Weiten des Gebäudes verloren. Dutzende lagen auf dem weichen Teppich unter der Kuppel und schliefen, dösten oder meditierten. Auch ich legte mich lang auf den Boden und spürte sofort die wohlige Entspannung, die mich immer überkommt, wenn ich eine Moschee betrete. Nach dem unerträglichen Lärm der Straße erschien mir die Stille unter der großen Kuppel fast wie ein Gottesbeweis.
Ich war eingeschlafen und erwachte, als eine tiefe, gutturale Stimme zum Gebet rief. Sie füllte die gesamte Moschee, sie war überall, in der Halle, in den Winkeln, in meinem Kopf. Als sei in den Schlafenden ringsum mich herum ein Schalter umgelegt worden, öffneten sie die Augen, erhoben sich und gingen zur Kiblawand. Von überall her, von den Brüstungen, Etagen und Treppen, kamen die Menschen und knieten sich nebeneinander vor die Wand, die in Richtung Mekka wies. Wie beneidete ich in diesem Augenblick diese Menschen um ihre religiöse Geborgenheit und ihre spirituellen Kraftreserven, die sie schützen werden, wenn ihre Stunde kommt. Ich dagegen war ein spirituelles Federgewicht, das nur in den Zeiten des Glücks gedeihen konnte, wie viele meiner Zeitgenossen ein Gutwettergewächs, das sofort einknicken würde, wenn der Sturm kommt.
Auf Indonesier, die nicht wohlhabend genug waren, die Weiten ihrer Heimat selbst zu erkunden, wartete im Süden Jakartas eine Attraktion der besonderen Art: der „Mini Indonesia Park“, eine weiträumige Anlage mit Grünflächen, Ausstellungshallen und Tiergehegen, in der die Sehenswürdigkeiten des Landes im Legoformat präsentiert wurden. Auch Touristen, die in Jakarta ihre Indonesienreise begannen, hätten im Mini Indonesia-Park einen ersten Eindruck von ihren Zielgebieten gewinnen können – wenn die lange Anfahrt nicht die meisten Besucher abgeschreckt hätte. Auch ich benötigte mit Ojek, Korridorbus und Taxi geschlagene zwei Stunden, bis ich von der Innenstadt aus den Park erreichte. Er war mäßig besucht und hatte seine besten Tage hinter sich. Rasen und Wege waren verunreinigt, eine ganze Reihe von Ausstellungshallen war geschlossen, vom benachbarten Freibad hallte Kindergekreische herüber. Die Hauptattraktion des Parks war ein künstlicher See, in dem sich kleine Inseln befanden, die den Umrisse der indonesischen Geografie nachgebildet waren. Diesen See konnte man in den Gondeln einer Seilbahn überqueren und so auf „Borneo“, „Java“ oder „Bali“ herabblicken. Den größten Zuspruch fanden die Nachbauten altindonesischer Behausungen, die in der Nähe des Sees aufgestellt worden waren. Ein spitzgiebeliges Batakhaus und eine mattengedeckte Papuahütte, dazu die eine oder andere Pappfigur, vermittelten eine Stimmung zwischen Kitsch und Urweltlichkeit.
Authentischer wurde es im benachbarten Tiergehege des Freizeitparks. Ich sah Adler, Kakadus, Kormorane, Pelikane und bunte Vögeln aller Art, nur der angekündigte Komodo-Waran war gerade erst verstorben. Ich begegnete dem Beppo, dem klassischen Weichverdauer, den die Evolution dazu verurteilt hatte, das ganze Leben lang an Durchfall zu leiden. Dann betrachtete ich einen Vogel, an dem Charles Darwin seine Freude gehabt hätte: die Eier, die er legte, besaßen so harte Schalen, dass es nur den kräftigsten Küken gelang, ans Licht der Welt zu schlüpfen. Ein Nandu stand unbeweglich in seinem Käfig. Was war an ihm bemerkenswerter? Sein Kopfputz oder seine kräftigen Beine mit denen er beachtliche Tritte austeilen konnte? Ich sah es mit Interesse, vergaß aber die Vogelnamen sofort wieder. Ich kann mir nur Götternamen merken, bei Vögeln versagt mein Gedächtnis.
So vergingen die Tage, und langsam gewann ich ein Gefühl für die Stadt, für Ihre Größe, ihren Verkehr, für die besten Tageszeiten, um bestimmte Orte zu besuchen oder es besser bleiben zu lassen – und für ihren Ehrgeiz, eine Metropole wie Singapur, Hongkong oder Tokyo zu werden, die nicht nur als Etappe, sondern um ihrer selbst willen besucht werden. Die großen Einkaufsmalls im Süden der Stadt und die neue Schnellstraße zwischen Innenstadt und Flughafen verdeutlichten schon heute den Anspruch, eine Weltstadt zu sein – die Gassen von Sunda Kelapa oder Glodok erinnerten aber noch immer eher an Kalkutta oder Manila.
Weltstädtisch wirkte Jakarta am ehesten vom Aussichtspunkt des Unabhängigkeitsmonumentes. Einhundertelf Meter über dem Merdekaplatz erschien mir die Stadt wie ein Ozean aus Stein. Ein Kranz aus Hochhäusern hatte sich wie ein lückenloser Ring um das Stadtzentrum gelegt, dahinter verschwanden die endlosen Häuserflächen im diesigen Dunst des Tages. Wie groß war diese Stadt? In den offiziellen Stadtgrenzen waren es zehn Millionen. Da die Stadt aber immer weiter ins Umland hinein wuchs und mit den Nachbarstädten Bogor, Depol, Tangerang und Bekasi zunehmend verschmolz, war eine Metropolregion mit etwa 30 Millionen Menschen entstanden. Dieses neue Gebilde, das man bereits auf den Kunstnamen Jabodetabek getauft hatte, war damit nach Tokyo der zweitgrößte urbane Ballungsraum der Erde.
Drei Dolche müssen es schon sein
Lazy days in Yogjakarta
In einem Akt unbedachter Selbstkasteiung hatte ich mir ein Ticket für den Nachtzug nach Yogjakarta besorgt. Ich hätte auch fliegen oder mit einem Touristenbus fahren können, aber ich wählte den Zug, denn ich wollte möglichst „authentisch“, das heißt, volksnah, reisen, was immer das auch bedeuten mochte. Inzwischen hege ich an diesem Konzept meine Zweifel, aber damals glaubte ich noch daran, und so nahm das Unheil seinen Lauf.
Am Eingang des Hauptbahnhofs hätte ich noch umkehren können, doch ich blieb verstockt. Ganz unjavanisch nervös, hektisch, mit Tunnelblick und unwirschen Gesten liefen die Leute hin und her. Es roch nach Curry, Schweiß und Öl. Kleine Kinder lagen neben ihren Müttern auf einer Decke und schrien. Sehnsüchtig dachte ich an die Disziplin, wie ich sie einmal auf dem großen Bahnhof von Xian in China erlebt hatte. Dort hatten sich die Passagiere in Zweierreihen aufstellen müssen, ehe sie, von strengen Aufseherinnen geführt, den Bahnsteig betreten durften.
Aber Jakarta war nicht Xian, und so brach, kaum dass der Zug hielt, ein mittleres Chaos aus. Alle malaiische Höflichkeit war verschwunden, als sich die Massen durch die Eingänge quetschten. Mein Rucksack war Hindernis und Hilfe zugleich – mit ihm kam ich zwar nur mit Mühe durch den Eingang, konnte aber durch geschicktes Schwenken den Zugang zu dem Platz abwehren, den ich schließlich besetzte. Am Ende fand ich einen Platz in einem offenen Abteil neben einem halben Dutzend Javaner von Gottseidank schlanker Statur.