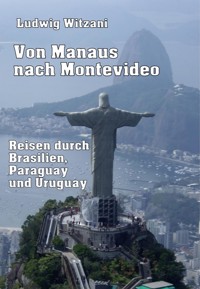Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Untergang des Kommunismus hat die baltischen Länder und Polen befreit, sie sind aus ihrem totalitären Kälteschlaf erwacht und dabei, eine noch ungewisse Zukunft zu gestalten. Anders verhält es sich noch mit dem Kaliningrad Oblast, mit Sankt Petersburg und Weißrussland, aber auch hier hofften die Menschen endlich Abschied nehmen zu können von den Verwüstungen des 20. Jahrhunderts. Ein anderes Europa nimmt Gestalt an, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Formen, und Ludwig Witzani wollte mit eigenen Augen sehen, wie sich diese Umbrüche vollziehen. Dabei trifft der Autor auf ein Europa, das dabei ist, einen stürmischen Aufbruch zu wagen, und dass doch zugleich noch immer an den Hypotheken einer Vergangenheit trägt, die nicht vergehen will: der Erinnerung an den nationalsozialistischen Massenmord und die Deformationen, die der Kommunismus den osteuropäischen Völkern nach dem Zweiten Weltkrieg zugefügt hat. In der Begegnung mit den historischen Zeugnissen dieser Epochen aber auch mit den Menschen, die ihm auf dieser Reise begegnen, gewinnt der Autor ein neues Bild von der europäischen Peripherie, die keine Peripherie mehr sein will - und eine neues Verständnis seiner deutschen Identität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titel
Copyright
Karte
Vorbemerkung
START IN HELSINKI
ESTLAND oder: Was ist Osteuropa?
LETTLAND oder: Die Russen sind an allem schuld
LITAUEN oder: Der kleine Engel der Freiheit
KALININGRAD OBLAST oder: Palimpsest der Geschichte
OSTPOLEN oder: Der Christus unter den Nationen – Danzig
OSTPOLEN oder: Der Christus unter den Nationen – Warschau
OSTPOLEN oder: Der Christus unter den Nationen – Zakepie, ein Dorf in Polen
WEISSRUSSLAND oder: Im Herzen des Blutlandes – Brest
WEISSRUSSLAND oder: Im Herzen des Blutlandes – Grodna
WEISSRUSSLAND oder: Im Herzen des Blutlandes – Minsk
WEISSRUSSLAND oder: Im Herzen des Blutlandes – Khatyn
FINALE IN SANKT PETERSBURG
Literaturhinweise
Über den Autor
Ludwig Witzani
Die kleine Posaune
der Freiheit
Osteuropäische Reisen
zwischen Riga und Danzig,
Warschau und Sankt Petersburg
Ludwig Witzani: Die kleine Posaune der Freiheit
_________________________________________________________________
Copyright: Ludwig Witzani 2016
VORBEMERKUNG
Glück heißt, im Augenblick zuhause zu sein - besser kann ich es nicht sagen. Gemessen daran, ist es für das Glück des Reisens von Vorteil, daheim nicht allzu viel zurück zu lassen: keinen Ärger, keine Schulden, keine Termine und schon gar keine große Liebe. Eine große Liebe passt nicht zum Reisen. Die Sehnsucht legt sich dem Reisenden wie eine Klappe vor die Augen, und er sieht nur seine Liebe und nicht die Welt.
Da traf es sich gut, dass zuhause auf mich überhaupt keine Liebe wartete, weder eine große noch eine kleine. Ich war frei und offen wie ein Scheunentor für das, was es zu sehen gab. Das war die Stimmung, in der ich beschloss, eine Reise durch Osteuropa zu unternehmen.
Der Untergang des Kommunismus hatte die baltischen Länder und Polen befreit, sie waren aus ihrem totalitären Kälteschlaf erwacht und dabei, eine noch ungewisse Zukunft zu gestalten. Anders verhielt es sich noch mit dem Kaliningrad Oblast, mit Sankt Petersburg und Weißrussland, aber auch hier hofften die Menschen endlich Abschied nehmen zu können von den Verwüstungen des 20. Jahrhunderts. Ein anderes Europa nahm Gestalt an, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Formen, und ich wollte mit eigenen Augen sehen, was dort geschah.
Bald merkte ich jedoch, dass nicht nur die Zukunft wie eine Verheißung über diesem anderen Europa lag. Dieses Europa trug auch an den Hypotheken einer Vergangenheit, die nicht vergehen wollte. Eigentlich waren es zwei Belastungen, die mir auf Schritt und Tritt begegneten, einerseits die Spuren der nationalsozialistischen Massenmorde während des Zweiten Weltkrieges, und andererseits die mentalen und materiellen Deformationen, die der Kommunismus den osteuropäischen Völkern nach dem Zweiten Weltkrieg zugefügt hatte. So änderte sich, zuerst unmerklich, dann aber immer deutlicher, die Stimmung der Reise.
Am Ende bin ich als ein anderer heimgekehrt. Nicht unbedingt klüger, aber demütiger vor dem, was den Esten, Letten und Litauern, den Russen, Polen und Weißrussen wiederfahren ist und was sie erwartet.
Mein Dank gilt allen Mitreisenden, die mich eine Strecke begleiteten, allen neuen Freunden, die ich unterwegs gefunden habe und den Gastgebern, die mich eine Zeitlang beherbergten. Wo es erforderlich schien, wurden einige Namen aus Gründen der Diskretion verändert. Einige Abläufe wurden im Interesse der Lesbarkeit gestrafft. Für meine Perspektive und meine Urteile bin ich jedoch ganz allein verantwortlich.
Wer anderer Meinung ist, soll sich auf die Socken machen und selber sehen…
(Zur Vergrößerung der Bilder
einfach nur auf die Bilder klicken)
START IN HELSINKI
Dass eine Reise durch den großen Osten in Helsinki beginnen sollte, dafür gibt es gute Gründe. Der unwichtigste ist noch der, dass die Flugverbindungen nach Helsinki ausgezeichnet sind, weniger wichtig ist auch, dass man sich in dieser Welthauptstadt der Intelligenten und der Fleißigen noch einmal so richtig an europäischer Normalität laben kann, ehe man das Reich von Schmalzbrot und Bortschsuppe betritt. Das bedeutendste Argument aber, das für Helsinki spricht, ist der Kontrast. Helsinki, die nördlichste Hauptstadt der Welt, liegt so nahe an Osteuropa, dass Stadt und Land nicht ohne Blessuren durch die gemeinsame Geschichte gekommen sind - aber auch in einer so hinreichenden Distanz, dass es den Finnen möglich war, sich nicht in den Strudel hereinreißen zu lassen, der von den Völkern Osteuropas so furchtbare Opfer abgefordert hat. Im Vergleich zu Kaliningrad, Minsk oder Riga ist Helsinki eine wohlhabendes Auenland, ein politischer Balkon, von dem aus man halb mit Schrecken und Grausen, halb mit Interesse und Mitgefühl auf die Völker jenseits des Meeres blicken könnte – wenn man es nur wollte. Aber dieses Interesse daran, was östlich der eigenen Haustüre geschieht, ist in Helsinki nur mäßig ausgeprägt. Das Land ist ganz und gar nach Europa ausgerichtet und hat damit schon lange genau das vollzogen, von dem der Großteil der Osteuropäer so lange vergeblich träumte.
Solche Gedanken hatte ich nur ganz vage im Kopf, als ich am Beginn meiner osteuropäischen Reise für ganz kleines Geld einen Flug von Köln nach Helsinki buchte. Es war Sommer, meine Reisekasse war hinreichend gefüllt, und ich verfügte über ein leidliches Hotel in Zentrumsnähe. Morgen würde ich nach Estland fahren - Zeit genug, heute ein wenig durch die Stadt zu schlendern.
Ich begann meinen Spaziergang durch Helsinki an der Esplanade. Sie ist die Flaniermeile der Stadt, großbürgerlich, was ihre Fassaden betrifft, und einladend, weil ein lang gestreckter Park in ihrer Mitte zum Verweilen einlädt. Als ich die Esplanade erreichte, herrschte Hochbetrieb, denn die Sonne schien, was in Helsinki nicht allzu oft vorkommt. Nachwuchssänger mit ihren improvisierten Kombos gaben Kostproben ihres Repertoires zum Besten, südländische Gaukler vollführten ihre Kunststücke, und Schwarzafrikaner tanzten zum Schlag der Bongotrommel. Auch die Eismänner machten gute Geschäfte, und ein einsamer Polizist schaute zufrieden auf die erbaulichen Bilder öffentlicher Ordnung. .
Doch hinter der Idylle lauert das Grauen, sagte Adorno, und tatsächlich ließen im Rücken des einsamen Polizisten die Halbwüchsigen auf den Wiesen feixend die Schnapsflaschen kreisen. Gierig öffneten sie die Münder und schüttelten sich den Fusel in den Schlund. Musste man sich Sorgen machen? Nein, antworten die Offiziellen, denn die extrem hohen Alkoholpreise haben in Finnland längst dazu geführt, dass achtzig Prozent der Finnen trocken und nur zwanzig Prozent verarmte Alkoholiker sind – übrigens nach Meinung der Einheimischen genau umgekehrt wie bei der sexuellen Libertinage, die dazu führt, dass zwanzig Prozent der Finnen total befriedigt sind und achtzig Prozent unerlöst in ihre Unterhose schauen müssen.
Wer an diesem Nachmittag befriedigt oder unerlöst über die Esplanade lief, war für mich auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Reizvoll aber war es, unter all den anwesenden Finnen nach jenen Merkmalen überragender Intelligenz zu suchen, die den Sprösslingen dieses Volkes ihre atemberaubenden Leitungen in den Pisa-Tests ermöglichen. In Mitteleuropa musste man eine Zeitlang nur „Finnland“ sagen, und schon ging ein Ruck der Ehrerbietung durch die Zuhörer, als hätte man ein geheimes Codewort geäußert, das die Antwort zu allen Grundfragen des Bildungssystems, der Müllentsorgung und der Sozialversicherung beinhaltete. Auch das Verhalten der Finnen in der aktuellen Eurokrise sprach für ihre Intelligenz. Sie waren die einzigen gewesen, die den Schalmeiengesängen der Griechen nicht geglaubt hatten und sich ihre Kredite durch die Goldvorräte der griechischen Nationalbank absichern ließen. Umso überraschter war ich, dass an diesem Tag besondere Anzeichen der Intelligenz in den Gesichtern der Finnen nicht zu sehen waren. Immerhin konnte ich erkennen, dass das Gesicht des Finnen auf Eindeutigkeiten hin angelegt ist: Nokia oder Sonera, Elch oder Wolf, Tanne oder Fichte, Samstag oder Sonntag – das waren die binären Entscheidungen, die der Finne auf der Esplanade in seiner Mimik präsentierte. Wenn er lachte, dann lachte er von einem Ohr zum nächsten, wenn er böse war, dann rutschten ihm die Augenbrauen wie ein zu tief herabgezogener Vorhang über die Augen. Soweit ich erkennen konnte, war der Normalfinne in der Regel blond, was niemand überraschen dürfte, litt aber oft unter recht dünnem Haarwuchs. Seine Ohren kamen mir kräftig vor, wie zwei Haltegriffe ragten sie links und rechts vom Schopf aus weit in die Tiefen des Raumes. Das Kinn war kantig, die Nase aber klein, ebenso wie die Augen, die die Umgebung immer ein wenig skeptisch musterten.
Als ich die Esplanade verließ und über die großen Straßen der Stadt flanierte, war es erstaunlich menschenleer. Am Wetter konnte es nicht liegen - auch, dass nun alle, die sich nicht auf der Esplanade herumtrieben, zuhause saßen und sich weiterbildeten wollte ich nicht glauben. Und wenn ich einmal einen Finnen sah, dann saß er/sie allein auf einer Parkbank am Meer und starrte nach Süden. Meistens handelte es sich dabei um junge Frauen, die sich wie die Tauben auf den Bänken niedergelassen hatten, als erhofften, sie dass sich ein Fenster des Nachbarhauses öffnen möge und ein junger Finne als Täuberich herangeflogen käme.
Die meisten Menschen aber die mir an diesem Tag begegneten waren Touristen, und ich merkte bald, dass der typische Finnlandtourist ein rüstiger Fünfziger ist - ganz einfach, weil die Preise in diesem Land so gepfeffert sind, dass sie nur ein arrivierter Erwachsener bezahlen kann. Übrigens entstammt auch das Olympiastadion den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als Finnland Austragungsort der Olympischen Spiele gewesen war, Feldmarschall Mannerheim, der Freiheitsheld der finnischen Geschichte, an dessen Reiterstandbild die Touristenbahn vorbeiführt, war ebenfalls in den Fünfziger Jahren gestorben. Die Straßenbilder, die Architektur von Hauptpost und Bahnhof, die Gemächlichkeit des öffentlichen Lebens, all das erinnert an die Fünfziger Jahre, so dass ich mich schon fragte, welche besondere Bewandtnis es mit dieser Zahl in Finnland haben mochte. War es denn kein Zufall, dass mein Low-Budget-Zimmer 50 Euro kostete und dass Finnland ungefähr der 50.größte Staat der Erde ist?
Mit dieser ungeklärten Frage im Kopf erreichte ich die Felsenkirche von Helsinki, vor deren Eingang der berühmte Monumentalkopf des Komponisten Jean Sibelius die Besucher erwartet. Im Inneren der Felsenkirche lief ein Endlosband mit der Nationalkomposition „Finnlandia“, ein so leicht eingängiger Musikgenuss, dass er in unseren Breitengraden vom strengen Theodor Adorno als „banal“ gescholten wurde. Ich notierte: Adorno ist kein Finnenversteher! Tatsächlich war Genie und Produktivität des großen Sibelius schon dreißig Jahre vor seinem Tod versiegt. Hoffentlich geht das mit Finnland nicht ebenso, dachte ich: Super Pisa-Leistungen am Beginn des 21. Jahrhunderts, dann spätestens ab 2050 totale Ebbe. Wie man hörte, waren die Ergebnisse der PISA-Tests nach der Einführung moderner Unterrichtsmethoden auch schon böse eingebrochen.
Nicht weit entfernt von Felsenkirche und dem Sibeliuspark befand sich der Hietaniemistrand, eine Uferpassage, an dem ich kaum Badegäste, aber jede Menge öffentlicher Teppichwaschplätze erblickte. Öffentliche Teppichwaschanlagen gehören in Helsinki ebenso zum Straßenbild wie der Paschtune mit Kalaschnikow in Kabul. Dass der Finne sich um derart um die Sauberkeit seiner Teppiche sorgte, erschien mit wie ein Beweis hoher zivilisatorischer Gesittung. Selbstverständlich sollte nach der Teppichreinigung auch niemand mit seinen dreckigen Tretern den Wohnungsboden verunreinigen, weswegen vor den Hauseingängen kunstvolle Vorrichtungen ineinander verkeilter Bürsten installiert waren, mit denen der Finne sein Schuhwerk bereits vor dem Betreten von Treppenhaus und Wohnung säubern konnte. Unter diesen Umständen ist es natürlich kein Wunder, dass der Finne den Hund, einen potentiellen Wohnungs- und Teppichverschmutzer, am liebsten nur im Fernsehen sieht. Der reale Hund in Finnland hat im Unterschied zu Elch und Ren kein gutes Leben, ist er doch darauf angewiesen, in genau umzirkelten Hundearealen sein Häufchen zu verrichten und ansonsten streng an der Leine durch die Gegend geführt zu werden. Hat der Finne außer dem Hund mit dreckigen Pfoten auch noch andere Feinde? Offiziell nicht, wenn man von den Mücken absieht, die an heißen Sommertagen bis in die Innenstädte vordringen und das Wohlbefinden der Einheimischen stören.
Allerdings gleichen heiße Sommertage in Helsinki einem Gast, der nur sehr selten erscheint und sich schon wieder verabschiedet, wenn er gerade erst gekommen ist Hatte gerade noch eine kräftige Sonne durch eine großzügige Wolkenlücken die Kuppel des Engelsdoms illuminiert, so zogen sich jetzt schon wieder die Wolken über der Stadt zusammen. In dramatischem Tempo verdüsterte sich der Himmel und senkte sich als graue Wolkenfront fast bis auf die Scheitel einsamer Flaneure herab. Ich notiere: Helsinki ist kein Ziel für späte Nachmittage. Die Farben verblassten. jede Weite verschwand, dafür waberte plötzlich eine neblige Nässe durch die Straßen. Eine Ahnung skandinavischer Schwermut stieg in mir hoch, und ich ahnte: wir näherten uns der Stunde des ersten Schnapses.
In dieser Stimmung erreiche ich das historische Herz der finnischen Hauptstadt, den Senatsplatz von Helsinki. Noch nie habe ich einen so großen Platz mit so wenigen Menschen gesehen. So richtig voll wird er wohl nur in geschichtlichen Hochdruckzeiten gewesen sein - etwa im Jahre 1812, als der russische Zar Alexander I den Finnen ihre nationalen Sonderrechte innerhalb des Zarenreiches bestätigte und Helsinki zur Hauptstadt Finnlands erhob - oder ein Jahrhundert später, als nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches im Jahre 1917 auf dem großen Platz der blutige Bürgerkrieg zwischen Linken und Rechten begann. Heute ist der Senatsplatz umrahmt von sorgfältig restaurierten Fassaden und begrenzt durch die monumentale Treppe, die zum Engelsdom führt. In der Mitte des Platzes, der von oben wie eine große Schüssel wirkt, befindet sich die Statue des großen Reformzars Alexanders II, des einzigen Russen, wie es etwas böse heißt, den die Finnen jederzeit wieder in ihrer Hauptstadt sehen wollen.
Gerne hätte ich auf der obersten Stufe der großen Treppe auf dem Senatsplatz noch ein wenig über die Geschichte dieses erstaunlichen Volkes gegrübelt, doch der Regen wurde immer stärker. So blickte ich ein letztes Mal über die Dächer der Stadt, die so gar nichts Heldisches an sich hatte, sondern klein und überschaubar wirkte wie ein Freund, zu dem man auf Anhieb Vertrauen fasst. Langsam versank der große Platz im Regen, und die letzten Finnen, die den Arkaden des Engelsdomes gesessen und Trübsinn geblasen hatten, erhoben sich nach und nach - wahrscheinlich um nachhause zu gehen um zu sehen, was der Teppich macht.
ESTLAND
oder:
Was ist Osteuropa?
Die Umrisse Helsinkis entschwanden im Nebel, und das Fährschiff nahm Kurs auf hohe See. Dunkel und schwarz teilte sich das Wasser der Ostsee vor dem mächtigen Kiel, während im Schiff die Lampen angingen. Meine Reise in den Großen Osten hatte begonnen.
Überall lag Gepäck in den Gängen, Kinder plärrten, und gestresste Mütter und Väter versuchten so gut es ging, ihre Familien zusammenzuhalten. Vor der gerade erst geöffneten Bar drängten sich die finnischen Touristen, denn so preiswert wie auf einer estnischen Fähre konnte man sich in Finnland nirgendwo volllaufen lassen.
Bei einem Bier traf ich Stefan, einen deutschen Touristen aus Koblenz, einen blonden, groß gewachsenen Mann in späten Dreißigern, der auch das Baltikum bereisen wollte. Er besaß ein offenes Gesicht mit energischem Kinn, breite Schultern und kurz geschnittenes, glattes Haar, was ihm das Aussehen eines Soldaten auf Heimaturlaub gab. Was Stefan beruflich machte, war nicht zu erfahren, stattdessen plauderte er recht unverblümt über das Motiv seiner baltischen Reise. Stefan interessierte sich nicht für die Städte und Kirchen, nicht für Politik oder Geographie, sondern ihn interessierten die Frauen von Estland, Lettland und Litauen, die nach seinen Informationen zu den schönsten Europas zählten sollten. Daheim seien die Frauen zu schwierig, zu viel Zickenpotential, zu anspruchsvoll. Die baltische Frau dagegen, so Stefan, sei groß gewachsen, gut aussehend, belastbar und anschmiegsam, außerdem gebildet und dankbar. Das wisse er von seinem Onkel, der eine Baltin aus dem Katalog herausgesucht und schließlich geheiratet hatte.
Es war schon dunkel, als wir Estland erreichten. Alles war flach: die Ufer, das Meer, der Horizont, nur in der Mitte unterbrachen die Hochhaussilhouetten der Neustadt von Tallinn das eintönige Bild. Das war die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht war, dass im Schatten dieser Hochhäuser die Altstadt lag, eine in ihrer Bausubstanz vollkommen erhaltene Bilderbuchsiedlung mit Wachtürmen, Wällen und holprigen Pflasterstraßen. Kein hässlicher Betonneubau beeinträchtigte den Anblick der alten Gildenhäuser, keine Auspuffgase verpesteten die Luft, wir betraten ein autofreies Miniatur-Prag im Baltikum. In der Altstadt von Tallinn war die Geschichte zur Erbauung der Touristen einfach angehalten worden, gerade so, als man hätte endlich alle Fremdherrscher aus der Stadt heraus geworfen und nur die Esten zurückgelassen, die nun als Kellner, Platzanweiser und Fremdenführern den westlichen Gästen zu Diensten stehen.
Ohne groß zu fragen, heftete sich Stefan an meine Fersen, als ich durch die Straßen der Altstadt lief. Ich suchte das "Vana Tom" eine in allen Travellerführern wärmstens empfohlene sogenannte "Low Budget Unterkunft" für Individualreisende. Das Hostel befand sich in der in unmittelbarer Nachbarschaft des Marktplatzes auf der ersten Etage eines unscheinbaren Hauses, in dessen zweiten Stock gerade ein Stripteaselokal eröffnet hatte.
Da nur noch ein Doppelzimmer frei war, teilten wir uns einen Raum mit zwei durchgelegenen Matratzen und einer einzigen Glühbirne an der Decke. Ich klopfte an die Wände und stellte fest, dass sie überwiegend aus Sperrholz bestanden. „Macht nichts“, sagte Stefan, „ich habe ausreichende Vorräte an Ohrstöpseln in meinem Gepäck.“
In der Gemeinschaftsküche, in der wir unser Abendbrot nahmen, trafen wir einen österreichischen Schauspieler, einen amerikanischen Studenten und zwei Finnen, mit denen ein munteres Geschnatter einsetzte. Verkehrssprache auf den internationalen Travellerpfaden war Englisch, auch wenn man davon oft nur sehr wenig verstand und sich manchmal nicht sicher war, ob der Gesprächspartner nicht vielleicht doch in seiner Muttersprache zu uns sprach. So war auch an diesem Abend nur sehr wenig zu verstehen, außer, dass es sich bei dem Gemeinschaftskühlschrank um das letzte Relikt des Kommunismus in Estland handelte - einem Gerät, in das die Guten und Fleißigen jeden Tag Eier, Butter, Käse Milch und Joghurt hineinlagerten, während die Bösen und Faulen diese Güter unbemerkt verzehrten.
Nach dem Abendessen verschwand Stefan in die Stadt. Ich las noch ein wenig in meinen Reiseführern und lernte, dass ich mich in einem regelrechten Zwergstaat befand, der auf der Landkarte immerhin die Größe der Schweiz oder der Niederlande erreicht, ansonsten aber nur 1,2 Millionen Einwohner zählt, von denen auch noch ein Drittel Russen sind. Wie ich weiter erfuhr, hatte die Geschichte den Esten ganz und gar nicht gut mitgespielt. Jahrhundert für Jahrhundert war das Land von Schweden und Russen derart malträtiert worden, dass die estnische Bevölkerung, die im Mittelalter genauso groß gewesen sein soll wie die finnische, immer weiter geschrumpft war, bis sie schließlich im 20. Jahrhundert nur noch ein Fünftel der finnischen Bevölkerung ausmachte. Angesichts der massenhaften Einwanderung der Russen nach Estland hätte wahrscheinlich nicht viel gefehlt, dass die Esten im Vielvölkerstaat der alten UdSSR einfach verschwunden wären. Eine der vielen Ethnien, die in der großen Suppe des Ostens verloren gingen und von denen heute keiner mehr spricht. Doch manchmal hält die Geschichte auch ein happy end bereit: kurz vor dem demografischen Verschwinden des estnischen Volkes brach die UdSSR zusammen, Estland wurde frei und rettete sich mit letzter Kraft in die NATO und 2004 sogar in die Europäische Union.
Inzwischen wurde der Lärm aus dem Stripteaselokal über dem Hostel immer lauter. Dumpfe Bässe wummerten durch die Wände, spitze Schreie waren zu hören, trotzdem fiel mir bald das Buch aus den Händen,und ich schlief ein.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, lag Stefan schnarchend im Nachbarbett. Immerhin war er allein, hatte also bei den schönen Baltinnen noch keinen Stich landen können. Ich kochte mir einen Morgenkaffee in der Gemeinschaftsküche, duschte in der Gemeinschaftsdusche und begann meinen Rundgang durch die Stadt.
Es war noch früh am Morgen, doch der Marktplatz der Stadt war bereits von Buden zugestellt. Vor einer Apotheke aus dem Jahre 1422 unterhielt ein Schaukünstler die Passanten mit seinen Kapriolen, Eiscafés hatten geöffnet, und vor den Restaurants bedrängten Schlepper in die vorbeiflanierenden Touristen. Ich sah mich um und versuchte, eine bestimmte Atmosphäre zu erspüren. War das hier Osteuropa? Oder Skandinavien? Irgendwie sah alles so aus wie in Rothenburg ob der Tauber, nur die Männer kamen mir stämmiger vor, manche hatten Unterschenkel wie Kinderrümpfe, andere liefen im Unterhemd und mit der Bierflasche in der Hand breitbeinig über den Platz. An der Erscheinung der Frauen, die Stefan so gepriesen hatte, konnte ich keinen Unterschied zu denen aus Mitteleuropa feststellen, was vielleicht aber auch daran lag, dass die meisten, die ich an diesem Morgen sah, ohnehin Touristinnen waren.
Ich schlenderte ein wenig umher, wandte mich dann nach Norden und besuchte den Gottesdienst in der Dominikanerkirche von Tallinn. Vor der Reformationszeit hatten sich die Dominikaner in Estland um die Bildung der Landbevölkerung gekümmert, las ich in einem kleinen Faltblatt, das vor der Kirche auslag. Die Esten haben es den Dominikanern aber nicht gedankt, denn kaum hatte sich die Reformation in Estland durchgesetzt, wurde das Dominikanerkloster bis auf die Grundmauern zerstört. Die estnischen Frauen, die heute die wieder aufgebaute Kirche betraten, hatten sich Kopftücher über ihre Haare gelegt, sie sangen inbrünstig und hielten die Köpfe gesenkt, als der Priester den Segen sprach.
Am nördlichen Stadttor verweilte ich ein wenig bei der "Dicken Margarethe", dem berühmtesten Stadtturm der Befestigungsanlage von Tallinn. Vor ihr hatte im Jahre 1570 sechs Monate lang das Heer Iwans des Schrecklichen die Stadt belagert, ohne Tallinn wirklich einnehmen zu können. Dafür hatte dieser Zar etwa die Hälfte der estnischen Bevölkerung massakriert, ein Ethnozid, von dem sich die Esten bis heute nicht erholt haben. Noch weiter zurück in die Geschichte führte ein Besuch der Olafskirche von Tallinn, benannt nach König Olaf II von Norwegen, die im späten Mittelalter mit ihren damals etwa 150 Metern Turmhöhe neben dem Ulmer Münster das höchste Gebäude der Erde gewesen sein soll.
Im Historischen Museum interessierte mich vor allem der Saal, in dem ein Faksimile der ersten Erwähnung Estlands ausgestellt war. Es handelte sich um eine Manuskriptseite aus dem Reisebericht des arabischen Geographen Al-Idrisi, der seinem Monarchen, dem Normannenherrscher Roger II. von Sizilien, im 11. Jahrhundert von einem "Astalanda", einem östlichen Land, berichtet hatte. Aus Astalanda wurde Estland, ein kleines Land östlich von Deutschland, dessen Bewohner im Laufe ihrer Geschichte wenig zu lachen hatten. Kanonenkugeln aus der Zeit Iwans des Schrecklichen, schwedische Uniformröcke, Helme, Rüstungen, Waffen, die puppenhafte Nachbildung eines grimmig dreinblickenden Wandermönches und eines Henkers, der in Originalgröße mit seiner Axt Maß an dem Nacken des Delinquenten nahm, waren die anschaulich präsentierten Elemente einer jahrhundertelangen Horrorgeschichte.
Endete das Historische Museum mit dem 18. und 19. Jahrhundert, wurde im "Stadtmuseum" auch die neuere Geschichte Tallinns behandelt. Das berühmteste Exponat dieses Museums war die doppelte Wand des Kommunismus, ein Gebilde, das auf einer vorderen Wand die Propaganda der Sowjetzeit visualisierte, während auf einer zweiten Wand, die man durch Fortschieben der ersten Wand sichtbar machen konnte, die wahren Verhältnisse der kommunistischen Epoche dargestellt waren. Enthusiastisches Grinsen korrupter Bonzen unter Parteitagsparolen auf der ersten, Leid und Schmerz in den durchfurchten Gesichter der Opfer auf der zweiten Wand, schicke Wohnungen mit Balkonen vorne, Gulags im Hintergrund - Sein und Schein im direkten Vergleich.
Für die Esten war die Heimsuchung durch den Bolschewismus nur eine der vielen Plagen, die sie im Laufe der Geschichte zu ertragen hatten. Sonderlich heiter ging es aber auch in vorkommunistischen Zeiten nicht zu, wie der kuriose "Kieck in de Köck" Turm dokumentierte. Von den Aussichtspunkten dieses Turmes schauten die Stadtwächter im 16. und 17. Jahrhundert den Leuten in die Fenster und die Küchentöpfe, um festzustellen, ob es nicht verbotenerweise am Freitag Fleisch oder am Wochenende Feuer im Herd gäbe. Auf heutige Verhältnisse übertragen, wäre das etwa so, als würden ökologisch orientierte Regierungen Ökowarte ausschicken, um die Einkaufswagen der Supermarktkunden auf den politisch korrekten Einkauf hin zu kontrollieren.
Am Nachmittag, in der Stunde des besten Lichtes, erreichte ich nicht weit von der Alexander Newski Kathedrale am Südende des Trompea Hügels den schönsten Aussichtspunkt der Stadt. Dunkle Wolken hatten sich über die Bucht von Tallinn gelegt, in der Ferne schimmerte das Wasser des finnischen Golfs in einem bedrohlichen Schwarz. Hier und da glitt ein Sonnenstrahl durch die zerfetzten Wolkenberge und beleuchtete wie eine wandernde Kompassnadel die Details eines Schieferdachs, einer Turmwand, eines Häusergiebels.
Für einen Moment imaginierte ich, die unübersehbare Neustadt mit ihren 400.000 Einwohnern im Osten sei verschwunden, ich sähe nur das von den Dänen im 13. Jahrhundert gegründete Tallinn, die "Stadt der Dänen" vor mir, neben der dann Reval entstand, der von deutschen Händlern gegründete Handelsstützpunkt an den Grenzen des Reiches von Nowgorod. Aus beiden war eine Hansestadt mit freien Bürgern und Händlern entstanden, eine multinationale Enklave am Rande Europas, die mit den Esten auf dem Lande nur wenig gemein hatte. Ansatzweise zusammengeschweißt wurden Stadt und Land erst durch die Überfälle der Schweden und Russen, in deren Reich Estland nach dem Ende des Großen Nordischen Krieges im Jahre 1725 scheinbar für immer verschwand.
Ich saß schon eine Weile auf der Aussichtsplattform, da setzten sich zwei junge Männer neben mich. Ich weiß nicht, ob es Russen oder Esten waren, auf jeden Fall begannen sie sofort zu trinken, zu rauchen oder in die Tiefe zu spucken. Ihre Gesichter waren leer, ihre Stimmen rau, ihre Gesten abgehackt. Für die Schönheit des Ortes besaßen sie kein Sensorium, stattdessen begannen sie mit zunehmendem Alkoholgenuss zu grölen und zu gestikulieren. Als sie mich anrempelten, mehr aus Ungeschicklichkeit, denn aus Absicht, machte mich auf den Heimweg.
Unterwegs traf ich Stefan, der mit einem fetten jungen Mann in einem Straßencafé auf dem Marktplatz bei einem Bier saß und diskutierte. Ich setzte mich dazu und erkannte bald, dass sich das Gespräch um die baltischen Frauen drehte, da sich Stefans Erwartungen speziell an die estnischen Frauen auch an diesem Tag noch nicht erfüllt hatten. Zu "nuttig" waren sie ihm vorgekommen, aufgedonnert, hochhackig, kess - von anbiedernder Unterwürfigkeit leider keine Spur. Stefans Gesprächspartner, Michael, ein Architekturstudent aus Regensburg, der sich wegen einer städtebaulichen Diplomarbeit in Tallinn aufhielt, wollte das nicht bestätigen. Seiner Ansicht nach sei die estnische Frau sehr schön, sehr kühl, aber emotional seltsam fad, meinte er, wobei er geschmäcklerisch seinen kleinen Mund schürzte, als hätte er von dieser Fadheit schon öfter kosten müssen. Ich konnte weder das eine noch das andere kommentieren, dachte einen Moment an den Anblick der züchtigen jungen Frauen in der Dominikanerkirche, trank ein zweites Bier, wurde müde und ging bei Einbruch der Dunkelheit zurück zum Vana Tom.
*
Woran erkennt man Länder, die spät in die Moderne gestartet sind? Daran, dass sie kein Festnetz besitzen, sondern ihre Kommunikation mit dem Handy abwickeln. Aber auch daran, dass sie über kein leistungsfähiges Eisenbahnnetz verfügen, sondern den Personentransport vorwiegend über Busse organisieren, jene guten alten Busse, mit denen wir als Kinder wie in einem zweiten Wohnzimmer durch die Landschaft gefahren waren, bis wir in unsere eigenen Fahrzeuge, den ICE oder das Flugzeug umstiegen.
Im Baltikum ist der Bus natürlich das Verkehrsmittel Nummer eins. Er ist billig, effektiv und bei der (noch) geringen Verkehrsdichte relativ schnell. Seine Fahrer stellen das Konzentrat jener Industriearbeiterelite dar, die es entweder noch nicht oder nicht mehr gibt. Wie die Kapitäne der Landstraße steuern die ihr Gefährt durch Tag und Nacht, Regen und Sturm ihren Zielen entgegen. So auch in Tallinn, wo wir auf dem Busbahnhof der Stadt einen ausrangierten deutschen Bus bestiegen, der sicher schon bessere Tage gesehen hatte, seinen Dienst aber noch immer tadellos versah. Ohne dass weiter darüber gesprochen worden wäre, hatte auch Stefan ein Busticket nach Tartu gelöst. Ich musste mich wohl damit abfinden, dass er mich so lange begleiten würde, bis er die passende baltische Frau gefunden hätte.
Die Busreise nach Tartu war ebenso unspektakulär wie die Landschaft. Wir durchfuhren endlos flache Ebenen, Meere von Wiesen, Weizen- und Rapsfeldern, Waldinseln und Weideflächen, überquerten Flüsse und Bäche auf schmalen Brücken, brausten durch weltvergessene Dörfer ohne anzuhalten, erhaschten hier und da den erstaunten Blick eines Kindes, das am Wegesrand mit einem Gummireifen spielte.
Dann war plötzlich Tartu, das alte Dorpat, erreicht, das intellektuelle Zentrum des Landes mit der ältesten Universität Estlands, die ihren Ursprung bis auf das Jahr 1632 zurückführte. Es war eine regelrechte Postkartenstadt, die mit ihrer klassizistischen restaurierten Altstadt und einer durchgrünten Promenade am Ufer der Emajogi Flusses Mitteleuropa entsprungen schien. Wieder versuchte ich die Atmosphäre zu erspüren: War das hier Osteuropa? Ganz bestimmt nicht. In Tartu sah es eher aus wie in Marburg. Studenten lümmelten sich auf den Brückengeländern, die Dozenten lasen Manuskripte in den Cafés, und ein ganzer Papierwald von Plakaten informierte über die Musikszene der Stadt. Für jeden, der sich in Tartu länger aufhalten oder an diesem Ort ein Studiensemester einlegen wollte, hielt die Stadt Galerien, Ausstellungen und Museen bereit,und wer nicht gerade eine Vernissage besuchte oder eine Vorlesung hörte, lag mit einem Buch auf einer der zahlreichen Wiesen im Schatten der Bäume. Auenland am Rande Mordors, ging es mir durch den Kopf, als ich die zahlreichen Skulpturen sah, die die Stadtverwaltung an allen Ecken Tartus positioniert hatte: Meeresjungfrauen, Liebende, die sich als Paare über einem Springbrunnen umarmen, Gelehrte in Denkerpose, Kleinkinder in Erwachsenengröße - es war, als sollte nur eine Busstunde von der russischen Grenze entfernt, eine Idylle beschworen werden, von der jedermann ahnte, wie brüchig sie war.
Denn die idyllischen Außenansichten, die Estland in Tartu und anderswo so ostentativ präsentierte, konnten die Schattenseite des Landes nicht vergessen machen. Und der Schatten, der über Estland lag, hieß Russland. Um dieses Problem in seiner ganzen Bedrohlichkeit zu verstehen, genügte ein einziger Blick auf die demographischen Daten des Landes. Von Narva im Norden bis Petsen im Süden lebten mehrheitlich Russen, eingewandert in den Zeiten der Sowjetunion, die sich nun, nach dem Untergang der UdSSR, plötzlich als ungeliebte Fremde in einem Land außerhalb der eigenen Heimat wiederfanden. Es waren gut 400.000, höchstens eine halbe Million Menschen, ein Klacks, verglichen mit den 115 Millionen Russen im Heimatland, aber in Estland eine massive Minderheit, von der niemand recht wusste, was mit ihr geschehen sollte.
In der Mitte zwischen Narva und Petsen befand sich Kallaste, eine russische Enklave am Peipussee, die wir nach einer kurzen Busfahrt von Tartu aus erreichten. Die Felder waren wilder, die Landschaft hügeliger,und die Zahl der Holzhäuser nahm umso stärker zu, je weiter wir nach Osten fuhren. Vor den kunstvoll geschnitzten Holzfenstern saßen üppige Matkas auf Holzschemeln und schwatzten. Uralte BMW´s und Audis, von denen keiner wissen konnte, wie sie ihren Weg in diesen Teil Europas gefunden hatten, sorgten mit offenen Türen und aufgedrehten Radios für die kostenfreie Beschallung der staubigen Dorfstraße. Wer hier mit einem dieser Autos durch das Dorf fuhr, machte das nicht unter siebzig Sachen, so dass meterlange Staubfahnen noch lange vom Vorüberbrausen eines importierten Westschlittens erzählten. Der Kaffee, den wir im einzigen Café von Kallaste tranken, war dünn, die Milch, die wir dazu orderten, war Westimport und kostete das Doppelte des Getränks.
Nur wenige Schritte abseits der Dorfstraße war der Peipussee erreicht. Wie eine Kostprobe dafür, wie riesenhaft das Land war, das jenseits des Sees begann, erstreckte sich Wasser vor uns, soweit das Auge reichte. An einem kleinen Strand tummelten sich vorwiegend Frauen - elfenhafte und pummelige, junge und alte, schlanke und dicke Russinnen verdösten den Nachmittag, während ihre Männer die Motoren ihrer Fahrzeuge frisierten. Eine Bande kreischender Knaben rannte vorüber, nackt und verschmutzt bewarfen sie sich jauchzend mit Schlamm und pinkelten im hohen Bogen in den See.
Es war warm an diesem Tag, und ein flimmernder Dunst lag über dem großen Grenzsee, mit dem die Russen einen der größten Tage ihrer frühen Geschichte verbinden: den Sieg der Russen unter der Führung Alexander Newskis im Jahre 1242 über eine Armee des Deutschen Ritterordens auf dem Eis des Peipussees, eine wahrscheinlich noch nicht einmal sonderlich bedeutsame historische Episode, die erst durch die Eisensteins Verfilmung zum ersten großen Abwehrkampf Russlands gegen den imperialistischen Westen hochstilisiert worden war.
Daran, dass dieser See jemals zufrieren könnte, war an diesem Tag nicht zu denken. Es wurde immer wärmer, und ein heißer Wind wehte von Osten heran. Den Wiesen entströmte ein erdiger, dumpfer Geruch nach nasser, warmer Fäulnis, als sich Stefan neben mich setzte und darüber philosophierte, was die Frauen im Kern ihres Wesens bewegte. Seine bisherigen Misserfolge bei der Partnersuche hatten in ihm offenbar das Bedürfnis nach vertiefter Analyse geweckt. Seiner Ansicht drehte sich alles um die "Erbse" zwischen den Beinen einer Frau, die es zuallererst zu finden und zu bearbeiten gelte. Wer die "Erbse" nicht finde, gerate bei den Frauen ganz einfach auf die Abschussliste, sinnierte Stefan, während ein warmer Wind weiter durch die Blätter rauschte. „Was hältst du von dieser Theorie?“
„Erinnert mich ein wenig an die Prinzessin auf der Erbse“, antwortete ich.
„Stimmt“, sagte Stefan. „Komm, lass uns abhauen aus dieser Gegend. Hier gibt es nur hässliche Weiber.“
*
Es gibt Länder, in denen kann man in zwei bis drei Stunden von Osten nach Westen reisen, ohne dass man an der Landschaft merken würde, dass man vorangekommen ist. Im Falle Estlands ist dies nur teilweise richtig, weil wir nach den drei Stunden Busfahrt, die uns von Tartu und Kallaste nach Pärnu an die Ostsee führten, immerhin das Meer erblickten. Allerdings war das Wetter umgeschlagen, und hinter nassen Regenschleiern und tief hängenden Wolken verschwand der Horizont der Ostsee in einem konturlosen Grau.
So war auch von Pärnu, dem hochgelobten ersten Seebad des Landes, im Regendunst nur wenig zu erkennen. Überall nur Pfützen, mit Zellophanplanen überzogene Kaffeehausstühle und dunkler, matschiger Sand an den Stränden. Kaum jemand war auf den Straßen zu sehen, dafür war aber auch weit und breit kein Zimmer frei. Schließlich fanden wir eine kleine Datscha im Garten eines Privathauses, von dem ich noch nicht wusste, dass seine Toilette im Garten nur mit Sägespänen funktionierte und dass uns der Dackel des Hauses Tag und Nacht heulend belagern würde, um mit uns zu spielen. Im Innern der Datscha waren die Wände mit Fischernetzen, einem Elchgeweih, Matrosenbildern, Urkunden in kyrillischer Schrift und diversen Skulpturen behangen. Eine Ronald-Reagan-Maske aus Gummi hing an einem Haken gleich neben einer Marienstatue, und der Teppich sah so aus, als beinhaltete er noch immer sämtliche Sekrete, die seit der Zarenzeit in diesem Raum verspritzt worden waren. Doch der Regen klatschte immer drängender gegen die dunklen Scheiben der Datscha, und so nahmen wir das Zimmer, brachten den Wasserkocher in Schwung und tranken unseren ersten Kaffee in Pärnu.
„Ganz schön trist hier“, sagte ich zu Stefan. „Ich könnte verstehen, wenn du jetzt abhaust und dich in einem besseren Hotels einquartierst.“
„Nein“, wehrte er ab. „Das ist schon in Ordnung. Ich schlafe erst mal eine Runde. Morgen wird schon wieder die Sonne scheinen.“
Das allerdings war ein Irrtum. Volle zwei Tage zogen immer neue schwarze Regenwolken von der Ostsee heran und entluden sich über der Stadt. Nur zwei- oder dreimal hörte der Regen für ein oder zwei Stunden auf, um dann umso stärker aufs Neue loszubrechen. Wir gewöhnten uns an ein Geräusch, als würden Tag und Nacht Millionen Fingerkuppen auf das Holzdach trommeln, beobachteten, wie die Pfützen im Garten immer größer wurden und ließen schließlich den jämmerlich vor unserer Türe jaulenden Dackel in unsere Hütte, um ihn abzureiben und mit ihm zu spielen.
Eigentlich hatte ich mich am Strand von Pärnu ein wenig sonnen wollen, daraus wurde nun nichts. Und auch für Stefan war es sinnlos, den Schönheiten der baltischen Frauen im strömenden Regen nachzuspüren. Da er kaum las, schlief er viel oder saß stundenlang am Fenster und blickte in den Regen. Er hatte zwei Flaschen Wein besorgt, aus denen er sich in immer kürzeren Intervallen ein Glas einschenkte.
„Sag mal, hast Du eigentlich schon mal eine Freundin aus Osteuropa gehabt?“ fragte er mich unvermittelt.
„Nein.“
„Ich schon.“
„Und, wie war´s?“
„Eigenartig.“
„Wo kam sie denn her?“
„Aus Sofia“, antwortete Stefan. „Fährst du da auch noch hin?“
„Schön möglich“, antwortete ich. „Aber erzähl doch mal.“
Stefan schenkte sich nach, goss auch mir ein Glas Wein ein und zog eine Schnute, die ich an ihm noch nicht gesehen hatte.
„Es begann wie eine richtige Romanze, dann wurde es eine richtige Liebe, und am Ende zerplatzte es wie eine Seifenblase.“
Nun donnerte es draußen. Der Himmel hatte sich vollkommen verdunkelt, der Dackel lag behaglich auf meinem Schoß und schnarchte.
„Ihr Name war Lydia, sie war Anfang zwanzig und studierte Politikwissenschaft in Frankfurt. Ich traf sie, als ich in den Zug nach Koblenz einstieg, um einen Freund in Köln zu besuchen. Sie war so schlank, sie wirkte so zerbrechlich und zugleich so herzlich, dass ich mich auf der Stelle in sie verliebte.“
„Sprach sie denn deutsch?“
„Fließend. Sie studierte Philosophie in Frankfurt und begann mir auch gleich etwas über den Kategorischen Imperativ zu erzählen. Auf jeden Fall sprang sofort ein Funke über, und als sie in Bonn ausstieg, bin ich mit ausgestiegen. Wir gingen an das Rheinufer und erzählten uns den ganzen Abend unsere Leben. Schließlich tauschten wir unsere Adressen aus, sie brachte mich zum Bahnhof, und ich fuhr alleine weiter nach Köln.“
Stefan machte eine Pause und blickte aus dem Fenster. Dann wendete er den Kopf und sah mich an: „Keine zwei Tage später klingelte es an meiner Türe, und Lydia stand mit zwei vollgepackten Taschen im Treppenhaus. Ohne zu fragen, ließ ich sie ein, wir schliefen zusammen und lebten hinfort wie Mann und Frau.“
Ich trank das Glas leer und schwieg.
„Die ersten zwei drei Monate waren wunderbar“, fuhr Stefan fort. „Ich war so lange Single gewesen, hatte mich mit all diesen unzuverlässigen Weibern herum geschlagen,und hier war plötzlich eine junge, schöne Frau, die sich hundertprozentig auf mich einstellte, die den Tisch gedeckt hatte, wenn ich heimkam und sich nachts an mich kuschelte, als gelte es ihr Leben.“
„Hört sich etwas traditionell an“, wandte ich ein.
„Nein, das hört sich wunderbar an“, widersprach Stefan. „Aber leider war das nur der Anfang. Denn bald kam sie dahinter, dass ich ein Langzeitstudent und keineswegs so vermögend war,wie sie angenommen hatte. Und auch ich erkannte, dass sie von jeder Art Examen noch meilenweit entfernt war. Sie war einfach aus Sofia abgehauen, hatte in Frankfurt bei entfernten bulgarischen Verwandten gelebt und sich gedacht, dass sie bei mir festen Boden unter den Füßen bekommen könnte.“
„Das hätte doch klappen können. Warum seid ihr denn nicht beide arbeiten gegangen?“ fragte ich.
„Ging nicht, ich versuchte mich gerade an einem zweiten Anlauf zum Jura-Examen, aus dem mit dieser Liebesgeschichte natürlich nichts mehr wurde. Und sie verfolgte immer deutlicher nur ein Ziel: ich sollte sie heiraten, damit sie die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten würde, denn ihre Aufenthaltserlaubnis lief ab.“
„Hast du sie denn geliebt?“
„Ich glaube, ja.“
„Und warum hast du sie nicht geheiratet?“ fragte ich.
„Ich weiß auch nicht, Plötzlich traute ich ihr nicht mehr. Die Sache schien mir gar zu durchsichtig. Ich zögerte. Und dann war sie eines Tages weg.“
„Wie das?“
„Eines Tages kam ich nach Hause, und ihre Sachen waren weg. Über eine Freundin erfuhr ich später, dass sie nach Paris gefahren war, wohin sie ohnehin bald hatte reisen wollen. Dort hat sie innerhalb kürzester Zeit einen Franzosen geheiratet.“
„Das ist bitter.“
„Nein“, antwortete Stefan. „Nur lehrreich.“
„Und warum versuchst Du es mit den baltischen Frauen nun noch einmal?“
„Weil man aus Fehlern eben nicht lernt.“
Nach zweieinhalb Tagen hörte der Regen endlich auf. Noch immer hingen die Wolken wie eine feuchte Decke über der Küste, doch nun konnte man immerhin durch die Stadt spazieren und über den Strand laufen. Vom feuchten Wind der Ostsee umweht, besuchten wir das Estonia- Denkmal von Pärnu, ein groteskes Stahlgewirr, das zum Gedenken an den Tod von achthundert Esten bei dem Untergang der Fähre „Estonia“ im Jahre 1994 errichtet worden war. Ich erinnerte mich noch gut an das Aufsehen, dass dieses Unglück damals in der Presse des Westens verursacht hatte, begriff aber erst jetzt, welche Katastrophe der Tod von 800 Menschen für eine Ethnie bedeutete, die ohnehin nur noch 800.000 Menschen zählte. Umgerechnet auf die Bevölkerung Deutschlands hätte ein proportional vergleichbares Desaster die unfassbare Zahl von 80.000 Opfern fordern müssen.
Gleich neben dem Estonia Denkmal befand sich am Rande eines Wohnkomplexes in Strandnähe ein Stahlgebilde von etwa dreißig Metern Höhe. Etwa auf halber Höhe erkannten wir beim Näherkommen zwei Kinder, die scheinbar sorglos und ungezwungen in riskanter Höhe an den Eisenstangen herumkletterten. Ihre Mutter, eine rothaarige junge Frau, mit Pelzjacke und weißen Stiefeln bekleidet, saß auf einer Bank neben dem Stahlgerüst und rauchte.
Erst dachte ich, dass sie zu ängstlich sei, die Kinder herunterzuholen und erbot mich, das für sie zu erledigen. Doch sie winkte ab. „Die kommen schon zurecht“, sagte sie in tadellosem Deutsch. „Aber woher kommen Sie?“
So begann ein Gespräch, bei dem ich nervös die tollkühnen Kinder im Auge behielt und erleichtert feststellte, dass sie langsam herunter kamen, während sich ihre Mutter eine Zigarette nach der anderen anzündete.
Ihr Name war Anna, sie hatte Germanistik studiert und weilte nun schon seit einem Monat zur Sommerfrische in Pärnu. Wie sie offenherzig bekannte, hing ihr die Betreuung der Kinder inzwischen zum Hals heraus und sie hätte nichts dagegen gehabt, wenn die kleinen Biester abgestürzt wären.
Als sie unsere betroffenen Mienen sah, lachte sie laut auf. „Mein Gott, das war doch nur ein Scherz.“ Dann veränderte sich urplötzlich ihr Gesichtsausdruck, und sie blickte mir tief in die Augen, am Herzen vorbei direkt ins Eingemachte. Ich spürte es ganz deutlich, mir lief es kalt den Rücken herunter, während ich mich fragte: Ist das Osteuropa?
Da hatten wir endlich eine schöne baltische Frau, aber ganz anders als erwartet. Von dankbarer Unterwürfigkeit war hier nichts zu erkennen, stattdessen hatte ich das Gefühl, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, wenn ich als dekadenter Westling auf der Stelle meine Brieftasche und meine Scheckkarte auspacken und dieser Frau zu Füßen legen würde. Ihre Wangen waren edel geschwungen, hinter ihren üppigen Lippen sah ich den Schmelz traumhaft weißer Zähne, und ihre Augen waren so groß und dunkel, dass ich auf der Stelle in ihnen zu versinken drohte. Mir war, als würde ein Netz ausgeworfen, und als würde ich im nächsten Augenblick die Kontrolle verlieren.
Gerade wollte ich nach ihrer Adresse fragen, als mich Stefan rüde von der Seite anstieß. „Los, komm, wir müssen weiter, gleich fängt es wieder an zu regnen.“
LETTLAND
oder:
Die Russen
sind an allem Schuld
Manche Grenzen gleichen Inszenierungen des Übergangs. An der Grenzstation von Belize und Guatemala wird der Reisende von knapp zwei Meter großen schwarzen Zollbeamten verabschiedet und von kleinen, rundlichen Indiobeamten in Empfang genommen, die kaum größer als mehr als ein Meter sechzig sind. Am Amur kontrollieren große blonde Russen die Pässe der agilen und kleingewachsenen Chinesen beim Grenzübertritt zwischen Russland und China.
An der estnisch-lettischen Grenze zeigten lediglich zwei Flaggen und ein Zollhäuschen, dass der Bus eine internationale Grenze überfuhr. Estland und Lettland gleichen sich wie ein Ei dem anderen, sagen die Russen, und jeder Blick aus dem Busfenster zeigte, dass diese Aussage nicht übertrieben war. Es war der gleiche Menschenschlag, das gleiche Meeresufer, es waren die gleichen Städtebilder und alles in allem auch die gleichen Physiognomien, die es an den Haltestellen in Estland und Lettland zu betrachten gibt. Die 800.000 Esten und zwei Millionen Letten diesseits und jenseits der Grenzen verbindet nicht nur die gleiche Herkunft aus dem Innern Asiens, eine ähnliche Sprache, Geschichte und Küche, sondern auch die gleiche enthusiastische Liebe zu ihrer baltischen Heimat.
Natürlich war auch das Wetter in Estland und Lettland identisch. So setzte sich der Regen, der uns in Pärnu die Nerven strapaziert hatte, auch während unserer Reise nach Lettland fort. Grau und nass erstreckte sich die Küstenstraße den Golf von Riga entlang nach Süden, immer neue Regenschauer rauschten von der Ostsee über das Land, und als wir die Peripherie von Riga erreichten, verschwanden die endlosen Plattenbauten in einem geradezu amphibischen Dunst. Auf dem Busbahnhof eilten die Menschen mit Regenjacken und Rucksäcken durch die Hallen, nasse Hunde liefen bellend über den Vorplatz. Überall saßen Frauen mit Kopftüchern, Wollwesten und Plastiktüten in den Wartehallen.
Doch so schlecht das Wetter in Riga auch war, an Gästen schien es der Stadt nicht zu mangeln, denn alle preisgünstigen Unterkünfte, die wir ansteuerten, waren voll. Schließlich führte uns der Zufall in die Bahnhofsgegend zum "Aurora", einem Etagenhotel mit düsterem Treppenhaus, langen Fluren und einem Empfangschef, der uns mit kaum verhohlener Skepsis musterte. Ich konnte es ihm nicht verdenken, denn wir sahen nach der langen Tagesreise stark mitgenommen aus, und die nassen Hosen und Hemden, die uns am Körper klebten, machten unsere Erscheinung nicht einladender. Außerdem waren wir doch Westler. Was also machten wir in dieser Absteige für fliegende Händler, Liebespaare und Halunken? Ich wusste es auch nicht, war aber trotzdem dankbar, als er uns nach einigem Zögern endlich den Schlüssel zu dem letzten freien Zimmer gab. Es handelte sich um eine Etagennische, die nur durch eine dünne Wand vom Treppenhaus abgetrennt war, einen langgezogenen Schlauch mit verblichenen Tapeten an den Wänden, einem Waschbecken und zwei Schlafpritschen, die verdächtig knirschten, als wir unsere Rucksack ablegten. Die Türe hing so schief in der Wand, dass ein einziger Tritt genügt hätte, um sie aus den Angeln fliegen zu lassen. Dafür konnten wir von dem kleinen Zimmerfenster aus den Aufmarsch der Prostituierten beobachten, die zu allen Tageszeiten den Reisenden, die den Bahnhof von Riga verließen, ihre Angebote zuriefen, um bei Interesse mit ihrem Kunden sofort im Eingang des „Aurora“ zu verschwinden.
Schon in der ersten Nacht gab es im Hotel ein Riesengeschrei. Ein Freier und eine Prostituierte waren sich über Dienstleistungen und Preise in die Haare geraten. Die Türen knallten, die Fäuste flogen, und mit großem Gebrüll griffen die örtlichen Zuhälter ins Geschehen ein. Dann wurde wieder alles ruhig. Ich blickte aus dem Fenster und sah den nächtlichen Bahnhofsvorplatz im Laternenlicht. Die Straßenstricher rüsteten zu ihrer letzten Schicht, ich kroch wieder ins Bett und schlief gleich ein.