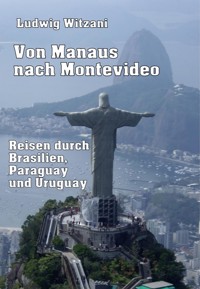Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren der europäischen Siedler, der Indianer und seiner eigenen Familiengeschichte reist Ludwig Witzani sechstausend Kilometer kreuz und quer durch Kannada. Die Reise beginnt in Toronto, Montreal und Quebéc im kanadischen Osten. Dann geht es mit dem Greyhoundbus eine Woche lang nach Westen bis nach Calgary in der kanadischen Provinz Alberta. In Calgary steigt der Autor in einen Camperhome um, mit dem er Alberta und Britisch Columbia erkundet, ehe die Reise auf Vancouver Island am Pazifik endet. Der Leser, der dem Autor auf dieser Reise folgt, erlebt eine transkanadische Reise zu europäisch anmutenden Städten, endlosen Tannenwäldern und zu einigen der größten Seen der Erde. Er besucht die Calgary-Stampede, das größte Rodeo Amerikas, wandert zu den atemberaubenden Naturszenerien der Banff-Jasper-Straße und durch die Straßen Vancouvers, einer der schönsten Städte der Welt. Der Autor belässt es aber nicht bei der Erkundung der Gegenwart, sondern fragt auch nach dem geschichtlichen Gewordensein dessen, was ihm begegnet. Sein eigenes Erleben ist voller Sympathie und Anteilnahme für sein Reiseland, aber auch geprägt durch das Bewusstsein, wie stark die eigene Subjektivität seine Wahrnehmung leitet. in Reisebuch für Kanada-Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Witzani: Kanada - Von Québec nach Vancouver
(Weltreisen Band XVI)
ISBN 978-3-757566-53-1
Lektorat: UHU Services, Köln
Epubli Verlag, Berlin 2023
Ludwig Witzani
KANADA
Von Québec
nach Vancouver
Für Lilly
und Alicia
„Aber Kanada liebe ich.
Es ist ein wunderbares Land,
wenn auch
nach vernünftigen Maßstäben
viel zu kalt,
bewohnt von
aufrechten, klugen Menschen,
die alle dringend
einen besseren Friseur bräuchten.“
Yann Martell:
Schiffbruch mit Tiger, F.a.M., 2005
INHALTSVERZEICHNIS
Vorbemerkung 8
ERSTER TEIL: DER OSTEN
Redneck Lilly
Ankunft in Toronto 14
Von Irokesen und Huronen
Reisen durch den Westen Ontarios 21
Niagara
Die Natur als Chiffre
für Leidenschaft und Liebe 29
Nachrichten von der Familie
Im Cottage von Bracebridge 36
Die Stadt an der Grenze
Ottawa 41
Frankreichs Perle in der Neuen Welt
Québec 46
Am königlichen Berg
Montreal 54
ZWEITER TEIL: ZENTRALKANADA
Der lange Weg nach Manitoba
Mit dem Greyhoundbus von Montreal nach Winnipeg
67
Exkurs: Kanadas zweite Wiege:
Die Hudson Bay Company 80
Erinnerung an Louis Riel In Winnipeg geht die Geschichte wie ein Riss durch die Stadt 85
Die Kathedralen der Prärie
Von Winnipeg nach Calgary 95
DRITTER TEIL: DER WESTEN
Acht Sekunden können eine Ewigkeit sein
Auf der Stampede von Calgary 105
Exkurs: Am ökologischen Schandpfahl der Welt
Brennpunkte der kanadischen Politik 118
Die Saurier und der Buffalo Jump
Reisen durch den Süden der Provinz Alberta 119
Sinfonie aus Wasser und Stein
Die Banff-Jasper-Straße 133
Ein kanadisches Kalifornien
Auf den Spuren von Fraser und Thompson
durch Britisch Columbia152
Licht und Schatten in der schönsten Stadt der Welt Tage in Vancouver 165
Exkurs: Wettlauf zum Pazifik
Kleine Geschichte der Entdeckungen an der Westküste des nordamerikanischen Kontinents 178
Wo die Wale tanzen
Vancouver Island 185
BONUS TRACK: KLEINE EINLADUNG
IN DAS YUKON TERRITORIUM
Viele Wege führen zum Yukon
Inside Passage und Alaska Highway 200
Die Mutter aller Goldrauschstädte
Historische Mimesis in Dawson City 210
Anhang 227
Literaturhinweise 228
Bild- und Kartennachweis 235
Über den Autor 236
Vorbemerkung
Kanada hat einen guten Ruf in der Welt. Es ist weit genug weg, dass sich die Fantasie daran entzünden kann. Es ist groß genug, um jedermann Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, es ist freier als Europa, aber nicht so anarchistisch-ellenbogenwild wie die Vereinigten Staaten. Wenn man der Geschichtsschreibung glauben darf, dann sind die Kanadier nicht ganz so rüde mit den Indianern umgesprungen wie ihre südlichen Nachbarn. Sie haben noch nie einen Krieg angefangen und verfügen über eines der erfolgreichsten Einwanderungssysteme der Welt. Das Land ist reich an Bodenschätzen und Naturschönheiten und besitzt eine vielfältige Tierwelt vom Grizzly bis zum Buckelwal. Mit einem Wort, es vereinigt wenigstens in der Vorstellungswelt der Völker so viel Wünschenswertes und Hoffnungsvolles, dass es zu den beliebtesten Einwanderungsländern zählt.
So war es auch bei unserer Familie. Meine älteste Schwester wanderte als junge Frau nach Kanada aus. Nahe Verwandte meiner Frau verließen Polen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus und gründeten eine neue Existenz in Kanada. Sicher könnten viele Leser ähnliche Beispiele liefern. Auf der anderen Seite gibt es kaum einen Kanadier, der nicht ganz genau erzählen könnte, aus welcher Ecke von „good old Europe“ seine Vorfahren stammen.
Auch meine Reise nach Kanada hatte einen familiengeschichtlichen Hintergrund. Wie aus den weiteren Ausführungen hervorgehen wird, entstamme ich einem internationalen Familieneintopf, in den Sudetendeutsche, Rheinländer, Franzosen, Italiener und Polen ihre Zutaten hineingegeben haben. Dieser Familieneintopf wurde auf der heißen Herdplatte der turbulenten Geschichte des letzten Jahrhunderts gekocht, so dass es nicht verwundern darf, dass sich die meisten Etappen unserer Familiengeschichte nicht nach Sitte und Gesetz, sondern nach jenem Drunter und Drüber vollzogen, mit dem die Geschichte die Menschen im letzten Jahrhundert traktierte. Wenn ich hier und da neben der eigentlichen Reisebeschreibung auf sie zu sprechen komme, dann nicht, weil ich sie für besonders wichtig halte, sondern weil ich in ihr etwas Exemplarisches erblicke, etwas Chaotisches, verbunden mit dem Wunsch, aus dem Chaos zu Ordnung zu finden. Wen das nicht interessiert, der kann das Kapitel „Nachrichten von der Familie“ auch einfach überlesen.
Denn auch ganz unabhängig von verwandtschaftlichen Imponderabilien ist Kanada allemal eine Reise wert. Auf seinen fast 10 Millionen Quadratkilometern Fläche finden sich Taiga und Tundra, europäisch anmutende Städte, endlose Tannenwälder, Weinanbaugebiete, einige der größten Seen der Erde, abartig schöne Gebirgsszenerien und eine atemberaubende Küste. Auch von ihnen ist in dem vorliegenden Buch die Rede, nicht objektiv und expertisenhaft, sondern wie immer subjektiv mit dem Blick eines Reisenden, der in dem, was er sieht, immer auch sich selbst als Sehenden erkennt
Wer bereit ist, mit diesem doppelten Blick eine transkanadische Reise von Québec nach Vancouver, vom Atlantik zum Pazifik mit gelegentlichen Abstechern in die Geschichte zu unternehmen, der ist bei diesem Buch an der richtigen Adresse.
Für etwaige Fehler bitte ich im vorneherein um Entschuldigung, für meine Urteile um Nachsicht, sie sind so subjektiv wie der Mensch an sich, und der ist es ja schließlich, der reist.
Karte zu kapitel 1:
Der Osten
ERSTER TEIL: DER OSTEN
Redneck Lilly
Ankunft in Toronto 14
Von Irokesen und Huronen
Reisen durch den Westen Ontarios 21
Niagara
Die Natur als Chiffre
für Leidenschaft und Liebe 29
Nachrichten von der Familie
Im Cottage von Bracebridge 35
Die Stadt an der Grenze
Ottawa 41
Frankreichs Perle in der Neuen Welt
Québec 46
Am königlichen Berg
Montreal 53
Redneck-Lilly
Ankunft in Toronto
Der Flug über den Atlantik war eine Tortur. Wie viele Atlantikflüge vollzog er sich fast vollständig bei Tageslicht. Obwohl ich wenig aß, fühlte ich mich vollgestopft wie eine Weihnachtsgans. Mein Sitznachbar, ein Zweimetermann, saß wie angenagelt neben mir. Beim Anflug auf Kanada verschlechterte sich das Wetter. Der Pilot umflog einen Sturm im weiten Bogen, und die Maschine landete mit erheblicher Verspätung in Toronto.
Wie vereinbart holte mich meine Nichte Lilly am Terminal ab. Lilly ist die Tochter meiner verstorbenen Schwester Hildegard, die ich niemals kennengelernt habe. Meine Schwester Hildegard war als junge Frau nach Kanada ausgewandert, hatte dort geheiratet, Kinder bekommen und war verstorben, ehe ich es geschafft hatte, sie zu besuchen. Ihre Tochter Lilly, die anderthalb Jahrzehnte jünger ist als ich, hatte ich nur einmal als kleines Mädchen auf einem Familientreffen in Köln gesehen. Nun trat sie mir gleich hinter der Zollkontrolle auf dem Flughafen von Toronto als eine große, stattliche Frau entgegen, die mich auf bestürzende Weise an meine Mutter erinnerte. Und wie diese griff sie nach mir mit ihren großen Händen und drückte mich an ihren Riesenbusen. Sie besaß ein großflächiges, freundliches Gesicht und eine dominante Nase. Erst später sollte ich lernen, wie ausdrucksstark dieses Gesicht sein konnte. Schaute Lilly grimmig drein, rutschte ihrem Gegenüber das Herz in die Hose. Wenn sie lachte, sah sie aus wie ein junges, vergnügtes Mädchen, das sich einen Schabernack erlaubte.
Während der Fahrt von Toronto nach Cookstown rauchte und erzählte Lilly in einem fort, als sei es ihr ein Bedürfnis, mir alle Neuigkeiten der letzten zwanzig Jahre mitzuteilen. Dabei hatte ich vor dieser Reise noch nie auch nur einen einzigen Satz mit ihr gesprochen. Ich sah mich der Anbrandung einer Nähe gegenüber, an die ich mich erst noch gewöhnen musste.
Lilly lebte in Cookstown, einer kleinen Gemeinde zwischen Toronto und der Georgian Bay am Südufer des Huronsees. Cookstown besaß eine belebte Hauptstraße mit jeder Menge kanadischer Flaggen, die an Giebeln, Torbögen und Regenrinnen befestigt waren. Wuchtige Laster donnerten vorbei. Ich sah monumentale Wohnwagen mit entschlossen dreinblickenden Rentnernomaden am Steuer. Die Häuser waren breit und gedrungen, wie die Menschen, die in ihnen lebten.
Nicht weit vom Stadtzentrum entfernt, bewohnte Lilly mit ihrem Sohn Rory und Baba, dem Golden Retriever, ein solches Haus. Es besaß einen kleinen Garten samt Gemüsebeet, in dem Lilly ihr Cannabis für den Selbstverbrauch zog. Daneben stand ein großes Trampolin neben betagten Gartenmöbeln und einer Miniaturwindmühle. Nirgendwo war ein Mensch zu sehen, nur die Blätter in den Bäumen rauschten.
Lillys Sohn Rory war an die zwei Meter groß und wog weit über einhundert Kilogramm. Er besaß die freundlichen Kinderaugen seiner Mutter, mit denen er seine Umgebung immer ein wenig staunend betrachtete. Er war Lillys Augenstern, und sie wurde regelrecht unruhig, wenn er nicht bei ihr war. Um immer genau zu wissen, wo sich Rory gerade aufhielt, stieß die Mutter in gewissen Abständen ein gutturales „Rrroorryy“ aus, woraufhin dieser aus irgendeiner Tiefe des Hauses mit einem kehligen „uurgghhh“ antwortete.
Mir gegenüber erwies sich Lilly als eine Freundin klarer Ansagen. Ob sie mich denn während meines Aufenthalts pausenlos bespaßen müsse, fragte sie mich nach dem Frühstück. „Das ist nicht nötig“, sagte ich, „ich brauche jeden Tag einige Stunden zum Lesen und Schreiben“, gab ich steif zurück. „Prima“, antwortete Lilly, „dann kann ich in dieser Zeit rauchen und saufen.“
Natürlich stellte Lilly damit ihr Licht gehörig unter den Scheffel, denn wie ich schnell merken sollte, liebte sie es, einen weiblichen Redneck darzustellen, ohne ein solcher zu sein. Nachsichtig hörte sie sich meine Reisepläne an, während sie das Gemüse schnitt. „400-year Jubilee of Québec City?“ „Oh really? Get it“ - „Samuel Champlain?“ „Is that the Name of the famous Cook in Montreal?“ „Canada Act of 1867?“ „Never heard and never mind.“
Toronto, die größte Stadt Kanadas, lag am Nordufer des Ontariosees. Sie war die englischsprachige Metropole Kanadas, während Montreal das französischsprachige Zentrum war. Ursprünglich nichts weiter als eine unbedeutende Pelzhandelsstation, verdankte Toronto seinen Aufstieg einem nie versiegenden Zustrom von Einwanderern, der die Stadt seit einem Vierteljahrtausend erreichte. Es begann im späten 18. Jahrhundert, als viele englische Kolonisten, die mit dem Abfall der Neuenglandstaaten vom britischen Mutterland nicht einverstanden gewesen waren, in die britischen Kolonien im Norden auswanderten. 1793 hatte die Niederlassung den Namen York erhalten, 1834 war sie in Toronto umgetauft worden. Eine weitere, noch umfangreichere Einwanderungswelle schwappte nach dem Zweiten Weltkrieg in die Stadt, als unzählige Europäer aus der ausgebombten alten Welt die Provinz Ontario erreichten. Die meisten ließen sich in Toronto nieder, das damals zur größten Stadt des Landes aufstieg. Auch meine junge Schwester Hildegard und ihr späterer Ehemann Victorio Berde waren damals nach Toronto gekommen. Heute war Toronto mit über 4 Millionen Einwohnern das mit Abstand größte städtische Ballungszentrum ganz Kanadas.
Als wir Toronto auf einem Tagesausflug mit Lillys SUV erreichten, war von diesen Millionen kaum jemand zu sehen. Es war ein Sonntag im Juni, und Hunderttausende Torontonians hatten sich zu den Seen im Hinterland, zu den Niagarafällen oder den Badestränden an der Georgrian Bay davongemacht. Erst an der Hafenfront wurde der urbane Eindruck etwas ansehnlicher. Hochhäuser säumten ähnlich wie am New Yorker Battery Park das Ufer, gepflegte Wiesen luden zum Entspannen ein, auch wenn niemand im Gras lag. Blickte man von der Hafeneinfahrt nach Norden, glich die Skyline der Wolkenkratzer einer Reihe hintereinander eingesteckter gigantischer Karteikarten. Mehr Anmutung besaßen sie nicht. Einen gewissen Sinn für Humor bewies die steinerne Woody Woodpecker-Figur, die an einem hoch aufragendem Totem neben dem CN Tower befestigt worden war. Der CN Tower, der Fernsehturm von Toronto, war zum Zeitpunkt meines Besuches mit seinen 553 Metern das höchste freistehende Gebäude der Welt. Erst später sollte ihn der Burj Kalifa von Dubai übertreffen. In langen Reihen standen die Leute vor den Aufzügen, um für 23 kanadische Dollar zur 365 Meter hohen Aussichtsplattform des CN Towers zu fahren. Wer noch ein paar Dollar drauflegte, konnte sich noch gut achtzig Meter höher bis zur 447 Meter hohen Aussichtsplattform transportieren lassen. Besonders lohnend war keine von beiden, denn es gibt ein Ausmaß von Höhe, das den Ausblick zur Absurdität werden lässt. Während man vom Kölner Dom aus etwa einhundert Metern Höhe einen fantastischen Ausblick auf Köln genießt, ist der optische Eindruck auf der obersten Etage des Eiffelturms (270 Meter) mangels Erkennbarkeit bereits stark reduziert. Von der 365 Meter hohen Aussichtsplattform des CN Towers von Toronto sah ich nur eine konturlose diesige Suppe tief unter mir, umgeben vom vom fahl glänzenden Ontariosee. Das hätte ich mir sparen können.
Erheblich lohnender war die Fährfahrt nach Center Island, einer vorgelagerten Insel, von der wir die ultimative Panoramaansicht von Toronto erblickten. Ich sah die Skyline im Yongle Bezirk, den CN Tower und den Sky-Dom hinter einer ganzen Armada weißer Segelboote, die an diesem Tag auf dem Ontario See kreuzten. Schönheit ist immer auch eine Frage der Distanz, und was Toronto betraf, war der Besucher auf Center Island genau an der richtigen Adresse.
Auf dem Rückweg nach Cookstown machte Lilly auf der Farm eines Freundes in Georgetown Station. Sein Name war Fred, er war ein schlanker Mann Mitte vierzig, den mit Lilly ein inniges Verhältnis zu verbinden schien. Jedenfalls griff Lilly sofort nach der Begrüßung beherzt in Freds Kühlschrank, um sich ein Bier zu gönnen. Anschließend zog sie sich um und sprang in den beheizten Swimmingpool. Während Lilly ihre Runden drehte, setzte sich Fred zu mir und erzählte ein wenig aus seinem Leben. Nachdem er durch den Verkauf einer Firma Millionär geworden war, arbeitete er aus purer Langeweile für einen Stundenlohn von 11,50 $ im Supermarkt, während er gleichzeitig seinem Gärtner 15 $ die Stunde bezahlte. Er lag wie ein Sonnenanbeter im Liegestuhl, bekam bei seinen Berichten kaum die Zähne auseinander und hatte die Augenlider gesenkt, als würde er jeden Moment einschlafen. Irgendwann brach er mitten im Satz ab und ging weg.
Zwei Dinge erzählte Lilly, wenn sie mich einem ihrer Bekannten vorstellte. Zuerst: „He is a professor, he knows more about Canada than you“, was mir schmeichelte. Und: „He has my mamas mouth. He looks like a bulldog“, was mir schon weniger gefiel. Dafür umsorgte sie mich in ihrem Haus wie ein altes, wunderliches Kind. Nach unserer Rückkehr aus Toronto ließ sie es sich nicht nehmen, mir ein komplettes Abendessen zuzubereiten. Morgens, wenn ich stundenlang faul im Bett lag, las, schrieb und Kaffee trank, rannte sie kreuz und quer durchs Haus und brachte alles auf Vordermann. In der unverdrossenen Servicebereitschaft, in der sie beständig auf den Beinen war, um Rory, Baba oder mich zu umhegen, erkannte ich meine Mutter wieder.
Blick auf Toronto von Center Island aus
Von Irokesen und Huronen
Reisen durch den Westen Ontarios
Lillys Wohnort Cookstown lag nicht nur recht nahe an Toronto, auch das Südufer des Huronsees war in weniger als einer Autostunde zu erreichen. Der Huronsee, der seinen Namen nach dem Indianervolk der Huronen trug, war einer der fünf großen nordamerikanischen Seen. Mit seinen knapp 60.000 qkm Fläche belegte er im Ranking der weltweit größten Seen einen beachtlichen vierten Platz (hinter dem Kaspischen Meer, dem Lake Superior und dem Victoriasee). Geografisch war er zweigeteilt in den eigentlichen Huronsee, der sich nach Südwesten bis fast nach Detroit erstreckte und einem östlichen Becken, der Georgian Bay , die vom Rest des Sees durch eine Halbinsel und eine Kette kleiner Inseln separiert war.
Im Süden der Georgian Bay, zwischen den Orten Collingwood und Midland verbrachten viele Torontonians ihre Sommerfrische. Die beliebteste Anlaufstelle des Georgian Bay-Badetourismus war der Strand von Wasaga, von dem es hieß, dass er mit einer Länge von 16 km der längste Süßwasserstrand der Welt sei. Der schönste aber war er ganz bestimmt nicht, jedenfalls nicht nach Lillys Meinung. Für sie war Wasaga „a party mile for the lower class“ , ein „Freak-Center of inellectual underperfomers“, die in „ugly cottages“ lebten. So schlimm fand ich es nicht, zumal Wasaga wegen der Wassermassen des Huronsees über ein wärmeres Mikroklima verfügte als der Rest Ontarios.
Wir übernachteten bei Susan, einer engen Freundin von Lilly, bei der wir schon am Nachmittag einfielen. Wie schon bei Fred in Georgetown spazierte Lilly auch hier gleich zum Kühlschrank, um sich ein Bier zu besorgen. Handelte es sich um einen kanadischen Freundschaftsritus, nach dem enge Freunde gleich nach dem Betreten der Wohnung ihre Vertrautheit durch den direkten Gang zum Kühlschrank beweisen durften? Jedenfalls hätte Susan eine Schwester von Lilly sein können; die gleiche rundliche, aber bewegliche Figur, das gleiche aufgeschlossene Temperament und die gleiche offensive Gastlichkeit. Nach der Begrüßung schaute mich Susan kurz an, als taxiere sie, welches Getränk zu diesem Gast passte und setzte mich dann mit einer Flasche Rotwein auf die Veranda. Gegen diese Art von Gastlichkeit hatte ich nichts einzuwenden. Dann verschwanden Susan und Lilly in der Küche, unterrichteten sich gegenseitig über den neuesten Tratsch und Klatsch und begannen mit der Zubereitung des Abendessens.
Natürlich wurde zum Abendessen wieder reichlich Wein aufgefahren, dem die Damen mächtig zusprachen, während ich mein Bestes gab, die Honneuers zu machen. Besonders witzig brauchte ich gar nicht zu sein, denn die beiden kreischten dankbar über jeden meiner halbgaren Witze. Die Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als Susan von ihrer Scheidung erzählte und berichtete, wie sie ihrem Ehemann dieses Haus abgeluchst hatte. Der Abend klang aus mit einer feurigen Philippika von Lilly über den bevorstehenden Untergang der Welt, der nur durch die Stärkung der familiären Werte aufzuhalten sei. Ich war schon so benebelt, dass mir das einleuchtete, obwohl wir drei es in diesem Raum fast schon auf ein halbes Dutzend Scheidungen brachten.
Am nächsten Morgen war das Wetter umgeschlagen. Wie ein langer Strich lag die Georgian Bay vor der Küste. Ein Nieselregen hatte eingesetzt, die Möwen kreisten über dem Ufer, als ich meinen Morgenkaffee trank. Susan ließ sich nicht anmerken, wie verkatert sie war und erzählte, dass das Wasser in den letzten dreizehn Jahren um fast fünfzig Meter zurückgegangen sei.
Am späten Vormittag verließen wir die gastliche Susan und fuhren weiter nach St. Marie am Huronsee, einem der historisch bedeutsamsten Orte der kanadischen Kolonialgeschichte. Hier hatten die Franzosen im Jahre 1639 mitten im Siedlungsgebiet der Huronen einen Stützpunkt gegründet, der zum Ausgangspunkt einer indianisch-katholischen Kultur werden sollte. Inmitten einer Bevölkerung von 20.000 Huronen, die in hunderten großer und kleiner Indianersiedlungen lebten, wandelten die christlichen Missionare einher wie die Schäfer unter den Lämmern und machten dem großen Manitou die Anhänger abspenstig. Nur gut zehn Jahre sollte es dauern, bis diese Idylle im Blut versank.
Von heute aus war die Erinnerung an dieses Drama am südlichen Ufer des Huronsees mit vielen Unklarheiten belastet. Schon die Namen „Huronen“ und „Irokesen“ waren Fremdzuschreibungen, die eine Kompaktheit der Volkskörper vortäuschten, die es wahrscheinlich gar nicht gegeben hat. Zudem stammten alle überlieferten Fakten aus der Feder europäischer Autoren, die den Indianern nicht besonders freundlich gesonnen waren. Selbst die Datierung und die Geografie der Siedlungsgebiete waren umstritten. Trotzdem bestand kein Zweifel daran, dass das Leben der Indianer im 16. und 17. Jahrhundert im Gebiet des Sankt-Lorenz-Stroms und der großen Seen eine einzige Abfolge von Gemetzeln gewesen war. Im Zuge der Reisevorbereitungen hatte ich mir einige grundlegende Tatsachen in mein Skizzenbuch notiert.
(1) Die Franzosen trafen bei ihrer Ankunft auf kein menschenleeres, sondern auf ein heiß umkämpftes Land, das von drei großen Völkern, Stämmen oder Konföderationen bewohnt wurde, von den Irokesen, den Huronen und den Algonkins.
(2) Das bedeutendste dieser Völker waren die Irokesen. Sie erhielten ihren Namen von den benachbarten Algonkin-Indianern, die sie herzlich hassten und die ihnen den Namen „Klapperschlangen“ gaben, woraus die Franzosen in einer fehlerhaften Übersetzung „Irokesen“ machten. Sie lebten im Süden des Ontariosees, aufgeteilt in die fünf Stämme der Mohawk, Oneida, Cayuga, Onondaga und Seneca. Diese fünf Stämme (manchmal auch „fünf Nationen“ genannt) schlossen sich um 1570 zu einer Konföderation zusammen, die die internen Konflikte beendete und die geballte Macht der Irokesen nach außen richtete.
(3) Den Irokesen standen die Huronen gegenüber, die im Norden des Ontariosees und im Süden des Huronsees lebten. Auch sie waren in unterschiedliche Stämme oder Clans aufgeteilt, als Ganzes aber nicht durch eine Konföderation vereinigt. Auch ihre Namensgebung ist wenig schmeichelhaft. Der Begriff Hurone geht auf das französische „La hure“ zurück, was so viel wie „Wildschweinkopf“ bedeutet.
(4) Von Irokesen und Huronen werden die Algonkinindianer unterschieden, die im Norden des St. Lorenzstroms lebten und sich nach Möglichkeit aus den kriegerischen Auseinandersetzungen heraushielten.
Was das zivilisatorische Niveau betraf, unterschieden sich Irokesen, Huronen und Algonkins wenig. Die Ernährung beruhte auf primitivem Ackerbau, der den Frauen oblag, sowie Jagen und Fischen. Aufgrund der Primitivität der Bodenbearbeitung und der Härten des Klimas vegetierten die meisten Indianerstämme permanent am Rande der Hungersnot, so dass – man traut es sich kaum niederzuschreiben - regelmäßiger Kannibalismus an Gefangenen an der Tagesordnung war. Anders als es romantisierende Indianerdarstellungen des 19. Jahrhunderts nahe legen, waren die Indianer in der Darstellung ihrer weißen Antagonisten ungebärdig, unberechenbar, tapfer bis zur Selbstaufgabe, wenngleich auch verschlagen, wenn es sein musste und ihren Feinden gegenüber von unerhörter Grausamkeit. Wem das zu stereotyp klingt, dem sei versichert, dass die Franzosen auch keine Kinder von Traurigkeit waren.
Diese Welt eines permanenten Existenz- und Überlebenskampfes wurde durch die Franzosen mit zwei neuen Einflussfaktoren konfrontiert. Der erste war der Handel mit Biberfällen, nach denen in Europa eine enorme Nachfrage bestand. Kurios aber wahr: die modische Vorliebe der höheren europäischen Stände für den opulenten Filzhut rief ab dem späten 16. Jahrhundert eine weltweite Biberhatz von Sibirien bis Kanada hervor, in deren Verlauf ganze Völker aus der Geschichte verschwinden sollten. Der zweite war der Ausbruch von Epidemien, die ganze Stämme dahinrafften.
Zunächst aber begann alles sehr vielversprechend. Für die Indianer des Sankt Lorenz-Stroms und der Großen Seen bestand durch diesen Handel die Möglichkeit, europäische Metallwaren, später sogar europäische Waffen zu erhalten. Sägen, Hämmer, Zangen und Scheren aus Metall waren für die Indianer eine regelrechte Offenbarung, ganz zu schweigen von den Feuerwaffen der Weißen, die die Franzosen aber nicht herausrücken wollten.
In der ersten Phase des französischen Biberfellhandels nach der Gründung von Québec (1608) waren die Huronen die bevorzugten Handelspartner, was ihr Verderben werden sollte. Denn die Franzosen wollten nicht nur Biberfelle einhandeln, sondern auch missionieren. Katholische Priester, vorwiegend Jesuiten, wanderten im Geiste von Todesverachtung und Märtyrertum durch die Indianergebiete, verkündeten die frohe Botschaft und hatten doch nur den Tod im Gepäck. Nach allem, was man heute weiß, waren sie es gewesen, die, ohne es zu wissen, Pocken, Blattern und Pest unter den Huronen verbreiteten. Da die Huronen dagegen keinerlei Resistenz besaßen, fielen sie diesen Krankheiten zu Tausenden zum Opfer. Kein Wunder, dass viele Huronen auf die Missionare nicht gut zu sprechen waren. Es entstand zwar eine christliche Huronengemeinde, doch eine traditionalistische Mehrheit lehnte Christentum und Taufe entschieden ab.
Die Irokesen blieben zunächst von diesen Entwicklungen verschont, ganz einfach, weil sie alle Missionare, derer sie habhaft werden konnten, konsequent töteten und wenig Handel mit den Franzosen trieben. Ihre bevorzugten Handelspartner waren die südlich im heutigen US-Staat New York aktiven Holländer, die wenig Skrupel hatten, den Irokesen europäische Feuerwaffen gegen Biberfelle zu liefern.
Diese Feuerwaffen verschafften den Irokesen schnell ein militärisches Übergewicht, gegen das sich die Huronen auf Dauer nicht behaupten konnten. Ungerührt, fast desinteressiert sahen die Franzosen zu, wie die Huronen immer mehr in die Defensive gerieten. 1648 und 1649 überrannten die Irokesen die Huronendörfer an der Georgian Bay und richteten ein schreckliches Gemetzel an. Auch die christlichen Missionare, die bei dieser finalen Auseinandersetzung gefangen wurden, erwartete ein schreckliches Schicksal. Der Jesuit Jean de Brébeuf, dessen Denkmal heute das Freilichtmuseum von St. Marie überragt, hatte noch Glück. Er starb bereits nach drei Stunden am Marterpfahl, als ihm die Irokesen glühende Kohlen in die ausgestochenen Augenhöhlen legten. Sein Glaubensbruder Gabriel Lalemant dagegen musste siebzehn Stunden lang unvorstellbare Qualen erleiden, ehe ihn endlich der Tod erlöste.
Gefecht zwischen Huronen und Irokesen,
Kupferstich nach einer Skizze von Samuel de Champlain
Damit war der Expansionsdrang der Irokesen noch lange nicht gestillt. Beinahe wäre es ihnen im Bündnis mit den Engländern sogar gelungen, Québec und das neu gegründete Montreal (vgl. S. 53ff.) zu vernichten. Dann aber wurden auch sie durch Seuchen und Alkoholismus geschwächt. Schließlich verstärkte Frankreich endlich seine militärische Präsenz in der Neuen Welt und etablierte am Beginn des 18. Jahrhunderts seine unangefochtene Herrschaft am Sankt-Lorenz-Strom.
Nur wenig von dieser blutigen Geschichte wurde im Freilichtmuseum von St. Marie am Südufer der Georgian Bay lebendig. Nach einer kurzen Filmvorführung am Eingang des Freizeitparks hob sich die Leinwand, und die Besucher durchschritten das Festungstor. Ein Faltplan führte an den verschiedenen Stationen der Siedlung vorbei. In Gärten wurde Gemüse angebaut, in einem großen Langstall befanden sich die Hühner. Es gab eine Küche, in der Brot gebacken und Fleisch in großen Töpfen gekocht wurde. In einer Schmiede und Schreinerei wurden Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände hergestellt. Es gab ein Wohnhaus der Jesuiten und eine Art Altarraum, dazu Brunnen, Feuerstellen und eine Kaserne. Hinter den Palisadenwällen befand sich der Wasserzugang. Dazu existierte ein Hospital, in dem versucht wurde, indianische und europäische Heilkunst zu kombinieren. Am Ende stießen wir auf einen Friedhof für die von den Irokesen erschlagenen Jesuiten.
Gleich jenseits der Straße, in der Kirche der Märtyrer, wurden Brébeuf und Lalemant verehrt. Sogar den Schädel von Brébeuf und einige Knochen diverser französische Märtyrer wurden in kostbaren Schreinen verwahrt. Papst Johannes Paul II höchstselbst hatte diesen Platz besucht und für die Märtyrer gebetet. Lange saß ich vor den Schreinen und beobachtete die Besucher. Viele knieten nieder und beteten, manch einer schüttelte den Kopf, als er von den Qualen der Heiligen las. Erschütternd dagegen war die unbeteiligte Stumpfheit, mit der übergewichtige Kinder in ihren Ghettohosen und ihren umgedrehten Kappen auf ihre leeren Köpfen an den Schreinen vorüber liefen.
Niagara
Die Natur als Chiffre
für Leidenschaft und Liebe
Es war keine gute Idee gewesen, ausgerechnet an einem Sonntag von Toronto zu den Niagarafällen zu fahren. Vier Stunden brauchten wir für die 175 km, aber dafür war der größte Andrang bereits vorüber, als wir am Nachmittag die Niagarafälle erreichten. Schon von weitem war das Tosen des Wassers zu hören, und Lilly wurde ganz unruhig vor Ergriffenheit. Für sie waren die Niagarafälle „the greatest falls of all“, was allerdings nur hinsichtlich ihrer Berühmtheit stimmte. Verstand man unter der „Größe“ die „Höhe“ eines Wasserfalls, dann rangierten die Niagarafälle mit ihren noch nicht einmal sechzig Metern Falltiefe unter ferner liefen, irgendwo hinter Rang 100 auf der Liste der höchsten Wasserfälle der Erde. Verstand man unter „Größe“ aber auch die „Breite“ eines Wasserfalls, dann sah es schon anders aus. Die drei Wasserfälle, die insgesamt die Niagara Wasserfälle bildeten, der American Fall, der Bridal Veil Fall und der Horseshoe Fall, brachten es zusammen auf eine Breite von einem Kilometer. Das kam zwar bei weitem nicht an die Ausdehnung der Victoriafälle heran und schon gar nicht an die kilometerbreiten Ausmaße der Iguacufälle, machte aber aus der Nähe gewaltig was her.
Allerdings dauert es seine Zeit, bis man einen Überblick über die Niagarafälle gewinnt. Ich erkannte die Brücke, die Kanada und die USA verbindet, blickte in dutzendmeterhohe Gischtfontänen und identifizierte die Konturen von Hotels und Casinos hinter den Nebelwolken. Aber erst von der Aussichtsplattform des Skylon Towers gewann ich einen Eindruck vom Gesamtpanorama. Im Mittelpunkt des Bildes befand sich der Niagara River, die Wasserverbindung zwischen dem Eriesee und dem etwas tiefer gelegenen Ontariosee. Kurz vor den Wasserfällen wurde der Fluss durch die beiden Inseln Luna Island und Goat Irland in drei Teile geteilt. Dementsprechend waren es drei separate Wasserfälle, die über die Abbruchkanten in die Tiefe stürzten, im Westen der American Fall mit einer Breite von 270 Metern und einer Falltiefe von etwa dreißig Metern, daneben der viel kleinere Bridal Veil Fall und schließlich der siebenhundert Meter lange gewaltige Horseshoe Fall, der mit unglaublichem Getöse 57 Meter die Tiefe stürzte.
Überblickte man die Szenerie, war es schwer zu glauben, wie erdgeschichtlich jung sie noch war. Gerade mal vor zwölftausend Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, war der Eriesee mit seinen Schmelzwassern übergelaufen, um sich über einen Abfluss, den heutigen Niagara River, in den tiefer gelegenen Ontariosee zu ergießen. Eine weitere geologische Besonderheit kam hinzu. Die Wassermassen, die beständig über die Abbruchkanten stürzten, rieben diese Kanten ab und verkürzten den Niagara River Jahr für Jahr, so dass die amphitheatralische Kulisse unterhalb des Horseshoe Falls immer größer wurde.
Soweit die dürre Beschreibung der Fakten. Etwas ganz anderes war es, auf der kanadischen Seite am Gelände der Horseshoe-Fälle entlangzugehen und die unglaubliche Wucht des Wassers aus nächster Nähe zu erleben. Unterhalb der Fälle fuhren kleine, mit Gästen vollgestopfte Ausflugsboote so nah wie möglich an die Fälle heran, bis sie durch den Wasserdunst fast völlig eingenebelt und die Passagiere zu ihrem kreischenden Vergnügen pitschnass geworden waren.
Früher hatte es an den Niagarafällen auch noch ganz andere Spektakel gegeben. Dutzendweise hatten sich kühne
Niagara Falls
„Niagara Daredevils“ in Tonnen oder Fässer die Niagarafälle herabgestürzt, entweder, um bekannt oder berühmt zu werden oder ganz einfach ihren persönlichen Fimmel auszuleben. Die erste, die amerikanische Tanzlehrerin Annie Taylor, die sich am 24. Oktober 1901 mit ihrer Katze in einer Tonne die Fälle herabtreiben ließ, überlebte, starb aber später im Armenhaus. Weniger gut erging es dem Koch George Stathakis, der sich 1930 mit seiner Schildkröte in einem Fass die Fälle herunterstürzte. Nur die Schildkröte wurde lebendig aus der Tonne geborgen. Schließlich fanden diese Aktionen so viele Nachahmer, dass die Polizei auf beiden Seiten der Grenze alle Hände voll damit zu tun hatte, andere „Niagara Daredevils“ vor ihrem Sturz herauszufischen. 2012 balancierte Nik Wallanda auf einem 600 Meter langen Drahtseil über die Niagarafälle, drei Jahre später kletterte der Extremsportler Willi Gadd über das Eis der zugeforenen Niagarafälle bis zur Abbruchkante. Namenlos dagegen bleiben die meisten Selbstmörder, die sich ohne großes Aufsehen in die Fluten stürzen und auf Nimmerwiedersehen verschwanden. Experten schätzen, dass jährlich etwa zwei Dutzend Menschen den Freitod an den Wasserfällen suchen.