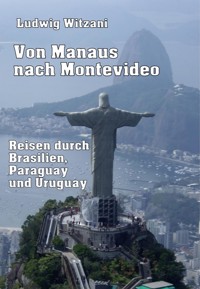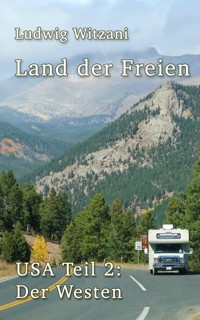Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ludwig Witzani bereist in dem vorliegenden Buch die Schau-plätze der polynesischen Kultur und Geschichte zwischen Tonga und den Osterinseln, Hawaii und Neuseeland. Er beobachtet das Fire-Walking auf den Fidschi Inseln und badet am "Return to Paradise Beach" auf Samoa. Er umrundet Rarotonga und Bora Bora mit dem Fahrrad und folgte dem Lavastrom des Kilauea auf Hawaii. In Rapa Nui begegnete er den Überresten einer ökologi-schen Apokalypse und auf den Galapagosinseln einem Experimentierfeld der Evolution. Kaum eine Region der Welt hat den modernen Menschen derart dazu verführt, seine Utopien und Sehnsüchte auf eine unbekannte Ferne zu projizieren. Ein informatives und zugleich tief emotionales Buch über Schönheit und Vergänglichkeit von einem Autor mit einem Faible für Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Witzani
Der unendliche Ozean
Pazifische Reisen zwischen Fidschi und Hawaii,Neuseeland und den Osterinseln
(Weltreisen Band XIV)
Der unendliche Ozean
Copyright: © 2022 Ludwig Witzani Konvertierung: sabine abels, Hamburg
published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Vorwort
Das erste Mal, dass ich etwas von der Südsee hörte, war in meiner Schulzeit. Erdkundelehrer Wollbrett rollte den Fernseher in den Klassenraum und zeigte uns eine Filmdokumentation über Thor Heyerdahl. Sie berichtete von einem Norweger, der zusammen mit einer wagemutigen Crew auf dem Balsaboot „Kon Tiki“ durch den Pazifik segelte. Warum er das machte, habe ich damals nicht verstanden, aber die herrlichen Palmenstrände diverser Südseeinseln machten mächtig Eindruck auf mich.
Das nächste Mal begegnete mir die Südsee in der Oberstufe. Einer meiner Schulkameraden hatte ein kleines Büchlein mitgebracht, aus dem er uns wundersame Betrachtungen vorlas. Es handelte sich um die Reden eines Südseehäuptlings, der seinem Volk von den bedauernswerten „Papalagi“, den Weißen, erzählte, die nie Zeit hatten und sich Tag und Nacht bei ihrer Arbeit abrackerten. Das hörte sich schön kritisch an und gefiel mir. Erst später erfuhr ich, dass der Verfasser ein Deutscher und das Buch reine Fiktion war.
Meine nächste Kontaktaufnahme mit der Südsee vollzog sich in einem Proseminar über Kulturanthropologie in der Kölner Universität. Dort vernahmen wir Margret Meads frohe Botschaft vom Segen einer frei ausgelebten Sexualität auf der Südseeinsel Samoa. Das hörte sich noch besser an als der Papalagi, und diesmal schien es sogar wahr zu sein, denn eine weltberühmte Wissenschaftlerin war höchstselbst nach Samoa gereist, um die rundum befriedigten Eingeborenen diesbezüglich zu befragen.
Doch die Zeit verging, und auch diese Information stellte sich als falsch heraus. Potzdonner, dachte ich. Was ist bloß los mit der Südsee? Erzählte denn jeder, was er wollte?
Ich wurde älter und las die Südseegeschichten von Stevenson, Jack London, Sommerset Maugham und Hermann Melville. Merkwürdig, dass jeder der Autoren von sich selbst ebenso viel wie von der Südsee erzählte. Die Südsee war ihnen wie ein Spiegel, in den jeder gerne blickte, weil er darin sich selbst (und das, was ihm fehlte) erkannte.
Wie aber war sie wirklich?
Es dauerte noch etwas, bis ich diese Frage auf der Grundlage eigener Reisen angehen konnte. Wie die Südsee „wirklich“ ist, habe ich allerdings auch nicht herausgefunden - wohl aber, wie sie sich anfühlt, wie sie aussieht, was es zu sehen und möglicherweise von ihr zu lernen gibt. Davon handelt dieses Buch.
Es beschreibt vier Reisen in die Südsee, genauer gesagt: nach Polynesien im Laufe einer ganzen Generation. Fidschi, Tonga, Samoa, Tahiti, Cook und Hawaii habe ich auf einer einzigen langen Reise besucht, später kamen Galapagos, Rapa Nui und Neuseeland auf drei kleineren Reisen hinzu. Grundlage der einzelnen Kapitel sind die Aufzeichnungen meines Reisetagebuches, die ich, soweit es möglich war, unverändert übernommen habe. Nur hier und da habe ich offensichtliche Fehler korrigiert und die eine oder andere neuere Information hinzugefügt. Aus Gründen der Diskretion habe ich die Namen von Reisebekanntschaften anonymisiert. Wie in allen meinen Büchern spielt auch in diesem Reisebuch die Geschichte eine wichtige Rolle, denn sie ist in einer imaginären Vertikale das, was der Raum in der Horizontalen ist.
Alle Urteile in diesem Buch sind natürlich subjektiv und gehen auf meine Kappe. Sollte ich jemanden ohne Absicht auf die Füße getreten sein, bitte ich schon vorab um Vergebung. Aber ganz recht machen kann man es ohnehin nicht allen. Ganz besonders nicht unterwegs
In diesem Sinne: Gute Reise!
Na Pali Coast Kauai/Hawaii Archipel
Statt einer Einleitung:
Argonauten des Pazifiks
Über die Reisen der Polynesierins Nirgendwo
Bruce Chatwin hat in seinem Buch „Traumpfade“ den Menschen als Nomaden bezeichnet, als einen Wanderer, der die Ortsveränderung liebt und sich immer neue Ziele sucht. Diese Wesensbestimmung mag angesichts unserer urbanen Lebensweise befremden, aber im Hinblick auf den Gang der Weltgeschichte ist sie zweifellos richtig. Der Homo sapiens wanderte von Afrika nach Europa und Asien, und seine Nachkommen wanderten weiter durch die ganze Welt. Die Bantus wanderten von Kamerun aus durch Afrika. Mongolische Völker überschritten die Beringstraße und besiedelten Amerika. Die Malaien bevölkerten von Südchina aus in zwei großen Schüben die indonesischen Inseln und kamen bis Madagaskar. Die erstaunlichste Ausbreitung unter diesen nomadischen Großereignissen aber war die Besiedlung des Pazifiks durch die Polynesier.
Diese Erkundung einer ozeanischen Unendlichkeit hatte etwas vom Zug der Lachse in Alaska. Es schien unmöglich, dass sie ihr Ziel erreichten, doch die große Zahl derer, die unterwegs waren, sorgte dafür, dass einige ankamen. Über die ungeheure Zahl der Opfer sprach man nicht. David Abulafia schätzte die Zahl der Polynesier, die zwischen Hawaii und Neuseeland, Samoa und Rapa Nui auf ihren Flößen umgekommen waren, auf eine halbe Million Menschen. So wie Gericault die verdurstenden Schiffbrüchigen auf seinem Gemälde „Das Floß der Medusa“ darstellt, stellte ich mir das hundertausendfache Sterben im Ozean vor. Auf der Basis dieses Blutzolls wurden die Inseln Polynesiens besiedelt.
Mit ihnen verhält es sich wie mit den Grashalmen im „Mann ohne Eigenschaften“. Auch wenn ein jeder anders ist, weht sie der Wind doch alle in die gleiche Richtung. Zum besseren Verständnis der einzelnen Kapitel dieses Reisebuches soll deswegen im Folgenden auf einige Grundtatsachen verwiesen werden, die für die gesamte polynesische Zivilisation maßgeblich waren. Wen dieser geschichtliche Exkurs nicht interessiert, kann das Kapitel überspringen und gleich auf Seite 21 weiterlesen. Weiterführende Literaturangaben zu diesem Thema finden sich im Anhang.
Das erste Rätsel der polynesischen Zivilisation bestand in der Frage , woher die Polynesier kamen. Dazu wurden in der Vergangenheit die fantastischsten Theorien aufgestellt, angefangen von der Behauptung, dass die Nachfahren der Kinder Israel die Inseln der Südsee bevölkert hätten, bis zu Tor Heyerdahls Idee einer Besiedlung des pazifischen Raumes von Südamerika aus. Vergleichende sprachwissenschaftliche und genetische Untersuchungen haben aber inzwischen zweifelsfrei ergeben, dass die Vorfahren der Polynesier aus dem Westen kamen, wahrscheinlich aus Taiwan oder von den Molukken.
Die Motive, die die proto-polynesischen Seefahrer zu ihren riskanten Reisen veranlassten, werden die gleichen gewesen sein, wie bei allen großen Wanderungsbewegungen der Geschichte: Überbevölkerung, Verknappung der Nahrungsgrundlagen, ökologische Krisen, aber auch soziale Konflikte, Bürgerkriege und religiöse Visionen von einem gelobten Land jenseits des Horizonts.
Von einem gelobten Land jenseits des Horizonts zu träumen ist das eine - es auch zu erreichen etwas ganz anderes, womit wir bei dem größten Rätsel der polynesischen Geschichte wären: dem Rätsel der polynesischen Navigation. Über die nautische Kompetenz der Polynesier hatten bereits die europäischen Weltumsegler des 18. Jahrhunderts gestaunt, ehe nach und nach auf westlicher Seite ein Verständnis für die Vielfalt der Techniken entstand, mit denen die polynesischen Seefahrer auf die Reise gegangen waren. Offenbar hatten die Polynesier schon sehr früh die Kunst entwickelt, den Stand und den Lauf der Sterne für ihre Navigation zu nutzen. Sie kannten die Windrichtungen und Meeresströmungen und wussten unterschiedliche Wassertemperaturen zu deuten. Sie nutzten das Wissen über die Distanzen, die Vögel über das Meer zurücklegen konnten und waren in der Lage, Wolkenformationen am Horizont zu interpretieren. Auch mit den Te lapas waren sie vertraut, sogenannten Unterwasserlichtern, die im Umkreis von bis zu einhundert Kilometern um manche Inseln herum sichtbar werden.
All das war beeindruckend, aber zu wenig, wenn nicht eine zusätzliche Eigenschaft hinzukam, ohne die kein Navigator sein Ziel erreichte: Fortune. Bei all seiner Kompetenz brauchte der polynesische Navigator ganz einfach das Glück, als einer unter Tausenden den richtigen Weg eingeschlagen zu haben- – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Abstände zwischen den Inseln immer größer wurden, je weiter die Reise nach Osten ging.
Über die Chronologie der polynesischen Expedition kursierten lange Zeit die abenteuerlichsten Datierungen. Am Anfang hatte man die polynesischen Mythen herangezogen und die dort angegebenen Stammbäume zurück gerechnet - etwa so, wie der anglikanische Bischof James Ussher, der auf diese Weise aus den Lebensdaten des Alten Testamentes die Erschaffung der Welt auf dem 4. Oktober 4004 v. Chr. datierte. Die moderne Forschung dagegen stützt sich auf die ärchäologische Untersuchung kultureller Artefakte und die Radiokarbondatierungen organischer Überreste. Auf dieser Grundlage ergibt sich folgender Befund: Von Taiwan oder den Molukken aus waren die Proto-Polynesier in einem Jahrtausende währenden Prozess von Insel zu Insel „gehüpft“, ohne lange zu bleiben oder sich intensiver mit Melanesiern zu vermischen. Irgendwann, wahrscheinlich Tausende von Jahren vor der Zeitenwende, passierten sie Papua-Neuguinea und das Bismarck Archipel, später Vanatu und Neukaledonien, um etwa um das Jahr 1000 vor der Zeitrechnung Fidschi, Tonga und Samoa zu erreichen.
Merkwürdigerweise setzte nach der Ankunft in Fidschi (dem westlichen Ende Melanesiens), Tonga und Samoa, „den Stamminseln Polynesiens“ eine Pause ein, die je nach Datierung tausend bis anderthalbtausend Jahre dauerte. Erst im fünften, sechsten und siebten Jahrhundert brachen die Polynesier wieder auf, diesmal gegen den Wind in die vollkommen unbekannten Weiten des zentralen pazifischen Raumes. Sie erreichten die Cookinseln, Tahiti, die Marquesas und etwas später auch Hawaii, Rapa Nui und möglicherweise Südamerika, wo sie aber nicht blieben. Mit der Entdeckung Neuseelands im späten 13. Jahrhundert kam dieser Prozess zum Abschluss
Übrigens war längst nicht jede Insel für eine Besiedlung geeignet. Manche waren zu felsig, andere lagen zu flach im Meer, besaßen zu wenig Süßwasser, keine Bäume oder nur mangelhafte Vogel- oder Fischbestände. Wie heikel diese Suche sein konnte, mussten die Meuterer der Bounty feststellen, die nach ihrer Meuterei monatelang kreuz und quer durch den Pazifik segelten, ehe sie eine geeignete Insel für ihre Niederlassung fanden. War eine Insel ungeeignet und wurde doch besiedelt, konnten die Folgen tödlich sein. War die Population der Neusiedler zu klein und fehlten exogame Heiratskandidaten, drohte langfristig die genetische Degeneration.
Wie sich die Gründung einer Kolonie auf einer neu entdeckten und menschenleeren Insel konkret vollzog, wissen wir nicht. Entscheidend war, dass das mitgebrachte Saatgut auf dem jungfräulichen Boden der neuentdeckten Insel gedieh. Sicher wird sich bald eine Arbeitsteilung zwischen Handwerkern, Bauern und Kriegern entwickelt haben, die sich Schritt für Schritt in eine politische Hierarchie übersetzte. Als die Europäer im 18. Jhdt. die Südseeinseln erforschten, trafen sie jedenfalls auf stark hierarchisch gegliederte Stammesgesellschaften mit Königen, Priestern, Kriegern, Bauern und rechtlosen Sklaven. Von der Südseeidylle, von der die europäischen Entdecker schwärmten, wird im konkreten polynesischen Alltag wenig zu spüren gewesen sein.
Erstaunlich ist, dass trotz der weiträumigen Ausdehnung der polynesischen Siedlungsgebiete die kulturelle Ausdrucksformen ähnlich blieben. Die wichtigste Klammer war die Sprache, die von Hawaii bis nach Neuseeland verstanden wurde. Als Captain Cook 1769 Neuseeland erreichte, konnte er sich über seinen tahitianischen Dolmetscher Tupaia problemlos mit den Einheimischen verständigen – im Unterschied zu seiner Begegnung mit den australischen Aborigines, die eine gänzlich andere Sprache sprachen. Auf allen polynesischen Inseln existierte eine hochentwickelte Kunstfertigkeit in der Bearbeitung von Bast und Holz, eine Tradition der Sternenbeobachtung, allerdings keine Metallverarbeitung und keine Schrift (mit Ausnahme der Rongo-Rongo-Tafeln in Rapa Nui). Eine ähnliche Ernährung mit kalorienreicher Kost (Taro, Yams, Süßkartoffeln etc.) führte zu dem wuchtigen Erscheinungsbild, das gleichsam zum Markenzeichen des Polynesiers geworden ist.
So lebten die Polynesier auf ihren schönen Inseln durch die Jahrhunderte hinweg ein merkwürdig ungeschichtliches Leben, über dessen Einzelheiten nur die Inselmythen berichteten. In den Südseegeschichten von Robert Louis Stevenson ist ein Teil von Ihnen auf die Gegenwart gekommen. Sie erzählen von religiösen Festen und Opfern, Hungersnöten und Kriegen, Kannibalismus, erneuten Auswanderungen und Ankünften, die wie die Speichern eines immer gleich dahinrollenden Rades das Auf und Ab der Generationen prägten.
Wirkliche Umwälzungen setzten erst wieder ein, als die Europäer über Ozeanien hereinbrachen und ihre Nutzpflanzen, Krankheiten und Kontraktarbeiter aus China, Japan und Indien auf die Inseln holten. Für jede Insel schlug die Stunde der Wahrheit, als die europäischen Segler am Horizont erschienen. Wie die einzelnen Inseln sich dieser Herausforderung stellten, bestimmt ihr heutiges Gesicht, ganz gleich, wie man moralisch die europäisch-amerikanische Überfremdung bewerten mochte.
Idyllisierendes Südsee-Stilleben (Auckland Gallery, Auckland)
Der westliche Pazifik
Landleben auf Viti Levu
Die Inselder zwei Geschwindigkeiten
Tage auf Viti Levu,der Hauptinsel des Fidschi Archipels
Stunde um Stunde überflog die Maschine die Unendlichkeit des Ozeans. Inseln wie Farbtupfer auf einer blauen Leinwand zogen tief unter mir vorüber. Wie dürr und blass waren alle Zahlen, mit denen der Pazifik beschrieben wurde. Vergebliche Mühe, eine Weite auszumessen, die die Vorstellungskraft überstieg. Der Pazifische Ozean war alleine größer als alle Kontinente zusammen und bedeckte mit gut 165 Millionen Quadratkilometern ein Drittel der Erdoberfläche. Aber er war nicht nur groß, sondern auch gefährlich. Der Pazifik „schwamm“ auf einer Erdplatte (der „pazifischen Platte“) deren Ränder sich an anderen Erdplatten „rieben“, so dass sich ein „Feuerring“ an seinen Grenzen befand, eine planetarische Unruhezone, die immerfort Vulkanausbrüche, Erdbeben und neue Inseln gebar. Diese Inseln, so hieß es, waren sein größter Schmuck, allerdings wurden sie von Westen nach Osten immer kleiner, bis hin zur winzigen Osterinsel viertausend Kilometer vor der südamerikanischen Küste.
Das Flugzeug hatte Neukaledonien passiert, dann die südlichen Inseln von Vanatu überflogen und näherte sich den Fidschi-Inseln. Die Fidschi-Inseln gehörten zusammen mit Samoa und Tonga zum Westpazifik und waren ähnlich groß wie Hawaii. Fidschis 322 Inseln brachten es auf eine Gesamtfläche von 18.376 Quadratkilometern, von denen allein die beiden größten, Viti Levu und Vanua Levu, 87 % ausmachten. Der Pilot flog einen weiten Bogen über Viti Levu und landete auf dem internationalen Flughafen von Nadi.
In der Abfertigungshalle roch es nach Bohnerwachs und Konservendosenfleisch. Die Uniformen der dunkelhäutigen Grenzbeamten spannten, und ihre mächtigen Hälse spotteten jedem Kragenknopf. Ihre Finger waren so dick, dass ich mich fragte, wie es mit ihnen gelang, die Computer zu bedienen. „Welcome to the Republic of Fidschi“, sagte der Grenzbeamte mit einer Bassstimme aus den untersten Regionen seines Zwerchfells und knallte mir den Stempel in den Pass. Ich hatte ein Land von Riesen betreten.
Dann im Bus nach Nadi die nächste Überraschung. Indische Jungen und Mädchen auf dem Heimweg von der Schule bestiegen den Bus. Adrett gekleidet in weiß-blaue Schuluniformen gaben sie ihr Fahrgeld dem melanesischen Fahrer, die Mädchen mit entzückenden weißen Schleifchen in den Haaren, die Jungen mit wichtigen Mienen und durchgedrücktem Rücken. Zwei Reihen hinter mir saßen einige Melanesier mit Kraushaaren und großen, flachen Gesichtern. körperlich wuchtig, die Mütter geradezu kolossal, immer aber freundlich lächelnd. Ich sah, wie ein junger Melanesier insgeheim die hübschen kleinen Inderinnen musterte. Aussichtslos, Fidschi war ein komplett binationaler Staat, dessen Angehörige sich nicht vermischten. Früher, vor den Ausschreitungen der 1987er Jahre, hatten die Inder sogar die Bevölkerungsmehrheit gestellt, inzwischen bewegte sich ihr Anteil bei etwa 40 %.
In Nadi gab es nichts zu sehen als flache Häuser mit angegriffenen Fassaden, staubige Straßen und einer Stadtbevölkerung, die sich in zwei Geschwindigkeiten bewegte; schnell und hektisch die Inder, langsam und behäbig die Melanesier. Kaum zu glauben, dass die Angehörigen beider Bevölkerungsgruppen in der gleichen dreidimensionalen Welt zuhause waren.
Die meisten Touristen passierten Nadi nur als Durchgangsstation zu den Ferienressorts auf den vorgelagerten Mamanuca-Inseln. Auf Beachcomber-, South Sea- und Treasure-Island erlebten Australier, Neuseeländer und Amerikaner ihren Luxusurlaub an puderweißen Stränden weitab der abgeholzten Wälder im Inselinnern von Vitu Levu. Es gab sogar eine Insel mit dem Namen Bounty-Island, weil Captain Bligh nach der berühmten Meuterei auf der Bounty auf seinem langen Weg nach Timor hier mit seinem Boot vorbeigerudert war.
Ich hatte mir vorgenommen, meinen Fidschi-Aufenthalt auf Viti Levu zu verbringen, war mir jetzt aber nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee gewesen war. Weil mich Nadi deprimierte, nahm ich den Bus nach Lautoka, der zweitgrößten Stadt Viti Levus. Die Landschaft zwischen Nadi und Lautoka war von bedrückender Kargheit. Abgegraste Wiesen, ausgedünnter Laubwald und kränkliche Palmen wohin das Auge blickte. In den Siedlungen am Straßenrand häuften sich die Abfälle, um die sich die Hunde balgten. Hier war schon lange keine Müllabfuhr mehr vorbeigekommen.
Lautoka war Fidschis Zuckerrohrhauptstadt, und entsprechend stark war der indische Bevölkerungsanteil. Zuckerrohr hatte im 19. Jahrhundert die indischen Vertragsarbeiter nach Fidschi gelockt, und nach dem Auslaufen ihrer Kontrakte waren sie im Land geblieben, hatten Familien gegründet, ihre Tempel und Moscheen gebaut, sich vermehrt und nach und nach die ökonomische Oberhand gewonnen.
Ich lief durch die Innenstadt, den Hafen und die Markthallen, trank reichlich Chai und beobachtete die Passanten. Die Inder hatten die Arbeit und das Geld, die Melanesier die gute Laune und die Zeit, was eine wunderbare Mischung gewesen wäre, hätte man sie nur zusammenbringen können. Aber das schien nicht zu funktionieren. Die Inder hielten die Melanesier für dumm und faul, die Melanesier sagten den Indern nach, sie seien hinterlistig und verlogen. Bei meinem Rundgang war allerdings von Aversionen nichts zu bemerken. An der Supermarkttheke bedienten mich nacheinander eine indische und eine melanesische Verkäuferin, die sich blendend verstanden.
Ich hatte mir schon gleich nach meiner Ankunft in Lautoka ein Zimmer in einem Budget Hotel am Hafen genommen, in dem ich mein Gepäck abgestellt hatte. Mit Budget Hotels habe ich zeitlebens gute Erfahrungen gemacht. In Asien traf man in solchen Häusern viele Alleinreisende, mit denen man sich austauschen konnte, und weil auch Einheimische diese preiswerten Unterkünfte frequentierten, erhielt man eine Injektion Lokalkolorit gratis dazu. Leider wurden die Zimmer im Lautoka Hotel auch stundenweise für genau definierte Zwecke vermietet, so dass auf den Fluren ein Kommen und Gehen war. Da die Durchgänge eng und die Gäste breit waren, kam es zu regelrechtem Geschiebe in den Treppenhäusern, das die ganze Nacht anhielt. Die Verrichtungen hinter den geschlossenen Türen liefen allerdings, soweit ich das beurteilen konnte, schnell und schnörkellos ab. Tür auf, Tür zu, Ruck zuck, und auf Wiedersehen.
Am nächsten Morgen checkte ich in aller Frühe aus und nahm ein Sammeltaxi zurück nach Nadi. Um zu verhindern, dass ich auf der Rückbank zwischen hünenhaften Melanesiern zerquetscht wurde, zahlte ich einen Aufpreis für einen freien Platz im Fahrerhaus, wo es neben der stattlichen Freundin des Fahrers aber auch recht eng wurde. In Nadi stieg ich in einen Bus, der mich zum Hide Away Ressort an die Südküste brachte. Dort buchte ich einen Bungalow direkt am Meer mit einer kleinen Terrasse und Strandzugang. Vielleicht war die Zeit des low budget travellings vorbei, und ich brauchte ab und an ein wenig Komfort, um die Seele im Lot zu halten. Erleichtert schmiss ich meinen Rucksack in die Ecke und nahm eine ausgiebige Dusche.
In den nächsten Tagen ließ ich es ruhig angehen, schlief lange, nahm drei Mahlzeiten am Tag und schwamm meine Runden im Pool. Wie immer auf Reisen dachte ich viel an zuhause und an die Sackgassen, in die ich mich verrannt hatte. Einer der Vorzüge des Reisens bestand darin, dass sich die Realität des eigenen Lebens in der Fremde viel transparenter darstellte als daheim. Ganz falsch aber war es, diese Transparenz den Daheimgebliebenen in langen Ergüssen zu vermitteln, weil nach der Rückkehr das Bild auch wieder ganz anders aussehen konnte. So schrieb ich nur einige Briefe und erklärte, warum es bis zu meiner Rückkehr noch etwas dauern würde.
Das Hide Away Ressort umfasste ein Hauptgebäude und etwa zwei Dutzend gut ausgestattete Bungalows. Die Chef-Rezeptionistin hieß Miss Billa und war eine hochnäsige Inderin mit einem aufdringlichen Patschuliparfum. Auch die Zimmermädchen waren Inderinnen, ebenso wie der Hotelmanager, der fast nie zu sehen war. Die einzigen Melanesier im Hide Away Ressort waren drei Angestellte der Security, die den ganzen Tag am Ressorteingang zusammensaßen und palaverten. Die Gäste kamen überwiegend aus Großbritannien Australien, Neuseeland und den USA. In der Mitte des Lebens angekommen, hatten sie sich und ihre Ehe mit einer sogenannten „Traumreise“ in die Südsee konfrontiert, ohne zu bedenken, welche Fallstricke eine solche Unternehmung bereithielt. Manche langweilten sich zu Tode, andere stritten den ganzen Tag oder sprachen kein Wort miteinander. Verriet ich ein Geheimnis, wenn ich sage, dass dergleichen Anblicke das Alleinreisen erleichterten?
Am den Nachmittagen spazierte ich gerne vom Ressort aus die benachbarte Küste entlang, auch wenn die Strände im Süden Viti Levus grobsandig und schattenlos waren. Bei Ebbe ragten schwarze, abgestorbene Korallenriffe aus dem Wasser. Immer wieder stieß ich auf Gruppen von Melanesiern, die im Gebüsch oder am Strand saßen, als wären sie Mitglieder einer fidischianischen Küstenwacht. Eine Frau durchsuchte den Wollkopf ihres Kindes nach Läusen, eine andere zerstampfte Hirse in einem Bottich.
Kava Zeremnie
Vorbereitung für das Fire Walking
Ein Mann kam des Weges mit einer Schubkarre voller Kartoffelpellen und Knollenreste, um die Schweine zu füttern. Grunzend protestierten die Schweine, als der Eigentümer zuerst das kleinste Schwein aus dem Verschlag holte und wie einen Prinzen mitten in die Schubkarre voller Nahrung stellte. Das kleine Vieh war aber durch die Trennung von seiner Muttersau völlig verängstigt und pinkelte vor Angst auf die Kartoffelschalen. Derweil versuchte eine hässliche schwarze Sau, der die Hunde bereits ein Ohr abgebissen hatten, das Gatter in rasender Gier zu durchbrechen. Amüsiert über mein Interesse waren einige mammutartige Melanesier neben mich getreten. Verstohlen musterte ich die riesigen Gestalten aus den Augenwinkeln. Der regelmäßige Genuss extrem kalorienreicher Nahrung wie Süßkartoffeln, Maniok. Taro und Yams hatte einen wahrhaft pompösen Menschenschlag geschaffen.
An diesem Abend schlug das Wetter um. Der Himmel über Viti Levu zog sich zu, und es begann zu regnen. Der Wind heulte, und die Brandung hörte sich an, als würden die Wellen im nächsten Augenblick durch die Fenster brechen. Nicht ohne Behagen machte ich es mir in meinem Bungalow bequem und las den Roman „Hurricane“ von Nordhoff und Hall, die Geschichte eines Unwetters auf einer Pazifikinsel, in deren Verlauf ein ganzes Dorf unter den Schlägen der Natur zusammenbricht
Am nächsten Morgen war der Sturm vorüber. Die Natur hielt den Atem an und gab keinen Mucks von sich. Unzufrieden saßen die Gäste vor ihren Unterkünften und blickten auf das spiegelblanke Meer. Ich frühstückte, lief zur Straße und nahm den öffentlichen Bus nach Suva. Dreimal am Tag bedienten Busse der staatlichen Transportgesellschaft die zweihundert Kilometer lange Strecke zwischen Nadi und Suva in beide Richtungen. Im Bus saßen eine Mutter mit zwei kleinen Mädchen, dazu mehrere ältere Melanesier und eine Gruppe Jugendlicher, die auf der Rückbank laut herumfeixten. Einer von ihnen glich einem Tapir mit einem spitz vorstehenden Gesicht und glatt rasierten Schläfen. Als es zu laut wurde, drehte sich einer der älteren Fahrgäste um und herrschte die Jugendlichen in scharfem Ton an. Merkwürdigerweise war dann Ruhe. Andere Länder, andere Sitten.
Suva, die Hauptstadt des Fidschi Archipels, lag auf einer Halbinsel im Südosten Viti Levus und zählte knapp 100.000 Einwohner. Das Straßenbild erinnerte an eine indische Kleinstadt, nur mit weniger Menschen. Schneidereien, Garküchen und Elektrogeschäfte mit indischen Firmennamen säumten die Cummings Road. Ich aß ein Tandori Chicken Masala, das genauso schmeckte wie in Madhya Pradesch, trank zwei stark gesüßte Chais und spazierte durch die Markthallen, in denen Taro, Yams, Maniok, Reis, Kartoffeln, Bananen, Orangen, Fleisch und Fisch auf langen Tischen lagen. Manche der verderblichen Angebote waren mit Eis gekühlt, an anderen hatten die Fliegen ihre Freude. Es roch scharf nach Gewürzen und Gehacktem, an einigen Marktständen wurde eine Art Corned Beef serviert, das reißenden Absatz fand.
Ich spazierte ein wenig die Queen Elisabeth Road entlang, die Küstenstraße von Suva, die die Stadt wie ein Gürtel umgab. Im Albert Park beobachtete ich Jugendliche beim Rugby Spiel, dem Nationalsport der Fidschianer, bei dem sie es zusammen mit den benachbarten Samoanern und Tonganesen zu uneinholbarer Meisterschaft gebracht hatten. Keine Rugby Weltmeisterschaft, bei der sie ihre Konkurrenten nicht grün und blau geschlagen hätten. Allenfalls die Maori-Mannschaften aus Neuseeland konnten ihnen Paroli bieten.
Hinter dem Albert Park erreichte ich das Fidschi Museum, die einzige kulturelle Sehenswürdigkeit von Belang auf den ganzen Fidschi Inseln. Es enthielt Tausende von Exponaten aus der altfidschianischen Geschichte, dazu Informationsmaterial in Englisch und eine kleine Leseecke, in der der Besucher recherchieren konnte. Beim Durchblättern einer Broschüre stieß ich auf ein Bild des französischen Entdeckers Dumont d´Urville, der 1827 die Fidschi Inseln besucht und kartografiert hatte. Auf ihn ging die Unterscheidung von Polynesiern und Melanesiern zurück, wobei er entdeckt hatte, dass die polynesischen Sprachen auf weit verstreuten Inseln eine enge Verwandtschaft aufwiesen, während die melanesischen Sprachen, obwohl in einem begrenzteren Raum beheimatet, untereinander viel unterschiedlicher waren. Neuere Forschungen hatten ergeben, dass Melanesier und Polynesier, trotz ihrem ähnlich imposanten Phänotyp genetisch nicht verwandt waren. Eine Besonderheit der Melanesier waren die bei ihnen gelegentlich vorkommenden blonden Haare, die sie mit den Papuas von Papua-Neuguinea in Verbindung brachten, obwohl diese wieder einen gänzlich anderen Körperbau besaßen. Wie alle Völker der ozeanischen Inselwelt waren die Melanesier aus Asien gekommen, hatten sich vom Osten des indonesischen Archipels über Papua-Neuguinea von Insel zu Insel ausgebreitet. Als erstes Volk der Menschheit hatten sie sich mit ihren Kanuten auf den offenen Ozean hinausgetraut, um schließlich spätestens im dritten Jahrtausend vor der Zeitrechnung Fidschi, das Ende der melanesischen Welt, zu erreichen. Zu den kostbarsten Exponaten des Fidschi Museums gehörte ein rekonstruiertes Doppelkanu als Modell jener Schiffe, mit denen diese Überseeexpeditionen unternommen worden waren. Seine Basis bestand aus zwei mehrere Meter auseinander liegenden Kanus, auf denen eine Plattform mit einer kleinen Unterkunft befestigt worden war. Auf solchen Gebilden waren einzelne Clans oder Familien mit Tieren und Saatgut tausende von Kilometern über das offene Meer gesegelt, wobei man davon ausgehen musste, dass die Mehrzahl dieser Erkundungsfahrten scheiterte. Der Westpazifik war das nasse Grab unzähliger Melanesier, die am Ende doch kein Land gefunden hatten und elend verhungert und verdurstet waren. Möglich, dass die Ursprünge des Kannibalismus in Ozeanien aus Verzweiflungstaten auf derart langen Reisen entstanden waren.
Doppelkanu mit Aufbau - Fidschi Museum/Suva
Aber auch nach der Landung der Melanesier auf Fidschi blieb der Kannibalismus ein fester Bestanteil der melanesischen Kultur, nicht unbedingt als regelmäßige Nahrungsgrundlage, aber als ein relativ oft angewandtes Überwältigungsritual, bei dem der Sieger über den Besiegten insofern triumphierte, als er ihn sich buchstäblich einverleibte und ihn nach der Verdauung als Exkrement ausschied. Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts war es den viel gescholtenen christlichen Missionaren gelungen, dem Kannibalismus auf Fidschi den Gar auszumachen, allerdings nicht ohne, dass der eine oder andere Missionar ihm noch selbst zum Opfer gefallen wäre. So wurde im Fidschi-Museum der tragische Fall des protestantischen Pfarrers Thomas Baker dokumentiert, der im Jahre 1867 auf Viti Levu ermordet und verspeist worden war. Nichts war von ihm geblieben, als seine alten Stiefel, die hinter Glas zu besichtigen waren. Sinnigerweise befand sich in einer Vitrine gleich nebenan das sogenannte „Kannibalenbesteck“. Dabei handelte es sich um hölzerne, gabelartige Instrumente, mit denen man sich das Menschenfleisch zum Munde führte, weil das Berühren mit der Hand tabu war.
„Kannibalenbesteck“ im Fidschi Museum/Suva
Die weiteren Räume des Fidschi Museums waren weniger spektakulär. Sie dokumentierten die Geschichte der Inseln nach ihrer „Entdeckung“ durch die Europäer. Diese Geschichte verlief auf Fidschi wie auch auf den anderen ozeanischen Inseln in sechs typischen Phasen, die man vereinfacht wie folgt beschreiben kann:
Der Entdeckung durch die Europäer folgte in einer ersten Phase die spontane
Ausbeutung
durch Seefahrer und Händler, im Falle Fidschis die wilde Abholzung der Sandelholzwälder.
Die zweite Phase war durch den Aufbau fester Stützpunkte gekennzeichnet, im Falle Fidschis und praktisch aller anderen Inseln handelte es sich dabei um den
Aufbau von christlichen Missionsstationen.
In der dritten Phase, wenn die unmittelbar zugänglichen Naturressourcen (z. B. Sandelholzwälder auf Fidschi, Kauri-Fichten auf Neuseeland) aufgebraucht waren, erfolgte der
Import inselfremder Nutzpflanzen
, z. B. Zuckerrohr auf Fidschi oder Ananas auf Oahu. Sie führte
zur
Einwanderung asiatischer Kontraktarbeiter
(z. B: Inder in Fidschi, Japaner auf Hawaii), die nach dem Auslaufen ihrer Verträge im Land blieben und die demografischen Verhältnisse revolutionierten.
Zur Sicherung eigener Investitionen und zur Abwehr indigener Widerstandsbewegungen wurde die Präsenz der Kolonialmächte auf den Inseln schrittweise verstärkt, bis es einer von ihnen gelang, die
Inseln zu annektieren
(z. B. Neuseeland 1840 und Fidschi 1872 durch Großbritannien, Tahiti und die Marquesas ab 1842 durch die Franzosen, Hawaii 1893/1900 durch die USA oder 1899 Westsamoa durch Deutschland). In der Endphase dieses „gesamtpazifischen Inselfledderns“ gerieten die imperialistischen Mächte mehrfach an den Rand eines Krieges. Einzig den Tonganesen gelang es, wenigstens eine nominelle Unabhängigkeit zu bewahren.
Nach dem zweiten Weltkrieg erhielten die pazifischen Inseln ihre politische Unabhängigkeit zurück (z. B. Fidschi 1970). Nur Frankreich behielt aus Gründen der nationalen Glorie seine Kolonien um den Preis einer endlosen und kostspieligen Subventionierung. Die Inkorporation Hawaiis als gleichberechtigtem Bundesstaat der USA bildete eine Ausnahme.
Wie segensreich die Entkolonialisierung des pazifischen Raumes gewesen war, gingen die Meinungen auseinander. Im Falle Fidschis war sie jedenfalls keine Erfolgsgeschichte. Als die indische Bevölkerungsmehrheit im Jahre 1987 die gesamtfidschianischen Wahlen gewann, putschte die melanesische Armee unter der Führung Generals Sitiveni Rabukas und errichtete eine Militärdiktatur, die die Diskriminierung der indischen Bevölkerungsmehrheit zum Verfassungsprinzip erhob. Parallel zu diesem Staatstreich kam es zu schweren Ausschreitungen gegen die Inder, die daraufhin zu Zehntausenden das Land verließen. Im Kleinen wiederholte sich also auf Fidschi, was sich im Großen vorher in Ostafrika abgespielt hatte: die militärische Elite der indigenen Bevölkerung deklassierte die produktive indische Bevölkerung und fügte damit dem Land schweren wirtschaftlichen Schaden zu. Die Jahrzehnte nach dem Rabuka-Putsch waren dementsprechend ein einziges Durcheinander von Staatsstreichen, Pogromen, Enteignungsgesetzen und zeitweiliger Rückkehr zu pseudoparlamentarischen Verhältnissen. Gegenwärtig waren die offiziellen Diskriminierungen der indischen Bevölkerung wieder einmal abgeschafft worden, aber wer konnte wissen, wann der nächste Putsch ins Haus stand? Der Urheber dieser unheilvollen Entwicklung wurde übrigens niemals zur Rechenschaft gezogen. Mr. Rabuka verbrachte seinen Lebensabend im Rang eines hochgeehrten Stammeshäuptlings irgendwo auf einer fidschianischen Insel.
Es war schon dunkel, als ich in das Hide Away Ressort zurückkehrte. Ich kam gerade noch rechtzeitig zum Abendbuffet und einer Kulturshow, für die schon seit Tagen geworben worden war. Drei kräftige Männer, in denen ich die Security Leute vom Eingangstor wieder erkannte, betraten in Baströckchen und mit Wurzelwerkschmuck an den Oberarmen den Saal, um eine Kava-Zeremonie zu präsentieren.
Die Kava Zeremonie war ein traditionelles Ritual, bei dem Fremde gemeinsam ein Wurzelknollengetränk zu sich nahmen, um ihre friedlichen Absichten zu demonstrieren. Händeklatschen und gutturales Grollen begleiteten das rituelle Zerstampfen der Wurzelknollen. Dann betraten zwei vorher ausgewählte Touristen die Bühne, um in der Rolle der „Ehrengäste“ den Kava Trunk einzunehmen. Gottseidank waren sie sorgfältig gebrieft worden, so dass sie an genau den richtigen Stellen klatschten und nur sehr verhalten am Kava-Becher nippten. In diesem Rhythmus von Klatschen und Nippen ging der Kava-Becher so lange reihum, bis er leer war. Dann erhob sich einer der drei Melanesier und begleitete die "Ehrengäste" unter dem Beifall der Abendgesellschaft zu ihren Tischen. Die meisten Gäste nickten sich gegenseitig anerkennend zu, als hätten sie etwas Großartiges erlebt. Ich versuchte mir die Szene kulturverkehrt vorzustellen. Was wäre, wenn drei Melanesier nach Europa reisten und nach ihrem Abendessen in einer neapolitanischen Trattoria mit ansehen müssten, wie verkleidete Kellner der Trattoria eine szenische Darstellung des Abendmals auf das Parkett legten?
Am letzten Tag meines Aufenthaltes auf Fidschi besuchte ich das „Kalevu Cultural Center“ in der Nähe von Sigatoka. Glanzstück dieses fidschianischen Kulturzentrums war ein originalgetreu rekonstruiertes traditionelles Fidschi-Dorf mit Hütten, Versammlungsplatz, Feuerstelle und Vorratsspeichern am Ufer eines künstlichen Sees. Wer wollte, konnte für eine Extragebühr ein Floß besteigen und sich über diesen See zu einer kleinen Insel rudern lassen, um eine Menschenfressergemeinde zu besuchen. Die Regie war immer die gleiche: wenn sich das Floß der Insel näherte, sprangen urplötzlich habnackte Melanesier mit Keule und Speer brüllend aus dem Unterholz. Einige Sekunden lang gebärdeten sie sich wie Berserker und drehten sich immerfort um die eigene Achse, um den Touristen ein möglichst dramatisches Fidschi-Menschenfresser-Foto zu ermöglichen. Ich saß am Ufer des Sees und beobachtete drei Anlandungen von Flößen und drei choreografisch identische Auftritte der Kannibalenbrigade. Da sage noch einer, der Melanesier sei kein Leistungsträger.
Aber das war alles nur Vorspiel für den eigentlichen Programmhöhepunkt. Nachdem wir eine gesonderte Eintrittskarte gelöst hatten, wurden wir zu einem Freilufttheater mit Holzbänken geführt, von dem aus wir eine Fire Walking Zeremonie im Fidschi Dorf beobachten konnten. An der Feuerstelle des Dorfes machte sich ein halbes Dutzend Männer an einem mächtigen Holzscheit zu schaffen, der schon seit Stunden vor sich hin glomm. Ein Priester erschien und beaufsichtigte die rituelle Zubereitung des heiligen Feuers. Zuerst wurde mit grotesk großen Griffhölzern der brennende Scheit über den Steinen entfernt, dann wurden die heißen Steine „durchmischt“, wie ein Kommentator erläuterte, in Wahrheit aber umgedreht. Schließlich sorgte das sogenannte „Auspeitschen der Steine“ mit Farnwedeln für die Beseitigung aller Aschenreste. Diesem Belag, der weder glühte, noch zischte oder im strömenden Regen auch nur ein wenig dampfte, näherten sich nun die eigentlichen „Feuergeher“. Sie hatten sich, wie der Kommentator versicherte, in den letzten Wochen von jedweder Kokosnuss oder Frau ferngehalten und auf diese Weise genügend mentale Energie gespeichert, um diesen Härtetest ohne bleibende Schäden zu überstehen. Immerhin warfen sie während ihres Fire Walkings die Arme in die Luft, starrten inbrünstig in den Himmel, als käme nicht schon genügend Kühlung von oben und zuckten solange mit den Schultern, bis auch dem letzten klar wurde, dass sie sich im Trancezustand befanden.
In der Hinterwelt
Phlegma auf Tongatapu
Volle drei Stunden brauchte die Propellermaschine der Fidschi Airlines für die tausend Kilometer zwischen Viti Levu und Tonga. Einen Bordservice gab es nicht, dafür war es bitter kalt. Manchmal ruckelte das Flugzeug, trudelte ein wenig und stabilisierte sich wieder. Mein Sitznachbar Bill schloss dann die Augen, als riefe er den Höchsten um Errettung an und öffnete sie erst wieder, wenn die Turbulenzen vorüber waren.
Bill war Mormone und befand sich auf dem Weg nach Amerikanisch-Samoa, wo er in einer Missionsstation arbeitete. Er hatte ein glattes, freundliches Gesicht und trug ein blütenweißes Oberhemd zu einer messerscharf gebügelten Stoffhose. Ob ich denn schon wüsste, dass die Polynesier aus Amerika gekommen seien? fragte er.
„Nein“, antwortete ich, „das ist mir neu. Ich dachte immer, die Polynesier wären aus Taiwan oder Südchina gekommen und hätten den Pazifik von Westen nach Osten besiedelt.“
„Völlig falsch“, gab Bill zurück. „Die heutigen Polynesier sind die Nachfahren Hagoths, eines nephitischen Seefahrers, der vor zweitausend Jahren von Amerika aus mit großen Schiffen und tausenden Begleitern in See gestochen war. Er und seine Gefolgsleute haben die Inseln besiedelt, die wir heute Polynesien nennen.“
„Gibt es denn dafür Beweise?“ fragte ich.
„Ja“, nickte Bill. „Eindeutige Aussagen im Buch Mormon.“
Eine Durchsage kündigte die bevorstehende Landung in Tongatapu an. Ich blickte aus dem Fenster und sah weit verstreute, winzige Inseln tief unter uns. 177 von ihnen bildeten das tongaische Archipel, dass Zigtausende qkm Meeresfläche umfasste, aber alle Inseln zusammengerechnet nur auf 745 qkm Landfläche kam. Tongatapu war Tongas größte Insel. Auf ihr lag die Hauptstadt Nuku´alofa, eine der kleinsten Hauptstädte der Welt.
Merkwürdigerweise war ich der einzige Fluggast, der auf dem Flughafen von Nuku´alofa ausstieg. „Gottes Segen sei mit Ihnen“, rief mir Bill hinterher. Zu Fuß lief ich zum flachen Abfertigungsgebäude und wartete eine halbe Stunde auf mein Gepäck, obwohl es doch das einzige war, das ausgeladen wurde. Bei der Zollkontrolle musste ich den Rucksack öffnen und sah die gewaltigen Pranken des Zollbeamten in meiner Wäsche wühlen. Lange betrachtete der Beamte mein Passfoto. Hätte ich eine Tätowierung auf der Stirn gehabt, wäre es für ihn einfacher gewesen. Am Wechselschalter erhielt ich ein Bündel abgegriffener Pa´anga Banknoten und verließ das Flughafengebäude.
Sofort fielen mir die Unterschiede zu Fidschi auf. Die Landschaft war flacher und üppiger begrünt, die Passanten hellhäutig und womöglich noch eine Spur dicker, und es gab keine Asiaten in nennenswerter Zahl. Viele Personen, die mir entgegenkamen, liefen mit Bastmattenteppichen um die Hüfte herum. Es sah so aus, als hätten sich die Leute bis zur Hüfte in einen Teppich einwickeln wollen, der sich als zu schmal erwiesen hatte, so das der Oberkörper und die Füße herausschauten.
Mit dem Bus fuhr ich in den Süden der Insel zum „Good Samatarian Inn“. Die Straßen waren in Teilen unaspahltiert und holprig, dafür von Palmen gesäumt. In den kleinen Dörfern saßen die Mütter vor ihren Hütten und schrubbten entweder die Wäsche oder ihren Nachwuchs. Kinder rannten barfuß zwischen den Häusern herum und trieben einen Fahrradreifen mit Stöcken vor sich her.
Das Good Samatarian Inn war ein einfaches Hotel, das aus einem Haupthaus und einigen Hütten am Meer bestand. Die Hütten waren klein und dunkel und besaßen ein Bett, einen Stuhl und einen Tisch. An den Wänden und unter dem Bett krochen Geckos und Käfer herum. Dafür hörte ich das Rauschen des Meeres in der Nacht, auch wenn der Strand hinter meiner Hütte grausandig und unansehnlich war. Auf meinen ersten Traumstrand würde ich wohl noch etwas warten müssen.
Viel los war nicht im Good Samatarian Inn. Nur zu den Mahlzeiten versammelte sich etwa ein Dutzend Gäste im Speisesaal. Die Köchin war Joane, eine Polynesierin, die gelegentlich besorgt aus der Küche in den Speisesaal blickte, als sei sie unsicher, ob den Gästen ihr Essen schmeckte. Kellner waren ihre beiden Söhne Jake und John, die die Teller so langsam aus der Küche trugen, dass keine Gefahr bestand, dass die Soße überschwappte.
Am nächsten Morgen lernte ich meine beiden britischen Hüttennachbarn kennen. Henry, der Schlankere, saß den ganzen Tag auf einem Stuhl neben der geöffneten Türe seiner Hütte und versuchte jeden, der vorüberging, in ein Gespräch zu verwickeln. Fred, seinen Begleiter, bekam ich selten zu Gesicht, weil er fast nur schlief und nur ein- oder zweimal am Tag zur Toilette schlurfte. Wie mir Henry erzählte, waren sie auf Tonga gestrandet, weil ihnen das Geld ausgegangen war. Seit über einer Woche warteten sie nun schon auf den rettenden Geldtransfer aus der Heimat. Die Wirtin hatte ihnen Kredit bis zur nächsten Woche gegeben. Wenn das Geld dann nicht da wäre, würden sie ausziehen müssen.
Die Insel Tongatapu war kaum größer als das Stadtgebiet von Köln, so dass es kein Problem war, mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Tag jeden Platz der Insel zu erreichen. Die Busse fuhren fast im Schritttempo, und Haltestelle war immer da, wo jemand stand und die Hand hob. Außerdem war der Verkehr nicht der Rede wert. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, jemals irgendwo so wenig Automobile gesehen zu haben.
Nach einer gemächlichen Umrundung des Inselostens stieg ich im Dorf Niutoua aus und spazierte zum Trilithon von Ha´amonga. Dabei handelte es sich um ein fünf Meter hohes wuchtiges Megalithtor, das aus drei zwanzig Tonnen schweren Korallenblöcken bestand. Historiker vermuteten, dass der Trilith im 13. Jahrhundert entweder als Teil eines inzwischen verschwundenen Palastes oder als eine Art steinerner Kalender errichtet worden war.