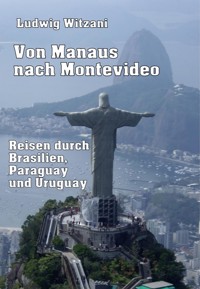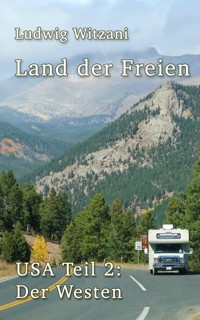Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Mit Bussen und Marushkis, Eisenbahnen und Automobilen ist Ludwig Witzani durch den sogenannten "wilden Osten" Europas gereist, hat den Donaudurchbruch und die Walachei durchwandert und die Burg des Grafen Dracula besucht. Er erkundete Siebenbürgen, die "Perle der Karpaten", und lief durch die Gänge des Kiewer Höhlenklosters. An der bulgarischen Schwarzmeerküste erhielt er eine "Lektion in Massentourismus", und im verregneten Czernowitz kämpfte er gegen die Melancholie. Von Belgrad über Sofia und die Schwarzmeerküste führt das vorli-gende Reisebuch durch ganz Rumänien, zur Krim, nach Kiew, der "Mutter aller russischen Städte" und zum Abschluss über Galizien nach Moldawien, den "unbekanntesten Staat Europas". Ein Blick auf ein anderes, "wilderes" Europa, das das eigene Selbstverständnis modifiziert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Witzani
Europas wilder Osten
Reisen durch Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine
(Weltreisen Band XII)
Impressum
Europas wilder Osten
Ludwig Witzani
published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Copyright: © 2020 Europas wilder Osten Lektorat: Michael Hoppe, Köln Konvertierung: sabine abels, Hamburg
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Europas wilder Osten
Vorspiel: Große Männer in kleinen Autos
Serbische Ouvertüre
BULGARIEN
Die Pistole im Handschuhfach
Sofia als urbane Collage
Mit den Massen am Meer
Die bulgarische Schwarzmeerküste
Von einer Fremdherrschaft in die nächste
Späte Blüten in Veliko Tarnovo und Russe
RUMÄNIEN
Die Stadt, in der die Revolution ausbrach
In Temeswar, der Hauptstadt des Banat
Der wahre Dracula
Mit Vollgas durch die Walachei
Vom Nebeneinander des Ungleichzeitigen
Bukarest nach Ceausescu
Zankapfel der Völker
Siebenbürgen zwischen Kronstadt und Klausenburg
Der rumänische Gulag
Sigheti Marmației im Maramureșgebirge
Die Bilderbücher Moldawiens
Ein Abstecher zu den Moldauklöstern
Wo Europa zu Ende ist
Constanța und das Donaudelta
Zwischenspiel: Die Reise nach Odessa
UKRAINE
Die berühmteste Treppe der Welt
Ein Tag in Odessa
Russlands Traum vom südlichen Meer
Jalta zwischen Pracht und Verfall
Wladimir und die Schwarzmeerflotte
Geschichtliche Streifzüge durch Sewastopol
Der Tränenbrunnen von Bakhchisaray
Ein Ausflug zu den Krimtataren
Weltstadt am Dnjepr
Kiew im Schnittpunkt der Zeiten
Exkurs 1: Die Nestorchronik
Exkurs 2: Die orangene Revolution und der Euromaidan
Exkurs 3: Der Holodomor
Die Perle Galiziens
Spaziergänge durch Lemberg
Unterwegs mit dem Marushki
Auf der Suche nach Galizien
Exkurs 4: Die Mitte Europas
Welthaupstadt der Melancholie
Czernowitz im Daueregen
MOLDAWIEN
Pingpongball der Geschichte
Die moldawische Hauptstadt Chișinău
Der höchste Lenin der Welt
Sowjetkult in Transnistrien
Nachspiel: Was bleibt?Ein Rückblick
Anhang
Reisehinweise
Ausgewählte Literatur
Fotonachweis
Über den Autor
für Andreas Fuhrmann,den Freundund Reisebegleiter
EINLEITUNG
Europas wilder Osten
„Was ist Osteuropa?“ fragen viele und wissen es nicht.
Ich weiß es auch nicht, glaube aber daran, dass es mindestens zwei Osteuropas gibt. Ein Osteuropa, das kein Osteuropa sein will, und eines, das in diesem Buch als der „wilde Osten“ beschrieben wird. Das bedarf natürlich einer Begründung.
Zum europäischen Osten, der gar kein Osten sein will, gehören Polen, das Baltikum, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Diese Länder beanspruchen, was Lage und kulturelle Traditionen betrifft, zur geografischen und zivilisatorischen „Mitte“ Europas zu gehören.
Ganz anders verhält es sich mit dem so genannten „wilden Osten“. Dazu gehören nicht nur Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine, die in diesem Reisebuch beschrieben werden, sondern auch Serbien, Bosnien, Albanien, Mazedonien und Montenegro. Russland und Weißrussland sind noch einmal eine ganz andere Hausnummer.
Was aber soll an diesem Osten „wild“ sein? Als der Herzog von Richelieu im Jahre 1774 die Bukowina bereiste, notierte er pikiert, „dass hier Europa zu Ende“ sei, weil Sitten und Gebräuche viel mehr Ähnlichkeit mit dem Orient hätten als mit Europa.
Ist das gemeint? Ist der „wilde Osten“ ein zurückgebliebener Teil Europas, in dem das Ungezügelte und Ungeformte alter Zeiten so stark nachwirken, dass sie den Durchbruch der Moderne behindern?
Dreimal nein. Der wilde Osten kann zwar auf eine durchaus „wilde“ Geschichte zurückblicken, in der serbische Haiducken, montenegrinische Tschetniks, rumänische Vlachen oder ukrainischen Kosaken ihren turbulenten Auftritt hatten, aber er besitzt auch jahrhundertealte religiöse und kulturelle Traditionen, die der Kommunismus nur verschüttet, aber nicht beseitigt hat.
„Wild“ ist der Osten vielmehr aus zwei anderen Gründen. Erstens, weil er sich in einem nicht vollständig steuerbaren Prozess der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Transformation befindet, den man aus einer gewissen Perspektive durchaus als „wild“ bezeichnen könnte. Um die Erfahrungen dieses Umbruchs wird niemand die Menschen dieser Region beneiden. Die radikale Eingliederung in die globalisierte Arbeitsteilung hat die einheimischen Industrien weitgehend zerschlagen, ohne dass genügend Geld ins Land gekommen wäre, um zukunftsträchtige Wachstumsbranchen aufzubauen. In den ersten zehn Jahren nach der revolutionären Wende von 1989ff. sind die Einkommen der Serben, Bulgaren, Rumänen, Ukrainer und Moldawier um durchschnittlich ein Drittel abgestürzt, stellenweise sogar noch mehr. Aus dieser Massenverarmung, die die Freiheit mit sich brachte, rappeln sich die Länder Südosteuropas inzwischen wieder auf, gestützt durch einen viel stabileren religiösen Halt, als er im Westen existiert, immer wieder aber auch gehandicapt von ethnischen Konflikten, politischer Korruption und Wirtschaftskrisen.
Umso erstaunlicher ist das, was es dreißig Jahre nach dem Untergang des Kommunismus schon wieder zu sehen gibt. Bukarest und Sofia, selbst Czernowitz und vor allem Kiew und Lemberg sind aus ihrem kommunistischen Kälteschlaf und der marktwirtschaftlichen Schocktherapie erwacht. Wer durch die Straßen dieser Metropolen geht, spürt einen Geist des Aufbruchs, der auch Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei nach der Wende prägte und diese Länder inzwischen aus dem Gröbsten herausgeführt hat. Möglich, dass viele der älteren Menschen, denen der Kommunismus das Leben zerstörte, inzwischen zu alt geworden sind, um mit der neuen Freiheit noch etwas anfangen zu können. Aber die jungen und die mittleren Jahrgänge scheinen ihre Chance zu ergreifen und ernsthaft zu versuchen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. „Wild“ in diesem Sinne möchte ich die Entschlossenheit vieler Menschen nennen, aus der Unterentwicklung herauszukommen und zum Wohlstand des Westens aufzuschließen. Das ist in dieser Allgemeinheit natürlich sehr großes Karo, hunderttausendfach individuell gebrochen und variiert, aber die Richtung dürfte stimmen.
Vor gut zehn Jahren bin ich durch den Osten, der kein Osten mehr sein will, gereist und habe versucht zu verstehen, was in Polen und in den baltischen Staaten vor sich ging. („Die kleine Posaune der Freiheit“, Weltreisen Band IV). Jetzt war ich in Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und der Ukraine unterwegs und habe mich in diesen Ländern umgeschaut. Mein Antrieb war die Neugierde, mein Spielfeld der Raum und die Geschichte, und der Ertrag war nicht anders als der Ertrag aller Reisen: die Hoffnung auf eine vertieftes Verständnis der Welt und die Bereicherung, die die Begegnung mit der Fremde mit sich bringt. Es muss nicht besonders erwähnt werden, dass die Urteile und Blickwinkel, die in diesem Buch zur Sprache kommen, so subjektiv sind wie Reiseerfahrungen oder Leseeindrücke nur sein können. Vieles von dem, was ich erwartete, habe ich auch so angetroffen. Aber noch viel mehr war auch ganz anders. Davon erzählt dieses Buch.
Erbeutetes Kriegsgerät in der Zitadelle von Belgrad
VORSPIEL:Große Männer in kleinen Autos
Serbische Ouvertüre
Der Zug fuhr durch weiteres, ebenes Land. Wir passierten, Weinfelder, Sickergruben und kleine Dörfer, in denen die Kirchtürme wie widerspenstige Wächter das Land überragten. Auf den Bahnsteigen roch es nach Kohl. Die Frauen wirkten resolut, und die Grenzbeamten marschierten durch den Zug wie eine Schwadron Texas Rangers. Sie waren kurzgeschoren, völlig ohrenfrei, und freundlich, als wunderten sie sich darüber, dass Mitteleuropäer ihr umstrittenes Land besuchten.
Viele Touristen waren es nicht, die in diesem Zug von Budapest nach Belgrad reisten, denn seien wir ehrlich: Serbien besitzt keinen besonders guten Ruf in Europa. Nicht wenige betrachten die Serben auf dem Balkan als das, was die Deutschen lange Zeit in Europa waren: als die Spitzbuben der Völkergemeinschaft, die immer nur Kriege anzetteln und ihre Nachbarn nicht in Ruhe lassen wollen. Die Balkankriege und der Kosovokonflikt hatten die Serben einmal mehr an den Schandpfahl der Welt genagelt, was mir ungerecht vorkam, weil jeder, der sich auch nur ein wenig mit den Einzelheiten dieser Konflikte beschäftigte, entdecken musste, dass Gut und Böse bei weitem nicht so säuberlich getrennt waren, wie es die öffentliche Meinung vorgab.
Nach dem Grenzübertritt durchquerte der Zug die Wojwodina, einen flachen und extrem fruchtbaren Teil der pannonischen Tiefebene. Raps, Sonnenblumen, Getreide- und Gemüsefelder, soweit das Auge reichte. Im jugoslawischen Vielvölkerstaat war die Wojwodina eine autonome Region Serbiens mit einem hohen ungarischen und kroatischen Bevölkerungsanteil gewesen. Die deutsche Bevölkerung, die als Donauschwaben zum Teil jahrhundertelang in diesem Gebiet ansässig gewesen war, hatte man schon nach dem Zweiten Weltkrieg entrechtet, ermordet oder vertrieben. Auch ein blutiges Kapitel der Weltgeschichte, über das niemand mehr spricht.
Bei Novi Sad wurden Berge sichtbar. Langsam durchfuhr der Zug die zweitgrößte Stadt Serbiens. Unbefestigte, halb überwachsene Uferpfade, Eckensteher, schrottreife Autos vor der Ampel. Nichts deutete heute noch darauf hin, dass in der Gegend von Novi Sad, die Geschichte des Balkans „gekippt“ war. Die österreichischen Truppen unter der Führung von Prinz Eugen hatten 1697 die Türken in der Schlacht von Zenta vernichtend geschlagen und die Donaufestung von Peterwardein gegründet, aus der später die Stadt Neusatz (serbisch Novi Sad) entstehen sollte. Als die Türken fast zwanzig Jahre später noch einmal an der Donau erschienen, wurden sie 1716 in der Schlacht von Peterwardein wieder besiegt. Ihre Zeit war abgelaufen, die türkische Dünung, die fast ein halbes Jahrtausend die christlichen Völker des Balkans überspült hatte, war rückläufig.
Bald lag Novi Sad hinter uns, und der Zug nahm Kurs auf Belgrad. In gemächlicher Geschwindigkeit schlängelte er sich durch eine verbuschte Landschaft mit winzigen Weilern neben Tümpeln und Teichen. Im Regen erreichten wir schließlich die serbische Hauptstadt Belgrad, zuerst die Trabantenstädte von Novi Beograd, dann die Innenstadt.
Es ist immer ein spannender Moment, zum ersten Mal den Bahnhof einer fremden Stadt zu betreten. Es ist wie der erste Händedruck mit einem fremden Menschen, der einen dauerhaften Eindruck hinterlässt. Auf dem Bahnhof von Belgrad spürte ich nichts. Die große Halle lag in Dämmerlicht, vor winzigen Schaltern standen die Leute nach Fahrkarten an. Ohne Probleme gelang es mir, ein Schlafwagenticket für die Weitereise nach Sofia zu reservieren. Dann mietete ich mich ins „Hotel Beograd“ ein, einem alten, abgewohnten sozialistischen Bums, vollkommen überteuert, aber immerhin mit funktionierenden Duschen ausgestattet.
Auf meinen Studentenreisen nach Griechenland war ich auf dem sogenannten „Auto-Put“ immer nur mit dem Bleifuß auf dem Gaspedal an Belgrad vorbeigerauscht. Graue Betonklötze oberhalb der Unterführungen war das einzige gewesen, was ich von Belgrad gesehen hatte. Was mochte diese Stadt zu bieten haben, hatte ich oft gedacht. Diesmal sah ich es, und was ich sah, war wenig erbaulich. In der Umgebung des Bahnhofs standen zweifelhafte Gestalten neben heruntergekommenen Hotels mit unverschämten Preisen. Männer und Frauen besaßen die harten Gesichter von Menschen, die ihr Leben lang gezwungen gewesen waren, unter dem Diktat der Knappheit ihre Ellenbogen einzusetzen. Kein Wunder, dass die Übervorteilung regierte, wohin ich auch kam, im Hotel, beim Getränkeeinkauf, beim Essen, im Taxi und selbst beim Ticketverkauf im Bus, als sei das das Gesetz, das die Menschen weiter brächte.
Als ich am Morgen in meinem kargen Hotelzimmer erwachte und den trüben Himmel über der Stadt erblickte, war alles hässlich: die Betten, die Aussicht, die Tapeten, und selbst der Becher im Bad kam mir verdächtig vor. Wer hatte aus diesem Becherlein vor mir getrunken? Das Wasser unter der Dusche roch penetrant nach Chlor. Nachdem ich mir die Haare gewaschen hatte, saß die Frisur wie ein Helm auf meinem Kopf. Noch nicht einmal den Morgenkaffee konnte ich kochen, weil der Stromanschluss defekt war. Ohne Kaffee am Morgen war ich aber nichts wert, und so nahm die klassische Reiseeröffnungsdepression ihren Lauf. Sie überfällt mich manchmal in der ersten Reisewoche, lässt aber nach einigen Schnäpsen schnell nach.
Beim Frühstück saßen lauter angesäuselte Kerle vor ihrem Schnaps und ihren Würsten. Ich notierte: Die Serben sind ein fleischfressendes Volk und beginnen ihren Verzehr schon am frühen Morgen. Auf der anderen Seite trinken sie gerne einen Slivovitz zu früher Stunde, und das kam mir in meiner derzeitigen Verfassung gerade recht.
Als ich das Hotel verließ, lag ein bleigrauer Himmel über der Stadt. Das einzig Bunte, was es auf der Bahnhofsstraße zu sehen gab waren grelle Pornoplakate, auf denen es dicke serbische Männer und Frauen miteinander trieben. Ich blieb sehen, um zu sehen, wer vor den Pornoplakaten stehenblieb. Niemand. Es schien den Passanten peinlich zu sein.
Fast schon den Rang einer Sehenswürdigkeit besaß das durch die NATO Angriffe zerstörte Gebäude des Verteidigungsministeriums. Treppenhäuser hingen inmitten aufgerissener Fassaden in schwindelnder Höhe halb im Freien, während unter ihnen der Verkehr weiterbrauste.
Einen Anblick besondere Art bot die Sveti Sava, eine orthodoxe Kirche von solchen Ausmaßen, dass sie von fast jedem Punkt der Stadt aus zu sehen war. Das ganze eben erwähnte Verteidigungsministerium hätte spielend unter die Kuppel der Kirche gepasst. An der Spitze eines circa 30 Meter hohen Krans turnten Arbeiter vor irgendeinem Fries herum. Als ich eine Passantin vor der Kirche nach dem Namen des Gotteshauses fragte, wusste sie ihn nicht.
Fünf Minuten von der Sveti Sava Kirche entfernt, befand sich in der Mitte eines Parks und durch kein Hinweisschild erschlossen, das Grab von Josef Brosz, genannt Tito, dem im Westen hochverehrten Nationalkommunisten und jugoslawischen Staatsgründer, nach dem gleichwohl heute kein Hahn mehr kräht. Dabei hatte er für einen kurzen geschichtlichen Moment den Traum der Südslawen vom einheitlichen Staat erfüllt. Allerdings hatte es schon kurz nach seinem Tod ein blutiges Erwachen aus diesem Traum gegeben, und ein gnädiges Geschick hatte es Tito erspart, das Auseinanderbrechen Jugoslawiens miterleben zu müssen. Seine sterblichen Überreste befanden sich in einem weißen Marmorsarg unter einem Baldachin. Eine Gruppe von Veteranen, einer wackliger als der andere, stand salutierend vor dem Sarg, als ich den Grabbezirk betrat.
Nach dem Besuch des Tito-Grabes fuhr ich mit dem Bus in die Innenstadt, die aussah wie die Innenstadt von Castrop-Rauxel, womit ich nichts gegen Castrop-Rauxel gesagt haben möchte. In den Fußgängerzonen dominierte der Kolchosflair sozialistischer Zeiten, bevölkert von Passanten, die mit verschlossenen Gesichtern aneinander vorbeirannten. Die Frauen, denen ich in der Innenstadt begegnete machten einen erschöpften Eindruck. So schwer die Geschicke der Völker auch sein möchten, am härtesten traf es immer die Frauen. Die Männer sahen gesünder aus, geradezu stattlich. Kriegergesichter, breiter Gang, eine Variante europäischer Maskulinität, mit der möglicherweise nicht gut Kirschen essen war. Umso merkwürdiger, dass sie fast alle in winzigen Autos durch die Gegend fuhren - mit Gesichtern, die auszudrücken schienen: „Warte nur ab, bald fahre ich mit einer großen Limousine durch die Stadt.“
Da ich schon einmal da war, besuchte ich die Belgrader Festung, einen seit uralten Zeiten umkämpften Platz am Zusammenfluss von Sava und Donau, über den sich zu diesem Zeitpunkt ein Balkangewitter zusammenzog. So sah ich diesen Ort, um den Germanen, Römer, Hunnen, Ungarn, Serben, Türken und Habsburger gekämpft hatten, vor der Kulisse einer anbrandenden schwarzen Wolkenfront.
Vor dem bald einsetzenden Regenguss floh ich in das militärgeschichtliche Museum, das in der Zitadelle der Festung untergebracht war. In dieser sehenswerten Ausstellung wurde die stürmische Geschichte Serbiens von der Einwanderung bis in die Gegenwart darstellt. Folgte man dem Tenor der Museumsdidaktik, dann hatte das kleine, aber heldenhafte Volk der Serben im letzten Jahrtausend nur ganz wenig zu lachen gehabt. Nach der der kurzen Glanzzeit eines sogenannten „serbischen Großreiches“ im späten Mittelalter begann mit der Schlacht auf dem Amselfeld im Jahre 1389 die lange Nacht der türkischen Fremdherrschaft. Die Blüte des serbischen Adels, die am 28.6.1389 auf dem Amselfeld im heutigen Kosovo gegen die osmanische Übermacht angetreten war, wurde vernichtet, für die Serben eine nationale Katastrophe, die bis auf den heutigen Tag nichts von ihrer Eindringlichkeit verloren hat. In der Folgezeit wurden die Serben aus dem heutigen Kosovo und der Region rund um den Ohridsee nach Norden vertrieben, das heißt, sie verloren ihre angestammte Heimat und mussten mitansehen, wie sich in ihr moslemische Albaner und Türken ausbreiteten. Die Verbissenheit und Härte, mit der die Serben im Kosovokonflikt ihre Restpräsenz in dieser Region verteidigten, muss vor diesem Hintergrund verstanden werden. Kein Wunder, dass sich die Serben als ein „einsames“ Volk begreifen, das von Europa immer wieder im Stich gelassen wurde. Wieso zum Beispiel fand der Aufstand der Serben gegen den Sultan im Jahre 1815 nicht die Unterstützung der mächtigen christlichen Monarchen, die sich zur gleichen Zeit in Wien zum Kongress versammelt hatten? Weil nach den Prinzipien von „Gottesgnadentum“ und „Legitimität“ auch den christlichen Untertanen eines muslimischen Sultans der Aufstand verboten war. So sprach Metternich, und die Folge war, dass Serbien 1815 nur eine partielle Autonomie errang und bis 1878 im osmanischen Reichsverband verbleiben musste. Erst als die Griechen sich 1821 erhoben, zerbrach die religionsübergreifende Legitimitätstheorie der reaktionären europäischen Monarchien. Die verhängnisvolle Rolle, die der chauvinistische serbische Staat bei der Entfesselung des Ersten Weltkrieges gespielt hatte, wurde in dem Museum leider nicht beleuchtet.
So lief ich in dem Museum durch die Jahrhunderte, während draußen der Donner krachte. Am Ende des Rundgangs, am Rande der Gegenwart angekommen, erwartete mich eine große, bunte Karte aus dem Jahre 1999. Sie zeigte die Luftangriffe der NATO, die das Regime des serbischen Präsidenten Milošević zum Rückzug aus dem Kosovo gezwungen hatte. Nun kamen also die Schläge nicht mehr aus dem Süden, sondern aus dem Westen. Derweil verrottete im Hof der Zitadelle das von der NATO erbeutete Kriegsgerät im Regen.
In Sweti Marko, der zweitgrößten Kirche Belgrads, befinden sich zwei Gräber, die die ganze Spannweite der serbischen Geschichte repräsentieren: das Grab von Stefan Dusan und das Grab von Aleksandar Obrenović. In der Regierungszeit Stefan Dusans (1331-1355) erblicken die Serben bis heute das Goldene Zeitalter ihrer Geschichte. Stefan Dusan besiegte die Türken, Bulgaren und Byzantiner, eroberte Mazedonien, große Teile Albaniens, Nordgriechenlands, Bosniens und das damals noch unbedeutende Belgrad. Von seinen Hauptstädten Skopje (heute Mazedonien) und Pizen (heute Kosovo) aus regierte er als mächtigster Herrscher Südosteuropas ein weit ausgedehntes Balkanreich, verkündete eine der ersten Gesetzessammlungen Europas und ließ sich schließlich von einer neu gegründeten serbischen Nationalkirche zum serbischen Zaren (Kaiser) krönen. Wer hätte ahnen können, dass sich der Glanz dieses serbischen Imperiums weniger zwei Generationen nach Stefans Dusans Tod auf dem Amselfeld in nichts auflösen würde?
Das zweite Grab der Markuskirche beherbergt die sterblichen Überreste König Aleksandar Obrenovićs, der im Jahre 1903 mitsamt seiner Gattin von serbischen Offizieren in seinem Palast in Belgrad abgeschlachtet worden war. Dieser Mord, der damals ganz Europa erschütterte, war das Präludium zum Ersten Weltkrieg, denn er bewirkte das Umschwenken Serbiens vom österreichischen ins russische Lager. Einer der Mörder des Königs, der Serbe Dragutin Dimitrijevic, sollte später als „Apis“ die Terrororganisation „Schwarze Hand“ gründen, die 1914 das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand organisierte.
Die Inbrunst der Besucher von Sveti Marko war bestürzend, ganz gleich, ob sie den Heiligenbildern oder den Gräbern galt. Vor manche Ikonen legten die Gläubigen Pflaumen, Birnen und Äpfel ab, ehe sie die Bilder küssten. Fast wie im Orient warfen sich einige Besucher vor den Heiligenbildern zu Boden, ehe sie die Kirche verließen. Manche mochten über solche Gesten die Nase rümpfen. Vielleicht aber zeigte sich in der demütigen Frömmigkeit, die in solchen Gebärden zum Ausdruck kam, auch eine Kraft, die die meisten Menschen des Westens verloren haben, ohne zu wissen, dass ihnen etwas fehlt.
Religionen haben überall in der Welt dazu beigetragen, Nationen zu erhalten. Man denke etwa an die katholischen Polen im Vergleich zu den protestantischen Preußen und den orthodoxen Russen - oder an die katholischen Iren im Vergleich zu den anglikanischen Engländern und den protestantischen Schotten. Sie haben aber auch dazu beigetragen, Völkerschaften zu spalten - am ehesten nachweisbar etwa an der Auseinanderentwicklung der orthodoxen Serben und der katholischen Kroaten, die ansonsten die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Sportarten lieben und die gleichen Suppen löffeln.
Am Abend vor der Weiterreise nach Sofia aß ich serbische Bohnensuppe und Cevapcici und dachte an die vielen entspannten Abende, die wir früher „beim Jugoslawen“ zugebracht hatten. Dieses Jugoslawien gab es nicht mehr. In einer Zeit, in der die maßgeblichen Protagonisten der europäischen Politik auf supranationale Einigungen setzten, hatte die Geschichte des Balkans eine gegenläufige Entwicklung eingeschlagen.
Zehntausend Dinare hatte ich als Geldreserve in meinen Pass gelegt. Mitten in der Nacht, als die serbische Passkontrolle an der serbisch-bulgarischen Grenze unsere Kabinentür pochte, hatte ich das vergessen. Der Zöllner stempelte die Pässe für die Ausreise ab und kassierte die Scheine. Ein wenig Balkan-Kolorit zum Abschied. Ansonsten brachte mich der Nachtzug planmäßig von Belgrad nach Sofia. Als der Morgen graute, durchfuhren wir wildes Karl-May-Land und erreichten schließlich den Bahnhof von Sofia.
BULGARIEN
Bulgarien – was weiß man schon von diesem Land? Ich erinnere mich an sumogleiche Ringer, die früher regelmäßig olympisches Gold gewannen, an Schwarzmeerstrände, zu denen in den frühen Tagen der alten Bundesrepublik diejenigen fuhren, die sich Mallorca oder Italien noch nicht leisten konnten. In meiner Studienzeit hatte es mich einmal nach Bulgarien verschlagen, wo ich eine Familie aus Erfurt traf, die bitter über die deutsche Teilung klagte, die doch im Westen längst als eine Selbstverständlichkeit hingenommen wurde. Kennzeichnend für das westdeutsche Bulgarienbild der frühen Jahre war die Bemerkung des deutschen Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki, der von seiner Verwunderung berichtete, als er Günter Grass kennenlernte, denn der habe ausgesehen „wie ein bulgarischer Geheimagent.“
Mit der Geschichte verhält es sich natürlich nicht anders. Auch für den Geschichtsinteressierten gleicht die bulgarische Historie einem Buch mit sieben Siegeln. Fremd klingen die Namen und die Schauplätze dem Mitteleuropäer in den Ohren, kaum nachvollziehbar die nationalen Dramen, deren größtes das halbe Jahrtausend war, während dem Bulgarien unter der türkischen Fremdherrschaft beinahe seine Identität verlor.
Der geschichtliche Raum, in dem sich die bulgarische Geschichte vollzog, war das alte Thrakien, das ausweislich der Berichte antiker Autoren von einem kriegerischen Menschenschlag bewohnt wurde. Denken wir nur an den Gladiator Spartakus. Erst im sechsten Jahrhunderts erscheinen die Slawen als ein amorphes Stammesgemisch. Bald darauf folgten die sogenannten „Proto-Bulgaren“, ein asiatisches Reitervolk, das als Herrenschicht die ansässige Slawenbevölkerung unterwarf und regierte. Die ersten Khane dieser „Proto-Bulgaren“ brachten mächtig Schwung in die Geschichte des Balkans, denn sie besiegten die Byzantiner und belagerten mehrfach die Kaiserstadt Konstantinopel. Im Unterschied zu den Ungarn, die ihre ethnische Identität und Sprache durch die Jahrhunderte hinweg bewahrten, wurde die kleine Schicht der Proto-Bulgaren allerdings mit der Zeit von der zahlenmäßig weit überlegenen slawischen Mehrheitsbevölkerung assimiliert. Die beiden Populationen vermischten sich, so dass am Ende von den asiatischen Proto-Bulgaren nur noch der Name „Bulgaren“ für das mehrheitlich slawischsprachige Volk übrigblieb. In der Regierungszeit von Zar Boris I (852-889) wurde dieses frühbulgarische Völkergemisch durch die Einführung des orthodoxen Christentums und der kyrillischen Sprache europatauglich kultiviert. Zar Simon (889-027) erhob Bulgarien zur Vormacht unter den Balkanvölkern. Von der religiösen Inbrunst der frühen Bulgaren legen die Gründungen des Rila-Klosters und einiger Athos Klöster Zeugnis ab.
Leider haben es die goldenen Zeiten der großen und der kleinen Völker an sich, meist schnell zu Ende zu gehen. Im Falle Bulgariens geschah dies im Jahre 1014 durch eine nationale Katastrophe. Der byzantinischen Kaiser Basileius II, ein gewaltiger Schlagetot, der das byzantinische Imperium von Armenien bis zur Donau wieder aufrichtete, besiegte die bulgarische Armee und ließ 14.000 gefangen Bulgaren blenden. Jedem Hundertsten ließ er wenigstens ein Auge, damit er seine blinden Kameraden zurück in die Heimat führen konnte. Zar Samuel traf angesichts dieses Elends der Schlag. Damit war das Ende des ersten bulgarischen Reiches besiegelt.
Im 13. und 14. Jahrhundert entstand ein zweites bulgarisches Reich, das aber schon 1393 den Türken erlag. So ging es den Bulgaren ähnlich wie den Serben vier Jahre vorher: ein halbes Jahrtausend lang währte die türkische Herrschaft, ehe 1878 die russischen Befreier kamen.
Trotz oder gerade wegen der Türkenzeit war die Erinnerung an die glanzvollen Jahrhunderte der bulgarischen Geschichte unvergessen. Stolz bezeichnen sich die Bulgaren als das „erste“ aller slawischen Völker. Sie waren es, die die den ersten slawischen Staat gründeten (noch vor der Kiewer Rus), sie waren das erste slawische Volk, das das Christentum annahm, sie waren die ersten Slawen, die die kyrillische Schrift verwendeten, und der erste slawische Patriarch war ein Bulgare gewesen.
In gewisser Weise waren also die frühen Russen „Schüler“ der Bulgaren gewesen, woran sicher der eine oder andere gedacht haben mochte, als die Russen, nachdem sie die Bulgaren im 19. Jahrhundert von den Türken befreit hatten, sie im 20. Jahrhundert in ihr Sowjetimperium einsackten. Viel hörte man nicht von den Bulgaren innerhalb des Ostblocks. Dann aber stand dann plötzlich auch Bulgarien als Beitrittskandidat vor den Toren der Europäischen Gemeinschaft.
Reiterstatue Zar Alexanders II
Alexander Newski Kathedrale Sofia
Die Pistole im Handschuhfach
Sofia als urbane Collage
Zwei erste Eindrücke erwarteten mich in Sofia. Auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel passierte ich eine Gruppe jugendlicher Roma, die sich an einer Straßenecke aufhielten und die Passanten beobachteten. Als sich eine Gruppe italienischer Touristinnen der Ecke näherte, bewegten sich zwei Roma auf die Italiener zu. Ein Schrei der Reiseführerin, und die Gruppe zog sich vor den beiden Jugendlichen wie eine Raupe in Todesangst zusammen. Da freuten sich die Roma an der Ecke und schlugen sich vor Lachen auf die Schenkel. Der zweite Eindruck war auch nicht ohne. Als ich ins Hotel Lion eincheckte, sah ich, dass die Rezeptionistin eine Pistole im Halfter trug.
Vielleicht hätte mir die Pistole im Halfter eine Warnung sein sollen. Denn das Hotel Lion, so gut seine Zimmer auch in Schuss sein mochten, beherbergte jede Menge illustrer Gäste, vorneweg eine Gruppe Kosovo-Albaner, die den ganzen Tag in der Lobby herumsaßen und ihre Geschäfte abwickelten. Mit ihren bis zum Bauchnabel geöffneten Hemden, den Goldketten um den Hals und ihren Nazifrisuren hätten sie, ohne sich umziehen zu müssen, in jede Mad Max Verfilmung gepasst. In der Nacht veranstaltete diese Bande einen Riesenradau, der stockwerkeweit zu hören war, ohne dass die Hotelleitung einschritt. Das war umso erstaunlicher, weil auch vollkommen normale Westtouristen im Hotel Lion einkehrten. Auch beim Frühstück saßen sich zwei Welten gegenüber: ruhig den Kaffee trinkend die wenigen Westler, breitbeinig laut krakeelend die kettenrauchenden Rabauken mit ihren aufgemotzten Musen.
Mein erster Spaziergang durch Sofia führte mich zur Hauptattraktion der Stadt: auf den Alexander Newsky Prospekt, in dessen Mitte sich das Wahrzeichen Sofias erhob: die große Alexander Newsky Kathedrale. Von außen glich die Kathedrale einem Gebirge vergoldeter Kuppeln. In ihrem Innern spiegelte sich das Licht der großen Kronleuchter in dem Gold und Silber auf den Heiligenbildern. Alles an dieser Kirche war monumental: ihre Platzierung, ihre Ausmaße und ihre Ausstattung, gerade so, als hätten die Bulgaren eine Kirche für die Ewigkeit schaffen wollen. Für die Bulgaren war die Kathedrale mehr als ein Gotteshaus, sie war der steingewordene Ausdruck der wieder gewonnenen Freiheit nach einem fast fünfhundert Jahren türkischer Fremdherrschaft.
Wem sie diese wiedergewonnene Freiheit verdankten, haben die Bulgaren bis auf den heutigen Tag nicht vergessen. Vor der Kathedrale im Herzen ihrer Hauptstadt erbauten sie Zar Alexander II, dem „Bulgarenbefreier“ ein überlebensgroßes Reiterdenkmal auf einem meterhohen Podest. Immerhin waren 20.000 russische Soldaten bei der Befreiung Bulgariens während des russisch-türkischen Krieges 1877/78 gefallen. Dementsprechend martialisch waren die Reliefs auf dem Sockel des Zarendenkmals ausgestaltet. Unterhalb des Sockelplateaus stürmte ein steinerner Engel mit gezogenen Schwert nach vorne, links und rechts begleitet von Soldaten der russischen Armee, im Hintergrund ängstlich beobachtet von Flüchtlingen, Müttern und Kindern. Der russische Zar Alexander II, der bis heute in Bulgaren wie ein Nationalheld verehrt wird, starb übrigens nur drei Jahre später bei einem Mordanschlag der Sozialrevolutionäre in St. Petersburg.
Nach dem Besuch von Kathedrale und Zarendenkmal flanierte ich die Boulevards der Innenstadt entlang. Ihre stalinistischen Fassaden besaßen etwas Blockhaftes, das allerdings durch kleine Geschäfte in ihren Parterre aufgelockert wurde. Ich passierte Schaufenster mit Gucci und Prada, Moscheen und Gemüsestände, Straßencafés und Bauruinen wie die disparaten Bestandteile eines urbanen Eintopfes, dessen Geschmacksrichtung sich noch erweisen musste. Soweit ich erkennen konnte, waren Marx und Engels aus dem Stadtbild von Sofia verschwunden. Kyrill und Methodos, die Schöpfer des kyrillischen Alphabets, hatten den Wandel der Zeiten als Statuen vor der Universität dagegen unbeschadet überlebt. Mit Recht, denn wahrscheinlich hatte ihre Schöpfung, das slawische Alphabet, ebenso viel zum Überleben des orthodoxen Christentums beigetragen wie die Kirche selbst.
Da das Wetter immer besser wurde, nahm ich am Nachmittag den Bus und fuhr stadtauswärts an den Rand des Witoschagebirges nach Bojana. Ein namentlich nicht bekannter Künstler, der als „Meister von Bojana“ in die Kunstgeschichte eingegangen ist, hatte an die Kirchenwände von Bojana in der Mitte des 13. Jahrhunderts über neunzig Bilder gemalt und somit der Nachwelt ein visuelles Portrait seiner Zeit hinterlassen. Der kleine Jesus erschien auf diesen Fresken nicht als miniaturisierter Priesterkönig in den Proportionen eines Erwachsenen, sondern als wirkliches Kind, und auf dem Teller der Apostel ist der Knoblauch als Geschmacksverstärker nicht zu übersehen.
Im Hotel Lion kam ich mit Boris ins Gespräch, einem jungen Mann in den frühen Zwanzigern, der sich den ganzen Tag in der Lobby aufhielt und auf dessen Tätigkeit ich mir keinen Reim machen konnte. War er ein Informant der Obrigkeit, der die albanische Gruppe im Auge behielt oder einfach einer der Security-Angestellten des Hotels? Auf jeden Fall war er ein kontaktfreudigerer junger Mann, der mich in einem ganz ausgezeichneten Englisch in seine Weltanschauung einführte. Die „acht“, so Boris, sei die Zahl Bulgariens, denn die „acht“ sei das Zeichen der heiligen Sofia, deren Weisheit wie die „acht“ weder Anfang noch Ende habe. Die „acht“ war aber auch der rechte Schlüssel zum Verständnis der bulgarischen Geschichte. Denn es sei doch so, dass das Volk aus acht Teilen bestehe, von denen ein Achtel die Elite, ein Achtel der Abschaum und der Rest der Durchschnitt sei. Wenn das Elite-Achtel den Staat regiere und das Abschaum-Achtel hinter Gittern säße, dann herrsche Ordnung in der Welt, meinte Boris. So sei es unter der Herrschaft der guten Zaren gewesen, die in Bulgarien das Christentum eingeführt hatten. Unter der Herrschaft der Türken aber sei es so gewesen, dass alle acht Achtel nichts zu melden gehabt hatten, sondern dass der Achtel-Abschaum andere Völker Bulgarien regiert hatte. Zurzeit sei es leider so, dass in Bulgarien alles drunter und drüber gehe, dass alle Achtel mitmischten und gar nicht abzusehen war, welches Achtel am Ende die Oberhand behalten würde.
Wie immer es sich auch mit der Tragfähigkeit von Boris´ Achtel-Theorie verhalten mochte - dass im gegenwärtigen Sofia alles kunterbunt durcheinander ging, war unbestreitbar. Westliche Mode, Yuppies in Designerjeans, die in einem Wiener Kaffeehaus ihren Café Melange tranken, befanden sich in einem Bild mit Romafrauen, die mit ihren betäubten Babys bettelnd durch die Straßen liefen. Stattliche Häuserfassaden, die an die schönsten Ringe von Budapest erinnerten, standen neben baufälligen Häuserwänden. Altersschwache Straßenbahnen zockelten im slow motion modus durch die Stadt, während am Straßenrand Mercedes-Benz-Limousinen und BMWs von grimmig dreinblickenden Gestalten bewacht wurden, damit niemand die Nummernschilder abschraubte.
Am einladendsten wirkte die Stadt kurz vor der Dämmerung, wenn die Leute im Stadtpark Schach spielten, die Familien die Straßen entlangflanierten oder auf den Bänken saßen und schwatzten. Die Straßencafés der Innenstadt waren dann gut gefüllt, die Fontänen der Brunnen sprudelten, die Kinder und die Hunde tollten. Wenn der Wunsch, zu sehen und gesehen zu werden, ein Merkmal Mitteleuropas war, dann befand sich Sofia auf gutem Weg.
Aber nur bis zum Einbruch der Dunkelheit. Denn wenn es dunkel wurde in den Straßen, nahm die Zahl der Müßiggänger rapide ab. Dafür durchstreiften nun beunruhigende Gestalten das Gelände, das Gesicht und den Gang von Alkohol oder Drogen gekennzeichnet. Ich notierte: „Sofia in der Nacht ist nicht unbedingt eine Stadt zum Flanieren.“
In etwa 1150 Metern Höhe, mitten im bulgarischen Rila-Gebirge, hatte der Mönch Ivan Rilsky im 10. Jahrhundert das Rila-Kloster gegründet, einen abgelegenen Ort der religiösen Weltversenkung, der im Laufe der Zeit zum bulgarischen Nationalheiligtum aufgestiegen war. An der Rezeption des Lion Hotels bestellte ich einen Wagen, der mich zum Rila-Kloster bringen sollte. Der Fahrer hießt Dimitri, er war ein junger Mann Ende Zwanzig, Vater einer kleinen Tochter und über alle Maßen gesprächig. Ganz ohne Aufpreis machte er mich auf der zweistündigen Fahrt zum Rila-Kloster mit seiner Weltsicht vertraut.
Nach Dimitris Meinung wäre es das Beste für Bulgarien, etwa hundert Leute mit Gewehren ins Parlament zu schicken, damit sie alle Abgeordneten massakrierten. Wenn das erledigt sei, könne endlich im Namen des Volkes geherrscht werden. Wer dann konkret regieren sollte, wusste Dimitri nicht, denn er misstraute allen Politikern. Ganz schnutig wurde sein Gesicht, als er in dieser Sackgasse seiner Weltanschauung angekommen war. Doch schnell sprang er weiter zu den Amerikanern, die er fast so stark hasste wie die Israelis, die selbstverständlich für den Anschlag auf das World Trade Center verantwortlich seien. Dafür bewunderte er die russische Technologie, der die Zukunft gehörte. Gegen den EU Beitritt Bulgariens hegte er Vorbehalte, weil die EU für ihn eine Versammlung von lauter Weicheiern war. Beiläufig erwähnte er, dass im Lion Hotel vier Security Leute arbeiten würden, die zugleich auch Informanten der örtlichen Mafia seien. Niemand könne in Sofia ein Hotel eröffnen, ohne nicht an die Bosse der Halbwelt Schutzgeld zu entrichten. Den Gedanken ins Ausland zu gehen, wies er weit von sich, denn Sofia sei seine Heimat, und hier lebe seine Familie. Während er mich auf diese Weise unterhielt, raste er wie ein Berserker über die Straßen, achtete aber zugleich auf die Töne seines Radar-Detektors, der ihn vor den Verkehrskontrollen warnte. Als wir das Kloster erreichten, legte er sich in den Schatten eines Baumes aufs Ohr und ließ mir genügend Zeit zur Besichtigung.
Rila-Kloster
Wie die meisten mittelalterlichen Klöster war Rila von einer Wehrmauer umgeben. Im Zentrum des Klosters befand sich ein großer Innenhof, in dessen Mitte sich die Mutter-Gottes-Basilika erhob. Ihren harmonischen Gesamteindruck erhielt die Anlage durch die zweistöckigen Arkaden in der Wehrmauer, die einen Rundgang um den Klosterhof erlaubten. Die Klosterkirche, in der der letzte bulgarische Zar Boris III begraben lag, war außen mit bunten Wandmalereien geschmückt, im Innern glühte das Licht unzähliger Kerzen, die die Gläubigen vor der Ikonenwand entzündet hatten. Außer den Türmen entstammte alles, was in Rila zu sehen war, dem Klosterneubau des 19. Jahrhunderts. Original waren nur noch die Exponate des Kloster-Museums: lauter filigrane Weihrauchschwenker, Bibelumhüllungen aus Emaille und Silber, Klostertürenverzierungen, Gerätschaften, Waffen und unfassbar ziselierte Holzkreuze aus dem späten Mittelalter. Wie es hieß, sollen sich die Mönche bei den Miniaturschnitzereien der Holzkreuze derart ins Zeug gelegt haben, dass sie vor lauter Anstrengung erblindeten.
Den letzten Tag in Sofia verbrachte ich im Stadtpark. Die Sonne brachte die Blätter der Bäume zum Funkeln, ein warmer Wind zog über die Wiese. Babys kreischten, schöne Frauen schlenderten vorüber, Paare gingen Hand in Hand und mit selbstergriffenen Gesichtern vorüber. War das Osteuropa? Was war Osteuropa überhaupt? Ein Pejorativ, der aus westlicher Richtung immer weiter nach Osten weitergereicht wurde? War Sofia Osteuropa? Wenn ich an die Pistolen unter den Tischen und in den Handschuhfächern dachte, vielleicht. Hier an diesem Sonntagabend im Stadtwald von Sofia aber nicht.
Der Tag klang aus mit einem Abendessen in der Altstadt an einem Platz, auf dem sich die Jahrzehnte ein Stelldichein gaben. Schieferdächer, uralte Autos, Litfaßsäulen mit altertümlichen Reklameplakaten, modisch gekleidete bulgarische Paare, Häuserfassaden mit malerisch herabbröckelndem Putz, alles miteinander verwoben wie in einem Mischmasch der Zeiten. Das war mein letzter Eindruck von Sofia, dann ging die Reise weiter zum Schwarzen Meer.
Sozopol
Mit den Massen am Meer
Die bulgarische Schwarzmeerküste
Mit dem Nachtzug fuhr ich von Sofia zum Schwarzen Meer. Bei der morgendlichen Einfahrt in den Hafen von Burgas zeigte sich die industrielle Eingeweide der Stadt. Raffinerien, Gasleitungen, Röhren, ausrangierte Züge. Dahinter erstreckte sich hügeliges Land im Morgenlicht.
Ohne mich lange in Burgas aufzuhalten, nahm ich ein Taxi nach Sozopol. Der Name des Taxifahrers war Mehmet, er war ein freundlicher Türke mit gewaltigen Bäckerarmen. „Kara Deniz“, „Kara Deniz“ sagte er, als zur linken das Schwarze Meer in Sicht kam. "Mare Maggiore" – „großes Meer“ hatten die Genueser und Venezianer das Schwarze Meer genannt. Später, als die Osmanen im 16. und 17. Jahrhundert das Schwarze Meer zu einem türkischen Binnenmeer machten, übersetzten sie „Mare Maggiore“ mit „Kara Deniz“, wobei das Adjektiv „kara“ nicht nur „groß“, sondern auch „dunkel“ und „trüb“ bedeutete. So wurde aus dem „großen“ das „trübe“ und schließlich das „schwarze“ Meer.
Nach einer guten halben Stunde war Sozopol erreicht, das antike Apollonia, von dessen Überresten aber nicht mehr viel zu sehen war. Dafür besaß Sozopol eine malerische Altstadt, die sich auf einer Halbinsel wie ein gekrümmter Finger ins Meer erstreckte. Mehmet ließ es sich nicht nehmen, mich so lange in Sozopol herumzufahren, bis ich in der Oberstadt ein kleines Apartment mit Ausblick auf Altstadt und das Meer fand.
Was gab es in Sozopol zu sehen? Nicht besonders viel, wenn man einmal von der Nahansicht des gesamteuropäischen Massentourismus absah. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte sich Sozopol zu einem Zielgebiet für Serben, Rumänien, Russen, Albaner, Mazedonien und Bulgaren entwickelt, das durch die Anwesenheit der Türken, die hier noch immer in beachtlicher Zahl siedelten, einen Schuss ins Orientalische bekam. Diese touristische Klientel, ergänzt durch deutsche, britische und skandinavische Billigtouristen, logierte vorwiegend in den großen Hotelburgen an der Peripherie der Stadt und schob sich und Ihresgleichen allabendlich zehntausendfach durch die Altstadt. Das Netteste an diesen Massenprozessionen waren noch die Kinder, die schmuck herausgeputzt den Erwachsenen durch die Beine liefen, manchmal aber auch im Gewirr verschwanden, so dass ihre Mütter dann laut schreiend in der Menge nach ihnen suchten. Die Eltern waren schlank, wenn sie jung waren, dicker, wenn sie schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hatten, und quadratisch, wenn sie in das Lebensstadium des Großelterntums eingetreten waren.
Eine wahre Attraktion innerhalb dieser allabendlichen Massenparade war der bulgarische Mann, wie er kraftvoll und beleibt mit seiner Familie durch die Straßen schritt. Manchmal stand er breitbeinig vor einem Kebab Stand/ Souvenir-Shop/ Stuhl/ Geschäftsauslage in der Haltung eines Sheriffs, der die Arme schon angewinkelt hatte, um im nächsten Moment den Colt zu ziehen und sein Gegenüber abzuknallen. Besonders überzeugend wirkten solche Posen, wenn der bulgarische Sheriff reichlich Tattoos an beiden Armen hatte. Dann konnte man fast den Bulgaren Christo verstehen, der sein Land mit dem Habitus verlassen hatte, einfach so viel wie möglich von der Welt mit Säcken und Tüchern einzupacken und zu verbergen.
Die touristische Überbeanspruchung der Altstadtgassen zog sich normalerweise bis weit in den Abend hinein. Irgendwann verteilte sich die Menge in die diversen Lokale oder schwappte zurück in die Hotelbunker an die Peripherie. Ruhig wurde es dann trotzdem nicht, denn nun schlug die Stunde der Diskotheken. Bis kurz vor Sonnenaufgang jauchzen bulgarische Sänger und Sängerinnen ihre Lieder in die Nacht, und da ich hoch über dem Ort wohnte, bekam ich nach dem Prinzip der amphitheatralischen Verstärkung die Musik so plastisch mit, als würden die Künstler auf meiner Toilette singen.
Von Sozopol aus war es nicht weit bis zur türkischen Grenze, und da die Strände im Umkreis der Stadt hoffnungslos überfüllt waren, unternahm ich einen Tagesausflug nach Süden. Auf dem Busbahnhof machte ich die Bekanntschaft von Detlef (48) und Boris (6) aus Köln. Detlef war ein geschiedener Vater, der seinen kleinen Sohn Bulgarien zeigte - sprich: mit ihm mangels Reisekasse am Strand schlief, mit ihm angelte und auf low budget Basis kreuz und quer durch die Gegend zog. Boris‘ Mutter war bald nach seiner Geburt mit Detlefs bestem Freund durchgebrannt. Während Detlef und Boris am Eingang des benachbarten Nationalparks ausstiegen, fuhr ich weiter nach Kiten, einem vollkommen überbelegten Betonstrand, den ich einmal auf und ab lief, um dann gleich wieder abzuhauen. Auf der Rückreise stoppte ich an einem Naturreservat mit Flüssen, Schilf und jeder Menge Vögel und suchte eine ruhige Stelle, in der ich mich aufs Ohr legen konnte. Gerade lag ich im Gras, da raschelte es im Unterholz, und Detlef und Boris tauchten auf. Den Rest des Nachmittags posaunte mir Detlef weitere Einzelheiten über seine Lebensgeschichte ins Ohr, während der kleine Boris immer nörgeliger wurde. Es kam schließlich, wie es kommen musste. Nachdem mir Detlef den Nachmittag versaut hatte, pumpte er mich auch noch an. Ich gab ihm einige Lewa und schaute, dass ich heimkam.
Die letzte Nacht in Sozopol war durch einen Vollmond erhellt, wie ich ihn selten gesehen hatte. Sein bleiches Licht tauchte die gesamte Halbinsel in ein magisches Dunkel, von dem sich das Schwarz des Meeres noch einmal abhob. Ein funkelndes Lichtermeer zog sich die Küstenlinie entlang und verlor sich in der Ferne. Das war die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht war, dass kurz darauf, die Nachtmusik aus 50.000 Watt Boxen begann. Es handelte sich um rhythmische Technomusik, die kilometerweit jedes Schlafen unmöglich machte. Am Ende versuchte ich mit Ohrstopfen im Bad zu schlafen, was mir leidlich gelang. Vollkommen erschlagen wachte ich am Morgen auf. Das war mein Abschied von Sozopol.
Wieder zurück nach Burgas. Wieder die Ansammlung stählerner Arme, die als Raffinerietürme und Abfackelungsanlagen in den Himmel ragten. In der Innenstadt von Burgas gab es nichts, woran sich der Blick festhalten konnte, so sehr ich mir auch die Augen aus dem Kopf starrte. Bemerkenswert waren allenfalls die Taschendiebe, die sich im Umkreis des Busbahnhofes herumtrieben. Die Busse stoppten und starteten im Zehnminutentakt in alle Richtungen, und es dauerte nicht lange, da saß ich schon im Bus nach Nessebar.