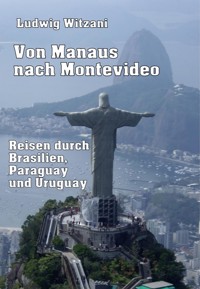Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch fußt auf einer selbstorganisierten Expedition, die der Autor von Kathmandu aus mit einem Reisepartner, zwei Fahrzeugen und einer fünfköpfigen Crew unternommen hat und die ihn über den Himalaja und das Tal des Tsangpo-Brahmaputra bis zum heiligen Berg Kailash und von dort aus über den Changthang nach Zentraltibet führte. Im Mittelpunkt dieses literarisch gestalteten Reiseberichtes stehen die grandiose Landschaft Tibets, seine Geschichte und Kultur, seine Klöster und Städte und seine Menschen mit ihrer bewundernswürdigen Spiritualität – aber auch die existentiellen Momente der Besinnung, die die Begegnung mit Tibet in allen Reisenden erzeugt, die dieses Land mit offenen Augen erleben. Eine Hommage an das Land der lebenden Götter für Tibet Einsteiger und Tibet Kenner gleichermaßen – und eine Aufforderung, diese Reise oder einen Teil von ihr nachzureisen – je zeitnäher und je öfter, desto besser, denn niemand weiß, wie lange die tibetische Kultur unter dem Ansturm der politischen und kulturellen Überfremdung noch überleben wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Copyright
Titel
I Vorbemerkung
II Personen
III Start in Kathmandu
IV In der Hölle des Milarepa
V An den Ufern des Tsangpo
VI Der Nabel der Welt
VII Schnittpunkt im Nirgendwo
VIII Das einsame Herz Asiens
IX Warten auf den wahren Panschen Lama
X Die letzte Festung
XI Als Feuer aus den Fingerspitzen schoss
XII Das Haus des Avalokiteshvara ist verwaist
Anhang: Geschichte – Mythologie – Geografie
Weitere Bücher von Ludwig Witzani
Dieses Buch ist der Bericht einer Reise durch Tibet. Aus Gründen der Diskretion habe ich einige Namen verändert. Um Doppelungen in der Darstellung zu vermeiden, wurden einige Episoden und Personen literarisch verdichtet.
Copyright © 2014 Ludwig Witzani
All rights reserved.
Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
ISBN 978-3-7375-0043-2
www.ludwig-witzani.de
Ludwig Witzani
TIBET – IM LAND DER LEBENDEN GÖTTER
Über den Himalaja
durch das Tal des Tsangpo-Brahmaputra
zum heiligen Berg Kailash
und über den Changthang
bis nach Zentraltibet und Lhasa
I Vorbemerkung
Das vorliegende Buch fußt auf einer selbstorganisierten Expedition, die ich von Kathmandu aus unternommen habe und die mich über den Himalaja und das Tal des Tsangpo-Brahmaputra bis zum heiligen Berg Kailash und von dort aus über den Changthang nach Zentraltibet führte. Diese Tibetexpedition war eine der großen Reiseerfahrungen meines Lebens.
Ich habe versucht, nicht nur die tibetische Landschaft, Geschichte und Kultur, die menschlichen Begegnungen und den Reiseverlauf zu beschreiben sondern auch den Wiederhall darzustellen, den die Begegnung mit Tibet in jedem erzeugt, der dieses Land mit offenen Augen bereist. Das ist einer der Gründe für die Wahl der literarischen Form, mit der ich versucht habe, bestimmte Abläufe und Erfahrungen so zu verdichten, dass sie für den Leser verständlicher werden. Mit Rücksicht auf private Empfindlichkeiten wurden alle Namen verändert. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen können nur von diesen bemerkt werden, wobei ich hoffe, dass ich jedem gerecht werden konnte.
Eine Reise nach Tibet, hat Lama Govinda einmal formuliert, gleicht einer Reise nicht nur in die Weiten der Welt, sondern auch in die Tiefen der eigenen Psyche. Genauso habe ich es erlebt, und auch davon erzählt dieses Buch.
Jeder sei eingeladen, die in diesem Buch beschriebene Reise oder einen Teil von ihr nachzureisen – je zeitnäher und je öfter, desto besser, denn niemand weiß, wie lange die tibetische Kultur unter dem Ansturm der politischen und kulturellen Überfremdung noch überleben wird.
-L.W.
II Personen
Frank
Reisebegleiter. Indienfan. Freund des Lun-gom-pa. Wurde gegen Ende der Reise immer ruhiger.
Shen
Tibetischer Mönch aus Dharamsala. Starb in Sikkim an den Pocken.
Karol
Sinnsuchender Pilger aus Kattovice. Verschwand in China.
Kelsang
Führerin und Freundin. Extrem strapazierfähig. Behielt immer die Nerven.
Topchin
Master of Dongfeng. Herr der Hochebene. Der unschlagbare Held.
Kunga
Mann in Grün. Endete in einem Nonnenkloster.
Tensing
Der sanfte Herr des Küchenzeltes.
Mun
Küchensherpa auf seiner Jungfernfahrt.
Löpsang-Cho
Wandermönch mit Kailash-Kora-Service.
Gedün
Ortskundiger Nomade am Paryang.
Leo & Ulli
Vaganten Zentralasiens. Fuhren im Kohlelaster über den Tibet Highway.
Giovanni & Paolo
Frohnaturen auch in aussichtslosen Lagen. Freunde des Spieles und der Überraschung.
Herr Li
Wirt und Geschädigter. Riskierte alles und verlor.
Irene
Individualreisende. Lobt die Chinesen in Tibet.
Mr. Wong
Chinesischer Fahrer. Hatte Probleme mit den Bremsen und den Schlaglöchern.
Joe Song
Sinoasiatischer Traveller der neuesten Art. Wusste immer auf alles eine Antwort.
Mr. Cheung
Chinesischer Fahrer mit Karriereambitionen.
Wolfgang
Gestrandeter Individualtourist in Lhasa.
Chrissi
Schönheit auf Reisen. Etwas unstet.
Jenny
Nervenbündel auf Reisen. Mag keine Tempel.
Heinrich
Freund der Berge.
III Start in Kathmandu
Ein krachendes Gewitter war über der Stadt niedergegangen, hatte Unrat und Schweiß davon gespült und Kathmandu wie ein schlecht gewaschenes Untier im Schatten der giftgrünen Berge zurückgelassen. Der Swayambunath-Hügel war im feuchten Dunst verschwunden, und grotesk geformte Wolkenfetzen hingen in langen Streifen über den Dächern. Kathmandu dampfte - die Haut der Menschen, das Fell der Kühe, Garküchen, Riesenpfützen und Abwasseröffnungen – alles gab seinen Anteil an Feuchtigkeit als neblige Nässe in den Himmel zurück, aus dem sie gekommen war. Monsun in Nepal.
Für die Rikschafahrer, die die Neuankömmlinge vom Tribhuvan Airport nach Kathmandu-Thamel brachten, war dergleichen Alltag. Wie die Slalomfahrer kurvten sie zwischen Schlaglöchern, Wasserlachen und Marktständen hin und her und riskierten bei ihren Überholmanövern Kopf und Kragen, um einige Sekunden zu sparen.
Bald war der Norden Kathmandus erreicht. Rikschafahrer, die ihr Gefährt zu einem Frisiersalon umfunktioniert hatten, boten ihre Dienste an, Kühe trotteten gemächlich über die Straße, Tschaistände folgten auf Wasserzapfstellen, vor denen sich lange Menschenschlangen gebildet hatten. Der Königspalast zog zur Rechten vorbei. Bald wurden die Straßen enger, die Auslagen üppiger und die Zahl der Reisebüros, Restaurants und Hotels immer unübersehbarer: Kathmandu-Thamel, eine der Welthauptstädte des internationalen Backpackertourismus war erreicht.
Wie soll man Thamel beschreiben? Am besten stellt man sich ein Viertel in einer großen europäischen Stadt vor, vielleicht das rechtsrheinische Köln oder Berlin-Kreuzberg, und fantasiert für einen Moment, dass in diesem Stadtteil nur wohlhabende asiatische Rucksacktouristen logieren, die von deutschen Bäckern, Fleischern, Hoteliers und Taxifahrern auf das Emsigste hofiert werden. Deutsche Küche würde nur am Rande serviert, dafür füllten alle Arten von Dal, Sate Ayam, Schweinefleisch mit Bambussprossen, Schlangensteak oder Chicken Curry die in Nepali, Hindi, Thai oder Chinesisch geschriebenen Speisekarten. Die zum Teil erstaunlich jungen Nepali, Inder oder Chinesen würden die deutsche Lederhose oder das Tirolerhütchen testen, während die deutschen Schneider oder Guides, der besseren Geschäftsanbahnung wegen, sich in Sarong oder Turban präsentieren.
Das Gegenteil davon ist Thamel, ein boomender Stadtteil von Kathmandu, in dessen Hotels nur westliche Touristen wohnen und in dem die gesamte alltägliche Ökonomie vom Koch und Kellner, über den Friseur, Hotelier, Reiseagent, Textilhändler und Rikschafahrer einzig und allein der Versorgung der ausländischen Gäste dient. Thamel ist der zur Wirklichkeit gewordene Traum der großen asiatischen Gesamtjugendherberge, in der eine unübersehbare Schar dienstbarer Heinzelmännchen keinen anderen Wunsch zu hegen scheint, als den Gästen aus Übersee jeden nur denkbaren Wunsch für kleines Geld zu erfüllen. Eine Grundversorgung mit einheimischer Kost, nach der mancher Backpacker in der Fremde mehr lechzt als er jemals vermutet hätte, oder alle Varianten der Beherbergung, angefangen bei Bretterverschlägen mit Holzpritschen bis hin zu gediegenen, ruhigen Zimmern mit Gartenblick, stehen ebenso zur Auswahl wie Trekking-, Climbing- oder Rafting-Abenteuer, die zu peppigen Pauschaltouren verpackt von findigen Tourismusagenten in Thamel angepriesen und vermarktet werden. Man brauchte keinen einzigen Schritt aus Kathmandu-Thamel herauszutun und könnte doch im Verlaufe der immer gleich konzipierten Akquisitionsabenden in den Hinterzimmern der Restaurants und Reisebüros allabendlich über dem Annapurna die Sonne auf- und untergehen sehen oder sich von spezialisierten Anbietern in die Wunderwelt von Yoga und Tantra einführen lassen. Seit Jahren schon fliegen die Paddler im „Rafter Adventure Mowie“ in die wildschäumender Flut, um hinterher wieder grinsend und glücklich auf der Leinwand aufzutauchen „No Danger“, spricht dazu eine beruhigende Stimme aus dem Off: „Just an Experience“ – ein Kommentar, der als Motto über ganz Nepal stehen könnte, denn das ganze Land ist dabei, die Züge eines gigantischen Freizeitparks anzunehmen, und Thamel ist seine unbestrittende touristische Hauptstadt.
Inzwischen hatte der Regen ganz aufgehört, die dunkelschwarze Wolkenfronten waren über der Stadt aufgerissen und hatten einer azurblauen Lücke platzgemacht, durch die die Mittagsonne die Straßen und Häuser von Thamel und Chetrapati beschien, als wären es die Dächer von Shangri-La. Touristen, käseweiß oder braungebrannt, abgerissen oder herausgeputzt, defilierten allein oder in Gruppen die Haupt- und Seitenstraßen entlang, diskutierten ihre Reisepläne in den kleinen Cafés oder handelten mit den Rikschafahrern die Preise für ihre Touren aus. So bemerkenswert bunt sie auch durch die Straßen liefen, trugen sie doch fast alle die individualtouristische Einheitskluft: Reispflückerhose, Reispflückerhemd, Sandalen und die obligatorische Bauchtasche, in der sich Ausweise, Kreditkarten und Devisen befanden. Fahrende Händler aus dem benachbarten New Road Bezirk kamen ihnen entgegen, lauter intelligente und findige Inder, die kistenweise Tand und Kitsch aus Thailand und Hongkong importierten, um ihn in Thamel als nepalesische Souvenirs an ahnungslose Touristen zu verhökern. Am Eingang zur Tridevi Marg hatte sich ein pittoresk ausstaffierter Yogi aus Pashupatinath niedergelassen, um darauf zu warten, dass irgendein Greenhorn ihn fotografieren und ihm damit Gelegenheit geben würde, dem unvorsichtigen Flaneur ein dickes Bündel Rupienscheine abzupressen. Jung waren die Laufburschen, Sherpas und Kellner, die allesamt zu Diensten standen, jung waren die Dealer, die an den jedermann bekannten Treffpunkten ihren Stoff anboten, noch jünger aber waren ihre westlichen Kunden. Eine geradezu triumphierende Jugendlichkeit prägte die Stimmung im Gartencafé der „Pumpernickel Bakery“, in dem sich die Mitglieder der internationalen Backpackergemeinde in heimatlichem Ambiente und in einer merkwürdig anmutenden Begeisterung aneinander ergötzten. Da bejubelten zwei Pärchen, die sich vor Monaten auf einer Bustour durch Java getroffen hatten, ihr unverhofftes Wiedersehen, ein Brite mit einem malerischen Germanenzöpfchen auf der Glatze parlierte mit einem behaarten Deutschen, dem ein Flachmann aus der Brusttasche lugte. Die eloquente Petra aus Porz informierte einen französischen Gletscherforscher über die Wetterverhältnisse im Tal von Pokhara, während der Schotte David, gerade vom Kanchenjunga mit einem erfrorenen Zeh zurückgekehrt, seinen Kumpel mit den Agonien seines Bergabenteuers unterhielt. Eine dunkelhäutige Amerikanerin diskutierte mit einem rothaarigen Australier die aktuelle Tennis-Weltrangliste - knalleng waren ihre Radlerhosen, während ihr Partner sein haariges Gebein unter einem grellroten Longhie verbarg. Und wer es nicht geglaubt hätte, wie weit und wie früh die Kinder der Industriegesellschaft schon in der Welt herumgekommen waren, den hätte ein einziger Blick durch das Gartenrestaurant der Pumpernickel Bakery eines Besseren belehren können: wie Positionsmarken einer imaginären Weltkarte ließen sich die typischen Weltreiserouten von den T-Shirts der Gäste ablesen- „Malakka“ und „Ko-Samui“ aßen Streuselkuchen, „Ha-Long-Dragon“ nippte an einem Bier, während sich „Goa“ und „Hongkong“(männlich) mit „Singapur City“(weiblich) mitten in einem stürmischen Flirt befanden.
Inzwischen hatte sich das Wetter über Kathmandu schon wieder eingetrübt. Besorgte Blicke gingen gen Himmel, und ehe man sich versah, entlud sich schon wieder ein neuer Wolkenbruch über der Stadt. Unter großem Gejohle flüchteten die Gäste der Pumpernickel Bakery in den überdachten Bereich des Restaurants, schüttelten sich wie nasse Katzen und jauchzten über diesen interessanten Auftritt der Natur an einem kurzweiligen Sommernachmittag. Derweil versank der Garten hinter einem Regenschleier, Blitze zuckten, Donner grollte, und für einige Minuten wurde es stockdunkel. Die Natur raste, doch es wurde weiter Müsli und Pancake serviert, als wäre alles nur Fiktion. Schließlich wurde sogar die Musikbox so laut gestellt, dass die scheppernde Musik das Donnergrollen des Monsungewitters übertönte.
An diesem Abend zog ich mich früh auf mein Zimmer zurück, um mich mit der bevorstehenden Reise nach Tibet zu beschäftigen. Frank, mein Reisebegleiter, war noch nicht eingetroffen, und ich wusste nicht genau, wie weit die Reisevorbereitungen für die Überquerung des Himalaja gediehen waren. Aber eines wusste ich genau – diesmal würde ich wirklich nach Tibet reisen, um meine Vorstellungen vom sagenhaften Schneeland jenseits der Berge endlich mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Möglicherweise würde ich enttäuscht werden, aber das war mir egal, das Reisefieber hatte mich ergriffen und überdeckte alles.
Wie bei vielen Reisenden ging auch meine Passion für Tibet auf eine frühe Lektüre zurück, eine Lektüre in ganz jungen Jahren, in denen die Wörter der Bücher noch ganz anders in der Seele wiederhallten als später. Die Rede ist von „Transhimlaja-Trilogie“ einem wuchtigen Wälzer, den ich im Knabenalter erwarb und wie einen Schatz hütete. Der Autor dieses Buches, der schwedische Forscher und Weltreisende Sven Hedin wurde mein erster Tibet-Lehrer. Mehr noch: Dieser aufrechte, aber politisch später so unglücklich agierende Schwede, den ich mir nur als Monument aus Wille und Muskeln auf dem Rücken eines Yak vorstellen konnte, wie er bei dreißig Grad unter Null über das vereiste Changthang Plateau den Weg zum Tsangpo suchte, wurde mein erster Held – nicht nur weil Hedins Berichte über das Tal des Tsangpo, über die Stadt des Panschen Lama oder die Quellen des Indus meinen Ahnungen vom Tibet Farbe und Gestalt verliehen, sondern auch, weil der Ton, in dem er von den unwirtlichen Enden der Erde erzählte, mein jugendliches Bedürfnis nach Abenteuer und Bewährung ansprach. Als ich als Pfadfinder am Lagerfeuer und zum Schein einer Taschenlampe von Hedins Träumen las, erschien es mir, als würde der große Reisende mich bis in den Kern meiner Seele kennen. „In der Nacht träumte ich, dass eine starke Hand mich an einen Scheideweg führte“, hieß es in der Transhimalaja-Trilogie. “Sie zeigte auf eine Straße, und eine Stimme sagte mir, dass diese mich in das Land der Ruhe und Gastfreiheit und des Sommers führen würde, die andere aber führe zu Gefahren und Entbehrungen zwischen hohen, dunklen Gebirgen.“
Zugegeben, Hedins endlose Detailbeschreibungen von Flüssen, Schluchten und Bergen waren mir auf die Dauer ein wenig eintönig vorgekommen - auch, dass er über die Lamas oft ein wenig abfällig schrieb, wollte mir nicht gefallen. Doch wie er auf einem Boot aus Yakhaut den Tsangpo hinab und der Stadt Shigatse entgegenfuhr und wie er dem Panschen Lama Auge in Auge gegenüberstand, prägte sich mir ebenso unauslöschlich ein wie seine Beschreibung tibetischer Menschen, Heiligtümer und Feste. Am meisten aber liebte ich ihn, wenn er wieder zuhause in seiner Kammer saß und von Tibet träumte und dabei Worte fand, die mir vorkamen wie der Spiegel meiner eigenen Sehnsucht. „Im Frühling des Jahres 1905 ging mir der Gedanke an eine neue Reise nach Tibet im Kopf herum.“ hieß es an einer Stelle bei Hedin. „Mein Arbeitszimmer begann mir zu eng zu werden, und wenn am Abend ringsum alles still wurde, glaubte ich im Sausen des Windes den Mahnruf zu hören: `Komm wieder zurück in die Stille der Wildnis.´ Und wenn ich morgens erwachte, horchte ich unwillkürlich, ob nicht schon draußen die Karawanenglocken läuteten. So verstrich die Zeit, der Plan gedieh zur Reife, und bald war mein Schicksal entschieden: ich musste wieder zurück in die große Freiheit der Wüste und hinaus auf die weiten Ebenen zwischen zwischen Tibets schneebedeckten Bergen.“
Auch dass der große Entdecker sein Lebensziel, die heilige Stadt Lhasa, trotz aller Bemühungen am Ende doch nicht erreicht hatte, nahm mich für ihn ein. Zum Helden gehörte die Tragik, das ahnte ich damals mehr, als ich es verstand, doch umso mehr bewunderte ich seine immer erneuerten und unverdrossenen Anläufe von der Seidenstraße, vom indischen Kaschmir aus oder als Schafhirte verkleidet über Westtibet das tibetische Kernland zu erreichen. Er hatte einem Gebirge seinen Namen gegeben, den heiligen Berg Kailash als erster Europäer umrundet und den Manasarovar-See im Sturm gemeistert - das war viel, doch der Zutritt zum Potala war ihm bis zu seinem Lebensende versagt geblieben.
Natürlich verstand ich noch nicht alles, was in der „Transhimalaja-Trilogie“ beschrieben wurde, aber Tibet als Projektionsfläche für Fernweh und Geheimnis wurde zu seinem Bestandteil meiner jugendlichen Identität. Losgelöst von seiner konkreten Geografie und Geschichte verwandelte sich Tibet für mich in eine Farbe, die Farbe des Abenteuers, von denen sich so viele wie möglich erleben wollte, wenn ich nur endlich herangewachsen wäre.
Ich wuchs heran, studierte und politisierte und empörte mich altersgerecht über alle möglichen Leiden auf der anderen Seite des Planeten. Dass meine Kommilitonen, die sich über die Vorgänge in Vietnam so inbrünstig erregen konnten, sich für die tibetischen Leiden unter der chinesischen Knute so wenig interessierten, verwunderte mich allerdings. Im Gegenteil: die delirierenden Jugendbanden, die damals als „Rote Garden“ die tibetischen Klöster und Heiligtümer zerstörten, wo immer sie sie fanden, galten vielen meiner linksgepolten Freunde als Vorbilder im Kampf für eine bessere Zukunft, in dem offensichtlich für Tibet kein Platz mehr sein sollte.
Das war die Zeit, in der ich in einem Kölner Antiquariat ein zerlesenes Taschenbuch fand, das mich sofort von der ersten Zeile an fesselte und meine Tibet-Passion erneut befeuerte: „Mein Weg durch Himmel und Höllen“ von Alexandra David-Neél.
Alexandra David-Neél wurde meine zweite, meine ganz andere Lehrerin für Tibet. Auch in ihren Schriften fand ich jenen Zusammenklang von Traum und Fernweh, den ich schon von Sven Hedin her kannte, diesmal jedoch noch eine Spur unbedingter, fanatischer und entschlossener. „Ich habe mehr als einmal bitter geweint, weil ich zutiefst fühlte, wie das Leben verrann, wie die Tage meiner Jugend leer, freudlos und öde vorübergingen“, schrieb bereits die junge Alexandra. „Ich war mir bewusst, dass ich eine Zeit unnötig vertat, die niemals wiederkehren würde, dass ich Stunden verlor die wunderbar hätten sein können.“ Als wolle sie sich auf diese wunderbaren Stunden so früh wie möglich vorbereiten, begann sich schon das kleine Mädchen nach Regeln abzuhärten, die sie den Lebensgeschichten christlicher Heiliger entnommen hatte. „Entbehrungen ließen mich kalt. Ich war nicht im Geringsten eitel. Kleider und Putz sagten mir überhaupt nichts: ich verachtete den Komfort. Der Geist, dachte ich, muss den Körper beherrschen und ihn zu einem willigen und widerstandsfähigen Instrument gestalten, auf den er sich in jeder Situation verlassen kann.“
So vorbereitet, hat sich Alexandra David Neél in einem abenteuerlichen Leben ihre Träume in einer Weise erfüllt, wie es nur wenigen Menschen vergönnt gewesen ist. Über die theosophischen Zirkel in London, über ein Engagement als Opernsängerin in Hanoi und eine Vernunftehe mit dem Schürzenjäger Philipp Neél führt sie ihr Weg in die Eremitagen des Himalaja, wo sie auf den Rat des 13. Dalai Lama hin Tibetisch studierte, ehe sie nach dem ersten Weltkrieg an der Seite eines jugendlichen Rotmützen-Lamas von Amdo aus ihre jahrelange Odyssee durch Tibet begann, an deren Ende es ihr tatsächlich gelang, sich als Pilgerin verkleidet zwei Monate in Lhasa aufzuhalten.
Die Belesenheit und Bildung, aber auch die Strapazierfähigkeit der kleinen Frau grenzt von heute aus gesehen ans Unglaubliche. Wie von einem guten Geist geführt, erreichte sie fast mühelos all die heiligen Orte, nach denen sich Sven Hedin sein Leben lang vergeblich verzehrte, und doch veränderte sich, je mehr ich über sie und von ihr las, meine Einstellung ihr gegenüber ins Ambivalente. Die unbedingte Konsequenz all ihrer Handlungen wirkte auf mich übermenschlich, ihre innere Freiheit gegen alle Bindungen unbarmherzig, und ihr der altindischen Philosophie entlehntes Lebensmotto, das sie in bis in ihr hundertstes Lebensjahr durchhielt, erschien mir fast hybrid. „Sei Dir Dein eigenes Licht. Sei Dir deine eigene Zuflucht“, verkündete die berühmte Orientalistin bei jeder Gelegenheit, und auch wenn ich heute glaube, dass der Adel dieser Haltung der Besonderheit Tibets am ehesten gerecht zu werden vermag, erfüllte mich die autonome Eiseskälte, die hinter diesen Worten stand, damals mit Angst.
In den Neunzehnhundertachtzigerjahren begann ich endlich zu reisen. Aus Gründen, die hier nicht näher interessieren, besaß ich genug Zeit und Geld, um ausgedehnte Reisen durch Asien zu unternehmen - und ganz oben auf meiner Liste stand natürlich Tibet. Leider war unter den Bedingungen der chinesischen Okkupation Tibets lange Zeit an eine Tibetreise nicht zu denken. Aber eine Reise nach Nordindien und Nepal war möglich, und so flog ich mit Heinrich Harrers „Sieben Jahre in Tibet“ im Gepäck nach Indien.
Heinrich Harrer, meinem dritten und hochverehrten Tibet-Lehrer, bin ich in den unterschiedlichsten Altersstufen, in denen ich das Buch immer wieder aufs Neue las, stets mit der gleichen Begeisterung durch Tibet gefolgt. Am liebsten begleitete ich ihn auf seiner Reise durch die Schluchten des Himalaja zum Changthang oder zu seiner Audienz beim kleinen Dalai Lama, der mir anfänglich vorkam wie eine Mischung aus dem kleinen Prinzen, Mogli und dem noch kindlichen Jesus, der alle seine Lehrer mit seiner Weisheit überraschte. Harrer war es vor allem, der meine undeutlichen Ahnungen des Lhasa-Tales, des Potala und des Sommerpalastes mit Konturen versah. Vor meinen Augen entstanden Tempel und Paläste, Verschwörungen und Intrigen, ich empörte mich über die Anpasser und Verräter, die es auch auf tibetischer Seite gab, und konnte das Verhängnis gar nicht fassen, dass die Chinesen am Ende des Buches über das schutzlose Schneeland brachten.
Heinrich Harrer, der als Teilnehmer einer deutsch-österreichischen Nanga Parbat Expedition beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges von den Engländern gefangengenommen worden war, ehe ihm die Flucht nach Tibet gelang, war mir auch emotional näher als die fast übermenschliche Alexandra David Neél. Denn Harrer erscheint in seinem Buch niemals als autonomer Kompass seiner selbst, sondern als ein Verzweifelter, ein Getriebener und Gefangener, den die Sehnsucht nach der Heimat in die fantastischste Fremde trieb. Wenn ich also Heinrichs Harrers Spuren in Tibet noch nicht folgen konnte, dann wollte ich wenigstens seine Flucht aus dem Internierungslager beim nordindischen Dehra Dun bis zu den Quellen des Ganges nachvollziehen
„Bei Nacht marschieren, am Tage verstecken“, ist eines der Kapitel überschrieben, in dem Heinrich Harrer seine Flucht durch das Gangestal beschreibt. Ganz so strapaziös war meine Reise zu den Gangesquellen nicht, wenngleich der indische Bustransport von Delhi über Rishikesh und Uttarkashi nach Gangotri an Bedrängung und Bestürzung alles übertraf, was sich ein durchschnittlicher europäischer Busreisender überhaupt vorstellen konnte. Gähnende Abgründe, unbefestigte Straßenränder, Unterspülungen nach einem Wolkenbruch und haarsträubende Rangiermanöver entgegenkommender Fahrzeuge erforderten von den Bus-, Jeep- und Taxifahrern ein Ausmaß an Kaltblütigkeit und Mut, das jedem Extremsportler Ehre eingelegt hätte. Keinen halben Meter rollten die Reifen der bedrohlich schwankenden Busse an den unbefestigten Straßenrändern vorüber, während sich in der Ferne bereits das Quellgebiet des Ganges als grandiose Silhouette von Bhagirathi, Gangorti und Shivling andeutete. Wenn die indischen Busfenster nicht sehr klein und zudem auch noch vergittert gewesen wären, hätte man sich herauslehnen und geradewegs in die Abgründe blicken können, auf deren Grund der Lauf des Ganges wie ein silbernes Band aus Jade zu sehen war.
Gangotri, die Endstation aller Fernbuslinien in etwa dreitausend Höhenmetern, war ein unfrommes Nest mit lauter Wucherern, Halunken und falschen Gurus. Wer sich hier längere Zeit aufhielt, riskierte eine Gelbsucht, und so machte ich mich gleich am nächsten Morgen auf, um die letzte Etappe bis zur Quelle des Ganges zu Fuß weiterzuwandern. Der trügerisch leicht zu begehender Weg führte sachte bergauf, und nichts deutete darauf hin, dass Steinschläge, Wetterumschwünge oder die Tücken nicht trittfester Passagen jedes Jahr ihre Opfer forderten - nach Meinung der Gläubigen allerdings nur unter denjenigen, die die Wallfahrt ohne Demut begingen. An diesem Tag schien es gottlob unter den Pilgern keine Spitzbuben zu geben. Stabil, wie für die Ewigkeit an die Berge geklebt, lagen die Felsen auf den Abhängen, ein sachter Wind wehte durch das sachte ansteigende Tal, und nichts war zu hören als das Rauschen des jungen Götterflusses. Gravitätisch einherschreitende Swamis, uralte Frauen, die Rücken wie Halbmonde gebogen und auf Stöcke gestützt, die dicker als ihre Handgelenke waren, Sadhus, Bettler und Familien mit Kindern defilierten über den Pilgerpfad, begegneten mir oder überholten mich, ehe ich mich an einem Aussichtspunkt zur Rast niederließ. Ich wollte gerade weitergehen, als sich unmittelbar neben mit zwei Pilger niederließen, die mir schon gestern im Bus aufgefallen waren, ein tibetischer Mönch in rostroter Kutte und ein Europäer in der indischen Sanyasin-Tracht, die darauf bestanden, ihr Dal mit mir zu teilen. Shen, der junge tibetische Mönch, stammte aus dem indischen Dharamsala, der Residenz des Dalai Lama und dem Sitz der tibetischen Exilregierung. Er war vor sechs Wochen zu einer Pilgerfahrt zu den Gangesquellen aufgebrochen, denn auch die tibetischen Buddhisten verehren den Ganges als einen heiligen Fluss, weil seine Quellgewässer unterhalb des Bhagirathi über einen unterirdischen Wasserlauf mit dem Manasarovar-See in Westtibet verbunden sein sollen. Shens Vorfahren kamen aus Tsethang, der drittgrößten Stadt Tibets, doch er selbst war bereits im Exil geboren worden, ohne dass er bisher Gelegenheit gehabt hatte, seine Heimat zu besuchen. Erst seit einer Woche reiste er zusammen mit dem Polen Karol, einem kurzgeschorenen hageren jungen Mann mit einem gütigen Gesicht, der alle seine Zelte in der Heimat abgebrochen hatte um nun schon seit zwei Jahren in den unterschiedlichsten Ashrams Indiens die Bhagavadgita zu studieren. Auch ich erzählte von meiner Herkunft, meinem Leben, meiner Passion für Tibet, worauf mir Shen spontan und unter zustimmendem Kopfnicken von Karol erklärte, meine Sehnsucht nach Tibet sei der Überrest eines früheren Leben. „Jede Sehnsucht ist ein innerer Reflex auf Erlebnisse in vergangenen Leben“, ergänzte Karol. „Die Seele erinnert sich umso besser, je glückhafter ihre Reinkarnation in einem früheren Leben gewesen sei.“ Als skeptischer Spross der 68er-Kultur kam mir eine solche These natürlich vollkommen abartig vor, aber in der magischen Umgebung des Gangestales erschien mir plötzlich alles möglich, und so ließ ich es auf sich beruhen
Zu dritt legten wir den letzten Teil der Reise zu den Gangesquellen zurück. Inzwischen war alle Vegetation verschwunden, Geröllfelder und Moränengletscher bestimmten das Bild, als wir am späten Nachmittag das Bhagirathi-Massiv in knapp viertausend Höhenmetern erreichten. Hinter einer letzten Felsenkurve wurde schließlich das „Kuhmaul“ sichtbar, eine fünf- bis sechs Meter hohe halbkreisartige Gletscheröffnung, aus der das Gangeswasser, wie von Turbinen angetrieben, tosend herausschoss. Ein einziger Blick genügte jedoch um zu erkennen, dass die Quelle des Ganges nicht nur ein heiliger, sondern auch ein gefährlicher Ort war. Rasant überhängende Gletscherbalkone überwölbten die Quelle, und keiner der Pilger wagte sich näher als zwanzig oder dreißig Meter an das Kuhmaul heran.
Über dieses Grenzgebiet von Bhagirathi, Shivling und alle den anderen grandiosen Bergketten des Garhwal war Heinrich Harrer nach Tibet entschwunden. Von den Briten, die ihn damals verfolgten, konnte und wollte ihm keiner über diese Berge folgen, obwohl die Entfernung von den Gangesquellen zum heiligen Berg Kailash und zum Tsangpotal im Westen Tibets nicht groß sein konnte. An diesem Tag glänzten Bhagirathi und Shivling wie die Verheißung universeller Erlösung im magischen Licht der Abendsonne, als mich ein starker Impuls ergriff, einfach die Abhänge der Berge emporzuklettern und Tibet in wenigen Tagen zu erreichen. Shen, der meine Gedanken erriet, legte mir die Hand auf die Schulter und schüttelte den Kopf. „Es ist sinnlos“, sage er. „Durch diese Eislandschaft kommt nicht einmal eine Bergsteigerexpedition nach Tibet.“
Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Aber ich weiß, dass du nach Tibet reisen wirst.“
Ich wendete erstaunt den Kopf. „Wann?“ fragte ich.
„Bald“, antwortete Shen, was immer das auch heißen mochte. „Bald wirst du auf der anderen Seite der Berge stehen und vom Kailash aus nach Süden blicken. Du wirst im Manasarovar-See baden und den Jobo Shakyamuni im Johkang Tempel sehen.“
Die nächsten Wochen blieben wir zusammen, Shen, der heimatlose Mönch aus Dharamsala Karol, der Sinnsucher aus dem polnischen Kattovice, und ich reisten nach Haridwar und Rishikesh und hielten uns eine Zeitlang in der Altstadt von Delhi auf, ehe wir uns auf dem Interstate Bus Terminal in Delhi verabschiedeten.
Zu meiner Überraschung kramte Karol zum Abschied in seinem kleinen Stoffbeutel herum und holte ein abgegriffenes und zerlesenes Buch heraus. „Wenn du dich für die Ursprünge deiner Sehnsucht nach Tibet interessierst“, sagte er, „dann lies dieses Buch. Es handelt von Lama Anagarika Govinda, einem Deutschen, der in Tibet zum Lama geworden ist und alles weiß, was es über Reinkarnationen zu wissen gibt. Nimm es und lies. Ich schenke es dir.“
Shen habe ich nach meiner Rückkehr aus Indien aus den Augen verloren, Karol sollte ich noch einmal treffen, aber Lama Anagarika Govinda ist noch immer bei mir. Nach der ersten Lektüre der englischsprachigen Taschenbuchausgabe, die Karol in einem Traveller-Bookstore in Goa erworben hatte, besorgte ich mir bald eine neue Ausgabe und verschlang schließlich alles, was es von ihm und über ihn zu lesen gab. Lama Anagarika Govinda wurde mein vierter Tibet-Lehrer.
Govindas Leben ist womöglich noch fantastischer als das von Hedin, David-Neél oder Harrer. Govinda wurde als Ernst Lothar Hoffman in Deutschland als Sohn eines Deutschen und einer Bolivianerin geboren. Er studierte Philosophie, promovierte und wich vor den heraufziehenden politischen Katastrophen des europäischen Totalitarismus nach Indien aus, wo er eine Zeitlang als Lektor in Patna arbeitete, ehe er sich zum tibetischen Buddhismus bekehrte. Als Frucht seiner jahrzehntelangen theoretischen, spirituellen und praktischen Beschäftigung mit Tibet entstand „Der Weg der weißen Wolken“ das vielleicht schönste aller Tibetbücher, ein Schwanengesang auf das Schneeland, seine Absonderlichkeiten, Enormitäten und Wunder unmittelbar vor den schrecklichen Zerstörungen der chinesischen Besatzungszeit.
„Was in Tibet vor sich geht“, schrieb Govinda nach dem Einmarsch der Chinesen, „ist symptomatisch für das Schicksal der Welt. Wie auf einer ins Riesenhaften erhobenen Bühne spielt sich vor unseren Augen der Kampf zwischen zwei Welten ab, der je nach Standpunkt des Beobachters entweder als der Kampf zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Rückständigkeit und Fortschritt, zwischen Religion und Wissenschaft, Aberglaube und Vernunft gedeutet werden kann – oder als der Kampf zwischen Mensch und Maschine, geistiger Freiheit und materieller Macht, der Weisheit des Herzens und dem intellektuellen Wissen des Hirns, zwischen der Würde des menschlichen Individuums und dem Herdeninstinkt der Masse.“
Nach meiner Rückkehr von den Quellen des Ganges sah es lange Zeit ganz und gar nicht so aus, als sollte sich Shens Prophezeiung erfüllen. Beinahe hätte ich geheiratet und eine Familie gegründet, was mein gesamtes Reiseleben verändert hätte. Dann nahm mich ein anderer Beruf in Beschlag, eine erneute Trennung, eine Krankheit, und die Jahre gingen ins Land. Weit über ein Jahrzehnt hatte ich warten müssen, bis ich nach der Öffnung Tibets für den Tourismus eine Reise nach Tibet ernsthaft ins Auge fassen konnte. Nun sollte es endlich so weit sein.
Am nächsten Morgen war Frank noch immer nicht in Kathmandu eingetroffen. Es lag auch keine Nachricht für mich vor. Deswegen entschloss ich mich, die Zeit zu nutzen und zur buddhistischen Stupa von Bodnath zu fahren. Als ich Bodnath erreichte, hatte der kühle Wind, der nach den Monsungewittern durch das Tal von Kathmandu wehte, die Wolkenfronten schon wieder auseinandergetrieben. Dunkle, schmutzige, aber auch schäfchenweiße Wolken zogen ineinander verklammert über die Stadt, und wieder illuminierte die Sonne durch die Wolkenlücken hindurch wie ein wandernder Scheinwerfer das Häusermeer im Tal von Kathmandu. Die große halbmondförmige Kuppel der Stupa von Bodnath erstrahlte im gleißenden Licht, die alles sehenden Augen des Buddha blickten in die vier Himmelsrichtungen, und hoch über dem Gebäude und den dreizehn Stufen der Erleuchtung ragte der goldene Schirm, die Verbindung von weltlicher und spiritueller Sphäre, in den Himmel. Die Pilger umrundeten das Gebäude im Uhrzeigersinn und verneigten sich vor den 108 Statuen des Buddha Amitabha, des großen Buddhas des Unendlichen Lichtes, ehe sie über die verschiedenen Terrassen der Stupa bis an den Rand der Halbkugel emporstiegen Ihre Gesten, Berührungen und Gebete besaßen eine genau umrissenen Bedeutung im Rahmen der Lehre, einen Sinn, der sich mir niemals ganz erschließen würde, so sehr ich mich auch um das Verständnis der buddhistischen Lehre bemühte. Denn so imponierend sich der Buddhismus auch über ganz Asien ausgebreitet hatte, so hatte doch jedes Land der buddhistischen Lehre seine eigene und unverkennbare Note beigemischt. Hinayana und Mahayana waren grobe Kategorien für Nachschlagewerke und Schulunterricht - in Wahrheit war der Buddhismus in Thailand ein anderer als in Burma, in Sri Lanka wieder anderer als in Kambodscha, und wie viele Götter der chinesische Buddhismus wirklich kannte, hätten selbst die Experten auf Anhieb nicht sagen können.
Dabei stand am Anfang der buddhistischen Lehre der Abschied von den Göttern. Über ein halbes Jahrtausend vor Christi Geburt hatte der indische Königssohn Siddhartha Gautama, der spätere Buddha, die Lehre vom achtfachen Pfad der Erlösung verkündet, derzufolge alles Leiden durch die „Gier“ entstand – Gier nach Sinnlichkeit, Gier nach Lust, Macht oder Reichtum - kurz: durch das Streben nach Materiellem in all seinen Erscheinungsformen, so dass eine Befreiung von diesem Leid wie auch vom ewigen Kreislauf der Wiedergeburten nur in einem „Loslassen“, in der konsequenten Askese und dem Verzicht auf alle weltlichen Güter bestehen konnte. Bei der Bewältigung dieses schier unendlichen Weges war von den Göttern keine Hilfe zu erwarten - mehr noch: nach der ursprünglichen Lehre des Buddha waren sie selbst auch nur Wesenheiten auf dem Weg ins Nirwana und ebenso wie die Sterblichen dem Rad der Vergeltung unterworfen.
Niemals wäre der Buddhismus zur großen asiatischen Weltreligion geworden, hätte die buddhistische Lehre für alle Zukunft die Gläubigen auf diesem steinigen Pfad der Erlösung allein gelassen. Doch schon wenige Jahrhunderte nach dem Tod des Erleuchteten - merkwürdigerweise etwa zeitgleich mit der Ausbreitung des Christentums - triumphierte die Idee des Mitleids in einem vollständig gewandelten Buddhismus. Im Mahayana-Buddhismus, dem Buddhismus des „Großen Fahrzeuges“, entstand die Idee, dass hilfreiche Götter und Geister den Gläubigen zur Seite stehen würden: die Idee des Bodhisattvas wurde geboren, eines guten Geistes, der am Ende einer langen Kette von Wiedergeburten aus Mitleid mit den Menschen auf das eigene Erlöschen im Nirwana verzichtete, um den Gläubigen als Retter aus Not und Elend beizustehen Unversehens hatte sich auf diese Weise der strenge „gott-lose“ Buddhismus zu einer Lehre entwickelt, in dem die Menschen zu Dutzenden der unterschiedlichsten Buddhas und Abertausenden gnädiger Bodhisattvas beteten.
In dieser reformierten Gestalt erreichte der Mahayana-Buddhismus das tibetische Hochland, wo er sich in einer jahrhundertelangen Auseinandersetzung mit alttibetischem Schamanentum und hinduistischen Einflüssen zur besonderen Form des tibetischen Buddhismus entwickelte. Innerhalb der buddhistischen Karmapa-Sekte wurde dann etwa im 13. Jahrhundert der letzte Schritt auf dem Weg zur Religion der lebenden Götter vollzogen. Verzichtete der Bodhisattva im Mahayana-Buddhismus aus Mitleid mit dem Unglück der Menschen auf seinen Einzug ins Nirwana, um als hilfreicher Geist zu wirken, so kehrt er nach tibetischer Lehre, als sogenannter „Tulku“ als wiedergeborener Buddha oder Bodhisattva in der leiblichen Gestalt eines Menschen auf die Erde zurück. Der Buddha des Unendlichen Lichts, der Bodhisattva Avalokiteshvara, Maitreya, Manjushri und wie die unzähligen Namen des tibetischen Pantheons auch lauten mochten - immer wieder stiegen sie in Menschengestalt auf die Erde herab, reinkarnierten sich in sogenannten „Himmelskindern“, die gefunden und sorgfältig erzogen werden mussten, ehe sie zu amtierenden Klosteräbten oder Schulhäuptern werden konnten. Im traditionellen Tibet vor der chinesischen Besetzung waren die Spitzenpositionen aller großen tibetischen Klöster und Schulen mit der Reinkarnationslinie bestimmter Buddhas oder Bodhisattvas verbunden, so dass es nach dem Tode der jeweiligen menschlichen Verkörperung unter den kurz nachher geborenen Kindern des Landes nach einer neuen Wiederverkörperung Ausschau zu halten galt.
Welch ein gewaltiger spiritueller Weg, den der Buddhismus wie ein großer Strom mit unzähligen Nebenarmen von der Philosophie ohne Gott zur Religion der tausend Götter und schließlich der wiedergeborenen Buddhas zurückgelegt hat! Kein Wunder, dass sich auf diesem jahrtausendelangen Weg die einzelnen Arme dieses transkontinentalen Stroms gänzlich unterschiedlich entwickelt haben, auch wenn sie bis auf den heutigen Tag benachbart geblieben sind. Tibets Geschenk an die Welt war die gnadenreiche Lehre der lebenden Buddhas, die für die Gläubigen die Gewissheit bereithielt, dass sie nicht allein waren, sondern dass ihr Schicksal, so unbedeutend es auch sein mochte, über die Präsenz des Göttlichen in ihrer Umgebung mit den höchsten Sphären der Spiritualität verbunden war.
Während ich diesen Gedanken nachhing, traf der wandernde Strahl der Nachmittagssonne die westlichen Augen des Bodnath-Buddha, und mir war, als würden sie plötzlich mit Leben erfüllt. Ich erschrak, denn ich empfand, dass sie mich anblickten – dann war der Sonnenstrahl schon wieder weitergewandert, und die glühenden Augen des Bodnath Buddha waren erloschen.
Ich stand auf und umrundete noch einmal die große Stupa, bewegte die Gebetstrommeln, berührte den warmen Stein und blickte hinauf zu dem Schirm, der sich an der obersten Spitze der Stupa befand. So wie die Stupa von Bodnath sich an diesem Abend über mir erhob, repräsentierte sie nicht nur das symbolische Abbild des Weltberges Meru, dem Sitz der obersten Götter im Zentrum des Universums, sondern auch eine Verheißung, denn in nur wenigen Wochen würde ich selbst im Westen Tibets vor dem Kailash stehen, dem heiligsten aller Berge und dem Statthalter des Meru in der diesseitigen Welt.
Als ich am nächsten Morgen den Frühstücksraum des Hotels betrat, sah ich, dass Frank eingetroffen war. Er hatte den Nachtbus genommen und trank gerade seinen Morgentschai. Frank war mittelgroß und schlank, hatte eine hohe Stirn, dunkle, leicht gelockten Haare, eine herrischen Nase und große ausdrucksstarke Augen. Er war ein sogenannter „Indien Freak“, einer jener Figuren, die von ihren ersten Reiseerfahrungen an ihr Herz an den indischen Subkontinent verloren hatten, wobei es ganz gleich war, ob es sich dabei um Indien, Pakistan, Bangla Desch oder den Himalaja handelte. Aber auch er war von dem Gedanken Lhasa, Shigatse oder den Kailash zu sehen, genauso besessen wie ich. Er hatte den Plan einer Tibetreise ganz unabhängig von mir schon seit längerem verfolgt, Erkundigungen eingezogen und Kontakte geknüpft und war wahrscheinlich genauso überrascht wie ich, jemanden zu finden, der das gleiche Ziel verfolgte.
Frank hatte nach einer halbjährigen Vorbereitung in den letzten Wochen vor meiner Ankunft in Kathmandu unsere Reise nach Tibet endgültig glattgezurrt. Ein Lastwagen, ein Jeep, Köche, Sherpas und Guides sollten in den nächsten Tagen für uns bereitstehen - falls alles glattgegangen war.
Deswegen kam ich nach der Begrüßung auch gleich zur Sache. „Ist alles ok?“ fragte ich.
„Beinahe“, antwortete Frank. „Aber es gibt ein Problem.“
Mir rutschte das Herz in die Hose. Wenn jetzt noch die gesamte Reise platzen würde, hätte ich nicht gewusst, wie ich reagieren würde. Alle beruflichen und privaten Termine waren mit dem Vorlauf eines ganzen Jahres auf diese Reise ausgerichtet worden. Auch eine Verschiebung der Reise kam nicht in Frage, denn in einigen Wochen würden die Pässe nach Tibet kaum noch passierbar sein.
„Was gibt es für ein Problem?“ fragte ich.
„Wir starten zwei Tage früher. Wir fahren morgen früh“, antwortete Frank und schlug mir auf die Schulter.
IV In der Hölle des Milarepa
Es waren Bilder wie nach der Sintflut, als wir am nächsten Morgen den Wagen nach Tibet bestiegen. Die ganze Nacht hatte es wieder geregnet, knöchelhoch stand das Wasser in den Gassen. Das Licht der morgendlichen Tschaifeuer spiegelte sich in den Pfützen, während für die Menschen im Halbdunkel der Toreingänge der Tag begann. An einer Ecke sah ich durch die Fensterscheiben in weit aufgerissene Kinderaugen, Kühe lagen am Rande der Straße, die Abfallhaufen waren mit einem pappigen, feuchten Film überzogen.
Bald hatten wir Kathmandu verlassen, nepalesische Popmusik tönte aus dem Autoradio, als wir die große Ausfallstraße nach Norden erreichten. Unser Fahrer sollte uns heute bis an die chinesische Grenze bringen, jenseits derer wir auf unsere Crew stoßen würden. Es war höchste Zeit, denn spätestens im Juli begann sich das alljährliche Zeitfenster für eine Reise nach Tibet zu schließen. Die Hochlandpässe nach Tibet waren zu dieser Jahreszeit eisfrei, doch der Sommermonsun würde schon damit begonnen haben, die Straßenführungen zu unterspülen. Noch zwei Wochen, und die Passage durch den Himalaja wäre ein Hasardspiel. Auch in Tibet würde uns die Geografie die Reiseroute diktieren: das Tal des Tsangpo würden wir gleich nach unserer Ankunft in Tibet so schnell wie möglich nach Westen durchqueren müssen, ehe die Schneeschmelze ihre volle Kraft entfalten und jedes Durchkommen bis zum Kailash unmöglich machen würde. Erst danach würden wir unseren Rückweg über das extrem hoch gelegene Changthang Plateau suchen müssen, um zum Finale unserer Reise das sattgrüne und relativ warme Zentraltibet zu erreichen.
Kurz bevor wir den Arniko Highway, die Straße durch den Himalaja, erreichten, stoppte der Wagen an einer Kreuzung, und zwei Gestalten mit Rucksäcken und Regenumhängen stiegen ein.
„Das sind die Sherpas“, kommentierte unser Fahrer. „Sie steigen schon hier ein. Der Rest der Crew wartet in Zanghmu.“
Frank, der eingeschlafen war, wachte auf und blickte mit halb zugeklebten Augen auf unsere neuen Begleiter. „Hallo“, sagte er müde und drehte sich wieder um. Der ältere der beiden Sherpas stellte sich als Tensing vor. Wie die meisten Nepali trug er seine tiefschwarzen Haare kurzgeschnitten. Er war kräftig gebaut und hatte ein rundliches Gesicht mit großen mandelförmigen Augen, einen sensiblen, weichen Zug um den Mund und eine überraschend tiefe Stimme.
Sein Partner, der Zeltsherpa Mun, sah aus wie ein junger Fuchs mit schrägstehenden Augen. Er wirkte auf mich zerbrechlich und unsicher, und als ich ihm die Hand gab, blickte er an mir vorbei, um sich gleich nach der Begrüßung ganz nach hinten zu setzen. Erst später erfuhr ich, dass unsere Tour Muns erste Reise als Sherpa war, und dass er schon das eine oder andere von der unberechenbaren Launenhaftigkeit der westlichen Kundschaft gehört hatte.
Keine Reise im Himalaja kann ein Erfolg werden, wenn du die falschen Sherpa dabei hast, heißt es irgendwo bei Sven Hedin. Aber woran erkennt man einen guten Sherpa? Von meinen früheren Wanderungen durch Nepal wusste ich nur, dass die guten Sherpas meistens nicht die waren, die viel redeten. Deswegen war es mir ganz recht, dass Tensing und Mun, kaum hatten sie ihre Plätze im Bus gefunden, sich einfach auf ihre Rücksäcke legten und einschliefen.
Inzwischen war die Morgensonne aufgegangen. Die Reisfelder und Wälder links und rechts der Straße schickten ihre nächtliche Feuchtigkeit als Nebelschwaden in den Himmel, so dass unser Fahrzeug wie durch eine endlose Reihe milchigweißer Vorhänge in den erwachenden Tag hineinfuhr. Erst in Dhulikhel wurde die Sicht etwas klarer. Nun hatten sich die Morgennebel zu weißen Wolkenschlangen zusammengeklumpt, die die umliegenden Bergabhänge wie Lametta verzierten. Für wenige Augenblicke hatte sich der Regenvorhang des Sommermonsuns vom Horizont zurückgezogen, um einen Blick auf eine fantastische Märchenwelt zu gestatten: Wie auf eine Familie von Riesen, bei denen der Fernere immer größer ist als der Nähere, mit weißen Fäden verziert, von denen man nicht sagen konnte, ob es Schneefelder oder Wolkenfetzen waren, so blickten wir für eine Sekunde in das feuchte Herz des Himalaja. Eine Unendlichkeit von Reisterassen wurden sichtbar, die einem System zerbrochener Spiegel glichen, die wie Brenngläser das Licht der Sonne reflektierten, wenn sie hier und da für wenige Augenblicke die Wolkendecke durchbrach. Dann schoben sich wieder die Wolken vor das Bild, und alles versank in einem stumpfen blaugrau.
Hinter Dhulikhel begann es wieder zu regnen. Die Straße war nun endgültig zu einer Piste geworden, unbefestigt und zunehmend rutschiger zog sie sich durch die Täler und passierte ein ärmliches Nepali-Dorf nach dem nächsten. Wasserbüffel standen teilnahmslos in einem Reisfeld, eine Mutter, die ihr Kind in einem Korb auf dem Rücken trug, hob die Hand und wollte mitgenommen werden, doch unser Fahrer winkte ab. „Diese Bauern bringen nur Dreck“, sagte er wegwerfend. „Außerdem klauen sie. Sollen sie doch den Bus nehmen.“ Tatsächlich kamen uns manchmal auch Busse entgegen, uralte Gefährte, die wie betrunkene Kolosse auf der glitschigen Straße an uns vorbeifuhren.
So vergingen die Stunden, ohne dass sich am Wetter oder an der Umgebung etwas Wesentliches änderte. Allerdings wurden die Reisefelder seltener, die Dörfer noch eine Spur erbärmlicher. Hinter Balabisa lagen noch die karrengroßen Felsbrocken in der Gegend herum, die beim letzten Steinschlag ins Tal herabgestürzt waren, doch die Straße war notdürftig freigeräumt. Der Fahrer küsste kurz die Ganesh Staue auf seinem Armaturenbrett, blickte die Bergabhänge hoch, an denen wegen des Nebels ohnehin nichts zu sehen war, und gab Gas. Wenn es jetzt krachte, war ohnehin nichts mehr zu machen.
Am frühen Nachmittag erreichten wir den Grenzort Kodari, ein langgezogenes Nest in einer Höhe von knapp 1800 Metern über dem Meeresspiegel. Von alters her nur eine Etappe auf den uralten Salzkarawanenrouten zwischen Tibet nach Nepal, hatte sich Kodari nach der Fertigstellung der Himalajastraße zu einem turbulenten Schnittpunkt der Welten entwickelt. Hier kreuzten sich die Wege von Gurkhas, Sherpas und Newaris, von Uiguren, Chinesen und Tibetern mit denen der wenigen Touristen, die überland nach Tibet reisen wollen. Eigentlich bestand der ganze Ort nur aus einer einzigen Straße, die tagaus tagein von Karren, Lastwagen, Bussen oder Gespannen verstopft war, so dass sich die Annäherung an die nepalesisch-tibetische Grenze etwa nach dem Prinzip einer Kniffel-Aufgabe vollzog: “Bringen Sie den roten Wagen möglichst schnell durch, ohne das die anderen es merken.“ Aber alle merkten es, alle drängelten, schnitten, rangierten und überholten so gut sie konnten, sodass das ineinander verkeilte Chaos immer unentwirrbarer wurde, je mehr wir uns der Grenze näherten.
Auf diese Weise dauerte es geschlagene zwei Stunden, ehe wir die nepalesisch-tibetische Grenze erreichten, eine unscheinbare graue Bogenbrücke, an deren Auffahrt nepalesische und chinesische Grenzbeamte die Reisedokumente kontrollierten. Je schlimmer der Anblick, desto freundlicher der Name, dachte ich, denn dieses Gebilde aus großen Schlaglöchern und fragmentarischen Brüstungen trug den stolzen Namen „Freundschaftsbrücke“.
„Einmal am Tag stürzt die Brücke ein“, spottete unser Fahrer, „hoffentlich nicht gerade dann, wenn wir auf der Brücke sind.“
Tatsächlich hatten wir Glück. Gerade als sich an der Abfertigung nur noch ein einziges Fahrzeug vor uns befand, stürzte urplötzlich und merkwürdig geräuschlos ein ganzes Brückenstück in die Tiefe. Der Zement hatte sich wie Fleisch von den Knochen gelöst, und während die Steine im reißenden Kodari-River unter uns verschwanden, war die Verbindung von Nepal und China auf ein zwei Meter langes Gestängegewirr reduziert.
Wirklich aufzuregen aber schien dieses Malheur jedoch Niemanden. Die Grenzbeamten zuckten nur mit den Schultern, da trat schon die ortsansässige Reparaturkolonne in Aktion. Eine Gruppe wüst aussehender chinesischer Straßenarbeiter erschien mit Zementsäcken, Hacken und Schubkarren und begann übergangslos zu rackern, als ginge es um ihr Leben. In gerademal einer guten Stunde hatten die sechs Wanderarbeiter aus Mörtel, Stangen, breiten Brettern und Schlamm das Loch in der Brücke so notdürftig wieder zugeschüttet, dass es wohl für den Rest des Tages keine Zwischenfälle mehr geben würde.
Die Nepalis beobachteten diese Arbeitsschlacht mit einer Mischung aus Staunen und Belustigung. “Diese Chinesen sind verrückt", sagte ein Lastwagenfahrer. "Sie arbeiten für ein paar Rupien wie die Sklaven.“
Hinter der Grenze befand sich ein großer Parkplatz, die Endstation für alle Fahrzeuge aus Nepal. Während Frank und ich, von Tensing und Mun unterstützt, unser gesamtes Gepäck auf die Ladefläche eines bereitstehenden chinesischen Dongfeng-Lastwagens umräumten, steckte sich unser Fahrer in aller Seelenruhe eine weitere Zigarette an. Ehe ich mich versah, war mein kleiner Rucksack mit meinem Fernglas und meinem MP3-Player verschwunden, Frank schlug einem Uiguren auf die Finger, der sich an seiner Jackentasche zu schaffen machte.
„Schön aufpassen“, rief uns der Fahrer zum Abschied. „Wenn ihr oben ankommt und euere großen Rucksäcke noch habt, könnt Ihr zufrieden sein.“ Mit lässiger Geste winkte er zum Abschied, ehe er wieder in seinen Wagen stieg und zurück nach Kathmandu fuhr.
„Alle Gepäcktücke festhalten“, rief Tensing auf Englisch, als er sich auf unsere Rucksäcke setzte. Wie in einem überfüllten Hühnerkäfig standen, lagen oder hockten einige Dutzend Menschen auf der offenen Ladefläche, als der Truck losfuhr, eine bunt durchmischte Gesellschaft voller Männer, Frauen und Kindern, Reisenden und Händlern, ehrlichen Leuten und Spitzbuben, von denen sich einer mein Fernglas und meinen MP3-Player unter den Nagel gerissen hatte.
Nur wenige Kilometer auf einer rutschigen Piste, aber fast eintausend Höhenmeter trennen die Grenzstation Kodari von Zanghmu, einer Retortenstadt, die die Chinesen wie einen schmutzigen Adlerhorst in einer Höhe von etwa 2.700m in die Abhänge der Berge hineingebaut erbaut hatten. Der Grenzkonvoi aus mehreren Fahrzeugen, der sich wie eine Karawane im Schneckentempo die glitschigen Straßen emporwand, benötigte für diese Strecke fast eine ganze Stunde. Das Kodari Tal mit der baufälligen Freundschaftsbrücke verschwand tief unter uns, und bald sahen wir nur noch die endlose Fahrzeugschlange vor der Grenze wie einen dünnen Faden, der sich im Nebel aufzulösen schien.
Als wir Zanghmu erreichten, herrschte eine Atmosphäre wie in einem Gulag. Regen, Eis und Sturm hatten in Wechsel der Gezeiten den Asphalt von der Straße gerissen, und als wäre das nicht genug, riss ein fanatischer Maschinenführer gleich neben der Grenzstation am Steuerknüppel einer riesenhaften Bulldozermaschine ganze Felsen, Wurzeln und Bäume aus den Eingeweiden des Berges. Wieder goss es wie aus Kübeln, so dass wir eine halbe Stunde im Regen warten mussten, ehe die chinesischen Grenzbeamten sich dazu bequemten, aus ihrem Häuschen zu kommen.
Das Zanghmu Hotel war wie die Stadt, ein Haufen Müll in den Wolken. Die Kabel hingen aus den Wänden, die Teppiche waren feucht, die Matratzen so verwanzt, dass wir sofort unsere Schlafsäcke auspackten. Obwohl es regnete, als stünde das jüngste Gericht unmittelbar bevor, gab es im ganzen Hotel kein fließendes Wasser. In den Toiletten schissen die Gäste einfach auf die Würste ihrer unmittelbaren Vorgänger oder pinkelten in hohem Bogen aus dem Fenster hinaus. Ein unbeschreiblicher Gestank zog durch die Gänge, so dass wir nur das Gepäck deponierten, die Kleidung wechselten und so schnell wie möglich das Hotel verließen.
Aber offenbar ist kein Platz auf der Welt so schäbig, dass es nicht noch etwas zu handeln gäbe. Zu meiner Überraschung existierte in Zanghmu ein überdachter Markt, auf dem Chinesen, Nepali und Tibeter allerlei Elektronik, Textilien und Schmuck austauschten. Wie die Angehörigen unterschiedlicher Spezies wuselten die flinken Nepali und die geschäftstüchtigen Chinesen durcheinander, flankiert von tibetischen Lastenträgern, Tagelöhnern oder Nomaden. die in ihrer abgerissenen Landestracht scheinbar unbeteiligt neben dem Geschehen standen, als wären sie nur Gäste in ihrem eigenen Land. Sogar eine „Bank of China“ hatte in Zanghmu geöffnet - wenigstens theoretisch, denn als wir uns nach den Wechselkursen erkundigten, blieben wir völlig unbeachtet. Die beiden Chinesinnen hinter dem Tresen hatten weitab der Heimat anscheinend eine Menge zu bereden, und als wir es wagten, nach einer höflichen Wartezeit leise zu insistierten, gab es nur ein unfreundliches „Meo“ „Meo“, „Meo“, die Universalauskunft des chinesischen Amtsträgers, die in etwa so viel bedeutet wie „Haben wir nicht“, „Bekommen wir nicht“ und „Können wir auch nicht.“
Nachdem wir vergeblich versucht hatten, in der Bank of Zanghmu irgendein Zahlungsmittel zu wechseln, führten uns Tensing und Mun zum Ortsrand, wo wir Kelsang, Kunga und Topchin kennenlernten, unsere tibetischen Guides, die uns auf dem größten Teil unserer Reise durch Tibet begleiten würden. Alle drei waren bereits einen Tag vorher aus Lhasa kommend in Zanghmu eingetroffen, wo sie wohlweislich kein Hotel bezogen sondern im überdachten Laderaum ihres großen Dongfeng-Lastwagens geschlafen hatten.
Kelsang, eine temperamentvolle junge Tibeterin, begrüßte uns in fließendem Englisch mit einer Tasse heißen Tees, die sie auf einem kleinen Kocher neben den Fahrzeugen zubereitet hatte. Sie hatte ein offenes, sympathisches Gesicht mit den hohen Wangenknochen, die den tibetischen Menschen aus der Perspektive des Europäers ebenso fremdartig wie attraktiv erscheinen lassen. Offenbar kannte sie Tensing bereits, den sie ebenso wie Mun umarmte, und auch unsere geplante Route war ihr bekannt. Dreimal ließ sie sich unsere Namen buchstabieren, wiederholte und modulierte sie zur kindischen Freude aller Anwesenden, bis sie sie beherrschte und stellte uns dann die beiden Fahrer vor. Kunga, ein kleiner, etwas verwachsener Tibeter mit einer Stoppelfrisur und einer Knollennase, war der Fahrer des Jeeps. Er nickte zu allem und jedem, was auch nur irgendwer gerade sagte, verstand aber kein Wort Englisch und sollte während in den folgenden Wochen, egal ob im Schneeregen des Changthang oder im Sumpf der Tschochenpiste, immer nur im gleichen grünbraunen Anzug herumlaufen. Sein ganzes Sinnen und Trachten würde zuerst und vor allem seinem eierschalenfarbenen Jeep gelten, den er in jeder freien Minute reinigen und pflegen würde, bis er schließlich - kurz vor Ende der Reise, als der Wagen schließlich schrottreif gefahren worden war - mit ihm alleine in einem Nonnenkloster zurückbleiben sollte.
Von ganz anderem Kaliber war Topchin, der Fahrer des großen chinesischen Dongfeng-Lastwagens, auf dessen Ladefläche sich bereits unsere gesamte Expeditionsausrüstung befand. Topchin trug einen Hut wie ein Cowboy, er war großgewachsen, breitschultrig und kräftig, hatte ein sympathisches, intelligentes Gesicht und Hände wie Schaufeln, denen man auf den ersten Blick ihr handwerkliches Geschick keineswegs ansah. Topchin war die tibetische Hochlandvariante von Tensing, kräftiger, urwüchsiger und kantiger, aber von der gleichen Kompetenz und Zuverlässigkeit, die ihn mit seinem Dongfeng-Lastwagen schon durch ganz China geführt hatte. Wie wir später erfuhren, hatte Topchin am Beginn seiner Karriere auf fremde Rechnung über die Szechuan-Route Fernsehgeräte zwischen der chinesischen Stadt Chengdu in Szechuan und Lhasa in Tibet geschmuggelt, Grenzbeamte und Banditen in Amdo bestochen, sich mit den Wölfen im Hochland von Kham herumgeschlagen, ehe er mit seinem eigenen Fahrzeug und einigen Gehilfen über den sogenannten „Tibet-Highway“ kostbare Holzarbeiten vom Uigurenmarkt in Kashgar nach Shigatse brachte. Weil die Gewinnspannen im Tourismus zu seiner Überraschung die Profitmargen von Kühlschränken, Fernsehgeräten oder Holzarbeiten noch um ein Beträchtliches überschritten, arbeitete er nun im Tourismus. Schon bei unserer ersten Begrüßung ging etwas Starkes von ihm aus, ohne dass man auf Anhieb hätte sagen können, was es war. Er sprach nicht viel, doch wenn er etwas sagte, stockte das Gespräch und alle hörten zu. Frank und mich sollte er während der ganzen Reise nur ganz selten direkt ansprechen, vielleicht genierte er sich wegen seiner unzureichenden Englischkenntnisse, doch wusste er sich durch wenige, treffende Gesten verständlich zu machen.
Noch bevor es am nächsten Morgen hell wurde, verließen Frank, Tensing, Mun und ich das stinkende Zanghmu Hotel. Der große Lastwagen und der Jeep warteten schon in der Dunkelheit, die Sachen wurden verstaut, dann begann unsere Reise in die Wolken.
Bald lag das unwirtliche Zanghmu hinter uns, und schnell ging es in atemberaubenden Serpentinen in die Höhe. Es dauerte nicht lange, da waren die Bäume verschwunden, die Abhänge wurden kahler, ohne dass deswegen die Straßen rutschsicherer geworden wären. Aus den Tälern, die wir weit unter uns gelassen hatten, folgte uns der feuchte Nebel, der uns bald so vollständig einhüllte, dass sich die Sicht schon in einer Entfernung von wenigen Metern verlor. Ich dachte an die Transamericana im guatemaltekisch-mexikanischen Grenzgebiet, wo die Fernbusse die Wolken durchstießen und immer wieder in die Schluchten stürzten. Aber im Unterschied zu Guatemala waren die Straßen jenseits von Zanghmu weder geteert noch befestigt, und je gefährlicher die Pisten wurden, desto mehr erschwerten Regen, Nebel, Dunst und Unterspülungen die Orientierung. Auch wenn man die schwindelerregenden Abgründe jenseits der unbefestigten Straßenränder wegen des Nebels kaum sehen konnte – ihre gefährliche Nähe war so sicher wie die Präsenz der der chinesischen Kontrollposten an jedem kleinen Pass oder Ortseingang.
Erst in einer Höhe von weit über viertausend Höhenmetern riss endlich der Nebel auf. Der Grenzbereich des südasiatischen Monsuns war erreicht. Unter dunklen Wolkenwänden, gleißenden Himmelspassagen und eiskalten Schattenfronten durchfuhren wir eine unwirkliche Szenerie mit endlosen Geröllfeldern, spärlichem Ginsterbewuchs und wie abrasiert wirkenden Buckelbergen. Ein bitterkalter Wind peitschte über die kargen Ebenen, auf denen die Nomaden ihre Yak-Herden grasen ließen. Windschiefe Jurten standen am Rand der Weiden, wie rasend bellende Hirtenhunde rannten hinter unseren Fahrzeugen her.
„Nyalam“ - „Hölle“ nannte der tibetische Yogi Milarepa das nepalesisch-tibetische Grenzland, in dem er im zwölften Jahrhundert unserer Zeitrechnung einige Jahre meditiert haben soll. Zerlumpte Kinder, denen der Rotz wie eine kleine Moränenlandschaft über Mund und Kinn lief, begannen zu betteln, kaum, dass wir die Fahrzeuge verlassen hatten. Ein Mönch, ein Soldat und ein
Nomade mit einer Ziegenherde standen plötzlich neben unseren Fahrzeugen, und in dieser Begleitung besuchten wir die Meditationshöhle des Milarepa, vor deren Eingang der 5. Dalai Lama im 17. Jahrhundert ein kleines Klostergebäude hatte erbauen lassen.
Das Klostergebäude war geschlossen, doch die Meditationshöhle des Milarepa stand für Besucher offen. Nur wenige Meter genügten, um die klirrende Kälte des Gesteins zu spüren. Mit jedem Schritt wurde es eisiger, weißer Hauch entstieg unseren Mündern, und der Widerschein der Butterkerzen erfüllte die uralte Höhle mit einer gespenstigen Lebendigkeit. Ich dachte an die Säulenheiligen der Spätantike, die unverdrossen in der glühenden Hitze auf ihren Emporen gestanden hatten - Milarepa, der als tantrischer Magier nach Belieben „tummo“, eine durch Yoga erzeugte innere Wärme hervorrufen konnte, repräsentierte offenbar das entgegengesetzte klimatische Kasteiungsprinzip: die Meditation und Versenkung im Permafrost. Kelsang, Kunga und Topchin verbeugten sich vor diversen Felsen und Steinen, auf denen nach der Überlieferung die Fuß- und Handabdrücke des Meisters zu sehen sein sollten. Für sie war der große Yogi keine geschichtlich abgelegte Gestalt, sondern eine gegenwärtige Wesenheit, ein großer buddhistischer Lehrer und Hochlandbarde, der in seinen „Hunderttausend Gesängen“ dem Volk die Feinheiten der buddhistischen Mahayana- Theologie in Gleichnissen und Geschichten verdeutlicht hatte. Milarepa, ein Zeitgenosse der mohammedanischen Sufis und jener christlichen Cluniazenser, die die abendländische Kreuzzugsbewegung ins Werk gesetzt hatten, war aber auch als Missionar erfolgreich gewesen. Vom Westen Tibets und dem heiligen Berg Kailash kommend, hatte Milarepa im frühen 12. Jahrhundert das tibetische Kernland erreicht, um es diesmal entgültig für den Buddhismus zu gewinnen.
Hinter Nyalam, das auf einer Höhe von knapp viertausend Metern lag, führte eine breite steinige Straße zum 5.055m hohen Lalung-Le Pass, auf dessen Scheitelpunkt man bei gutem Wetter dem Himalaja gewissermaßen in den Rücken hätte sehen können. Doch was man im Sommer von Dhulikhel in Nepal aus nicht erspähen kann, wird man auch von der anderen Seite nicht in den Blick bekommen. Wolken in allen Farbschattierungen von schwarzdunkel bis schäfchenhell, hier und da unterbrochen von tiefblauen Himmelsinseln, versperrten den Blick auf die Eisriesen des mittleren Himalaja. Sowohl der Gipfel des über siebentausendfünfhundert Meter hohen Chogsam wie auch die über achttausend Meter hohe Shisha Pagma-Kette verblieben hinter einer tiefschwarzen Wolkenfront. Umtost von eiskalten Winden glich der Lalung-Le Pass einem verwaisten Aussichtspunkt oberhalb der Welt, und die namenlosen Sechs- und Siebentausender, die ihn zur Gänze umgaben, erschienen in dieser Höhe nur als eine Ansammlung einsamer Hügel.
Hinter dem Lalung-Le Pass führte die Straße auf die Hochebene von Tingri, einem weitgezogenen Plateau auf einer Höhe von gut viertausenddreihundert Metern. Wir sahen die ersten Yakherden, eine Jurte, in deren Umgebung eine Herde Ziegen zum Melken zusammengebunden wurde, dann wieder lange Zeit nichts als Steintschörten und eine satt durchfeuchtete Landschaft, über der sich schwarzgraue Wolkendächer wölbten. Mitten hinein in diese Düsterkeit führte der Abzweig nach Rongbuk, einem etwa fünftausend Meter hoch gelegenen Kloster, hinter dem die Profis vom tibetischen Everest Base Camp aus die Besteigung des höchsten Berges der Welt in Angriff nahmen.
An derartige Heldentaten aber war für uns an diesem Tag nicht zu denken - im Gegenteil: der schnelle Anstieg über Zanghmu nach Nyalam und schließlich zum Lalung-Le Pass, der uns in nur einem einzigen Reisetag von 2.700 auf über 5.000 Höhenmetern geführt hatte, begann sich bemerkbar zu machen. Als wir am Abend das Qomolangma Hotel erreichten, plagten uns bereits starke Kopfschmerzen, die ersten und untrüglichen Symptome der Höhenkrankheit. Frank war ebenso bleich wie ich, und zum erstenmal waren wir froh, nicht anfassen zu müssen, als unser Gepäck in die kleinen Zimmer des Qomolangma Hotels verfrachtet wurde.
Von meiner letzten Erkrankung in Bolivien wusste ich, dass eine einmal ausgebrochene Höhenkrankheit zwar nicht mehr aufzuhalten, aber durchaus in ihrem Verlauf zu lindern war, vor allem, wenn man sich an die Erfahrungen der Einheimischen hielt. Auf dem bolivianischen Altiplano bedeutete das: cocahaltigen Mate-Tee trinken und darauf hoffen, dass die Symptome nach einem Tag verschwinden würden. Was in Bolivien mit dem Mate-Tee möglich war, funktionierte in Tibet mit dem Buttertee, einem salzhaltigen dickflüssigen Gebräu aus Yakbutter, das dem europäischen Gaumen etwa so schmeckt wie eine Tasse Lebertran mit drei Esslöffeln Salz. Während Frank und ich im Aufenthaltsraum des Qomolangma Hotels unschlüssig an der warmen, ranzig duftenden Flüssigkeit nippten, kippten Kelsang, Kunga und Topchin ebenso wie Tensing und Mun einen Becher Buttertee nach dem nächsten in sich hinein. Eigentlich war die Stimmung gut, draußen hatte ein Sturm begonnen, drinnen bollerte ein warmer Ofen unter jedem der großen Tische, so dass wir in behaglicher Wärme von Sven Hedins Abentern hätten erzählen können, wenn unser Befinden nicht stündlich schlechter geworden wäre.
Appetitlos und mit schmerzenden Knochen zogen Frank und ich uns schließlich in unsere Zimmer zurück. Doch an Schlafen war nicht zu denken - mehr noch: kaum lagen wir in unseren eiskalten Betten, steigerte sich die Pein zu ungeahnten Höhen. Das untergründige Kopfweh hatte einem stechenden, dolchartigen Schmerz platzgemacht, einem Gefühl, als sei der Kopf in ein Nadelkissen eingeklemmt, aus dem sich tausend winzige Messer in den Schädel bohrten. Keine Pein ist so schlimm, dass sie nicht noch schlimmer werden könnte, heißt es im “Bardo“, im buddhistischen Totenbuch, und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis zu den kaum noch erträglichen Kopfschmerzen ein erschreckendes Herzpumpen hinzukam. Und so sehr ich auch versuchte, durch alle möglichen Atemtechniken, Meditiationsübungen oder Körperhaltungen meine Qualen zu lindern - der einzige Effekt, der sich nach diesen Bemühungen einstellte, war eine unbeschreibliche Übelkeit, die mir zu meiner Überraschung noch quälender erschien als die Kopfschmerzen und das Herzpumpen.
Kurz nach Mitternacht sprang Frank wie von einer Tarantel gestochen auf und öffnete die Türe zum Hof. Augenblicklich erfüllte ein nasskalter Schwall kalter Luft das muffige Zimmer, ein Gewitter tobte über der Hochebene von Tingri, und der Himmel flackerte, als wäre das Ende aller Tage angebrochen. Zwei Hunde jaulten draußen zum Gotterbarmen, und für einen Augenblick fürchtete ich, sie würden uns in unserer Leidenskammer einen Besuch abstatten. Dann hörten wir die Geräusche eines Kampfes auf Leben und Tod, offenbar war ein dritter Hund im Hof erscheinen, der jetzt von den beiden Revierinhabern zerfleischt wurde. „Das ist die Hölle des Milarepa“, dachte ich immer wieder, während ich alle Geräusche der Außenwelt nur wie durch einen heißen Vorhang aus Schmerzen wahrnahm. Irgendwann schlief ich ein.
Als ich im Morgengrauen wieder erwachte, hatte sich mein Herzschlag normalisiert. Kopfschmerzen und Übelkeit waren einer latenten Benommenheit und Schwäche gewichen, doch im Vergleich zu den Unbilden der letzten Nacht waren diese Beeinträchtigungen locker zu ertragen.
Kelsang kam aus ihrer Schlafkammer und klopfte mir aufmunternd auf die Schulter, als ich die ersten wackeligen Schritte im Hof unternahm. Sie reichte uns einen Becher Buttertee, lachte und erzählte von Sir Edmund Hillary, dem Erstbesteiger des Mount Everest, der eine Gruppe neuseeländischer Politiker durch den Himalaja führen wollte und als erster höhenkrank wieder ins Tal geflogen werden musste. Frank, der jeden Extrembergsteiger bewunderte, zog einen Flunsch, ich dagegen fand es nett, dass Kelsang das sagte.