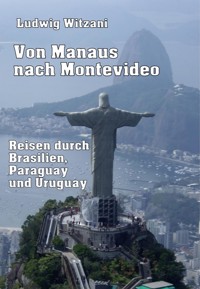Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Am Anfang war die ganze Welt Amerika" hatte der englische Aufklärer John Locke geschrieben und damit gemeint, dass sich am Beispiel Amerikas eine zweite Schöpfung beobachten ließe. Diese zweite Schöpfung hat hat inzwischen eine kaum noch überschaubare Vielfalt angenommen, die kein Reisender mehr bewältigen kann. Man kann es aber wenigstens versuchen, hat sich Ludwig Witzani gedacht und sich aufgemacht, "Mainland US "( die 48 Bundesstaaten der USA ohne Alaska und Hawaii) kreuz und quer zu bereisen. Im Mittelpunkt des vorliegenden Buches steht die Ostküste der USA einschließlich Floridas und der Great River Road zwischen New Orleans und Chicago. In Washington, Philadelphia, New York, Boston, Miami, Charleston, New Orleans, Memphis St. Louis und Chicago begegnet der Autor den unterschiedlichsten Facetten des amerikanischen Wesens, auf Roanoke Island, in Jamestown, Plymouth und Gettysburg besucht er Meilensteine der amerikanischen Geschichte. In den Appalachen, den Everglades, auf den Florida Keys oder im Tal des Mississippi bereist er eine Natur, die das ihre zur Entstehung der amerikanischen Identität beigetragen hat. Der Leser, der dem Autor auf seiner Reise durch den amerikanischen Osten folgt, erlebt ein Land am Schnittpunkt von rasendem Wandel und eigensinniger Beharrung, dessen weitere Entwicklung offen ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Witzani: Am Anfang war die ganze Welt Amerika
Reisen durch den Osten der Vereinigten Staaten
________________________________________
Weltreisen Band XVII
Ludwig Witzani
Am Anfang war die ganze Welt
Amerika
Reisen durch den Osten
der Vereinigten Staaten
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
EINLEITUNG
I New York
Ein Tag in New York
Einmal rund um New York
Nadelöhr der Weltgeschichte
Lady Dick und der vergessene Rucksack
II Neuengland
Die Küste der Walfänger
Trockenen Fußes in die Neue Welt
Eine Wiese mitten in einer Stadt
Exkurs: Als der Tee ins Hafenbecken flog
Von Hexen und Helden
III Central East
Das imperiale Herz Amerikas
Die Schlacht
Ausflug in die Anderswelt
Welcome everybody. We are open and free
Der Mythos von Liebe, Friede und Musik
Niagara
IV Virginia-Caroline Circle
Die grüne Perle Amerikas
Ein Schloss, ein Dichter und ein Skulpturengarten
Exkurs: Lynchaufrufe in der Tageszeitung
Die verlorene Kolonie von Roanoke
Wo Amerika begann
V Florida und der Südosten
Im Schatten der Konföderation
Auf der Sklavenroute
Von Seekühen, Rentnern und Raketen
Mit dem Auto über den Ozean
Keine Freiheit für den Killerwal
VI Great River Road
Rosen und Eisen in der Stadt unterhalb des Meeresspiegels
Jede Menge Regen in Mississippi
Musik und Tod in Tennessee
Die traurige Stadt und ein Besuch bei Mark Twain und Abraham Lincoln
Auf der Suche nach Präsident Obamas Friseur
Danke
Anhang
Reisehinweise
Reiseführer für Individualreisen
Foto- und Kartennachweis
Über den Autor
Impressum
EINLEITUNG
Ich war noch keine 12 Jahre alt, als ich bei einem Schülerwettbewerb ein Buch gewann. Sein Titel war „Der große Traum Amerika“, sein Autor war der heute fast vergessene Reiseschriftsteller A. E. Johann. Es war lange Zeit das mit Abstand dickste Buch, das ich damals mein Eigen nannte und das Buch, in dem ich, jedenfalls in meiner Schulzeit, am meisten las. Ein wenig wirkte es auf mich wie Aladins Wunderlampe, denn es enthielt Ingredienzien, die meine Fantasie lebenslang mit dem Reisen verbinden sollten. Zweierlei hatte mich damals in besonderer Weise beeindruckt: die Vielfältigkeit und Weite des Landes, das der Autor beschrieb und die Freiheit, mit der er nach Lust und Laune in ihm herumreiste. Beide Empfindungen sind mir bis heute lebendig geblieben.
Irgendwann las ich dann auch andere Bücher über Amerika, vor allem „Unterwegs“ von Jack Karouac und „Der Fänger im Roggen“ von J. D. Salinger - und dann fuhr ich hin. Erst einmal, dann immer wieder, wobei mir mit der Zeit auch die Schattenseiten Amerikas nicht entgingen. Schon A. E. Johann hatte auf die Rassenproblematik, die Einkommensungleichverteilung, die Kriminalität und die Umweltverschmutzung hingewiesen. Diese Probleme sind drei Generationen später keineswegs gelöst, wenngleich sie sich heute in anderer Form darbieten, von der tiefgreifenden gesellschaftlichen Spaltung gar nicht zu reden.
Aber das Land hat in seiner Geschichte bereits schwerere Krisen überstanden: die Lösung vom Mutterland, der Bürgerkrieg und die Weltwirtschaftskrise brachten Staat und Gesellschaft an den Rand des Zusammenbruchs, und doch war es immer weiter gegangen. „Am Anfang war die ganze Welt Amerika“ hatte der englische Aufklärer John Locke im späten 17. Jahrhundert geschrieben und damit gemeint, dass sich am Beispiel Amerikas eine zweite Schöpfung beobachten ließe. Diese Fähigkeit zum immerwährenden Neuanfang gehört zum Wesen Amerikas. Auch wenn das Land immer wieder in Sackgassen und Turbulenzen geriet, haben es die Amerikaner doch immer wieder geschafft, einen Reset einzuleiten. Das ist ihnen auch für die Krise zu wünschen, unter der das Land derzeit leidet.
Über dieses Land ist viel zu erzählen, so viel, dass es zwei Bücher geworden sind, eines über den Osten, eines über den Westen der Vereinigten Staaten. Im Mittelpunkt des vorliegenden Buches steht die Ostküste der USA einschließlich Floridas und der Great River Road zwischen New Orleans und Chicago. Sein Hintergrund sind fünf ausgedehnte Reisen, die ich im Verlauf der letzten fünfzehn Jahre unternommen habe. Ich hatte das Glück, diese Reisen nicht alleine, sondern in Begleitung meiner Frau und zweier guter Freunde zu unternehmen. Obwohl sie nicht im Mittelpunkt der Darstellung stehen, sind sie immer gegenwärtig, aber nicht verantwortlich für den Inhalt der folgenden Kapitel.
Was es in diesem Buch zu lesen gibt, ist weder eine Länderkunde noch ein Reisetagebuch, obwohl es auf meinen Reisetagebüchern beruht. In diesem Buch geht es nicht um ein Abbilden, sondern um ein Verstehen des Erlebten, angereichert mit einem gehörigen Schuss Zufall, Willkür und Spontaneität, die die kleinen Geschwister der Freiheit sind. Letztlich handelt es sich um die Aufarbeitung und Gestaltung meiner eigenen Begegnung mit Amerika, die ich in erster Linie für mich selbst geschrieben habe – getreu der Maxime von Ernst Jünger, dass nicht beschriebene Zeit verlorene Zeit ist. Dass die Darlegungen dieses Buches durch und durch subjektiv sind, versteht sich deswegen von selbst. Aber das sind alle Reisebücher, am meisten die, die ihre eigene Subjektivität nicht reflektieren.
Freiheitsstatue
INew York
Ein Tag in New York
Big Apple Intro
Einmal rund um New York
Eine Fahrt mit der Circle Line
Nadelöhr der Weltgeschichte
Das Einwanderungsmuseum
von Ellis Island
Lady Dick
und der vergessene Rucksack
Unsystematische Streifzüge
durch eine endlose Stadt
Empire State Building
Ein Tag in New York
Big Apple Intro
Kein Superlativ ist zu abgehoben, um ihn nicht für New York zu benutzen. Hauptstadt der Welt. Urbane Avantgarde. Steingewordene Moderne, Geburtsstätte des postmodernen homo sapiens. Und so weiter und so weiter. Ich legte die Zeitschrift beiseite und rieb mir die Augen. Die Reisejournalisten hauten mächtig auf den Putz, um New York zu preisen. Warum auch nicht, das war ihr Sound. Die Anschnallzeichen im Flugzeug gingen an, der Landeanflug auf New York begann.
Nach der Landung warteten wir anderthalb Stunden vor Pass- und Zollkontrolle. Fingerabdrücke, Iriskontrolle, Zweck der Reise, Kontaktpersonen und Hoteladresse, eine Frage folgte auf die andere, und die Prozedur zog sich. Ein Franzose, der sich vordrängeln wollte, wurde gnadenlos zusammengestaucht.
Mit einem jungen Engländer, den ich im Flugzeug kennengelernt hatte, nahm ich ein gemeinsames Taxi nach Manhattan. Sein Name war Mike, er kam aus London und wollte in New York eine Freundin besuchen. Der Taxifahrer war ein mürrischer Sikh, der seinen Turban und seinen Bart wie Zeichen der Erwählung trug. In kurzen Abständen musterte er uns im Rückspiegel, als fürchte er eine Verschwörung in seinem Fahrzeug.
Ich blickte aus dem Fenster. Straßenschluchten, gelbe Taxen, breite Parkways, Backsteinfassaden, Hochhäuser, Feuerleiter an den Außenseiten der Häuser. Bei der Überquerung der Queensboro Bridge wurde zum ersten Mal die Skyline von Manhattan sichtbar. Ich hatte die kompakteste Wolkenkratzerdichte der Welt erwartet, eine lückenlose Ansammlung steinerner Riesen, die so dicht beieinander stehen würden wie die Tannen von Yosemite. Doch Manhattans Silhouette glich eher einer Schüssel mit zwei Wolkenkratzerkonzenrationen an den Rändern, einer im Süden rund um den fast fertigen Freedom Tower und einer in Midtown im Umkreis des Empire State Buildings. Dazwischen lagen Little Italy, Chinatown, Greenwich Village und Chelsea, ein kilometerlanger Bezirk eher flacher Häuser, in dem ich wohnen würde.
Mein Hotel befand sich in Greenwich Village, einem Stadtteil auf halber Strecke zwischen Downtown und Midtown Manhattan. Im Namen dieses Viertels erklang seine Geschichte, denn früher war Greenwich Village tatsächlich nichts weiter als ein „grünes Dorf“ vor den Toren New Yorks gewesen, eine ländliche Enklave mit Kirche, Kühen und einem öffentlichen Galgen, an dem die Missetäter gehenkt worden waren. Heute war Greenwich Village ein sogenanntes „Künstlerviertel“ mit nostalgischem Straßenambiente, Flohmärkten, zahleichen Cafés und kleinen Insider-Restaurants, aber auch jeder Menge Kleinkriminalität und Drogendeals. Ich wohnte im Osten von Greenwich Village am Washington Square, einem kleinen Park mit einem Springbrunnen in der Mitte und dem Washington Arch, einem Triumphbogen, der zu Ehren von George Washington errichtet worden war. Die Rezeptionistin des Washington Square Hotels trug eine altmodische Hochfrisur. Sie verlangte Vorkasse für die erste Nacht, informierte mich über das Rauchverbot im ganzen Hotel und übereichte mir die Zimmerschlüssel. Das Zimmer im sechsten Stock war eng, aber gut eingerichtet, es besaß sogar eine Aussicht auf den Washington Square Park und die Straßenfassaden mit ihren leicht erhöhten Haustüren. Ich richtete mich ein, duschte und machte mich auf den Weg. Für den Washington Square Park würde es noch reichen.
Als ich das Hotel verließ, war später Nachmittag. Die Blätter der Bäume prangten in braungelb und rostrot, der sachte Wind in den Bäumen erzeugte ein zauberhaftes Schattenspiel auf den Fassaden. Auf der kleinen Bühne am Washington Square wechselten sich Musiker, Alleinunterhalter, Feuerschlucker und Jongleure mit ihren Auftritten ab. Die Leute kamen und gingen, lachten und klatschten und zeigten sich nicht knausrig, als die Schausteller ihre Hüte herumgehen ließen. Ein Artist balancierte auf einem Seil, ein junger Mann imitierte das Schwanenseeballett, und ein Gitarrenspieler sang von seiner verflossenen Liebe. Seitdem der junge Bob Dylan hier gesungen hatte, war der Washington Square eine Anlaufadresse für Musiker, die in New York ihr Glück versuchten. Manchmal kamen Club- oder Kneipenbetreiber zum Washington Square und engagierten Nachwuchsmusiker. „Leavin´ on a Jetplane“ sang die junge Frau und wiegte ihren Körper im Rhythmus des Liedes. Ein kleines Mädchen ging mit einem Hut herum, und die Zuschauer spendeten reichlich. Etwas abseits saß ein Mann auf einer Bank und schrieb unentwegt in sein Notizbuch. Hatte nicht auch Dos Passos am Washington Square „Manhattan Transfer“ verfasst?
Als die Sonne unterging und es kühler wurde, betrat ich eine Kneipe in einer Nachbarstraße und bestellte einen Hamburger. Der Laden hieß „Poppoloni“ und bestand nur aus einem langen Tresen und einigen Tischen, die sich im Halbdunkel des Hinterraums verloren. Ventilatoren surrten leise an der Decke. Die Weißen, Hispanics und Afroamerikaner saßen so bewegungslos an ihren Tischen, als warteten sie darauf, dass eine Filmcrew die Kneipe betreten und mit den Aufnahmen beginnen würde. Strolche kamen in das Lokal und bettelten um Zigaretten. Vor den Fenstern liefen Paare händchenhaltend vorüber, ein Polizist zu Pferde ritt auf der Straße vorbei, sein Knüppel baumelte am Halfter. Inzwischen war es draußen ganz dunkel geworden, ein schummriges Dämmerlicht erfüllte den Raum.
Eine hochgewachsene, schlanke Frau betrat das Poppoloni und setzte sich an den Nachbartisch. Sie war auf eine vage Art attraktiv. hatte ein großflächiges Gesicht und ansprechende, aber etwas kalte Augen. Im diffusen Licht dieses Lokals konnte man nichts gegen sie einwenden, außer, dass sie schon etwas älter war als der Durchschnitt der Gäste. Die Frau bestellte ein Getränk und blickte zu mir herüber. Sie weitete die Augen als sie mich ansah, hob in angedeuteter Koketterie die rechte Schulter und deutete ein Lächeln an.
Ich hatte mein Essen beendet und bestellte mir noch ein Bier. Die Frau schaute nun fast mürrisch zu mir herüber. Warum bewegte ich meinen Hintern nicht endlich an ihren Tisch? Die Internationale der Nachtschwärmer agierte auf allen Kontinenten ähnlich, wobei man berücksichtigen musste, dass es zwei Drehbücher für die Nachtschwärmer gab, eines für die „Temporären“ und eines für die „Stationären“. Die Temporären waren die, die nur so lange als Nachtschwärmer agierten, bis sie einen Partner fanden, mit dem sie von der Bildfläche verschwinden konnten. Die Stationären waren die, die diesen Absprung nicht schafften und die dazu verurteilt waren, in dieser Dämmerwelt zu verharren. Am schlimmsten waren die gut aussehenden Männer und Frauen, die als Stationäre auf der Szene herumgeisterten, denn sie hatten den größten Knall. Kein Wunder, dass der Partnerinnenimport aus Südostasien und Osteuropa auf vollen Touren lief, was natürlich auch keine Lösung war. Ein Stationärer war auf lange Sicht immer verloren, auch dann, wenn er sich auf Beziehungen mit blutjungen Frauen einließ. Am Ende stand doch immer nur der Gnadenschuss für einen alten Bock. Die Frau am Nebentisch erhob sich und ging zum Tresen. Im Vorbeigehen schenkte sie mir eine volle Breitseite ihres Lächelns. Sie gab einfach nicht auf. „Hey, I´m Susy,“ sagte sie „What is your name?“ Ich stand auf und wandte mich zum Gehen. „I´m Ludwig, but I´m so sorry, I have to leave.“ Ich zahlte und ging zum Hotel zurück.
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war das Wetter umgeschlagen. Der Regen prasselte gegen die Scheiben, die Bäume am Washington Square standen wie begossene Pudel im nebligen Dunst. Ich hatte bis in den Vormittag hinein geschlafen, so dass ich mich beeilen musste, wenn ich das Frühstück nicht verpassen wollte. Als ich herunterkam, saßen lauter Singles an den Einzeltischen im Frühstücksraum und kauten auf ihren Toast- oder Weißbrotscheiben herum. Dünner Kaffee, Plastikblumen, verhaltenes Licht, billige Popart an den Wänden - und lauter Gäste, die so versonnen in ihren Kaffee blickten, als fänden sich dort die Antworten auf all ihre Fragen.
Als ich aus dem Hotel trat, war der Himmel frei, und die Luft war kühl und klar. Im Washington Square Park wirkten die Hundeausführer und Morgenjogger wie eine besondere Spezies, die sich nur morgens zeigt. Jeder der Hundeausführer hatte ein halbes Dutzend kleiner und großer Hunde an der Leine, die wie verrückt kläfften, weil sie den Höhepunkt ihres Tages erlebten. Ein Polizist hoch zu Pferde achtete mit Argusaugen darauf, dass die kleinen Hunde nicht auf den Rasen kackten, während sein Pferd hinten dicke Kotkugeln auf den Gehweg fallen ließ.
Einige Minuten vom Hotel entfernt, erreichte ich in der Höhe des Union Square zum ersten Mal den Broadway. In den uralten Neuengland-Zeiten, als New York nichts weiter als ein kleines Kolonialnest im Süden der Halbinsel Manhattans war, hatte sich in der „Wall Street“ ein Palisadenzaun befunden, der die Einwohner vor Indianerangriffen schützen sollte. Der Broad-Way, der weite Weg, war der einzige Pfad gewesen, der aus der Siedlung hinaus in das Reich der Algonquin-Indianer geführt hatte. Das war vierhundert Jahre her, und längst war der 33 Kilometer lange Broadway, der von Süd-Manhattan bis in die Bronx führte, von der Stadt vollkommen umschlossen. Heute war der Broadway eine der Hauptschlagadern Manhattans, und die meisten Passanten, die auf ihm flanierten, schienen die hohe Schlagzahl der Stadt verinnerlicht zu haben. Aktentaschenbewehrte Männer liefen mit Tunnelblick und unvermeidbarem Body-Checking hastig in alle nur denkbaren Richtungen, als wären sie Teile eines gigantischen Uhrwerks, das jeden Vormittag am Broadway in Schwung geriet. Erstaunlich gutaussehende Frauen entstiegen Taxen, Bussen und Metroschächten, gestylt wie kleine Königinnen trugen sie ihr Rührmichnichtangesicht zur Schau, das Begehren erweckte, aber Anbaggern verbot. Zwei Obdachlose bewegten sich langsam über das Trottoir und trugen Kapuzen, als frören ihnen noch die Ohren von der kalten Nacht. Ein großer, massiger Afroamerikaner überquerte die Straße wie ein schwankendes Schiff, während ihn ein Ostasiate mit kleinen Tippelschritten überholte. Ein gut gekleideter Weißer wartete, den Kaffeebecher in der rechten Hand, so breitbeinig an einer Bushaltestelle, dass man sich unwillkürlich nach seinem Pferd umsah. Gleich nebenan saßen zwei Bettler auf einer Halde voller Müllsäcke und schnorrten die Passanten an. Als ich sie passierte, hoben sie den Daumen und riefen „Hey Man, do you have a Nickel?“
An der Kreuzung von 5th Avenue und Broadway befand sich das Flatiron Building, das tatsächlich wie die Spitze eines riesigen Bügeleisens in die Kreuzung hinein ragte. Der Wind, der aus zwei Straßenschluchten am Flatiron Building zusammentraf, hatte früher den Männern die Hüte vom Kopf und den Frauen die Röcke hoch geweht. Beides hatte sich mit dem Niedergang des Herrenhutes und dem Siegeszug der Damenhose erledigt. Nur der Wind war geblieben, und je weiter ich mich den Wolkenkratzern von Midtown näherte, desto stärker fegte er durch die Straßenschluchten.
Schneller als gedacht, erreichte ich das Haus der Häuser, das Empire State Building, das zwar längst nicht mehr New Yorks höchstes Gebäude, aber immer noch ihr architektonisches Wahrzeichen ist. Mit seinen 381 Metern Höhe war das Empire State Building zwischen 1931 bis 1972 das höchste Gebäude der Welt gewesen, ein stolzer Bau, der sich in der Höhe unmerklich verjüngte, was ihm ein majestätisches Aussehen verlieh. In der Ära der Weltwirtschaftskrise fertig gestellt, hatte es allerdings lange Zeit leer gestanden, so dass die New Yorker das damals höchste Gebäude der Welt als „Empty State Building“ verspottet hatten. Das war lange her - längst war das Haus ausgebucht, und die Besucherströme zählten jährlich nach Millionen.
Eine geschlagene Stunde musste ich im Foyer anstehen, eher ich den Aufzug zur Aussichtsplattform im 86. Stockwerk besteigen konnte. Die Aussichtsplattform des Empire State Buildings war eine um den ganzen Gebäudekorpus herumführende Terrasse, die wegen potentieller Selbstmörder durch einen Maschendrahtzaun gesichert war. Das erste, was ich sah, war der Anblick von Manhattan als Ganzem: eine wie eine Banane geformte Halbinsel, die vom Hudson River zwischen New York und New Jersey im Westen und dem East River zwischen Manhattan und Brooklyn im Osten begrenzt wurde. Im Süden Manhattans erhoben sich die Wolkenkratzer von Downtown, vor allem der Rohbau des noch nicht ganz fertig gestellten Freedom Towers, der an der Stelle der zerstörten Twin Towers bald das höchste Gebäude der USA sein würde. Nach Osten hin erstreckten sich die Häusermeere von Brooklyn und Queens vor dem flimmernden Licht des nahen Ozeans. Der Anblick auf die unmittelbar benachbarten Wolkenkratzer von Midtown Manhattan kam mir vor wie der Blick auf ein gigantisches Nagelbrett, zwischen dessen Elementen die Schlünde klafften und an dessen Basis sich hunderttausend bewegliche Punkte kreuzten. Makellose Vertikalen stürzten neben durchstrukturierten Glasfassaden in die Tiefe, und ein Loire- Schloss stand wie aus der Zeit gefallen auf dem Dach eines Hochhauses. Der eine Wolkenkratzer glich einer sich nach oben verjüngenden Hochzeitstorte, ein anderer einer überweltlichen Matrosenhose mit Schlag. Und das Wachstum der Wolkenkratzer ging ununterbrochen weiter. Im Westen entstand am Fluss ein ganz neuer Hochhauskomplex, der Hudson Yard, und ganz in der Nähe wurde am One Vanderbildt Building gebaut. Hier und da waren Kirchen zu erkennen, kümmerliche Relikte einer überwundenen Religion, die dem Kult der Vanderbilts, Rockefellers, Chryslers und Woolworths gewichen waren und deren Prunkbauten hoch über die Kirchen von New York hinausragten.
Blick auf Midtown Manhattan vom Empire State Building
Aber nicht nur Manhattan ist von der Aussichtsterrasse des Empire State Buildings zu überblicken. In konturloser Breite erstrecken sich rund um Manhattan die anderen Stadtteile New Yorks, die weit weniger bekannt sind als Manhattan und doch ein Vielfaches an Einwohnerzahl aufweisen. Groß-New York, das heißt Manhattan und die Stadtteile Brooklyn, Queens, Staten Island und Bronx, zählt gut acht bis neun Millionen Einwohner, eine gewaltige Menschenansammlung, deren Zahl sich aber schon seit zwei Generationen kaum mehr verändert. War New York mit dieser Bevölkerungsgröße nach dem zweiten Weltkrieg noch unangefochten die größte Stadt der Welt gewesen, war sie am Beginn des 21. Jahrhunderts auf den 17. Rang abgefallen. Mexiko-City, Sao Paulo, Peking, Shanghai, Delhi, Bombay, Djakarta, Istanbul und selbst Moskau rangierten vor ihr, auch wenn keine dieser Städte an die Bedeutung New Yorks heranreichte.
Ich warf einige Münzen in das Fernrohr und erblickte in frappierender Nähe das dichte System von Autobahnen, das den Verkehr aus Manhattan hinaus nach Norden leitete, an der Bronx vorbei, ehe die Schnellstraßen die flachen ländlichen Bezirke erreichten und weiter nach Albany, Buffalo oder bis zur kanadischen Grenze führten.
Als ich das Empire State Building verließ, war die Mittagszeit angebrochen. Im Bryantpark an der 42. Straße saßen die Rentner auf Stühlen und mümmelten an ihrem Mittagssnack. Auch ich holte mir einen Hot Dog und machte Brotzeit. Danach lief ich nach der Regie von Augenschein und Zufall im Zickzack weiter durch die Straßen und passierte eine Wolkenkratzerlegende nach der nächsten. Inmitten der funktionalen Riesenbauten von Midtown wirkte der Anblick des 318 Meter hohen Chrysler Buildings wie eine verspielte Collage. Die Wasserspeier und Kühlerfiguren an der Außenfassade und der pyramidenförmige Dachaufsatz verliehen dem Gebäude einen Retro-look, der die Nachbargebäude langweilig aussehen ließ. Auf dem Times Square glitzerten die elektrischen Reklameflächen und warben für die neuesten Theaterinszenierungen, aber auch für Elektronik, Computer und Luxusautos. Die vergoldete Prometheus-Statue vor dem Rockefeller Center wirkte, als befände sich der goldene Koloss im freien Fall in eine imaginäre Grube.
Über eine Länge von vier Kilometern und einer Breite von knapp einem Kilometer erstreckte sich der Central Park als „New Yorks grüne Lunge“ zwischen der 59. und 110. Straße. Kaum der geschäftigen Atmosphäre von Midtwon entronnen, betrat ich ein Refugium des Müßiggangs mit unzähligen Wegen, Teichen und Wiesen, auf denen die Leute alleine, zu zweit oder in Gruppen im Gras lagen, um zu schlafen, zu schmusen oder zu musizieren. Junge Farbige spielten Frisbee auf eine geradezu zirkusreife Weise, ließen die heransegelnden Scheiben an Rücken und Schultern abprallen, um sie dann unter den Beinen oder rücklings zu ergreifen und dem Partner in ebenso raffiniertem Schwung zurückzuwerfen. Der Engel über dem Cheryll Brunnen breitete seine Schwingen über den Eichhörnchen aus, die in verrücktem Zickzack über die Wiesen rannten. Schwarz war das Metall von Schillers Büste auf dem Naumburg-Brandshell Platz, prunkend die Farben der Bäume, und wie eine zweite Wirklichkeit erhoben sich die Gebäude der Upper West Side über den dunklen Wassern von „The Lake“.
Blick auf das Dakota Building vom Grand Reservoir aus
Westlich von „The Lake“ erinnerte der Strawberry Field Park an den Musiker John Lennon, der am 9. Oktober 1980 vor dem Dakota-Building ganz in der Nähe des Central Parks erschossen worden war. 120 verschiedene Pflanzen aus allen Teilen der Welt wuchsen im Strawberry Field Garten genau so friedlich nebeneinander, wie sich John Lennon und seine Anhänger das Nebeneinander der Rassen, Kulturen und Religionen in einer friedlichen Welt vorgestellt hatten. Zur Erinnerung an John Lennons berühmtesten Titel war das Wort „Imagine“ in ein Bodenmosaik in der Mitte des Strawberry Field Parks eingelegt worden - Imagine, Vorstellung, Einbildung, Phantasie, eine Membrane des Lebens, hinter der die Konturen der Wirklichkeit leicht verschwimmen konnten.
Etwa in der Mitte des Central Parks begann „The Grand Reservoir“, ein großer Binnensee, der von einem Maschendrahtzaun umgeben war. Hier drehten die Jogger zu allen Tageszeiten ihre Runden um den See. Ich erinnerte mich an eine Szene aus „Marathon Man“, in der Dustin Hoffmann als Jogger an diesem See von einem Schäferhund verfolgt wurde. Gleich nebenan, auf der großen Wiese, hatte sich Gordon Gecko in „Wall Street“ um Geld und Macht geredet, und in den Büschen rund um das Grand Reservoir hatte Al Pacino als getarnter Cop auf einen Serienkiller gelauert. Gab es auch Liebesfilme, die im Central Park spielten? Natürlich: „Manhattan“ von Woody Allen fiel mir ein - und hier vor allem die Szene, in der Woody und Diane vor einem Wolkenbruch aus dem Central Park in einen Hauseingang flüchteten.
Eine Stunde später hatte ich wieder den Südeingang des Parks erreicht. Hier setzte ich mich auf eine Brüstung und beobachtete die Rikschafahrer, die mit ihren bunten Gefährten auf Kunden warteten. In Südasien ein Transportmittel für Arme, hatte sich die Rikscha in Amerika in ein mobiles Freizeitassecoir verwandelt. Ich fuhr mit der Metro zurück zum Washington Square. Da ich noch nichts zu Abend gegessen hatte, ging ich ins Poppolini und bestellte wieder einen Hamburger. Der Barmann schien mich zu erkennen, auch die Tischnachbarin von vorgestern war wieder da, blickte mich aber nicht an, weil sie einen anderen Galan aufgetan hatte. Eine echte Stationäre eben. Ein Paar saß im Halbschatten des hinteren Lokals und schleckte aneinander herum. Am Tresen stritten zwei ältere Männer, sie bemühten sich zwar leise zu sein, doch ihr giftiges Zischen war überall zu hören.
Circle Line vor Manhattan Süd
Die Circle Line unterquert die Brooklyn Bridge
Blick auf Newark, Manhattan und Brooklyn
Einmal rund um New York
Eine Fahrt mit der Circle Line
Am nächsten Morgen war das Frühstücksbuffet bereits abgeräumt, als ich mit Kopfschmerzen herunterkam. Mehr als einen Kaffee und zwei Croissant gab es nicht mehr. Aber das Wetter war gut, und so beschloss ich, einen Ausflug auf der Circle Line zu buchen. Die Circle Line war ein Ausflugsschiff, mit dem es möglich war, in etwa drei Stunden einmal komplett Manhattan zu umrunden. Ich musste mich sputen.
An Pier 83 hatte sich bereits eine lange Warteschlange gebildet, als ich eintraf. Mit Ach und Krach erwarb ich ein Ticket für das nächste Boot. Während ich auf einer Bank auf das Ausflugsboot wartete, betrachtete ich den Hudson River, der breit und träge zwischen New York und New Jersey dahinfloss. Genau an dieser Stelle war im Januar 2009 ein Verkehrsflugzeug, dessen Triebwerke nach dem Start wegen Vogeleinschlags ausgefallen waren, im Hudson River notgelandet. Mit Können und Glück war es Kapitän Chesley Burnett Sullenberger gelungen, den defekten Airbus genau im richtigen Winkel auf den eisigen Wassern des Hudson Rivers zu landen, ohne dass das Flugzeug auseinanderbrach. Sämtliche Boote auf dem Hudson River, einschließlich der Ausflugsboote der Circle Line, waren damals mit Volldampf zu dem langsam sinkenden Flugzeug gefahren, um die Passagiere aufzunehmen. Am Ende war nicht ein einziger der 150 Passagiere zu Schaden gekommen. Dieses unglaubliche Ereignis war von Clint Easwood in dem Flim „Sully“ mit Tom Hanks in der Hauptrolle verfilmt worden.
Inzwischen hatte das nächste Ausflugsschiff der Circle Line angelegt. Das Boot war ein richtiger Kaffeedampfer mit jeder Menge Stühlen auf dem Oberdeck, auf denen die Passagiere bei Kaffee und Donuts die Rundfahrt genießen konnten. Allerdings waren manche Touristen so übergewichtig, dass sie mit ihren Hinterteilen kaum auf die Stühle passten. Sogar schon an den Kindern war der Ansatz künftiger Verfettung deutlich zu erkennen. Dergleichen hatte ich gestern bei meinem Rundgang durch Manhattan nicht bemerkt. Konnte es sein, dass der durchschnittliche New Yorker schlanker war als die US-Amerikaner aus dem Rest des Landes, die die Stadt besuchten? „New York, New York“, von Frank Sinatra klang aus den Lautsprechern, als das Boot ablegte und Kurs auf Süd-Manhattan nahm.
Die erste halbe Stunde der Bootsfahrt bot wenig spektakuläre Ausblicke auf eine Reihe von Docks und die Uferpassagen von Chelsea, Greenwich Village und Lower Broadway, immer überragt von der Nadelspitze des Empire State Buildings, die langsam im Nordwesten verschwand. Dann kam die Südspitze der Halbinsel Manhattan in Sicht, einstmals mit der Skyline von Downtown und den alles überragenden Türmen des World Trade Centers der Stolz Amerikas. Der Überfall islamistischer Mörder hatte am 11. September 2001 die beiden Türme des Word Trade Centers zum Einsturz gebracht und die Visitenkarte Amerikas für immer vernichtet. Auch wenn der sich im Bau befindliche Freedom Tower sogar noch etwas höher werden würde, als die Türme des zerstörten World Trade Centers, konnte seit dem 11. September 2001 niemand an der Südspitze Manhattans vorbeifahren, ohne nicht der dreitausend Opfer zu gedenken, die an diesem Tag gestorben waren. Es wurde ruhiger an Bord, als das Schiff den ehemaligen Standort des World Trade Centers passierte. Einige Männer nahmen ihre Kappen vom Kopf, anderen versammelten ihre Kinder um sich und erklärten ihnen, was vorgefallen war. Aus den Lautsprechern erklang „America, the Beautiful“.
Jenseits des Battery Parks im äußersten Süden Manhattans steuerte das Boot auf die Upper Bay, die große Bucht, die den Hafenbezirk New Yorks vom offenen Atlantik abtrennte. Diese unschlagbare Naturbucht war zuerst von Giovanni Verazzano entdeckt worden, der im Jahre 1524 die Ostküste Amerikas erkundet hatte. 1609 war ihm Henry Hudson gefolgt, nach dem der Hudson River benannt worden war. Dann hatte es nicht lange gedauert, bis die Holländer erschienen waren und dem Indianerstamm der Manhattan die gleichnamige Halbinsel abgekauft hatten. 1624 war die niederländische Kolonie Neu-Amsterdam gegründet worden, deren Bewohner vom Pelz- und Holzhandel auf dem Hudson lebten. Dieses Neu-Amsterdam wurde 1664 zu New York, als der Herzog von York mit einer Flotte vor der Stadt auftauchte und die Kolonie kampflos einnahm. Danach war die Geschichte New Yorks in die allgemeine Kolonialgeschichte der Neuenglandkolonien eingeschwenkt. Lange Zeit hatte New York im Schatten von Philadelphia und Boston gestanden. Erst ab dem 19. Jahrhundert sollte es alle anderen Städte überflügeln.
Mitten in der Bucht von New York lag Ellis Island, jenes Nadelöhr der Weltgeschichte durch das zwischen 1892 bis 1954 Millionen Menschen aus der Alten Welt in die Vereinigten Staaten eingewandert waren. Ursprünglich nur für eine Kapazität von 500.000 Einwanderern jährlich berechnet, mussten die Migrationsbehörden auf Ellis Island in den Spitzenjahren vor dem Ersten Weltkrieg mehr als eine Million Einwanderer pro Jahr bewältigen.
Nicht weit von Ellis Island ragt die Freiheitsstatue in den Himmel. Die über vierzig Meter hohe Monumentalskulptur einer weiblichen Gestalt, die in der Rechten die Fackel der Freiheit hält, erhebt sich auf einem noch einmal über vierzig Meter hohen Sockel, so dass die Gesamthöhe der Freiheitsstatue fast neunzig Meter erreicht. Wie winzige Punkte nahmen sich vom Schiff aus die Menschenmassen aus, die das Monument auf Liberty Island besuchten, um über ein System interner Treppen bis in den Augenbereich der Skulptur hochzuklettern.
Mit einem Blick auf die Verazzanobrücke ganz im Süden der Upper Bay endete der erste Teil der Circle Tour. Das Schiff drehte nach Norden ab und fuhr in den East River ein, der die Halbinsel Manhattan von Brooklyn und Queens trennt. Vier kilometerlange Brücken überspannen den East River auf der gesamten Länge des Flusses. Eine von ihnen ist die Brooklyn Bridge, einst die längste Hängebrücke der Welt, heute nur noch die schönste Brücke der Stadt. Wie klein wirkt sie auf den Landkarten, und wie riesig erschienen ihre Ausmaße, als das Schiff die Brücke unterquerte. Jenseits der Manhattan- und Williamsburg-Bridge wurden die Umrisse des United Nations Buildings sichtbar. Aus der Entfernung wirkte das von Le Corbusier und Oscar Niemeyer konzipierte Gebäude wie eine überdimensionierte leere Spielkarte. Seine Glasfassade reflektierte das Sonnenlicht wie ein Gleichnis dafür das das Meiste, was in diesem Gebäude geschieht, Blendwerk ist.
Nördlich von Welfare Island und der Queensboro Bridge zweigt der East River, seinem Namen entsprechend, nach Osten ab, um in den Long Island Sound zu münden. Mitten in diesem Long Island Sound befindet sich die Gefängnisinsel Rikers Island, eine Art Alcatraz der Westküste, auf der weit über zehntausend Häftlinge ihre Gefängnisstrafen abbüßen. Neunzig Prozent dieser Häftlinge sind Afroamerikaner oder Hispanics, ein Drittel aller Gefangenen leidet unter manifesten psychischen Beeinträchtigungen. Noch vor wenigen Monaten waren Berichte über Rikers Island durch die Weltpresse gegangen, als der Sozialist Dominique Strauß-Kahn, der Präsident des Internationalen Währungsfonds, wegen sexueller Belästigung einer schwarzen Putzfrau auf die Gefängnisinsel Rikers Island eingeliefert worden war. Auch das ist Amerika, dachte ich. In Frankreich wäre der Vorfall vertuscht worden, in den USA gelten die Gesetze (manchmal) auch für die hohen Tiere.
Das Ausflugsboot der Circle Line aber folgte dem Lauf des East River nicht, sondern bog in den Harlem River ein, in einen schmalen Wasserarm, der den Stadtteil Harlem von der Bronx trennt. Hier war das weltstädtische Flair Manhattans einem zersiedelten Vorstadtambiente gewichen, das alles andere als einladend aussah. Stillgelegte Fabriken, verrottete Fassaden, Müllhalden an den Ufern und eine Unzahl von Brücken zogen vorbei, ehe der Harlem River im Norden der Halbinsel Manhattan wieder in den Hudson River mündete. Nun begann der letzte Teil der Manhattan-Umrundung, die das Ausflugsboot unter der George Washington Bridge hindurch in südlicher Richtung die gesamte West Side entlang wieder zum Ausgangspunkt am Pier 83 zurückführte.
UN Zentrale / New York
Einwanderungsmuseum von Ellis Island
Nadelöhr der Weltgeschichte
Das Einwanderungsmuseum von Ellis Island
Nach den Statistiken der Vereinten Nationen gibt es in der Welt über 65 Millionen Flüchtlinge, und die meisten wollen dahin, wo ihnen ein besseres Leben winkt - vor allem nach Amerika und Europa. Allerdings wehrt sich ein großer Teil der Aufnahmegesellschaften gegen eine zu starke Zuwanderung, ganz egal, ob es sich um politisch Verfolgte oder Wirtschaftsflüchtlinge handelt. Die Alteingesessenen befürchten einen Verlust an Wohlstand, wenn sie ihn mit den Zuwanderern teilen müssen, die ins Land strömen. Andere preisen gerade die Zuwanderung als Grundlage künftigen Wohlstandes - auch und gerade für die Aufnahmegesellschaft.
Bekanntermaßen sind die Vereinigten Staaten das Einwanderungsland schlechthin. Um welche Art von Zuwanderung handelte es sich bei der historischen Massenmigration der Millionen in die USA und wie lief sie ab? Eine Antwort auf diese Frage gibt das Einwanderungsmuseum auf Ellis Island im Hafen von New York. Über Ellis Island kamen zwischen 1892 bis 1924 über 16 Millionen Menschen in die USA. Nach seiner Schließung wurde die Insel in ein Einwanderungsmuseum umgewandelt, das nun seine eigene Geschichte dokumentiert.
An einem vollkommen verregneten Tag entschloss ich mich, noch einmal ins Boot zu steigen und das Einwanderungsmuseum auf Ellis Island zu besuchen. Vorher allerdings nahm ich die kostenlose Fähre, die den Battery Park im Süden von Manhattan mit Staten Island verbindet, und das aus zwei Gründen: erstens wollte ich das Gesamtpanorama New Yorks aus maximaler Entfernung sehen und zweitens wollte ich auf der Rückfahrt bei der Annäherung an die Freiheitsstatue die Perspektive einnehmen, die Millionen Einwanderer gehabt hatten, als sie die Neue Welt erreichten. Aber auch so war die Fahrt mit der Staten Island Fähre unbedingt empfehlenswert. Immer weiter entfernte sich die Fähre von Manhattan, immer schmaler wurde der Wolkenkratzerstreifen, bis er sich mit den Skylines von Newark in New Jersey und Brooklyn verband. Am Ende verschmolzen sie in der Entfernung wie ein schmaler, zackiger Kamm.
Auf der Rückreise dann das gegenläufige Spiel. Immer bildfüllender erhob sich die Freiheitsstatue in den Himmel, als sich die Fähre Manhatten wieder näherte. Die Einleitungsszene von Francis Ford Coppolas „Der Pate II“ fiel mir ein, als das Einwandererschiff mit dem kleinen Vito Corleone bei der Einfahrt in den Hafen von New York die Freiheitsstatue passierte. Tausende Augen richteten sich auf die Freiheitsstatue in der Hoffnung auf ein neues, ein besseres Leben.
Aber bevor dieses neue, bessere Leben beginnen konnte, mussten alle Migranten die Einwanderungsstation auf Ellis Island passieren. Eine fünfzig Meter lange Warteschlange drängte sich vor dem Eingang der ehemaligen Einwanderungsbehörde. Ich blickte mich in der Warteschlange um und fragte mich, welche Besucher welche Vorfahren aus welchem Teilen der Welt kamen. Viele trugen in ihren Physiognomien die Mal ihrer Herkunft zur Schau, was die Kleidung betraf erkannte ich kaum Unterschiede. Auf der Ebene der Alltagsbekleidung schien der „Melting Pot“ zu funktionieren.
Mit einem muttersprachlichen Walkman im Ohr begann gleich nach dem Eintritt meine Reise durch die Hochphase der größten kontrollierten Masseneinwanderung der Geschichte. Ein Berg aus Holzkisten, Koffern und Säcken empfing mich in der großen Eingangshalle des Museums. Wo heute die Tickets und Broschüren für das Museum verteilt werden, mussten die Einwanderer sofort nach ihrem Landgang ihr Gepäck zur Desinfektion abgeben und sich in langen Warteschlangen über große Treppen in den ersten Stock begeben. Doch schon während des Treppenaufgangs konnte der Traum von der Neuen Welt zerplatzen. Ärzte, zu beiden Seiten der Treppe positioniert, unterzogen die bis zu siebentausend Personen täglich einer ersten Blitzdiagnose. Wer einen kranken oder „schwachsinnigen“ Eindruck machte, wer Verdacht erweckte, an ansteckenden Krankheiten zu leiden oder den Ärzten auf irgendeine Weise absonderlich erschien, wurde auf seiner Kleidung mit einem weißen Kreide-„X“ gekennzeichnet und zur weiteren Untersuchung aus der Masse ausgesondert.
Wer die „Doctor´s Parade“ auf der Treppe absolviert hatte, wartete im ersten Stock in fünf endlosen Reihen auf die zweite Prüfung. Hinter fünf Kathetern und unter einer gewaltigen amerikanischen Bundesflagge ließen sich die Beamten der Einwanderungsbehörde zeigen, was sie sehen wollten: Papiere aus der alten Heimat, die Geldvorräte, die Zähne, die Hände oder die Frisuren unter Hüten und Perücken.
Anschließend erhielten die Migranten das berühmte Einwanderungsformular mit seinen 22 Fragen, die mithilfe von Dolmetschern so gut wie möglich beantwortet werden mussten. Niemand prüfte die Angaben wirklich nach, alles kam nur darauf an, nicht negativ aufzufallen.
Es folgte die dritte, entscheidende Hürde: eine medizinische Schnelluntersuchung, in der alle Personen, die als krank diagnostiziert wurden, entweder in besondere Krankenstationen eingewiesen oder unter Quarantäne gestellt wurden. Auch hier fiel mir der kleine Vito Corleone aus „Der Pate II“ ein, der wegen Verdachts auf Leukämie in eine Einzelzelle kam.
Alles in allem wurden von den Ärzten und Beamten etwa 10 % der Einwanderer ausgesondert und speziellen Untersuchungen unterzogen. Die Psychologen von Ellis Island, vor die Aufgabe gestellt, die geistige Leistungsfähigkeit von Einwanderern wenigstens ungefähr einzuschätzen, entwickelten die ersten psychologischen Massentests in der Geschichte ihres Faches. Hunderttausende Einwanderer, oft Analphabeten, mussten einfache Bildassoziationen oder Rechenaufgaben bearbeiten, von deren richtiger Lösung mitunter die Entscheidung über Einwanderung oder Ablehnung abhing. Am Ende aber wurden nur etwa 2 % der Einwanderungswilligen, sogenannte Minderbegabte, Kriminelle oder mit ansteckenden Krankheiten infizierte Personen, zurückgeschickt.
Die Einwanderungsstation, 1892 für eine maximale Belastung von 500.000 Immigranten pro Jahr konzipiert, wurde bald bis über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit strapaziert. Trotz zahlreicher Aufschüttungen, die die Insel im Laufe der Zeit erheblich vergrößerten, trotz mehrerer Neubauten und einer enormen Ausweitung des Beamtenapparates, drohte der Einwanderungsbetrieb in den so genannten „Peak“ Jahren um die Jahrhundertwende zusammenzubrechen. Vor allem die aus der europäischen Heimat mitgebrachten Animositäten und Gewohnheiten der Einwanderer stellten die Beamten vor enorme Probleme. Zwar konnten sich die Angehörigen der einzelnen europäischen Nationen in den Riesenduschen von Ellis Island davon überzeugen, dass sich der nackte Deutsche vom nackten Russen nicht unterschied, doch schon bei der Verpflegung gab es regelmäßig Ärger, wenn die Deutschen auf Sauerkraut verzichten, die Dänen Spaghetti essen mussten und den Juden das Essen nicht koscher genug war. Polen und Russen gerieten in den Schlafsälen aneinander, Engländer und Iren durfte man nicht zusammenlegen, und manch ein Mitteleuropäer verweigerte einen Schlafplatz neben einem osteuropäischen Juden.
Doch der amerikanische „Melting Pot“ war nicht unbegrenzt aufnahmefähig. Als in den 1920er Jahren die Nachfrage nach Arbeitskräften stagnierte, wurde die liberale Immigrationspolitik beendet. Eine Reihe aus heutiger Sicht diskriminierender Gesetze beschränkte die Einwanderung, namentlich der Ostasiaten. Für Ellis Island war die bedeutendste Zeit damit vorüber. Aus der Millionenflut wurde ein Rinnsal. Doch erst am 12. November 1954 Uhr wurde die Station endgültig geschlossen.
Heute ruht der Blick der Besucher mit einer gewissen Nostalgie auf den Exponaten des Museums. Manch einer mochte in den zahllosen Portraitaufnahmen an den Wänden nach seinen Vorfahren suchen, die über Ellis Island in die USA eingewandert waren. Sie waren die späten Sprösslinge einer einmaligen geschichtlichen Sondersituation, in der Millionen relativ qualifizierter Personen aus einem demografisch expandierenden Raum in einen anderen wechselten, um ihn zu einem der mächtigsten und reichsten Länder der Welt zu machen. Insofern war die amerikanische Migration über Ellis Island eine Erfolgsgeschichte.
An der amerikanisch-mexikanischen Grenze zwischen San Diego und El Paso sieht es heute schon ganz anders aus, von der aktuellen, völlig ungeregelten moslemischen Masseneinwanderung nach Europa ganz zu schweigen. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Migrantendenkmal am Battery Park
Broadway
Lady Dick und der vergessene Rucksack
Unsystematische Streifzüge durch eine disparate Stadt
Einen Freund in New York hat jeder. Das ist die U-Bahn. Zugegeben, es ist ein Freund, der nicht immer gut aussieht, aber seine Aufgaben gut erfüllt. Auf einer Strecke von etwa 370 km fährt dieser Freund überwiegend unterirdisch über 450 Stationen an und hält die Stadt buchstäblich zusammen. Lange Zeit war dieser Freund allerdings übel beleumdet. In den 1970er Jahren, als New York in einem Strudel des Verbrechens zu versinken drohte, galt die New Yorker U-Bahn als ein Hotspot der Gewalt. Parallel zur Wiederauferstehung New Yorks in den 1980er und 1990er Jahren vollzog sich die Revitalisierung der Metro. Ein milliardenschweres Investitionsprogramm erneuerte ihre Ausstattung und ermöglichte die Etablierung einer effektiven Sicherheitsstruktur. Wie diese Struktur funktioniert, wusste ich nicht, aber als ein schwergewichtiger Fahrgast in der Great Central Station plötzlich begann, um sich zu schlagen und laut zu brüllen, erschienen wie aus dem Nichts unvermittelt zwei Sicherheitsbeamte und führten den Randalierer ab.
Aber dergleichen Vorfälle waren selten geworden. In der Regel funktionierte der Betrieb effektiv und störungsfrei und brachte tagtäglich fünf Millionen Fahrgäste an ihr Ziel. Auch mich transportierte die Metro an jeden gewünschten Punkt der Stadt, mal hierhin, mal dorthin, mal gezielt, mal auf Verdacht, bis ich wieder einstieg und weiterfuhr.
Einmal verschlug es mich nach Queens, einen der fünf Stadtteile New Yorks, und ich traf auf ein völlig verändertes Stadtbild. Hier erinnerte nichts mehr an die weltstädtische Skyline von Manhattan. Stattdessen lief ich durch kleinbürgerliche Wohnviertel mit abgenutzten Holzhäusern, vor denen sich anstelle eines Gartens ein enger Parkplatz für den Wagen befand. An einer anderen Stelle warb ein Rechtsanwalt um Kunden, doch die Fenster seines Büros waren rundum vergittert. An einer Ampel standen ein Inder, ein Rastafari und ein Afroamerikaner in einem grotesk weiten T-Shirt neben mir. Der Exot war ich.
Ein andermal fuhr ich mit der Metro nach Harlem in die Höhe der 110. Straße. Der Kontrast zu Midtown oder Greenwich Village war genauso frappierend, wie es in den Reiseführern beschrieben wurde. Gruppenweise standen afroamerikanische und hispanische Männer in grotesk großen Hosen und Jacken in den Hauseingängen oder hielten neben verbeulten Fahrzeugen ein Palaver ab. Hip-Hop-Musik ertönte aus offenen Fenstern, Kinder heulten, zerlumpte Gestalten lagen neben den Mülltonnen. Jugendliche mit Baseballkappen saßen in Unterhemden auf den Treppenabsätzen und beobachteten, was auf der Straße geschah. Sonderlich bedrohlich wirkte das nicht, es war aber auch alles andere als einladend, denn es war unverkennbar, wie genau die scheinbar untätig herumstehenden Anwohner ihre Umgebung im Auge hatten.
In Harlem, früher einmal ein vorzeigbarer New Yorker Stadtteil und zeitweise das Zentrum der afroamerikanischen Kultur in Amerika, leben eine halbe Million Afroamerikaner, fast die Hälfte davon von der Wohlfahrt, und die Verbrechensrate ist eine der höchsten in ganz New York. Darf man das überhaupt so unverhüllt schreiben? Die statistische Aufschlüsselung von Verbrechensraten nach Ethnien ist ein ganz heißes Eisen, seitdem die Rassenfrage in den USA wieder hochgekocht ist. Als ich erkannte, dass ich auffiel und dass sich die Männer nach mir umdrehten, ging ich zur nächsten U-Bahn Station und fuhr zurück nach Midtown.