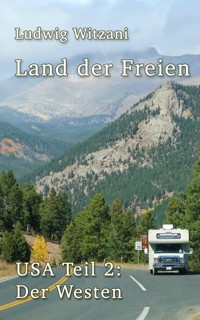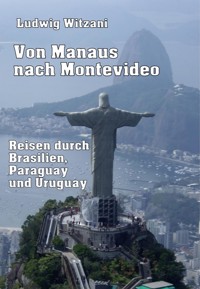
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ludwig Witzani hat auf vier ausgedehnten Reisen Brasilien, Paraguay und Uruguay besucht. Er ist mit öffentlichen Bussen von Rio nach Salvador de Bahia und Recife gereist, war im Dschungel Amazoniens und auf der nächtlichen Copacabana unterwegs und hat sich im Pantanal, dem größten Sumpf der Erde, vor Krokodilen und Moskitos in Acht genommen. In den Jesuitenreduktionen im paraguayisch-argentinischen Grenzgebiet spürte er einem faszinierenden Seitenpfad der Weltgeschichte nach, und in Montevideo verzehrte er die besten Rindersteaks der Welt. In seinem sehr persönlich gehaltenen Reisebericht kommen Situatives und Geschichtliches, Heiteres und Tragisches als eine Form des Fernwehs zur Sprache, die manch einen veranlassen mag, nach der Lektüre des vorliegenden Buches den Koffer zu packen, um sich auf die Socken zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ludwig Witzani
Von Manaus
nach Montevideo
Reisen durch
Brasilien, Paraguay
und Uruguay
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
BRASILIEN
Solange der Corcovado steht, wird die Stadt nicht untergehen
Die goldenen Kirchen von Minas Gerais
Afrika endet in Salvador de Bahia
Von einer Piranhasuppe wird man nicht satt
Die modernste Hauptstadt der Welt
Im Land der Störche und Krokodile
Am Garganta del Diabolo
Stadt der Jesuiten und Bandeirantes
Curitiba, die ordentliche Stadt
Schönheit ist eine Frage der Tageszeit
Copacabana bei Nacht
Vorher oder nachher zu lesen: Einige Basisdaten zu Brasilien
TRANSPARAGUAY
Die Guarani singen nicht mehr
Parade der Diktatoren
Die traurige Metropole des Kabelsalats
URUGUAY
Die Welthauptstadt des anabolikafreien Rindersteaks
Geschichte und Gegenwart in Colonial del Sacramento und Fray Bentos
Im Sanddünenparadies
Monaco am Rio de La Plata
Anhang
REISEPRAKTISCHE HINWEISE
WEITERFÜHRENDE LITERATUR
FOTO- UND KARTENNACHWEIS
ÜBER DEN AUTOR
Danke an
Impressum
Einleitung
Im April des Jahres 1500 landete eine portugiesische Flotte unter dem Kapitanat von Pedro Álvares Cabral in der Nähe von Puerto Seguro an der brasilianischen Küste. Der gewaltige Bogen, den die portugiesischen Indienflotten, die atlantischen Windströme ausnutzend, um den Süden Afrikas schlugen, hatte Cabral so weit nach Westen getrieben, dass er neues Land entdeckte.
Das war erfreulich, weniger erfreulich war, dass die Portugiesen zunächst mit diesem neuen Land wenig anfangen konnten. Es gab kein Gold und kein Silber, und die Indios machten sich davon, sobald sie einen Weißen erblickten. Allenfalls der Export eines roten Hartholzes, des sogenannten „Pau Brasil“, erbrachte bescheidene Gewinne. Deswegen dauerte es seine Zeit, ehe sich, ausgehend von Salvador de Bahia und Pernambuco im heutigen Nordosten Brasiliens, die schier endlose Küstenkolonie zwischen der Amazonasmündung und dem Tiefland des heutigen Südbrasiliens entwickelte. Der Anbau von Zuckerrohr und Kaffee, später die Verwertung reicher Goldvorkommen und Kautschukplantagen verbreiterte die Grundlagen der neuen Kolonie, die im Lauf der Jahrhunderte über alle denkbaren Grenzen hinauswuchs. Die Bandeirantes („Bannerträger“) zogen von São Paulo aus auf der Suche nach Edelmetallen und Sklaven nach Westen, während ihnen die Jesuiten folgten, um eben diese Indios zu missionieren und vor der Versklavung zu schützen. Bald entstand auf dem Hintergrund einer komplizierten, wechselvollen Geschichte aus europäischer Einwanderung, der „Einfuhr“ afrikanischer Sklaven und der indigenen Bevölkerung der brasilianische „Melting Pot“, dessen besonderes Kennzeichen darin besteht, über kein herausragendes ethnisches Merkmal zu verfügen - auch wenn die phänotypischen Ausprägungen in den einzelnen Landesteile erheblich differieren. Heute gehört Brasilien mit über 210 Millionen Einwohnern und einem Territorium von etwa 8,5 Millionen km² zu den größten Staaten der Erde, und - folgt man den Prognosen des amerikanischen Politikwissenschaftlers Samuel Huntington - zu den Weltmächten der Zukunft.
So weit ist es aber noch lange nicht, wie jeder Reisende, der das Land von Busbahnhof zu Busbahnhof oder von Flughafen zu Flughafen erkundet, leicht feststellen kann. Er macht dabei eine Erfahrung, die auch in anderen Teilen Lateinamerikas spürbar ist: eine Erfahrung von Vertrautheit und Fremde, die irritiert und die nur auf den ersten Blick den Zugang erleichtert. Denn die Lebenswelt, die Vorlieben und Empfindlichkeiten, die Identitäten und Tabus sind vollkommen andere, so dass der Reisende in Brasilien leicht in eine heikle Zwischenwelt gerät, die eine Sicherheit vorgaukelt, die gar nicht besteht. Um es ganz deutlich zu sagen: so faszinierend und auf eine naive Weise „schön“ sich Brasilien dem Reisenden auch darbietet, so gefährlich ist es auch. Unter den 50 gefährlichsten Städten der Welt befinden sich regelmäßig 25 brasilianische. Eine selbstorganisierte Reise durch Brasilien besitzt also durchaus jene ursprünglichen Erlebnisqualitäten, die früher generell zum Verreisen gehörten: Überraschung und Gefahr. Das beginnt schon damit, dass der Reisende gut beraten ist, mit lizensierten Taxen vom Santos Dumont-Flughafen in die Innenstadt von Rio de Janeiro zu fahren und endet nicht damit, dass man im Hotel nicht jedem, der an die Türe klopft, auch öffnen sollte.
Dies alles mitbedacht, gehören trotzdem meine brasilianischen Reisen (es waren zwei) zu den großen Reiseabenteuern meines Lebens. Die Busreise von Rio de Janeiro bis kurz vor die Amazonasmündung bot alles, was das Travellerherz begehrte: Kolonialambiente, prachtvolle Kirchen, exotische Riten, Musik und Tanz, Bilderbuchstrände vor tropischer Kulisse und jede Menge gastfreundlicher Menschen, die trotz der Bemerkungen oben in Brasilien natürlich die weit überwiegende Mehrheit stellen. In Amazonien und in der Umgebung von Manaus tauchte ich in den Dschungel ein, in Brasilia bewegte ich mich zwischen futuristischen Gebäuden. Der größte Wasserfall der Welt erwartete mich in Iguazú, ehe ich nach einem großen Bogen den Süden Brasiliens erreichte, der noch am ehesten mit Europa vergleichbar ist.
Lange lag mein brasilianisches Reisetagebuch im Schrank, ehe ich es im Vorfeld einer zweiten Brasilienreise neu las. Dabei machte ich eine Erfahrung, die alle Reisetagebuchschreiber beim zeitversetzten Lesen ihrer Aufzeichnungen machen: Die Erinnerung öffnet sich wie eine Ansammlung von Teeblüten (dieses Bild stammt von Ernst Jünger), und Einzelheiten, die für immer vergessen schienen, kehren in überraschender Plastizität in das Bewusstsein zurück. In dieser Stimmung entstand das vorliegende Reisebuch als eine Synthese zweier, zeitlich leicht versetzter Reisen, die ich, um Dopplungen zu vermeiden, zu einer einzigen zusammengefasst habe.
Je ein Kapitel über die kleinen Nachbarländer Paraguay und Uruguay runden dieses Buch ab. Beide Länder, so klein und unterschiedlich sie auch sein mögen, haben eines gemeinsam: sie passen nicht in den geläufigen Rahmen, der Lateinamerika in einen portugiesischen und spanischen Teil spaltet. Paraguay, der heiße Brutofen zwischen Brasilien, Bolivien und Argentinien, war für einen kurzen Moment in Gestalt der Jesuitenreduktionen ein Experimentierfeld der Weltgeschichte ohne happy-end. Nach einer wahrhaft leidvollen Geschichte ist es heute ein Land, dem man seine Narben schon in seinen Städten ansieht.
Ganz anders Uruguay, der kleine Staat, der wie ein Sandwich zwischen den Giganten Brasilien und Argentinien liegt. Auch Uruguay hatte seine geschichtlichen Turbulenzen, ist aber heute das sicherste Land Lateinamerikas mit dem höchsten Prokopfeinkommen des Kontinents. Es entspricht am ehesten dem Klischee der Europa-Ähnlichkeit, von dem bereits die Rede war.
Alles in allem beruht dieses Reisebuch auf zwei ausgedehnten Reisen durch Brasilien und zwei Besuchen in Paraguay und Uruguay. Wie immer habe ich diese Reisen unterwegs in Reisetagebüchern dokumentiert. Wo immer es möglich war, habe ich die Unmittelbarkeit dieser Aufzeichnungen in den vorliegenden Text übernommen. Nur an einigen Stellen musste ich im Nachherein Sachverhalte vertiefen oder Irrtümer korrigieren. Unnötig zu erwähnen, dass deswegen alle Urteile und Wertungen dieses Buches durch und durch subjektiv sind. Sollte ich irgendjemanden durch meine Sichtweisen erzürnen, so tut es mir leid. Sollte ich auf der anderen Seite für diesen Teil der Welt Interesse wecken und möglicherweise den einen oder anderen Leser dazu motivieren, eine ähnliche Reise zu unternehmen, würde es mich freuen.
BRASILIEN
Solange der Corcovado steht, wird die Stadt nicht untergehen
Rio, die erste
Die goldenen Kirchen von Minas Gerais
Ein Goldrausch verändert die Geschichte Brasiliens
Afrika endet in Salvador de Bahia
Zweitausend Kilometer mit dem Bus zwischen Rio und Cap Touros
Von einer Piranhasuppe wird man nicht satt
Zwei Weicheier in Amazonien
Die modernste Hauptstadt der Welt
Weite, Leere und Faszination in Brasilia
Im Land der Störche und Krokodile
Eine Woche im Pantanal, dem größten Sumpf der Erde
Am Garganta del Diabolo
Iguaçu und Itaipu
Stadt der Jesuiten und Bandeirantes
Stimmungsschwankungen in São Paulo
Curitiba, die ordentliche Stadt
Reisen durch Paraná
Schönheit ist eine Frage der Tageszeit
Brasilianisches Idyll zwischen São Paulo und Rio
Copacabana bei Nacht
Rio, die zweite (nicht jugendfrei)
Vorher oder nachher zu lesen:
Einige Basisdaten über Brasilien
Blick auf den Zuckerhut vom Corcovado aus
Solange der Corcovado steht, wird die Stadt nicht untergehen
Rio, die erste
Ich wachte auf, als sich die Maschine schon im Anflug auf Rio de Janeiro befand. Zerfetzte Wolken hingen wie ein zerrissener Vorhang über der Guanabarabucht, die Sonne war gerade aufgegangen und beschien eine bizarr geformte Küstenlandschaft. Zahlreiche Kegelberge, die sogenannten Morros, erhoben sich wie grüne Burgen über einer unübersehbaren Masse grauer Häuser.
Es regnete heftig, als ich nach der Landung und Abfertigung vom Flughafen Santos Dumont in das Zentrum von Rio fuhr. Aus Sicherheitsgründen hatte ich ein lizensiertes Taxi genommen, weil in letzter Zeit viele Touristen Opfer von Taxifahrern geworden waren. Diese Taxifahrer hatten ihre ahnungslosen Kunden zu fingierten Polizeisperren gefahren, wo sie von Pseudopolizisten ausgenommen worden waren.
Es gibt Länder, in denen die Vorsicht zur Reiseausrüstung gehört. Brasilien zählt dazu. Von den fünfzig kriminellsten Städten der Welt gehört fast die Hälfte zu Brasilien. Über fünftausend Menschen werden jedes Jahr alleine in Rio de Janeiro ermordet. Das ist die schlechte Nachricht. Neunzig Prozent davon in den Favelas und im Drogenmilieu. Ist das eine gute Nachricht? Ganz bestimmt nicht. Immerhin, so vermerkte ein findiger Reiseschriftsteller, fällt der Tourist in Rio nicht auf, weil die brasilianische Bevölkerung einfach keinen vorherrschenden Phänotyp kennt - schwarz und weiß oder gemischt, groß und klein, dick oder dünn, alles kommt aus dem gleichen Melting Pot.
Mein Taxifahrer war ein Kind dieses Melting Pots. Er war ein dunkelhäutiger junger Mann mit Stiernacken und Lockenfrisur. Seine Augen waren wachsam, die Lippen üppig, die Nase gerade wie ein Strich. In seinem Gesicht kam die Vielfalt der Welt zur Erscheinung. Mit dem Stadtbild verhielt es sich übrigens ähnlich. Ich sah grotesk breite Strandstraßen, auf die der Regen niederprasselte, dicht bewachsene Kegelberge, von Wolkenfransen umnebelt, Hochhausfassaden mit baufälligen Balkonen. Abfallhaufen lagen auf durchfeuchteten Rasenflächen. Neben ihnen, unter Pappe, schliefen Obdachlose.
Das Hotel „Monte Blanco“ befand sich an einer belebten Durchgangsstraße im Stadtteil Catete mitten in Rio. Von hier aus war es gleichweit zur Copacabana wie zu den nördlichen Geschäftsvierteln. Der Rezeptionist war ein drahtiger Mensch mit grauen Schläfenhaaren und einer langen, fleischigen Nase. In einem gutturalen Englisch verlangte er eine Vorauszahlung für die erste Nacht, meinen Ausweis und das Ausfüllen diverser Anmeldeformulare, ehe er die Schlüssel herausrückte.
Ich schlief einige Stunden in den Tag hinein und wachte noch vor Mittag auf. An der Hotelbar trank ich zwei starke Kaffee, aß ein Sandwich und brach zu meinem ersten Rundgang auf. Der Regen hatte inzwischen aufgehört. Vom nassen Asphalt waberten feine Nebelschwaden über die Bürgersteige. Die meisten Geschäfte hatten geöffnet, die Auslagen waren schon wieder herausgetragen worden. Neben einem Parkeingang saßen Bettler und verteidigten ihre Positionen gegen andere Bettler. Aus einer Seitengasse wurde eine mobile Garküche herbeigerollt, die Polizei verscheuchte die Obdachlosen aus den Hauseingängen.
Als ich mir ein frühes Mittagessen bestellte, verblüffte mich die Größe des Steaks. Ich sah mich um und erkannte, dass fast alle Gäste dieses Lokals an solchen Riesensteaks arbeiteten. Drei Straßenjungen lungerten vor dem Restaurant herum und warteten darauf, dass einer der Gäste aufgab. Wenn sie das jeden Tag machten, würden sie gut über die Runden kommen. Ich winkte einen der Jungen heran und gab ihm, in eine Serviette eingewickelt, das halbe Steak. Er trug nichts als eine Turnhose und ein Unterhemd, lachte aber über das ganze Gesicht und flitzte zur nächsten Ecke, wo er die Beute mit zwei Kameraden teilte.
Mein erstes Rio-Ziel war der Corcovado, der große Fels mit dem riesenhaften Christus auf seiner Spitze. An der Rio Catete fand ich die richtige Bushaltestelle und stieg ein. Der Fahrscheinverkäufer, ein kleiner Mulatte von unbestimmbarem Alter, saß als Schaffner auf einem Schemel hinter einer Absperrung.
„Corcovado?“fragte ich.
„Sim, sim“ nickte der kleine Schaffner und nannte den Preis der Fahrkarte. Da ich den Preis für die Fahrkarte nicht verstand, zeigte mit der Schaffner dreimal alle seine Zehn Finger und legte einen seiner beiden nackten Füße auf das schmale Schaffnerpult. Ein Zeh fehlte, es waren nur vier. Die Fahrt kostete also 35 neue Cruzeiros. Den fehlenden Zeh durfte ich nicht abrechnen.
Die Busfahrt von der Rua Catete zum Corcovado dauerte länger als gedacht, denn die breiten Avenidas verwandelten sich schon bald in enge Straßenschluchten. Massenhaft versperrten Taxen, Busse und Motorräder die Fahrbahnen, und manchmal ging es nur noch schubweise vorwärts. Der Besitzer einer großen Limousine, der in einer engen Straße durch einen Karren an der Ausfahrt gehindert wurde, begann durch das offene Autofenster den Karrenmann zu beschimpfen. Muskelbepackt und sorgfältig frisiert saß er mit seinem blütenweißen Hemd behäbig in seinem Ledersitz und schien sich an seinen Flüchen zu ergötzen. Der Karrenmann, eine ausgemergelte Gestalt mit einem gelben Gesicht, war barfuß unterwegs. Er trug löchrige, abgerissene Kleidung und streckte dem Wagenbesitzer vor dem heruntergekurbelten Fenster zuerst seine entsetzlich lange Zunge heraus und rotzte ihm anschließend einen vollen Gelben in den Wagen. Von meinem Busfenstersitz aus konnte ich aus nächster Nähe beobachten, wie eine dicke, konsistente Sputumkugel aus dem zahnlosen Mund des Alten schoss und den Autobesitzer voll am linken Auge traf. Gerade in diesem Moment setzte sich der Bus wieder in Bewegung, und die Szene entschwand aus meinem Blickfeld. Willkommen in Rio.
Nach einer halben Stunde gab mir der kleine Schaffner mit den neun Zehen ein Zeichen, das ich aussteigen musste. Schnell fand ich den Eingang zu einer Zahnradbahn, die mich über mehrere Stationen zum Corcovado brachte. Über wenig vertrauenserweckende Holzbrücken, durch Tunnel und Kurven ratterte die Schienenbahn im Zeitlupentempo den Berg hoch, bis sie an der Endstation unterhalb des Gipfels stoppte. Nun ging es noch einmal 220 Stufen eine Marmortreppe empor, ehe die Plattform des Cristo Redentor erreicht war. Achtunddreißig Meter hoch ragte der segnende Christus samt Sockel über mir in den Himmel, und selbst wenn ich mich vor der Riesenstatue auf den Rücken warf, bekam ich den großen Christus in seiner Gesamtheit nicht auf das Kamerabild.
Cristo Redentor (Corcovado-Rio de Janeiro)
Cariocasee, vom Corcovado aus gesehen
Die meisten Besucher hielten sich nicht lange am Cristo Redentor auf, sondern liefen gleich weiter zur Aussichtsplattform unterhalb der Statue. Tausendfach auf Bildern gesehen, war es doch ein Schock, dass die Panoramaaussicht von der Corcovadoterrasse genauso überwältigend war wie erwartet. Der erste Blick erfasste ganz Rio, die ganze Bucht, die ganze Küste, geradeaus den Pao de Acucar, den Zuckerhut, nördlich von ihm die Strände von Botofago und Flamengo und links davon, noch weiter nördlich, das Geschäftszentrum und die Niteroibrücke, die die Guanabarabucht überspannte. Südlich des Corcovado waren die Strände von Copacabana und Ipanema zu erkennen - und davor wie ein bizarres Meer in der Stadt, der Cariocasee mit dem Botanischen Garten. Das war der erste Blick, der zweite Blick aber sah mehr, er sah das Blau des Ozeans, der das Gesamtbild im Osten wie ein Rahmen umgab, erkannte die wuchtigen Ausläufer des Tijucamassivs, das sich vom Westen her wie eine steinerne Brandung in die Stadt ergoss. Überall ragten die dicht bewachsenen Morros über die Stadtviertel hinaus, und hellgelb glitzerten die Strände, die in der Ferne wie zarte, dünne Federstriche Land und Meer begrenzten. Ich erinnerte mich an den Golf von Neapel, an Istanbul und den Bosporus, an Hongkong, San Francisco oder die Bucht von Vancouver – alles Höhepunkte menschlicher Urbanität, doch nichts kam diesem Anblick gleich. Eine Stunde blieb ich oben, folgte dem Lauf der Wolkenschatten über der Millionenstadt, dem Licht der Sonne, die wie ein Scheinwerferstrahl Viertel für Viertel erhellte und erlebte hoch über Rio einen Moment der Befreiung, in dem ich aus mir heraustreten und mich als Teil eines größeren Bildes begreifen konnte.
Die zweite Exkursion des Tages führte mich zum Zuckerhut. Wieder bestieg ich nach einer komplizierten Anreise eine Zahnradbahn und erreichte mit ihr zuerst einen kleineren Kegelberg, um dann in eine Gondel umzusteigen, die mich auf das Plateau des 395 Meter hohen Zuckerhutes brachte. Vom Zuckerhut aus war das Panorama nicht ganz so umwerfend wie die Aussicht vom siebenhundert Meter hohen Corcovado, dafür war er selbst zu sehen, der monumentale Christus hoch über Rio vor der Kulisse des Tijucamassivs. Eine Schönwetterwolke hatte sich wie ein Heiligenschein über den Kopf des steinernen Erlösers gelegt, eine vergängliche Aureole, die an die Prophezeiung erinnerte, dass die Stadt trotz all ihrer Sünden so lange nicht untergehen würde, wie der Cristo Redentor auf seinem Sockel steht. Im Südwesten des Zuckerhutes war hinter dem niedrigen Morro do Urubu die Copacabana zu erkennen, der berühmteste Strand der Welt, der kilometerlang in einer perfekten Sichelform die Uferstraße begrenzte.
Erst vom Zuckerhut aus erkannte ich, wie riesig die Guanabarabucht war, ein großer, fragmentierter Meerbusen mit Inseln und Küsten, die im fernen Dunst verschwammen. Die Bucht sah aus, als sei sie ein Delta, obwohl hier kein Fluss ins Meer mündete. Deswegen hatten die ersten Europäer, die diese Küste im Januar 1502 erreichten, den Ort „Rio de Janeiro“, die „Stadt des Januarflusses,“ genannt.
Blick auf die Copacabana vom Zuckerhut aus
Die Avenida Copacabana, die ich vom Zuckerhut aus nach mehreren Tunneldurchfahrten erreichte, war eine kilometerlange Prachtstraße direkt am Meer - mit breiten Fahrbahnen, großzügigen Parkmöglichkeiten und einem Hochhaushotel neben dem nächsten. Zum Meer hin besaß die Copacabana einen puderweißen Strand, der sich breit und flach von den Kegelbergen in der Nähe des Zuckerhutes bis zu einem Landvorsprung im Süden erstreckte.
Leider war die Copacabana an diesem Tag für den Badebetrieb gesperrt. Die Unwetter der letzten Tage hatten sich zwar verzogen, aber das Meer war noch immer so unruhig, dass die Brandungswellen ein gefahrloses Baden unmöglich machten. Auch von den schönen, braungebrannten Brasilianerinnen war nirgendwo etwas zu sehen. Nur die Garde der Händler, Kuppler und Taschendiebe hatte sich vollständig eingefunden, ohne dass auf Anhieb genau zu erkennen gewesen wäre, wer nun Händler, Kuppler oder Taschendieb war.
Es war schon früher Abend, als ich ins Hotel zurückkam. Die Zeitverschiebung steckte mir in den Knochen, und ich war todmüde. Und so legte ich mich in der aufregendsten Stadt der Welt schon zur Abendessenszeit in die Kissen und schlief sofort ein.
*
Als ich am nächsten Morgen erwachte, war es noch dunkel. Es war fünf Uhr in der Frühe. Die letzte Stunde der Nacht ging gerade zu Ende. Ich zog mich an und verließ das Zimmer. Im Rezeptionsraum schlief der Angestellte auf einem Sofa, eine Bedienstete hatte im Nebenraum schon damit begonnen, das Frühstück vorzubereiten. Mit einem Kaffee, den ich mir an einem Automaten gezogen hatte, ging ich auf die Straße und setzte mich auf die steinerne Brüstung vor dem Hotel. Im Osten der Rua du Cateche wurde es hell, außer einigen wenigen Taxen waren die Fahrbahnen aber noch leer. Zwei Nachtschwärmer kamen aus dem Metroeingang und liefen die Straße entlang, ein Taxi hielt und entließ ein Paar, das sofort in einer Seitengasse verschwand. In dem Hotel auf der anderen Straßenseite gingen die Lichter an, einige Frauen verließen das Gebäude und stöckelten davon.
Nun gingen auch im Hotel „Monte Blanco“ die Lichter an, der Rezeptionist war endlich aufgestanden. Auch die Obdachlosen in den Hauseingängen erwachten - war nicht eines der Kinder drüben im Toreingang der Junge mit der grünen Turnhose, der gestern mein halbes Steak erhalten hatte? Straßenfeger kamen vorüber und kehrten den Unrat von den Bürgersteigen in die Gullys. Die Straßenbeleuchtung ging aus, und langsam, wie bei einem sich einstimmenden Orchester, erklangen die Geräusche der erwachenden Stadt: Hupen, Bremsen, Kreischen, Klirren und Stimmen verbanden sich zu einer urbanen Kakophonie. Ein neuer Tag war angebrochen.
An diesem Tag wollte ich mich durch die Innenstadt treiben lassen, was immer sich dabei auch ergeben würde. So habe ich die meisten großen Städte der Welt kennengelernt, die Metropolen als Überraschungseier, warum nicht? In Rio versagte diese Methode, denn eine Stadt, die ich in einem klassischen Rundgang hätte besichtigen können, existierte überhaupt nicht, von einer historischen Altstadt ganz zu schweigen. Fast alle Gebäude aus der Kolonialzeit waren zugunsten des Baus großer Avenidas abgerissen worden. Im Centro gab es nur triste Hochhausfassaden, gesichtslose Straßenzüge und jede Menge Bettler, die die Zugänge zu den Geschäften versperrten. Dann baufällige Kirchen, in die sich in Europa niemand hineintrauen würde, und ein groteskes Weltkriegsdenkmal, das zwei großen Krücken glich.
Vor dem Teatro Muncipal, einem Nachbau der Pariser Oper, fand eine Demonstration statt, die gerade aus dem Ruder lief. Hier standen keine Gutmenschen einfühlsamen Ordnungshütern gegenüber, sondern hier traf Wut auf Zorn. Weder die Polizisten noch die Demonstranten legten sich irgendwelche Zurückhaltung auf, es wurde geschrien und kräftig zugelangt, und ich machte, dass ich weiterkam. Von flotten Cariocas, die sambatanzend durch die Straßen hüpften, war nirgendwo etwas zu sehen, dafür hockten die Drogensüchtigen in den Parks, und alte Mütterlein boten Tierföten vor den Macumbageschäften zum Verkauf an. Die Nova Catedral, Rios zentrale und größte Kirche, die mehr als 20.000 Gläubige fassen konnte, war leer und sah aus wie ein pyramidales Parkhaus. Der Arcos de Carioco war ein Aquädukt aus dem 18. Jahrhundert, der die längste Zeit der Stadtgeschichte die Wasserversorgung Rios sichergestellt hatte. Inzwischen war die knapp zwanzig Meter hohe steinerne Wasserleitung längst außer Dienst und diente nur noch als malerische Brücke für die „Bonde“, eine uralte Straßenbahn, mit der man über den Aquädukt zum Künstlerviertel Santa Teresa fahren konnte. Beim Anblick des Aquädukts fiel mit eine Szene aus dem Film „Orfeo Negro“ ein, in dem der Straßenbahnschaffner Orfeo mit seiner Geliebten Euridice im offenen Straßenbahnwaggon durch das alte Rio fuhr. „Cancion de Orfeo“ gehört zu den schönsten Liebesballaden, die ich kenne.
Oben: Opernhaus von Rio de Janeiro
Unten: Kathedrale von Rio de Janeiro
Ich beschloss zu Ehren von Orfeo und Euridice mit der alten Straßenbahn über den Äquädukt nach Santa Theresa zu fahren. Aber der Schaffner war noch nicht da, ebensowenig der Fahrer, und nirgendwo konnte man ein Ticket kaufen. Das war merkwürdig. Anwohner kamen und gingen, hielten ein Schwätzchen, verkauften sich gegenseitig das eine oder andere Päckchen, ehe sie wieder ausstiegen. Kinder saßen auf der Rückbank und wetteiferten darin, wer den meisten Dreck zwischen den Zehen hatte. Sie hielten sich die kleinen Füße gegenseitig unter die Nase, jauchzten, lachten und hauten wieder ab. Es dauerte eine geschlagene halbe Stunde, ehe ich endlich begriff, dass die Straßenbahn heute nicht fahren würde, weil es an Strom fehlte und nicht abzusehen war, wann dieser Mangel behoben werden würde.
Die Kirche Nossa Senora da Gloria de Outeira liegt hoch über der Praia do Flammengo und gilt als die schönste Kirche Rio de Janieros, nicht wegen ihrer Azulejokacheln oder Holzschnitzereien, sondern wegen ihrer Aussicht auf Stadt und Bucht. Ich setzte mich auf die Terrassenbrüstung, sah die Schiffe am Ufer und die Favelas, die sich im Westen wie steinerne Geschwüre die Berge hochzogen. Ich spürte den warmen Wind, der über die Bucht wehte und versuchte mir für einen Moment den Anblick der Stadt am Beginn des 19. Jahrhundert vorzustellen. Eine kleine Siedlung zu Füßen der Kegelberge, Fluchtpunkt der portugiesischen Könige vor der napoleonischen Aggression, eine Stadt voller kleiner Alleen, mit Kolonialbauten, Palmenstränden, schon damals mit einer traumhaften Lage gesegnet, aber noch ohne Ahnung davon, dass sie einmal die schönste Stadt der Welt werden sollte. Allerdings besaß diese Schönheit nichts Historisches, es war eine Schönheit, die sich allein in der Gegenwart erschöpfte.
Kirche Nossa Senora da Gloria de Outeira
Am dritten Tag wölbte sich ein wolkenloser Himmel über der Copacabana. Die Augen taten weh, so weiß glitzerte der Strand in der Sonne. Und auch die Mädels waren da - nicht alle eine Venus, aber fast alle großartig gebaut, braungebrannt und genauso drall wie man es von einer brasilianischen Strandqueen erwartete. Fast noch besser sahen die Männer aus. Sie reckten ihre athletischen Körper beim Strandvolleyball, sprangen, liefen, und boten Anblicke prachtvoller Gesundheit im Vollgefühl ihrer Kraft. Für die Frauenwelt in ihrer Umgebung hatten sie kaum ein Auge. Es ging um Sport und Spiel, um Sieg und Niederlage, nur Weicheier machten dabei den Mädchen hinter den Seitenlinien schöne Augen.
Wie weiß und mickrig die europäischen und nordamerikanischen Touristen dagegen aussahen. Ich beobachtete, wie einige europäische Männer sich an den Rand des Strandes legten und ihre Umgebung aufmerksam beobachteten. Es dauerte nicht lange, da kam schon irgendein Eisverkäufer oder Schmuckhändler vorbei und stellte den Kontakt zu einer der jungen Frauen her, die scheinbar beiläufig auf der Uferbrüstung saßen. Wurde man sich handelseinig, dann kamen die jungen Frauen vorbei und verschwanden kurz darauf mit den Touristen zum Schäferstündchen.
Auch ich lag kaum eine halbe Stunde im Sand und befand mich schon kurz vor dem Einschlafen, da trabte der Inhaber des benachbarten Erfrischungsstandes heran und offerierte seine Angebote. Sein Name war Joseph, er war von unbestimmbarem Alter, wahrscheinlich schon weit über Fünfzig, hatte ein zerfurchtes Gesicht, eine Glatze und einen wabbeligen Bauch, der gar nicht zu diesem Strand der Schönen und Gesunden passen wollte. Obwohl ich seine Kupplerdienste ablehnte, kamen wir dennoch ins Geschäft. Für einen kleinen Obulus hatte er ein Auge auf mich, während ich schlief.
Am Nachmittag wachte ich auf und beobachtete das Strandleben. Auf den ersten Blick sah alles bunt und heiter aus, erst auf den zweiten Blick identifizierte ich abgerissen daherkommende Jugendliche, die wie heimatlose junge Hunde durch die Menge der Sonnenanbeter streiften. Obwohl die Badegäste von ihnen scheinbar keine Notiz nahmen, war an ihrer Körpersprache zu erkennen, dass sie die Jugendlichen genau im Blick hatten. Hatte man auch Mitleid mit den Armen, wollte man doch nicht ihre Beute sein.
Die meisten Jugendlichen, die am Tage die Straßenschluchten und Strände der Stadt beschlichen, lebten in den Favelas von Rio. Im Unterschied zu den üblen Peripherien afrikanischer Großstädte oder türkischer Gececondas befinden sich die Favelas von Rio in der Stadt selbst. Sie wuchsen wie ein urbaner Ausschlag die Morros hoch, was den kuriosen Effekt hatte, dass sich von den Favelas aus wahrscheinlich die schönsten Ausblicke auf Rio boten. Touristen sahen die Favelas immer nur von außen, als kunterbunte Brettersiedlungen an Bergabhängen, und der bisher einzige Versuch, geführte touristische Rundgänge durch die Favelas anzubieten, war vor einigen Jahren nach der Ermordung des Organisators eingestellt worden.
Am nächsten Morgen wachte ich auf, als es heftig an meiner Zimmertüre klopfte. „Pecueno almoco!“ rief eine weibliche Stimme. „Pecueno almoco! bedeutete „Frühstück“. Ich hatte aber kein Frühstück aufs Zimmer bestellt und zögerte, die Türe zu öffnen.
Das Klopfen hörte plötzlich auf und setzte sich einige Sekunden später an der Nachbartüre fort. Ein Sicherungsriegel wurde zurückgeschoben, und augenblicklich setzte ein unglaublicher Krach ein. Stühle fielen um, Glas klirrte, eine Frau schrie, ein Mann brüllte, dann ein klatschender Schlag, ein Schrei und Fluchtgeräusche. Irgendjemand rannte in großer Eile die Treppe herunter. Ich lief zum Balkon und sah, wie zwei Gestalten, ein junger Mann und ein Mädchen, aus dem Hotel rannten und über die Straße flüchteten. Eine Gruppe Verfolger blieb ihnen auf den Fersen.
Hotel Monte Blanco
Nun waren nebenan wieder Stimmen zu hören. Ein Mann sprach besänftigende Worte, andere Stimmen kamen hinzu. Ich öffnete die Türe und sah, wie der Rezeptionist mit einem älteren Paar sprach, das vollkommen entgeistert im Türrahmen stand. Der Mann trug einen Pyjama und ein Unterhemd und gestikulierte wild mit den Händen, seine Gattin, eine ältere Person mit grauen, strähnigen Haaren, stand neben ihm und weinte. Überall auf der Etage waren die Gäste aufgewacht, hatten die Türe geöffnet, um das Desaster zu sehen.
Als ich nach dem Duschen zum Frühstück herunterkam, traf ich auf zwei Polizisten in der Eingangshalle. Einer von ihnen, korpulent, kahlköpfig und von undefinierbarer Hautfarbe, verhörte den Portier, der andere, ein junger Mann mit glatten schwarzen Haaren und tückischem Blick, schaute sich um, ohne Fragen zu stellen. Ich erfuhr, dass ein junges Mädchen und ein junger Mann mit einem Messer in das Hotel eingedrungen waren. Im ersten Stock hatten sie auf gut Glück mit ihrer Frühstücksnummer an den Türen geklopft, um die Gäste, sobald sie öffneten, zu überraschen und auszurauben. Unklar war, wie sie am Portier vorbeigekommen waren oder ob der Portier mit den Dieben unter einer Decke steckte.
Heute stand der Ausflug nach Petropolis auf dem Programm. Es dauerte fast eine Stunde, ehe ich auf dem Busbahnhof von Rio den richtigen Bus nach Petropolis fand, und für die siebzig Kilometer lange Strecke benötigte der Bus noch einmal gut anderthalb Stunden. Zuerst passierte er im Norden Rios die Volkskirche Nossa Senhora da Penha. Wenn man den Reiseführern glauben konnte, war die weithin sichtbare Kirche ohne kunstgeschichtliche Bedeutung, ihre Lage auf einem Hügel im Rücken von Rio de Janeiro aber war eine Wucht. Eine Ahnung von Transzendenz mitten in Sodom. Als der Bus die Stadt endlich verlassen hatte, nahm der Verkehr ab. Links und rechts der Straße wucherten Gräser, Wiesen und Farne. An den Abhängen steil ansteigender Berge spross das Leben unter der Regie eines immerwährenden Regens.
Der Ort Petropolis, eine Gründung deutscher Einwanderer des frühen neunzehnten Jahrhunderts, war im Jahre 1843 von Kaiser Dom Pedro II. dazu ausersehen worden, ihm als Sommerresidenz zu dienen. Hoch über Rio und der Guananbarabucht wollte sich der Kaiser hier von den Zudringlichkeiten der Hauptstadt erholen. Seinen Palacio Imperial hatte er derart mit Möbeln, Tapeten und Spiegeln aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien vollgestellt, als befände er sich mitten im guten alten Europa. Das aktuelle Petropolis hatte allerdings mit diesen Fantasien nichts mehr zu tun. Die Zufahrtstraßen waren verstopft wie die Gassen einer mittelgriechischen Stadt, und abgesehen vom restaurierten Ortskern mit süddeutsch anmutenden Häusern bestand der Rest des Ortes aus einer planlosen Anhäufung moderner Bauten.
Allein der Palacio Imperial, die Sommerresidenz des Kaisers, bewahrte einen Rest historischer Patina. Das lang gezogene klassizistische Gebäude mitten in einem durchgrünten Parkgelände glich einer überdimensionalen Orangerie und wurde hingebungsvoll bewacht. Nur in Filzpantoffeln war es möglich, die Innenräume der Sommerresidenz zu betreten. Holzvertäfelungen und dicke Wandteppiche empfingen den Besucher, dann eine Portrait- und Fotogalerie, die den Kaiser in den verschiedenen Phasen seines Lebens präsentierte: zuerst den kleinen Pedro 1837 im Alter von 12 Jahren, dann den schon etwas herrischer dreinblickenden Kaiser 1857 im Alter von 32 Jahren und schließlich den alten Kaiser mit seinem Rauschebart kurz vor seinem Sturz im Jahre 1889. Die Sternwarte, die der Kaiser in der Sommerresidenz hatte einrichten lassen, war geschlossen, dafür hatte eine Sonderausstellung mit brasilianischer Landschaftsmalerei geöffnet. Die kleinformatigen Bilder in Öl zeigten Ansichten von Rio de Janeiro aus dem 18. und 19. Jahrhundert, ein kleines Wald- und Wiesennest auf der südlichen Erdhalbkugel. Über fiktive Uferstraßen promenierten Familien im Sonntagsstaat, in den Ecken drückten sich die Sklaven herum, man sah Geistliche mit ihren Sonnenschirmen flanieren und im Hintergrund die Umrisse von Corcovado und Zuckerhut ohne jede Bebauung. Zweieinhalb Kilogramm wog die Krone des brasilianischen Kaiserreiches, die Dom Pedro II. immerhin 68 Jahre lang getragen hat, womit er in der Rangliste der am längsten regierenden europäischen Fürsten neben Queen Victoria (1837-1901) und Kaiser Franz Joseph (1848-1916) einen respektablen Platz einnahm. Im Rückblick betrachtet erscheint seine Regierungszeit möglicherweise als die glücklichste Epoche der brasilianischen Geschichte. Aus einem dünn besiedelten ehemaligen Anhängsel des portugiesischen Kolonialreiches hatte sich in seiner Ägide ein aufstrebender Staat entwickelt, der mit den Einkünften aus Kaffee- und Kautschukanbau den Ausbau seiner Infrastruktur finanzierte. Häfen, Straßen, Postämter und Telegrafennetze waren ebenso entstanden wie ein elementares Schulwesen und eine Staatsverwaltung. Als Befürworter der Sklavenbefreiung war der Kaiser weniger erfolgreich gewesen, weil er auf die Interessen der konservativen Großgrundbesitzer Rücksicht nehmen musste. Am Ende war er im Jahre 1889 in einem unblutigen Putsch gestürzt worden und hatte sich ins französische Exil zurückziehen müssen, in dem er schon zwei Jahre später verstorben war. Eine Karikatur im Museumsteil der Sommerresidenz zeigte den alten Kaiser, wie er weinend im Nachthemd neben seinem Zepter und seinem Ornat stand, während sich das Volk totlachte. Schon damals hatte die Presse erfolgreich die Wirklichkeit verdreht, denn vom republikanischen Putsch des Jahres 1889 hatte nur eine kleine Elite von gerade mal 10.000 Menschen profitiert. So mildtätig wie der alte Kaiser, der in seiner Sommerresidenz ein Waisenhaus hatte einrichten lassen, waren die neuen Oligarchen nicht gewesen, so dass das Ansehen des Kaisers posthum immer weiter stieg, bis er heute neben dem Fliegerpionier Santos Dumont und dem Fußballweltmeister Pelé wieder zu den beliebtesten Brasilianern aller Zeiten zählt.
Nach dem Besuch der Sommerresidenz aß ich in der Nähe der Kathedrale zu Mittag und lernte einen allein reisenden Engländer kennen, der sich vorgenommen hatte, die Atlantikküste von Feuerland bis Cartagena mit öffentlichen Bussen abzureisen. Einen Monat lang war er in Argentinien unterwegs gewesen, hatte die Seeelefanten auf der Halbinsel Valdez gesehen, in den Spelunken von Montevideo Bife de Vaca gegessen und in Blumenau in Südbrasilien das zweitgrößte Oktoberfest der Welt besucht. Sein Name war Raymond, er hatte rosige Haut und dünne Haare, einen runden Kopf und eine unscheinbare Nase, die so gar nicht zu seinen Geschichten passen wollte.
Nach dem Essen fuhr Raymond nach Correira weiter, während ich mich auf die Suche nach dem „Stefan Zweig Haus“ machte. Dieses Wohnhaus erinnerte an den deutschen Schriftsteller Stefan Zweig, der nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten aus Deutschland vertrieben worden war und sich im Jahre 1942 zusammen mit seiner Frau Charlotte in Petropolis das Leben genommen hatte.
Das in den letzten Jahren mehrfach renovierte Haus befand sich zwei Kilometer südlich der Sommerresidenz in der Rua Goncalvez. Der einfache einstöckige Bungalow war über eine Treppe erreichbar, besaß eine überdachte und verglaste Arkade und im Gartenbereich eine Schachanlage, die daran erinnerte, dass Stefan Zweig in diesem Haus seine „Schachnovelle“ geschrieben hatte. Das Innere des Hauses war nicht zugänglich, mehr als einen Blick durch die Fenster war nicht zu erhaschen. Ziemlich leere Zimmer, ein paar Stühle, ein altes Sofa, das war´s.
Ich wollte gerade wieder die Treppe heruntergehen, als mir ein älterer Mann entgegenkam, der sich in kaum verständlichem Deutsch als Gustavo vorstellte. Er hatte ein flaches Gesicht, eine stumpfe Nase und Froschaugen und behauptete, Fremdenführer zu sein. Ehe ich etwas sagen konnte, zog er seinen Reiseführer aus der Tasche, um aus dem Buch vorzulesen. Die Person, die in diesem Haus gewohnt hatte, war ein Dichter gewesen, berichtete Gustavo. Sein Name sei Stefan Zweig gewesen. Mit bedeutungsvollem Timbre in der Stimme berichtete Gustavo weiter, dass es sich um Stefan Zweigs ehemaliges Wohnhaus handele, das nun als Ort für Kongresse und internationale Konferenzen diene. Zum Finale seines Vortrags zog er ein zerknittertes Blatt aus der Tasche, auf dem Stefan Zweigs Abschiedsbrief, die berühmte „Declaratio“ in Portugiesisch und Deutsch abkopiert war. Als ich das Blatt in die Hand nehmen und lesen wollte, verlangte Gustavo zuerst eine Bezahlung für seine Informationen. Ich überreichte Gustavo einige Cruzeiros und erhielt dafür das Blatt. Als Gustavo gegangen war, setzte ich mich auf die Treppe und las.
„Ehe ich aus freiem Willen und mit klaren Sinnen aus dem Leben scheide, drängt es mich, eine letzte Pflicht zu erfüllen: diesem wundervollen Lande Brasilien innig zu danken, das mir und meiner Arbeit so gute und gastliche Rast gegeben. Mit jedem Tage habe ich dies Land mehr lieben gelernt und nirgends hätte ich mir mein Leben lieber vom Grunde aus neu aufgebaut, nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist undmeine geistige Heimat Europa sich selber vernichtet. Aber nach dem sechzigsten Jahre bedürfte es besonderer Kräfte um noch einmal völlig neu zu beginnen. Und die meinen sind durch die langen Jahre heimatlosen Wanderns erschöpft. So halte ich es fürbesser, rechtzeitig und in aufrechter Haltung ein Leben abzuschließen, dem geistige Arbeit immer die lauterste Freude und persönliche Freiheit das höchste Gut dieser Erde gewesen.“
Das war aber noch nicht alles. Auf der Rückseite ging der Text weiter „Ich grüße alle meine Freunde! Mögen sie die Morgenröte noch sehen nach der langen Nacht! Ich, allzu Ungeduldiger, gehe ihnen voraus.“