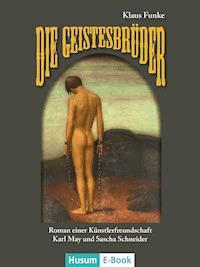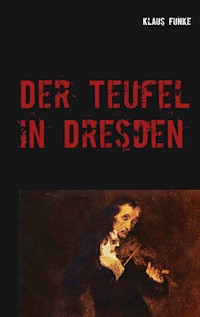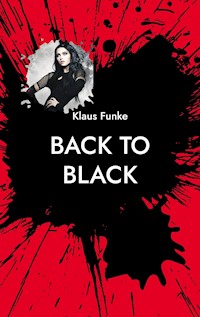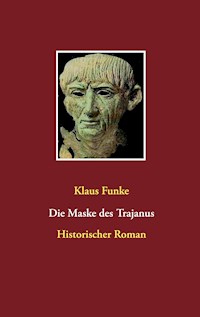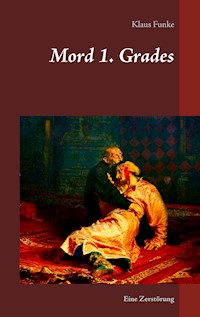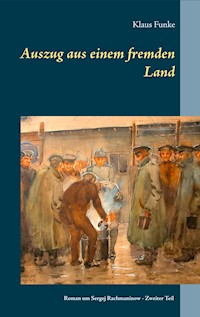Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Sie finden mich in Lissabon im Paradiso, hatte er gesagt, es ist eines jener stillen Cafés, beinahe eine Bar, sogar mit einer kleinen Tanzfläche und einer Art Terrasse, zurecht gemacht für den Touristenverkehr, und dennoch so zurückgezogen, dass es nur wirklich wenige von denen finden. Sie müssen die theatralische Kulisse der Praca do Comerco umfahren, sie kommen dann nach einiger Zeit in ein Gewirr von Treppen und Gassen, die aufwärts führen. Es wird nach Fisch, Knoblauch und Nachtblumen, nach Schlaf und Schweiß riechen, dann werden Sie das Kastell St. George im Nachthimmel wie einen schwarzen Riesen aufragen sehen. An diesem Aussichtspunkt werden Sie stehen bleiben und zu träumen beginnen. Alle Fremden träumen um diese Zeit dort, wo Sie stehen geblieben sind..." So beginnt eine portugiesische Nacht. Der bekannte Autor Murillho erzählt einem Neuling aus seinem Leben. Am Ende wird dieser Neuling sein Ghostwriter werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch:
Da ist eine geheimnisvolle Frau. Sie nennt sich Ninfa. Keiner weiß, woher sie kommt, welcher Nationalität sie angehört, wie alt sie ist. Aber sie ist verführerisch schön und scheint über magische Kräfte zu verfügen. Für den jungen Schriftsteller Franz Malef erscheint sie ein guter Geist, eine Art Fee zu sein, die ihn immer wieder auf die von ihr vorbestimmte Bahn zu geleiten sucht. Sie ist es auch, die ihn eines Tages mit einem berühmten, einem weltberühmten Schriftsteller zusammenbringt. Er heißt Raul Murillho, ist Portugiese und lebt in der Nähe von Lissabon auf seinem Anwesen. Dorthin lädt er den jungen Kollegen ein. Die beiden ungleichen Männer verbringen eine portugiesische Nacht miteinander. Der ältere erzählt aus seinem Leben. Der jüngere hört zu. Je länger Murillhos Erzählung dauert, desto mehr findet sich Malef in diesem Leben wieder. Es scheint ihm wie eine Spiegelung. Was bekommt der Leser nicht alles zu hören: Murillhos Pariser Studentenzeit, seine Bekanntschaft mit berühmten Zeitgenossen, seine Liebe mit der jungen Erfolgsschriftstellerin Francoise Saguin, seinen Kampf mit einem alten Feind, einem Jesuitenpater.
Dieser war sein Lehrer schon im Jesuitenkolleg und später der Gönner und väterliche Freund seiner Geliebten Saguin. Wir hören von Murillhos erstem literarischen Ruhm, erleben ihn in seiner Häuslichkeit auf seinem Anwesen, lernen seine Frau kennen. Schließlich lässt er die Katze aus dem Sack – er hat sich ausgeschrieben, er kann nicht mehr. Er braucht einen Ghostwriter, um wenigstens vor der Welt noch den Anschein zu wahren. Wird Franz Malef dieser Ghostwriter werden? Eine furiose, bildstarke, sprachmächtige Erzählung. Amüsant mit vielen Seitenhieben auf den Literaturbetrieb.
Über den Autor:
Klaus Funke, in Dresden geboren, ist ein bekannter Autor erfolgreicher Romane, Novellen und Erzählungen. Mit „Der Moccatrinker von Lissabon“ legt er ein bisher noch nicht veröffentlichtes Werk vor. Es reiht sich in die Reihe von Neuerscheinungen bei BoD ein, wozu auch „Der zwölfte Gast“, „Meine Verlage“, „Ich wollte König werden“, „Franzi“ und „Die Betrogenen“ u.a. gehören.
Sie finden mich in Lissabon im Paradiso, hatte er gesagt, es ist eines jener stillen Cafés, beinahe eine Bar, sogar mit einer kleinen Tanzfläche und einer Art Terrasse, zurecht gemacht für den Touristenverkehr, und dennoch so zurückgezogen, dass es nur wirklich wenige von denen finden. Sie müssen die theatralische Kulisse der Praca do Comerco umfahren, sie kommen dann nach einiger Zeit in ein Gewirr von Treppen und Gassen, die aufwärts führen. Sie müssen dann aussteigen aus dem Taxi und diese Treppen und winkligen Gassen emporsteigen.
Es wird nach Fisch, Knoblauch und Nachtblumen, nach Schlaf und Schweiß riechen, dann werden Sie das Kastell St. George im Nachthimmel wie einen schwarzen Riesen aufragen sehen, wenn Sie sich dann umwenden, werden sie unten den Hafen, die vertäuten Schiffe im nachtglitzernden Wasser liegen sehen. Dort unten ist auch die Stelle, wo der Tejo ins Meer fließt. Ich weiß, hatte er gesagt, an diesem Aussichtspunkt werden Sie stehen bleiben und zu träumen beginnen. Alle Fremden träumen um diese Zeit dort, wo Sie stehen geblieben sind. Dann, ein paar Schritte weiter nach links, werden Sie das Lokal sehen. Sie werden erstaunt sein über die zwei großen Ladenscheiben, die es zur Straße abtrennt, und dann hinter einer dieser Scheiben, an einem runden Tisch, werden Sie mich sitzen sehen. Vor mir eine Tasse Mocca und eine Zeitung in der Hand. Sie werden zuerst über mein gebräuntes Gesicht staunen, zu dem der graue Kinnbart in hellstem Kontrast steht. Alle, die mich zum ersten Mal sehen, sind über diesen Kontrast erstaunt. Treten Sie dann, wenn Sie mich entdeckt haben, in das Café, und fragen Sie den Kellner, der befrackt und beflissen auf Sie zueilen wird, denn man wird Ihnen den Fremden ohne Weiteres ansehen, fragen Sie ihn also ohne Umschweife:
Wo sitzt hier Señor Murilho?
Und er wird Sie zu mir an den Tisch führen…
Ich stieg aus dem Taxi, genau an der Stelle, wo die Treppen in die Oberstadt führen, ich roch den Nachtatem der Stadt, ich sah das Kastell St. George, diesen dunklen Riesen, und ich fühlte mich winzig, unbedeutend, ein Menschlein, ich sah unten den Hafen, sah wie sich das Mondlicht in den Wellen spiegelte und es zu mir, wie magische Strahlen, herauf flimmerte, ich sah die Schiffe am Kai, klein, fern, unerreichbar und ich blieb natürlich, wie von Murilho vorausgesagt, aus dem Taxi ausgestiegen, an dieser Märchenstelle stehen, um meinen Augen und meiner Seele zu trinken zu geben, denn mir dürstete nach solchem Eindruck. Erst eine ungeduldige Geste und ein Räuspern des Taxifahrers brachte mich zur Besinnung und ich gab ihm, immer noch berauscht und wie betäubt, das geforderte Geld.
Dann, nachdem ich eine kurze, steile Felsentreppe überwunden hatte, sah ich das Lokal; wie eine grell bunt illuminierte Oase schimmerte es inmitten des Nachtdunkels, wie ein beleuchteter Edelstein unter den zahllosen, winzigen, an schwärmende Nachtinsekten erinnernden hellen Fenstern des in den Fels gebauten Viertels.
Ja, dies musste das Paradiso sein. Da waren die zwei große Fenster, und im Näherkommen sah ich hinter dem einen eine Gestalt sitzen, genauso wie er sich beschrieben hatte, ich sah zuerst den grauen, fast weißen Kinnbart und den hellen, beinahe strahlenden Haarkranz, erst danach erkannte ich das dunkle, gebräunte Gesicht, aus dem die Augen, schwarz und groß hervorblitzten. Ich nickte dem Mann zu, doch er sah mich offenbar nicht, denn keine Reaktion ließ erkennen, dass er mich draußen vor der Glasscheibe im Dunkel des Abends entdeckt hätte.
Ich trat ein. Ein dämmriger Schimmer umhüllte mich, wärmend und duftend wie ein Nachtmantel. Über den Tischen hingen kleine Lampen in Bastschirmen und zeichneten Kringel aus gelb freundlichem Licht auf die mit dunkelblauen Ornamenten bedruckten Tischdecken. Ich fühlte mich an Bekanntes, Heimatliches erinnert, doch zugleich spürte ich die Fremde, das gänzlich Andere. Es roch auch hier nach diesen Nachtgerüchen, die ich schon beim Aussteigen aus dem Taxi wahrgenommen hatte, jedoch viel stärker, intensiver: Knoblauch, Thymian, gegrillter Fisch, Rotwein und der betäubende Duft heißen, frisch gebrühten Moccas.
Das Lokal war mäßig besucht. Insgesamt saßen hier nur ein Dutzend Gäste, verstreut an den Tischen, wie verirrte Schafe, mal allein, mal zu zweien, kein Tisch war voll besetzt. Mit den Augen suchte ich meinen weißbärtigen Mann, doch ich entdeckte ihn nicht gleich. Ein junger Kellner, tief gebräunt mit glänzenden dunklen Augen und gestyltem schwarzen Haar, das ihm borstig und wie dünner Draht vom Kopfe abstand, trat plötzlich, wie aus dem Nichts auf mich zu, und ich sagte ihm den Namen: Senior Raul Murilho! suchte nach dem portugiesischen „bitte“, fand es nicht, dieses Wort, flüsterte unbeholfen: please! und fühlte mich mit einem Mal fremd und hilflos.
Der Kellner nickte, sagte: follow me please! aber er sagte das so, dass ich mich ertappt wusste, für einen Engländer hielt er mich nicht. Dazu hatte er die drei englischen Worte mit einer solchen Nachlässigkeit und Betonung ausgesprochen, die mir verraten sollte, er wisse nicht, woher ich käme, aber ein Engländer, oder aus einem englischsprachigen Land stamme ich bestimmt nicht, möglicherweise sei ich irgendein unbedeutender Fremder, wahrscheinlich ein Osteuropäer.
Murilho hatte den Kopf abgewandt, starrte zum Fenster hinaus in die Nacht. Der Kellner sagte zu ihm irgendetwas auf Portugiesisch, ich verstand es nicht, es waren nur ein paar knappe Worte. Murilho fuhr herum, ich sah in seine übergroßen, schwarzen, erstaunten Augen, ein Lächeln, wie ein schwaches Erkennen glitt ihm, zuerst von diesen zwingenden, magischen Augen zur Stirn, die er leicht runzelte, dann zur Nase und von dort zu den Lippen, wo es wie ein Wassertropfen in einen See fiel, sich verstärkte, Kreise warf, zu den Augen zurückkehrte, um dort in einem fröhliches Leuchten aufzuglühen:
Ah, Sie sind Herr Malef! Franz Malef, nicht wahr? Sein Deutsch, so unbeholfen es war, klang liebenswürdig, dunkel, kehlig, etwas rau: Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben. Setzen Sie sich, bitte! Und er blickte zum wartenden Kellner, sagte wieder etwas Portugiesisches zu ihm, und als er gegangen war: Ich habe zwei Mocca bestellt. Der Mocca ist hier ganz vortrefflich, den müssen Sie probieren. Außerdem gibt er unserem Geist, Sie werden sehen, die richtige Schärfe, die wir brauchen werden für diese Nacht.
Ich hatte ihm zur Begrüßung die Hand gegeben, hatte eine warme, weiche, zugleich aber fleischige Arbeitshand in den Händen gehalten, und daran gedacht, mich dieses Händedrucks sogleich erinnernd, wie wir uns in Zagreb kennen gelernt hatten. Auch dort war es merkwürdigerweise in der Oberstadt gewesen, die einem Hügel gleich, das Häusermeer, die grässlichen aus Titows Zeiten stammenden Neubauten, überragte. In einer der Tavernen hatte ich gesessen, allein, bei einem Schoppen dunklen dalmatinischen Tischweines, und auf Russalka gewartet. Sie wird sich verspätet haben, dachte ich zuerst, dann aber, nach einer halben Stunde, wusste ich, sie würde überhaupt nicht kommen. Unentschlossen wartete ich noch einige Zeit, nippte an meinem Weinrest. Da sah ich plötzlich an einem der Nachbartische einen Mann sitzen. Er war vom Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, schwarzer Rollpulli, schwarze Seidenhosen, schwarzen, kragenlosen Blazer, auch schwarze Schuhe und schwarzseidene Socken. Sein Kopf und die Hände aber, die enthüllten Körperteile also, kontrastierten dazu in gelb glänzendem Braun, während dazu nun wieder sich sein weißsilberner Haarkranz und ein ebenso farbiges Kinnbärtchen lebhaft abhoben. Eine beeindruckende Erscheinung, dieser Mann, dachte ich, und mich befiel, ob meiner eigenen, vulgären Äußerlichkeit, an die ich sofort denken musste, lebhafter Neid. Hatte er eine hohe, freie, glatte Stirn, die von Kühnheit, Freiheitsdrang und Gedankentiefe kündeten, war die meine gefurcht, gefältelt und blass, eher breit und gar nicht hoch, hatte er feinnervige, kräftige Hände, Arbeitshände, Sport geübte Hände, und besah ich mir die meinen, so blickte ich auf weißliche, zarte Mädchenhände, die keine schwere Arbeit leisten konnten und jeder Sportlichkeit der größte Feind waren. Und dann seine Augen:
dunkel, sprühend, dabei tiefträumerisch, und von warmer Herzlichkeit, während ich wusste, meine Augen hatten unsicheres Flackern und Distanz, konnten niemals das verströmen, was ich im Herzen fühlte.
So saß ich und beobachtete den Mann. Wer mochte er sein, was wäre seine Profession? dachte ich. Ich kam nicht dazu, weiter nachzudenken, denn der Mann, der gesehen hatte, dass ich ihn beobachtete, sprach mich an. Er sagte etwas zu mir in einer fremden Sprache, und ich bemerkte nicht gleich, dass es Portugiesisch war. Natürlich verstand ich kein Wort, nur der Klang der Sprache verriet mir, es müsse eine iberische Sprache sein, spanisch wäre es aber nicht, denn da kannte ich ein paar Brocken. Ich musste ein ziemlich dummes und überrumpeltes Gesicht gemacht haben, denn er wechselte jetzt die Sprache, sprach zuerst Englisch und dann Deutsch: Verzeihen Sie, mein Herr, sie scheinen mich zu kennen oder Sie verwechseln mich mit einem Ihrer Bekannten? Was kann ich für Sie tun? Er sprach das Deutsche kehlig und dumpf mit einem angenehmen, fremden Akzent.
Ich antwortete: Nein, nein ich verwechsle Sie mit niemandem, ich besah mir nur Ihr Äußeres, Ihre Gestalt, Ihre Kleidung und rätsele nun, wen ich vor mir haben könnte: Einen Jesuiten, einen Geheimbündler oder einen Künstler.
Er lachte und antwortete: Sie haben gut geraten, denn ich bin von allem etwas. Da lachte auch ich.
In diesem Augenblick trat ein Fremder an den Tisch meines neuen Bekannten, er sprach ihn an, ich glaube, es war wieder dieses Portugiesisch. Sie wechselten nur ein paar Sätze, da sprang mein Tischnachbar auf, er wandte sich mir zu, rief: Wenn Sie einmal in Lissabon sind oder dorthin aufbrechen sollten, rufen Sie mich an. Wir sollten unser begonnenes Gespräch fortsetzen. Jetzt aber, Sie entschuldigen, muss ich in einer äußerst wichtigen Angelegenheit davongehen. Bitte entschuldigen Sie, sagte er noch einmal, reichte mir eine Visitenkarte und er gab mir die Hand, jene Hand, an deren Berührung ich mich jetzt, hier im Café Paradiso, sogleich erinnerte, an diese weiche, feinnervige, zugleich aber fleischige Arbeitshand.
Kaum war er gegangen, als Russalka erschien. Mit ihrem federnden hüftdrehenden Schritt kam sie auf mich zu und ich wunderte mich, denn ihr Hinken, das sie sonst kaum unterdrücken konnte, war nicht zu sehen. Die Gäste, an denen sie vorbeischwang, blickten auf. Es war wie immer: Überall, wohin sie kam, erregte sie sofort alle Aufmerksamkeit. Na, hast du dich ohne mich gelangweilt, fragte sie, und zum heraneilenden Kellner: Einen großen Wermut, bitte!
Ich vergaß augenblicklich meinen entschwundenen Tischnachbarn, vergaß mein Interesse für ihn, sah nur noch diese Frau ... - und doch habe ich später nie genau gewusst, ob es sie, Russalka, nicht wieder gewesen wäre, die dieses zufällige Treffen und die folgende Zusammenkunft mit dem großen Murilho zuwege gebracht habe. Vielleicht war ihr Zuspätkommen Absicht gewesen. Solche Arrangements gehörten zu ihren Tricks. Wie ich später erfuhr, kannten sie sich Russalka und Murilho schon lange ...
Immerhin, Raul Murilho, war ein Weltbestsellerautor, einer, dessen Bücher Millionenauflagen erreichten, ein Magier der Literatur, wie er von vielen genannt wurde, eine Kultfigur. Ein Wunder, dass er einen wie mich an sich heranließ, mich überhaupt eines Blickes gewürdigt hatte, wo er doch sonst sehr wählerisch, auch bei der Auswahl seiner journalistischen Gesprächspartner wäre, wie es immer wieder hieß.
So setzen Sie sich doch, hörte ich Raul Murilho sagen, ich schrak auf, besann mich, ach, ich sei ja in Portugal, in Lissabon, dachte ich und ich sah Murilho eine weitausholende, einladende Geste machen.
Als wir uns das letzte Mal sahen, sagte er mit einem Lächeln, da wussten Sie noch nicht genau, mit wem sie es zu tun haben. Ist es nicht so?
Ich nickte, wagte ein unsicheres, zaghaftes Lächeln, blinzelte. In der Tat, so sei es gewesen, aber jetzt ...
Jetzt aber wissen Sie, wer Ihnen gegenüber sitzt. Sie haben über mich und von mir gelesen, was sie kriegen konnten, und – er dehnte den Satz, lehnte sich zurück, zwinkerte mir zu und hob die Mokkatasse an den Mund, sodass seine schwarzen Augen über den goldgebänderten Tassenrand mir geradewegs und herausfordernd ins Gesicht blickten, und, fuhr er fort, immer noch die Tasse in dieser Schwebe haltend, und da Sie selbst auf dem Weg sind, auf dem Weg, den wir alle, die wir uns Autoren, Schriftsteller, Verfasser, Texter und wer weiß wie nennen, gehen müssen, erhoffen Sie sich viel, ja alles von unserem Gespräch. Deshalb sind Sie gekommen!
Wieder nickte ich, ich war irritiert, konnte nichts antworten, und, als mein Blick zufällig an einen der Nachbartische geriet, zuckte ich zusammen. Dort saß, es war unverkennbar - das rote Haar, der Rücken, der gebogene schlanke Hals, dort saß ...!
Ja, dies könne nur Russalka sein, dachte ich, und sie unterhielt sich angeregt mit ihrem Tischpartner, einem älteren Herrn mit gerötetem, glänzenden Gesicht. Wie war sie nur hierhergekommen? Warum hatte sie, als wir uns in Berlin verabschiedet hatten, kein Wort gesagt. Ich wandte den Blick ab, sah Murilho mit flackernden Augen unsicher an.
Der musste wohl mein Unbehagen gespürt haben, er wandte sich um, doch, als ich seinem Blick folgte und wieder zu diesem Nachbartisch hinüberschaute, saß dort eine ganz normale Frau, schwarzes, längeres Haar, olivenfarbiger Teint, offenbar ein Einheimische mit einem ausländischen, und wie sein rötliches Haar verkündete, einem Nordländer, einem Schweden, Dänen oder Iren zusammen.
Hatte ich mich getäuscht? Trügten mich meine Sinne? Ich war irritiert, unsicher, vielleicht zittern sogar meine Hände, dachte ich nervös und blickte auf meine Finger, die auf dem Tisch lagen, als gehörten sie nicht mir. Mein Herz klopfte plötzlich wie wild.
Dieses Weib! dachte ich, denn inzwischen hatte ich im Umgang mit Russalka so viel Seltsames und Unerklärliches erlebt, dass ich insgeheim wirklich vermuten konnte, sie wäre tatsächlich hier irgendwo, hätte sich herbeigezaubert und sie wolle mich foppen und zum Narren machen.
Sie scheinen verwirrt, Junger Mann, hörte ich Murilho sagen, ich gab mir einen Ruck und blickte ihm nun wieder ins gebräunte, markante Gesicht des bekannten Schriftstellers. Er hatte die Moccatasse abgesetzt, sich mit seinen gepflegten, wohlgeformten Fingern eine Brasil aus dem perlmuttfarbenen Etui gezogen, sie langsam und genussvoll in Brand gesteckt, und schaute mich jetzt mit einem satten, etwas herausfordernden Lächeln an.
Ja, ich weiß, deshalb sind Sie gekommen, wie Sie es im Übrigen kaum erwarten konnten, mich zu sehen, mich, von dem Sie nun wüssten, wer ich sei, ja natürlich (er lachte) besonders nach der hastig gelesenen Lektüre aus meinem Leben und der eines meiner letzten Bücher, des Druiden, wahrscheinlich, Sie sind beinahe atemlos hier heraufgeklettert, um mich endlich zu fragen, was mich im Übrigen immer gefragt wird, wie, Señor Murilho sind Sie zu dem geworden, der Sie heute sind. Wie schafft man dieses Wunder? Das Wunder des öffentlichen, des bekannten Lebens eines Weltmenschen. Ist es nicht so, Herr Malef?
Ich schwieg, aber in meinen Augen sah er Zustimmung, weshalb er fast ohne Unterbrechung fortfuhr: Nun, es ist ganz einfach. Immer ist es das Einfache, was so Enormes erreicht. Ich sage Ihnen, bei mir, wie bei allen übrigens, welche die gleiche Höhe erklommen haben, ist es der Zufall gewesen und das Glück, und ein wenig Talent. Denn, wenn diese drei Elemente zusammenstoßen, Zufall, Glückt und Talent, wenn Sie die richtige Zeit, den richtigen Ort, die richtige Temperatur haben, die richtigen Umgebungsbedingungen haben, dann entsteht, wie in der Chemie, wie es in den Naturwissenschaften uns oft belegt wird, etwas Neues, ein solches Produkt, ein Wunder wie ich es bin. Ja, ich bin ein Wunder, da staunen Sie, ein Wunder und ein Produkt, aber eben auch, und zu einem nicht unwesentlichen Teil, das Produkt, das Wunder aus mir selbst. Wie Nietzsche sagt: Die Erschaffung aus uns selbst. Der Wille und die Vorstellung in wunderbarer Symbiose! Wie mag das zugehen, fragen Sie? Ich will es Ihnen sagen. Natürlich, das weiß ich jetzt, damals, als es sich zutrug, als ich anfing, zu dem zu werden, der ich heute bin, als ich mich zu verwandeln begann, als ich wurde, der ich bin, da wusste ich nichts, nahm alles hin, wunderte mich nicht einmal, und doch war alles von Anfang an einer bestimmten, geheimnisvollen und wie es mir lange Zeit schien, von mir unbeeinflussbaren Gesetzmäßigkeit unterworfen ...doch, das ist die Unwahrheit, denn wir sind es selbst, wenn wir uns einmal erkannt haben, welche uns die eigenen Gesetze machen, die zu uns passenden, da kommt eines zum anderen und immer fügt es sich zu unserem Vorteil. Der Teufel wie auch Gott, beide sind immer nur auf der einen Seite, auf der des Glücks oder der des Unglücks. Ist es nicht so?
Er machte eine Pause, in der er mit gespannter Erwartung die Spitze seiner Zigarre betrachtete. Mir schien, als konzentriere er alle seine Geisteskräfte darauf, zu warten, bis der inzwischen mehrere Zentimeter lange Aschestab seiner Brasil, der wie eine Vulkanspitze vorne weiß und zum noch unverbrannten Tabakkörper grau werdend, abfiel, und, ohne irgendein Geräusch abzugeben, im kristallenen Ascher zerstäuben und nur den rotglühenden Glutkegel zurücklassen würde.
Ja, sagte er, als die Asche gefallen war und er erleichtert aufgeseufzt hatte, ja alles begann auf diesem Weg, auf den ich zuerst geschoben wurde und den ich dann selbstständig beschritt – alles, alles beginnt mit der Familie. Mit der Familie, in die man hineingeboren wird und aus der man dann später, wie gesagt wird, heraustritt. Was wäre ein Cäsar, ein Napoleon, ein Thomas Mann, und im Tragischen, solche Männer wie Kafka und Oscar Wilde ohne ihre Familien, mit der sie verbunden waren, die sie gezeugt und empor getragen und dann ausgestoßen haben, ja, solche Großen, die ihren Grundkonflikt mit der Familie bereits im Kindesalter in sich trugen oder ihn auslebten, exzessiv ausspien später, als sie berühmt wurden. Vielleicht, nein bestimmt sogar dadurch nur konnten sie dann das leisteten, was alle Welt von ihnen kennt ... Die Familie ist unser Gärbottich, unser Mikroklima, aus der wir im Positiven, wie im Negativen unsere Genialität gebären.
Sollte dies bei Ihnen ähnlich sein, so nehmen sie das als ein erstes günstiges Zeichen ...
Murilho schwieg, wie ein Dirigent, der den Taktstock hebt und das Orchester in wartende Stille versetzt.
Ich war überrascht und ich versuchte meinen Gesichtsausdruck, der in diesem Moment ziemlich unverständig, um nicht zu sagen, blöde ausgesehen haben muss, hinter einem krampfigen Lächeln zu verbergen. Murilho tat, als sähe er nichts. Er hatte die Zigarre mit großem Bedacht, ja mit einem fast zärtlichen Ausdruck, indem er, wie ich verwundert sah, den kleinen Finger der rechten Hand in graziöser Weise abspreizte, auf den Rand des Aschers gelegt, wieder die Moccatasse ergriffen, und hielt sie nun wieder in derselben Geste wie vor einigen Minuten an seinen Mund.
Sie muss doch leer sein, diese Moccatasse, dachte ich, warum macht er diese Geste, dieses Tasse heben, will er mich examinieren, prüfen, beobachten, will er mir einen Teil seiner Züge verdecken. Ein Schauspieler, ein Scharlatan! dachte ich für Sekunden.
Und doch schien er meine Gedanken erraten zu haben, denn, als er begonnen hatte, das von der Familie zu sagen, hatte ich sehr wohl an die meine gedacht und an die Zerwürfnisse, die es seit frühester Kindheit mit mir gegeben hatte, und ich versuchte irgendeinen Gedankenbezug zwischen meiner Leidenschaft zum Schreiben und diesen familiären Streitigkeiten, diesen fortwährenden, immer unumkehrbarer werdenden Zerfall, ja bis zum endgültigen Bruch mit den Meinen, herzustellen. Ich fühlte mich von diesem Murilho beobachtet, ertappt, doch nur einen Augenblick machte er diese Pause und hatte dieses Lauern im Blick, denn bald setzte er die Tasse wieder ab und sprach weiter:
Ich stamme aus einer begüterten Familie, aus einer Lissabonner Familie im Norden der Stadt, oder eigentlich müsste ich sagen, aus einer reichen Familie des ländliches Umfeldes, denn begütert sein, heißt auch immer, zu bedenken, aus welchem Umgebungskreis man kommt. Wer bei uns auf dem Lande reich ist, der ist am Stadtrand einer solchen Millionenstadt wie Lissabon schon nur mehr begütert, während er im Zentrum wohnend, als bloß noch wohlhabend bezeichnet wird, einer aus der Mittelschicht ist man mitten in der Stadt, aber im ländlichen Rand erscheint man schon zur Oberschicht gehörig, auf dem flachen Lande aber, wie man sagt, ist man dann bereits ein Patron, einer, den die arme, ländliche Bevölkerung achtet und ehrt, dessen Wort Gewicht hat, dessen Alltagssprüche Weissagungen gleichen. Wir waren also eine reiche Familie, und haben doch wie ein Vertreter der Mittelschicht in der City, das gleiche Geld, die gleichen Kontostände, dieselben „Reichtümer“ und Werte besessen ...
Murilho sprach das Wort „Reichtümer“ mit einer seltsamen Betonung aus und ich wusste nicht, war es Stolz oder Herablassung, die in seinen Worten lag.
Wir gehörten also zu den Reichen, obwohl mein Vater, anfangs mit dem eigenen Wagen fuhr und später mit einem Fahrer in seine Bank in der City kutschiert wurde, in der er einer der drei Manager, früher sagte man: Leitender Angestellter, gewesen ist. Meine Mutter widmete sich dem Haus, dem Garten und uns vier Kindern.
Vier Jungen, wissen Sie, sagte Murilho, und er schlug sich mit der Faust an die Brust. Sie hatte portugiesische Sprache und Französisch studiert und eine Zeitlang, bis sie meinen Vater kennen lernte, in einem Fremdspracheninstitut gearbeitet. Aber sie war eine gute Katholikin, während mein Vater alles Religiöse zwar ertrug, duldete und soweit es unserer Erziehung und Entwicklung dienen konnte, auch förderte, aber er ist in seinem Herzen ein Freigeist, allerdings mit einem Hang zu allem Mystischen, Zeit seines Lebens geblieben.
Vier Jungen. Ich war der dritte von oben! Murilho macht ein Zeichen mit der Hand, als wolle er verschiedene Etagen anzeigen. Der Dritte! Bei uns war es nach dem Willen des Vaters so: Der Erste musste Staatsbeamter werden, der zweite Militär, ich sollte zuerst ins Jesuitenkolleg, um dann Jura zu studieren, und der Kleine, Alonso, den hatten die Eltern zum Künstlerberuf auserwählt. Aber er ist keiner geworden.
Nun ja, er lachte, wir wurden alle etwas anderes. Die Zeiten waren nicht mehr so, wie zu meines Vaters Jugend. Das muss er wohl außer acht gelassen haben. Dennoch, mit acht Jahren kam ich auf ein Jesuitenkolleg. Es lag im Süden, in den Bergen, in der Nähe von Castro Verde, sagte Murilho und machte wieder eine seiner ausholenden Gesten, als wolle er die Höhe dieser Berge anzeigen. Ich kam also dahin, in dieses abgelegene Kastell, das einem Kloster nicht unähnlich, mit Natursteinmauern umgeben, aus den Steineichen ragte, wie eine letzte mittelalterliche Burg. Meine Kameraden, gleich mir aus wohlhabenden städtischen Familien, wir alle waren in den ersten Monaten hoffnungslose Romantiker. In meiner Kammer, die ich mit noch einem Jungen, der aus Espinho, das an der Küste liegt, stammte, saß ich oft am Fenster, träumte mich hinaus, ließ meinen Blick über die gewellten Bergkämme gleiten, dachte ich wäre der edle Spanier Inigo Lopez de Recalde aus dem Hause Loyola. Ich säße, wie er durch das Geschick (nun gut, bei ihm war es eine Kriegsverwundung, die er sich bei der Verteidigung von Pamplona gegen die Franzosen 1511 an beiden Beinen zugezogen hatte) zum Grübeln und Nachdenken verdammt, hier in diesem Kloster, wie er in seiner Burg. Doch ich liebte wie er die Literatur. Und gerade die Literatur macht aus uns ja oft das, was wir vorher von uns nie gedacht und gewusst hätten. Was erweckt sie nicht alles in uns, ist es nicht so, Herr Malef? Ist es bei Ihnen nicht auch so gewesen? Inigo las und liebte Ritterromane und Ritterromantik und er bekam, auf seine Heilung hoffend und harrend, zwangsläufig auch das Leben Christi und einiger Heiliger zu lesen. Das wurde sein Wendepunkt. Er wurde zum Begründer des Jesuitenordens.
Er wurde Ignatius de Loyola, als den wir ihn alle kennen, und von dem wir in unserem Kolleg beinahe täglich zu hören bekamen. Bei mir war es umgekehrt und doch auch wieder gleich. Während er, phantastisch von Natur, aus einer vorzeichnet erscheinenden Bahn geschleudert, die ihm das glänzendste Glück verheißen hatte, jetzt durch die unglücklichen Umstände zur Untätigkeit gezwungen war, geriet er, durch seine Leiden und das Fieber angestachelt, in einen seltsamen Geisteszustand. So glaubte er, die Taten des Heiligen Franziskus oder des Dominikus, die in allem Glanz geistlichen Ruhmes vor seinem Geiste auferstanden, seien nachahmungswürdig, und je mehr er davon las, dachte er, sie nachzuahmen, mit ihnen in Entsagung und geistlicher Strenge zu wetteifern. Indes, seine Gedanken wanderten zugleich auf weltlichen Pfaden, denn er stellte sich vor, seine Dienste einer von Herzen verehrten Dame zu widmen, sich ihr hinzugeben und ihr zu Ehren noch weitere Aufsehen erregenden Taten zu begehen. Ich aber, ich war neben dem Studium der Bibel und zahlloser katholischer und jesuitischer Schriften, wie Loyola eingesperrt, wenn auch nicht durch Krankheit, sondern durch die Regeln des Ordens, auf das Lesen durchaus nicht jugendfreier Schriften und Bücher verfallen. Ich verschaffte mir Bücher von Oscar Wilde, Henry Miller, Franz Kafka, Jorge Luis Borges und las und las und las. Ich nahm teil an den Abenteuern meiner literarischen Figuren, lebte mit ihnen und fing heimlich an, Eigenes zu Papier zu bringen. Natürlich ahmte ich nach.
Las ich Kafka, schrieb ich wie er, stellte mir, wie er ein Schloss, eine Burg vor und hatte diese schwülstigen, unerfüllten Gefühle, las ich Wilde, besah ich mich jeden Tag im Spiegel, ob nicht auch ich, auf geheimnisvolle Weise altere und ein Zauber in mir wäre. Nicht anders erging es Loyola, wenn er von seinen Heiligen las. Er wollte so wie sie sein, also war er so. Genau wie ich. Bei Loyola war es schließlich so, dass, je länger sein Zustand dauerte und je schlechter der Erfolg seiner Heilung war, bei ihm die geistlichen Gedanken die Oberhand gewannen. Vielleicht auch, weil er allmählich einsah, er könne niemals wieder vollkommen wiederhergestellt werden und der Weg zu Rittertum und Kriegsdienst sei ihm auf immer verwehrt. Wie ich sagte, war es bei mir genauso und doch in gewissem Sinne spiegelverkehrt. Je länger ich im Kastell des Ordens weilen musste, ja dort eingesperrt war, desto stärker wurde in mir das Verlangen, daraus auszubrechen, desto mehr wuchs in mir die Sehnsucht nach der Literatur, vor allem, da ich fest glaubte, selbst so schreiben zu können wie meine Vorbilder, ja mehr noch, mir selbst eigene Figuren und Geschichten zu erschaffen und auf diese Weise zum Herren meiner Träume zu werden. Dass ich dies alles tun könne zum Ruhm für mich selbst und um das Angebetet werden schöner Frauen, dieser Gedanke kam mir damals noch nicht.
Insofern unterschied ich mich von Loyola, aber er ist ja auch um Einiges älter gewesen, als ich es in diesem Kolleg war. Aber wie er stellte ich mir meine Erweckung vor, die vom Bösen zum Guten führte, nur war eben für mich das Übel, der zu überwindende Status das, was für ihn die Erfüllung des Glückes gewesen war. Er, Loyola, stellte sich zwei Heerlager vor (er war in seinem Denken immer ein Kriegsmann), eines bei Jerusalem, das andere bei Babylon: Christi und des Satans; dort alle Guten, hier alle Bösen; gerüstet miteinander den Kampf zu bestehen. Christus sei ein König, der seinen Entschluss verkündigt, alle Länder der Ungläubigen zu unterwerfen. Wer ihm die Heeresfolge leisten wolle, müsse sich ebenso nähren und kleiden wie er, dieselben Mühseligkeiten und Nachtwachen ertragen wie er: und nach diesem Maß werde er des Sieges und der Belohnungen teilhaftig werden. Vor ihm, die Heilige Jungfrau und dem ganzen himmlischen Hof werde dann ein jeder erklären, dass er dem Herrn so treu wie möglich nachfolgen, alles Ungemach mit ihm teilen und ihm in wahrhaftiger geistiger und leiblicher Armut dienen wolle. So phantastisch und romantisch waren die Vorstellungen Loyolas gewesen, die in ihm den unmerklichen Übergang von der weltlichen zur geistlichen Ritterschaft vollzogen, denn dies war es, das Ideal der Taten und Entbehrungen der Heiligen, in einen Dienst zu verwandeln, was er beabsichtigte. Ich aber, ein pubertierender Sechzehnjähriger, in meiner Widersetzlichkeit von dem immer wieder durch die Anstaltsoberen herbeigerufenen Vater geohrfeigt, geschlagen, gedemütigt und schließlich sogar in eine geschlossene Nervenklinik eingeliefert, ich wollte, wie Loyola, allerdings auf die Art und Weise meiner Bücherhelden und Schriftsteller, nämlich durch das eigene Schreiben mich selbst und die Welt erkennen. Viel später, da bin ich schon Vierzig gewesen und einigermaßen berühmt, erkannte ich, dass man die Leser wie Loyola seine Jünger und Gefolgsleute, dass man wie er die Jesuiten, eine Armee von Lesern hinter sich bringen kann, dass man Prediger wird oder ein Guru sogar, wie manche Journalisten von mir behaupten.
Ja, sagte Murilho, und fasste mit spitzen Fingern die Zigarre, streifte die Asche ab, besah die noch glimmenden Reste interessiert, ja, wiederholte er langsam, das war mein Vergleich zu Ignatius von Loyola. Immer ist es das Gleiche, immer kommt es auf die Idee und auf die beharrliche Umsetzung, ja auf das Beharren, auf die Sturheit an, mit der man einmal Erkanntes für sich nutzt und auf den Weg bringt.
Die Jesuiten haben mir viel beigebracht, und das Jesuitische hat mich nie verlassen, es kann einem bei seiner Mission, bei unserer Mission, lieber Malef, von großem Nutzen sein.
Murilho machte eine Pause und wieder hob er die Moccatasse. Ich zuckte nervös. Ihm schien das aufzufallen. Ach, sagte er, Sie denken, ich tue nur so und hebe eine leere Tasse an die Lippen, um Sie über den Tassenrand zu beobachten. Nein, nein, Verehrtester, er lachte und zeigte mir die halbvolle Tasse, immer hab ich etwas zu trinken, wenn ich sie an den Mund hebe. Eine leere Tasse? Warum?
Wieder lachte er.
Ich war verwirrt und muss in diesem Augenblick wie ein ängstliches Kind ausgesehen haben. Wie geht das nur, dachte ich, er trinkt und trinkt und immer bleibt die Tasse halbvoll, sie lehrt sich nicht. Wie macht er das? Ein Trick? Und seltsam, wieder fiel mir Russalka ein. Ich blickte zum Nachbartisch, aber da saß noch immer die Portugiesin mit ihrem Nordeuropäer.
Plötzlich ging die Tür auf und ein großer, hagerer Mann trat ins Lokal. Er trug einen abgetragenen Anzug mit schmutzigen Flecken an den Hosen, in der Hand hielt er ein weißes Stöckchen, mit dem er leise gegen Stühle und Tische, gegen Sektkühler und Fonduegestelle schlug. Ein Kellner eilte ihm entgegen. Doch der Mann sah ihn nicht und er hörte auch nicht die Zurechtweisung, denn er war blind und taub. Mit einer Hand fasste er den Kellner bei der Schulter, schob ihn weg und lallte mit der lauten Stimme der Tauben in schlechtestem Portugiesisch: Versündigen Sie sich nicht gegen einen armen, blinden und tauben Mann. Ich bitte um eine gnädige Spende!
Da erst, als dieser seltsame Bettler, der in diesem Lokal so fremd, so abstoßend wie ein Straßenköter auf eine Rassehundeschau wirkte, ein paar Schritte von unserem Tisch entfernt war, erkannte ich ihn. Ja, ich kannte diesen Mann. Es waren seine Gesichtszüge, unverkennbar diese Brauen, diese kühne, ein wenig gebogene Nase, der ehemals herrische, jetzt allerdings von Schmerz und Leid kündende Mund, die ganze Körperhaltung, wenn sie auch gebeugter als früher schien, so erkannte ich diesen Mann dennoch. Es war der ehemalige Literaturkritiker Dr. Schünemann aus meiner Heimatstadt D.
Was war mit ihm geschehen? Wieso war er jetzt blind, taub, in diesem erbärmlichen Zustand? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Sollte ich ihm zu verstehen geben, auf wen er hier im fernen Portugal in diesem Nachtcafé getroffen war, sollte ich ihm sagen (Sagen? Wie? Ihm dem Tauben), dass hier Franz Malef säße im Gespräch mit Raul Murilho, jenem berühmten Murilho, über den er einst glänzende Rezensionen und Elogen geschrieben hatte, dessen Bücher er besprochen und in den Himmel gelobt hatte, damals, als er noch der unumstrittene Kritiker gewesen war. Und bei ihm, Murilho, dem Großen, dem Weltbekannten, säße nun Franz Malef, der Unbedeutende, das Nichts, der kleine Schreiber, den er, der einstmals berühmte Schünemann, nicht einmal richtig zur Kenntnis genommen hatte.
Jetzt würde er mich weder sehen noch hören können, so wie er damals, als er beides noch gekonnt hatte, und es ihm als selbstverständliche Gabe nicht bewusst geworden war, nämlich, dass er die Fähigkeit des Sehens und des Hörens besäße, diese Fähigkeiten, über die wir nicht nachdenken, wenn wir sie besitzen, die aber, wenn sie uns fehlen, alles bedeuten können, alles, das ganze Menschsein, wie er also damals meinen ersten Roman zu Boden geworfen hatte, sehend und auch hörend. Es schüttelte mich. Ich rieb mir die Augen. War dies ein Traum? Stand dieser Schünemann hier wirklich neben meinem Tisch und klopfte mit seinem Stöckchen an die Stuhllehne? Ich öffnete die Augen. Da war der Blinde weitergegangen, klopfend, lallend, war noch bis zur Theke gekommen, ehe ihn ein beherzter Mitarbeiter am Kragen packte und mit sanfter Gewalt vor die Tür setzte.
Murilho blickte mir ernst ins Gesicht. Mir schien es fast, sagte er, als ob Sie diesen Blinden, diesen bedauernswerten Bettler gekannt hätten. Sie blickten so entsetzt und zugleich so erkennend, dass ich drauf wetten könnte, Sie seien ihm schon begegnet.
Nein, Sie irren sich, verehrter Meister, entgegnete ich, mir schien es auch so, da haben Sie wohl Recht, aber es ist ganz unmöglich. Ich kenne diesen Mann nicht. Ein alter Bekannter, ein ehemaliger Literaturkritiker, er ähnelte ihm ein wenig. Doch meine Phantasie hat da wohl zu viel gesehen, nein, er kann es gar nicht gewesen sein.
Ich hustete verlegen, blickte zur Seite.
Ah, ein Literaturkritiker also? Murilho zündete sich eine neue Zigarre an, sog daran, lehnte sich zurück. Ja, die Kritiker, ein besonderes Völkchen. Wir wollen später noch drüber reden, jetzt will ich noch zwei Geschichten erzählen, ein Histörchen (ha, ha) aus meinem Klosterleben und eines aus der Anstalt, und Sie werden verstehen, warum ich unbedingt weg musste damals, ganz fort aus diesem Leben von Erniedrigungen, Verbeugungen und Missbräuchen - nein, nicht nur wegen der Literatur - gut, sagte er und machte eine charakteristische Handbewegung, das Literarische steckte ja damals bereits so tief in mir, dass nichts davon abzutrennen gewesen ist von mir, meinem Leib und meinem Geist, aber es ist das tägliche Leben im Kolleg gewesen, das von Tag zu Tag unerträglicher wurde...
Plötzlich unterbrach er seinen Redefluss, machte ganz große Augen, zog dann sein Gesicht in Falten, Falten, die ihm eine pittoreske Ähnlichkeit mit einem Masto Napolitano gaben, stand auf, sagte, er müsse dringend zur Toilette: Das Mocca! Der Mocca! Er fuchtelte mit den Händen und stürzte davon …
Ich sah Raul Murilho nach, wie er, vollständig in Schwarz gekleidet, mit einem seltsam wiegenden Schritt eilig durchs Lokal ging, auf die zwei Holztüren zu, die so, als schämten sie sich ihrer Anwesenheit, bescheiden und still in ihren Rahmen steckten. Er wählte eine davon, es war die linke, und verschwand.
Seine Abwesenheit nutzend, winkte ich dem Kellner, der den Schünemann vor die Tür gesetzt hatte, ich gab ihm ein Handgeld, er beugte sich zu mir herab, und ich bat ihn flüsternd, mir, wenn ihm das möglich sei, den Aufenthaltsort des soeben Hinausbeförderten zu nennen, oder auf irgendeine Weise Näheres zu seinen Lebensumständen zu ermitteln. Schicken Sie irgendjemanden hinterher, sagte ich, ich wäre Ihnen sehr dankbar und ergeben (und zeigte ihm ein kleines Bündel Banknoten, das ich aus der Brusttasche meines Anzuges ein paar Zentimeter hervor zupfte, nur ein kleines Stück, nur die Ecken der Banknoten, dass der Kellner sehen konnte, der Herr habe die Belohnung schon bereit und er sei zahlungskräftig), wenn es noch im Laufe des heutigen Abends geschähe. Und da der Kellner mit fragendem Gesicht in seiner gebeugten Haltung verharrte, fügte ich hinzu, diesen Mann hätte ich einst in Deutschland gekannt und ich wolle gern mehr von ihm wissen, ihm vielleicht auch helfen, es läge mir sehr daran. Der Kellner verneigte sich, versprach sein Möglichstes zu tun. Ich bestellte eine Flasche echten portugiesischen Rotweines, mit Murilho hatte ich mich schon vorher auf die Marke verständigt. Er hatte einen ganz bestimmten vorgeschlagen, eine Spätlese. Dies wäre ein ganz besonderer Tropfen, hatte er gesagt. Der Kellner ging ab und im selben Moment erschien auch Murilho wieder am Tisch.
Ach ja die Histörchen! Davon wollte ich reden, schön, dass sie jetzt den Wein bestellt haben, der wird uns gut tun, sagte er, ohne eine Pause zu machen und setzte sich. Beim Wein plaudert sich so ungeheuer leicht und frei. Ist es nicht so, Herr Malef? Allerdings die Marke „Corpus Christi“, die haben wir hier nicht. Schade, es ist der beste Wein von der Welt. Ich stutzte. Hatte er diesen Wein zufällig genannt? Bestimmt, beruhigte ich mich, wie könne er auch wissen ...
Murilho sagte: Also, es gab da im Kolleg in Castro Verde einen Lehrer, Pater D´Orega, den wir Pater Sinalco nannten, weil er immer eine Flasche dieser neuen Limonade in seiner Mappe mit sich herumtrug. In Wahrheit hieß er Pater Raimundo D´Orega. Er unterrichtete uns im Lateinischen und im Fach Die Evangelien, seinem Lieblingsgebiet. Er war ein hochgewachsener Mann mit strengen, grauen Augen, einer steilen Falte auf der Stirn, grauem Kinnbart und seltsam weißen, länglichen Händen, die, wie Frauenhände, Madonnenhänden gleich, zart und weich waren, jeder körperlichen Arbeit nicht geeignet schienen. Dieser Pater D´Orega also, Sinalco genannt, den Spitznamen hatte ich ihm gegeben, wie ich überhaupt schon damals gern Begriffe der Alltagswelt, der Werbung, Allbekanntes und Gegenwärtiges, um den geistlichen Unterrichtsstoff, aber auch meine kleinen Geschichten, die ich meist nachts schrieb, damit zu würzen, verwendete; Pater D´Orega hasste mich von den ersten Tage an, bis zu meinem letzten Stunden im Kolleg, und er ist es auch gewesen, der meinen Vater dazu angestachelt hat, mich wegen meiner Widersetzlichkeit, meiner wirren, bunten Gedanken und meiner unberechenbaren Taten zeitweise in eine Irrenanstalt zu stecken. Jedoch am ersten oder zweiten Tag hat er mich noch nicht gehasst. Im Gegenteil.
Wir saßen im großen Lesesaal und sollten die Offenbarung des Johannes studieren. Der Pater ging zwischen den Bänken und Tischen hin und her und hielt stumme, aber wachsame Aufsicht. Er trat zu den einzelnen, gebeugt sitzenden Jungen, schaute ihnen über die Schulter, bei einigen murmelte er irgendetwas, dann ging er langsam, fast unhörbar weiter. Manchmal legte er seine weiche und zarte Hand auf einen Jungenkopf oder eine Jungenschulter, dann verharrte er mit geschlossenen Augen und in seinem bleichen Gesicht färbte ein aufglühendes Rot Wangen und Stirn.
So ist er auch bei mir stehen geblieben.
Ganz dicht stand er neben mir und ein süßlich betäubender Duft stieg mir in die Nase, der seinem dunklen langen Gewand entströmte. Ich fühlte mich an meine Mutter erinnert, denn auch sie hüllte sich häufig in die Wohlgerüche seltener Parfüms, und auch an unseren Onkel Ricardo aus Coruche. Er war Musiker und unverheiratet, und kam ein paar Mal im Jahr immer sonntags, um mit meiner Mutter zu musizieren. Er spielte Cello und Mutter begleitete ihn auf dem Piano.
Und auch der Onkel roch so seltsam parfümiert, und ich bin immer ein wenig irritiert gewesen von seinen Ausdünstungen, die, wenn er Cello spielend schwitzte, stärker und manchmal unerträglich wurden. Ist der Onkel ein Weib, dachte ich, denn nur diese, so wusste ich damals, parfümieren sich, oder was ist er sonst. Und er ging auch so stolzierend einher und redete geziert, wie eine alte Jungfer, der Onkel. Ich wurde nicht schlau aus ihm.
An meinen Onkel Ricardo also dachte ich, als Pater D´Orega neben mir stand. Er stünde eine Ewigkeit neben mir, empfand ich, und ich wartete ängstlich darauf, ob er auch mir seine Hand auf Kopf und Schultern legen würde. Ich wusste nicht warum, aber ich fürchtete mich vor dieser Berührung. Schließlich beugte sich der Pater zu mir herab, las in meinen handschriftlichen Notizen, die wir verpflichtet waren, zu verfertigen, der Geruch wurde stärker und es kam ein neuer, anderer hinzu, einer nach Minze und Salbei, der seinem halbgeöffneten Mund entströmte. Ich bekam Gänsehaut und ich fürchtete mich noch mehr. Da legte er seine weiche, zarte Hand auf meine magere Schulter.
Er ließ sie eine endlos lange Zeit in dieser Haltung und ich spürte die Körperwärme des Paters, wie sie über seine Hand auf mich eindrang.
Wenn er nur weiterginge, wenn er nur seine verdammte Hand von mir nähme, dachte ich. Aber nichts geschah. Er stand, gebeugt, mich mit seinem Minze-Atem streifend, und ließ seine warme, weiche Madonnenhand auf mir ruhen. Da entschloss ich mich zu ungewöhnlicher, und in unserem Kolleg selbstverständlich ungebührlicher Tat. Ich schüttelte mich, drehte meine Schulter weg, so dass der Pater seine Hand von mir nehmen musste und beinahe gestrauchelt wäre. Dazu sagte ich mit meiner schwankenden Stimme, die andauernd vom Sopran in den Bariton wechselte, er, der ehrwürdige Pater D´Orega, den wir alle, was er nur wissen solle, nur den Pater Sinalco nennen würden, er solle seine schweißige Hand von mir nehmen, es wäre mir unangenehm, störe mich und so könne ich die Offenbarung nicht studieren. Ich hatte laut gesprochen und alle Jungengesichter blickten zu mir. Der Pater richtete sich auf, ordnete sein Gewand, das bei seinem Bewegungen, die er infolge meiner Abwehr gezwungen gewesen zu machen, verrutscht war und in unnatürlichen Falten lag, und starrte mich mit seinen grauen Augen böse an. Er sagte kein Wort, ging mit gesenktem Kopf zwischen den Bänken dem Ausgang des Lesesaales zu, blickte sich nicht ein einziges Mal um und schlug dann die große Ornamentglastür zu, dass die Scheiben klirrten. Von da ab waren Pater D´Orega und ich Feinde.
Kaum erblickte er mich, brannten seine Augen hasserfüllt, und er unterließ es nicht, ob im Unterricht oder bei den Pausen, die er beaufsichtigte, oder in unserer Freizeit, wenn er dazu kam, ob vor oder nach der Andacht in der Kapelle, ob beim Appell, wenn wir angetreten waren in Reih und Glied zum Ausgang, den wir einmal im Monat hinunter in die kleine Stadt unternehmen durften, er verpasste keine Gelegenheit mich zu tadeln, mich zu beleidigen und zu erniedrigen.
Und ich zitterte jedes Mal, wenn ich ihn sah, denn er fand immer irgendetwas an mir auszusetzen: Mal waren es die Kleider, die ich trug, die schmutzig oder in Unordnung wären, mal die Frisur, die entweder zu kurz oder zu lang sei, mal habe ich mich schlecht auf die Seminare und Übungen vorbereitet, mal etwas vergessen, mal kannte ich die Zitate aus den Schriften nicht oder ich sang im Chor mit falscher Stimme. Immer gab es Grund zu Kritik und bösen Worten. Es war die Hölle. Da, eines Tages (und dies ist dann gleich der Übergang zum zweiten Histörchen) ertrug ich es nicht mehr. Ich spielte den wild boy!
Gerade hatte mir Pater wieder einen seiner Tadel ausgesprochen, vor allen anderen wie er es besonders zu lieben schien; denn trafen wir uns allein, da funkelte er mich nur böse an, sagte kein Wort, kaum aber waren wir coram publico, suchte er an mir Tadelnswertes, fand dergleichen natürlich, was nicht schwer war, und stellte mich an den Pranger seiner endlosen Sündenkartei. Diesmal hatte ich irgendein Heft vergessen aufzuschlagen. Wie ein Adler von seinem Felsenhorst hatte er mich von seinem Pult aus erspäht, beäugte mich einen Augenblick mit seinen stahlgrauen starren Augen, schwieg und verharrte geduckt, die Schultern hochgezogen, um sich dann auf mich, das unvorsichtige, unschuldige und vollkommen wehrlose Murmeltier, zu stürzen. Mit langen Schritten kam er auf mich zu, den Blick unbeirrt auf mein Gesicht gerichtet, packte mich mit seinen Händen, die plötzlich nicht mehr weich und warm, sondern kalt und hart waren, schüttelte mich, zog mich hoch und zerrte mich aus der Bank.
Was haben wir denn, verehrter Seminarist Murilho, wieder einmal vergessen, he? Wo ist denn das Heft, das bei allen anderen bereit und auf dem Platze liegt? Wo ist es, Sie Unglücksmensch!
Alle fünfundzwanzig Augenpaare waren auf mich gerichtet. Spott, Hass, Missgunst, Schadenfreude sah ich, unverhohlen tanzte sie in so manchem Auge, denn ich hatte nicht nur Freunde unter meinen Mitschülern, im Gegenteil zu den meisten Jungen hatte ich keinen Kontakt. Ich hatte mich zurückgezogen, beteiligte mich nicht an ihren Spielen, Neckereien und den meist dümmlichen Gesprächen. Ich las lieber zurückgezogen oder schrieb meine Geschichten, die ich heimlich in meiner Kammer versteckt hielt. Ich wusste, die meisten freuten sich über den Ärger, den ich so häufig beim Pater bekam. Sie witzelten hinter meinem Rücken, schlossen Wetten ab, ob und wie ich mich wehrte, dachten, dass ich auch dieses Mal, die Augen niedergeschlagen, errötend, meinen Fehler eingestehen und dem Lehrer den ganzen Triumph überlassen würde.
Heute jedoch, sollten sie sich getäuscht haben. Ich schüttelte den Klammergriff des Paters ab und biss ihm mit aller Muskelkraft meiner Kinnladen in die linke Hand. Er sprang zurück und stieß einen überraschten Wehlaut aus, hielt sich die verletzte Hand, aus der an zwei dunkelroten Einrissen, das sah ich voll Freude, aus zwei kleinen Wunden, als hätte ihn ein Vampir gebissen, Blut tropfte, hielt sie sich an den Mund, wie ein ertappter, erschrockener Räuber.
Er hat mich gebissen! Gebissen! Mich hat der Satan gebissen! schrie der Pater und rannte aus dem Zimmer.
Und ich? Ich schrie ihm aus vollen Kräften ein Triumphgeheul nach, schrie aus Leibeskräften hinter dem Davoneilenden her, ich der Kleine, der Wehrlose, das Murmeltier, hatte mich erfolgreich gewehrt, hatte den Adler in die Flucht geschlagen. Und wie ich so hinter ihm her heulte, alle Jungen des Seminars waren mit einem einzigen erstauntem Aufschrei aus ihren Bänken gesprungen, und wie der Pater nun, die Schultern hochgezogen, mit wehendem schwarzen Gewand davon sprang, da glich er wirklich einem geschlagenen Raubvogel, der nach erfolglosem Angriff die Schwingen erhebt und das Gebirgstal, sich höher und höher hebend, mit einem ärgerlichen Krächzen verlässt.
Doch, es dauerte nicht lange, und er kam wieder zurück, der Pater, kam in Begleitung von Hochwürden Despillho, dem Leiter des Kollegs, und mit diesen Beiden schritt der Pater Modo, ein untersetzter, kräftiger Mann, der hier so eine Art Hausmeister, Wärter, Feldwebel war. Sie blickten finster, die Drei, sprachen kein Wort. Man führte mich ab und hinauf in die Arrestzelle, die in einem der Schlosstürme, dazu diente, Widersetzliche und arge Sünder, in strenger Abgeschiedenheit zur Buße und Umkehr zu bringen. Ich wartete dort einen Tag, dann erschienen meine Eltern, die man benachrichtigt hatte, zornrot und ganz außer sich, mein Vater, und mit ihm, weinend, auch meine Mutter, und über mich wurde Gericht gehalten. Was sollte geschehen?
Hochwürden Despillho saß hinter einem Schreibtisch und las die lange Liste meiner Verfehlungen vor, er beeilte sich nicht, las langsam und mit Betonung und es schien, als genieße er die über mich aufgeschriebenen Peinlichkeiten und Sünden, schweigend saß der Pater, und in seinen Augen, das sah ich deutlich, glitzerte ein böses Feuer. Modo, der Hausmeister, hielt unterdes Wache vor dem Zimmer, damit ich nicht entfliehe. Aber ich dachte gar nicht an Flucht, in mir war Scham und Wut zugleich, denn ich wusste wohl, alles was da verlesen wurde, stimme so und war die Wahrheit, aber es sei eben nur die eine Seite, die verleumderische Seite meines Lehrers, die böse Sicht auf meinen Charakter, während ich doch ohne Absicht, eher leichtfertig und unbedacht, all das begangen hatte, was da in Rede stand. Dann, nach der Verlesung der Anklage, sagte Hochwürden, er und der Pater wollten sich jetzt zurückziehen, die Familie, der Vater und die Mutter sollten entscheiden, wie mit mir zu verfahren sei, an der Anstalt jedenfalls könne ich auf keinen Fall bleiben, einen solchen Schüler hätten sie hier noch nie gehabt, und sie wüssten nicht, wie sie es vor Gott und dem Orden rechtfertigen sollten, mich noch länger hier zu behalten.
Dumpf nachhallend schlug die Tür zu und ich war mit meinen Eltern allein. Lange Zeit, ich schaute nicht auf die Uhr, aber es schien mir eine Ewigkeit, herrschte zwischen meinen Eltern und mir Schweigen in diesem kalten, weißgekalkten Raum, an dessen Türseite einsam und ohne Trost ein großer Kruzifix hing, für mich hatte Jesus Christus nichts übrig, das dachte ich in jenem Moment, dennoch betete ich schweigsam für mich ein Vaterunser. Wie könne ich als Erster reden, dachte ich, sie hätte doch gehört, die Eltern, und nun sollten sie über mich richten. Von vornherein war ich mit allem einverstanden, was sie sagen würden, wenn ich nur recht bald diese Hölle hier verlassen könne. Doch, es verging die Zeit, das Schweigen saß fest, hockte im Zimmer, Minuten tropften zäh, Minuten auf Minuten verrannen, in denen die Mutter in ihr Taschentuch schluchzte und der Vater, schweratmend, zum Fenster hinaus starrte ...
Murilho machte eine Pause, in der er den Kellner herbeiwinkte und nach der Abendkarte verlangte, dann beugte er sich über den Tisch, als wolle er mir flüsternd ein Geheimnis verraten, und auch ich (vielleicht war dies eine Art reflektorischer Bewegung) beugte mich zu ihm hin. So saßen wir für den Moment wie Verschwörer, dann sagte er tatsächlich in leiserem, aber eindringlichen Ton, er erzähle mir all diese lange zurückliegenden Ereignisse mit deutlicher Ausführlichkeit, weil sie der Vorabend, die unmittelbare Vorstufe, seines wirklichen und tatsächlichen Wendepunktes gewesen seien, seiner endgültigen Hinwendung zum Schreiben und zum Schriftsteller, so wie es sich zugertragen habe, damals, und Sie ja (er meinte mich) hätten wissen wollen, wie er zu dem geworden sei, der er jetzt sei ...
Ich nickte, schwieg, obwohl ich ihn, wie ich mich auch jetzt erinnere, niemals darum gebeten hatte. Er sei es hingegen ja gewesen, überlegte ich, der mir gleich mit seinen ersten Worten solche Absicht unterstellt habe. Auf der anderen Seite stimmte es schon: Natürlich wollte ich wissen, wie er zu dem Raul Murilho geworden war, zum Weltautor und gefeierten Literaten. Natürlich wollte ich (eine unverzeihliche Unbescheidenheit von mir! Und noch heute schäme ich mich deswegen) diese Punkte wissen und Vergleiche anstellen zu mir und meinem Leben und meinem Schreiben, ob auch ich Parallelen bei mir fände, ob auch solche Spuren in mir wären, die uns zu Verbündeten, zu Gleichen im Geiste machten, die mir meinen Weg zeigten und die mich hoffen ließ, auch, Franz Malef, gehörte dazu ...