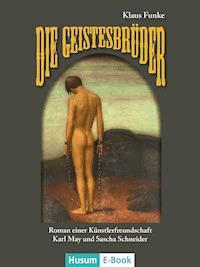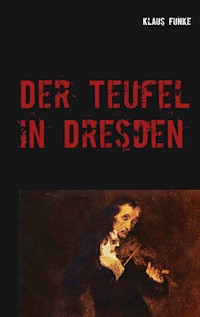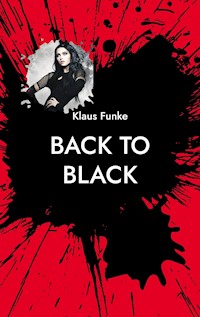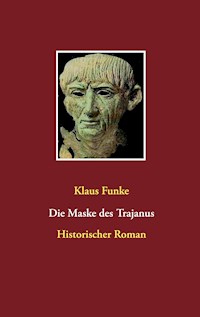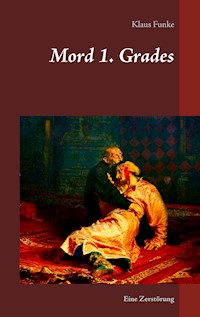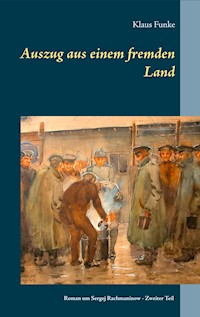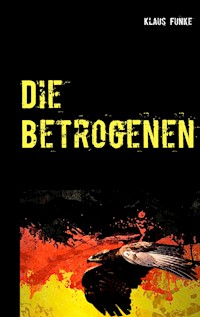
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman beschreibt die Verwerfungen und Umwälzungen des Jahres 1990 am Schicksal einzelner Menschen, und zwar sowohl von solchen, die mit dem DDR-System eng verbunden waren als auch von jenen, die darunter gelitten haben. Ganz verschiedene Leute erscheinen: Idealisten und Karrieristen. Der eine steigt auf, der andere geht unter. Auch Westdeutsche treten auf, Unternehmer, die Goldgräberstimmung wittern, Kirchenleute, die mit dem DDR Staat gemeinsame Sache gemacht haben, Mitarbeiter der Treuhand, ehemalige SED-Parteifunktionäre und politisch Verfolgte. Schonungslos zeigt der Roman die verschiedenen Interessen, dass Glück und Unglück. Am Ende ist es der Einzelne selbst, der sein Schicksal in die Hand nehmen muss. Es gibt kein kollektives Schicksal, wie es in der ehemaligen DDR den Bürgern verheißen wurde. Das Buch wird Sie packen und nicht mehr loslassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
…es ist nicht meine Absicht, Romane für Erwachsene zu schreiben, damit sie besser
einschlafen können. Ich will stattdessen dem Leser Dokumente in die Hand geben, mit denen er
seine Zeit besser verstehen kann…“
B. Traven, 1933
„Das Vergangene ist nicht tot. Es ist noch nicht einmal vergangen.“
William Faulkner, 1951
Meiner Frau Brita
und meinen Töchtern Cornelia und Corinna
Zum Buch:
Der Roman „Die Betrogenen“ beschreibt die Verwerfungen, Probleme und Umwälzungen des Nachwendejahres 1990 am Schicksal einzelner Menschen, und zwar von solchen, die mit dem DDR-System eng verbunden waren und von jenen, die darunter gelitten haben. Ganz verschiedene Leute erscheinen: Idealisten und Karrieristen. Der eine steigt auf, der andere geht unter. Auch Westdeutsche treten auf, Unternehmer, die Goldgräberstimmung wittern, Kirchenleute, die mit der Stasi gemeinsame Sache gemacht haben, Mitarbeiter der Treuhand, ehemalige SED-Parteifunktionäre und politisch Verfolgte.
Schonungslos zeigt der Roman die verschiedenen Interessen, auch das Glück und Unglück. Am Ende ist es der Einzelne selbst, der sein Schicksal in die Hand nehmen muss. Es gibt kein kollektives Glück oder Unglück, wie es in der ehemaligen DDR den Bürgern verheißen wurde.
Zum Autor:
Klaus Funke, geboren in Dresden, ist ein bekannter Autor erfolgreicher Romane wie „Zeit für Unsterblichkeit“ – „Der Teufel in Dresden“ - „Die Geistesbrüder“ – „Heimgang“ u.v.a. Neuerdings hat er auch Kriminalromane veröffentlicht, „Franzi“ – „Ein einsames Haus“ – „Jacek Boehlich und die blonde Tote“ u.a.
Mit „Die Betrogenen“ hat er ein authentisches Buch geschrieben, das viel Selbsterlebtes, Selbsterlittenes enthält und damit zugleich ein Zeitzeugnis ist.
Inhaltsverzeichnis
Prologe
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
PROLOG
In einem breiten, unmodernen Ehebett schliefen ein Mann und eine Frau.
Der Kopf der Frau lag in der Ellenbeuge ihres linken Armes. Ihr Mund, sachte Schnarchtöne ausstoßend, war halb geöffnet. Das Gesicht, ein wenig rot und verschwitzt mit einer angeklebten blonden Haarsträhne auf der Stirn, zeigte einen unruhigen, verärgerten aber unschlüssigen Ausdruck – als ob sie nicht recht wüsste, worüber sie sich Sorgen machen soll.
Die Frau lag in gehockter Stellung dem Manne abgekehrt. Der Mann schlief, auf die rechte Seite gedreht. Er hatte die Stirn gerunzelt wie einer, der nachdenkt. Auch ihm standen Schweißtropfen auf der Stirn. Auch er hielt den Mund halb geöffnet. Sein Kinn war unrasiert, mit dunklen Stoppeln bedeckt. Es war zu warm im Zimmer. Obwohl Anfang November und draußen noch nicht sehr kalt, hatten sie eines der Fenster geschlossen, das andere angekippt und dennoch die Heizung auf die höchste Stufe gestellt. Das tulpengeblümte Deckbett war zurückgeschlagen. Die beiden lagen in ihren Schlafanzügen, gleiche Farbe, gleicher Schnitt. Jeweils ohne Oberteil schliefen sie.
Wir schreiben den 10. November 1989.
Dresden, die Stadt an der Elbe, George-Bähr-Straße 72, eine Wohnung mitten in einem Neubaublock, eine Betonwabe in einem Menschenbienenstock aus Beton. Die Außenplatten mit bunten gemahlenen Schottersteinen bepflastert. Einheitsmaß die Fenster. Quadratisch. Fünfundachtzig mal fünfundachtzig Zentimeter. Zum Kippen und Normalöffnen. Sogenannte Kippdrehfenster. Der neueste Schrei des sozialistischen Wohnungsbaues.
Ein paar Blöcke weiter wird noch gebaut…
Gestern ein Großereignis im Fernsehen: Das Mitglied des Politbüros Günther Schabowski verkündet am Rande einer Pressekonferenz, eher beiläufig und mit ungewohnt lässigem Tonfall, dass die Staatsgrenzen der DDR zukünftig für jedermann passierbar seien. Minuten später überrennt in Berlin an den Grenzkontrollpunkten die Bevölkerung die überraschten Posten. Eine neue Ära scheint angebrochen. Ob dies das Ende des bisherigen Staates DDR ist, kann keiner sagen. Aber alles, selbst bisher Undenkbares, scheint möglich…
In den Schlaf dieser beiden Menschen sandte das Getriebe des Neubauviertels, der Betrieb der Baustelle vielfache Geräusche und Botschaften. Surrend fügt der Kran Platte zu Platte. Mit jedem Tag wächst der Block um drei Wohnungseinheiten. Planwirtschaft. LKW´s kommen brummend wie dunkle schmutzige Drohnen, entladen ihre Last und fahren wieder ab. Die kurzen Zurufe der Arbeiter, seit sechs Uhr sind sie hier tätig, sind zu hören. Es riecht nach feuchtem Beton, nach trockenem Zementstaub, nach den Abgaswolken der LKW und der Baumaschinen. Die Straßen, löchrige Bauwege, sind voller großer Pfützen, gelber Lehm und Dreck überall, über manche ausgefahrene Stellen hat man ein paar Bretter gelegt, damit sich die Bürger nicht gar zu sehr beschmutzen. Dort laufen sie, wie jetzt, wenn es zur Arbeit an die verschiedenen Orte der Stadt geht, in langer Reihe und heben wie die Störche die Beine. Aus den fertigen Wohnungen dringen Geräusche, wie aus einem Bienenstock, und mischen sich mit dem Lärm der Baustelle. Hier quäkt ein Kleinkind, dort bellt ein Hund, hier schimpft eine Männerstimme, da kreischt eine Frau, eine elektrische Kaffeemühle surrt los, ein Haartrockner sendet pfeifende Töne, übertönt einen Wasserkessel…
Obwohl nur eines der Fenster ein wenig geöffnet, sickern all diese Geräusche zu den Schlafenden. Die Lider der schlafenden Frau zucken. Ihr Kopf hebt sich ein wenig. Die Glieder strecken sich. Die Finger der linken Hand bewegen sich wie bei einer Klavierspielerin.
Nun hört sie aus dem Nachbarzimmer ein weinendes Kind. Doch das Weinen hört bald wieder auf. Die Frau murmelt irgendwas. Ihr Kopf sinkt zurück. Sie schläft weiter.
Im Hausflur rührt es sich. Schritte trampeln die Treppe hinab. Ein Mülleimer schlägt gegen das eiserne Geländer. Oben gurgelt Wasser in den Abfluss. Das Morgenbad scheint beendet. Oder ist es die Toilette? Jetzt summt nebenan die Türglocke. Worte sind zu hören.
Dann schlägt die Tür zu. Schlüsselgeräusche. Die beiden schlafen weiter…
Über der Elbestadt lag, wie an vielen Tagen des Jahres, wie er aber besonders im Herbst typisch ist, ein trüber Dunst. Es roch nach dem brackigen braunen Wasser des Flusses, nach den Abwässern der Fabriken, die schaumige gelbgraue Kronen bildeten und faulig stanken, und es roch nach dem Diesel der Schleppkähne, nach menschlichen Fäkalien und anderem noch.
Dieser Brodem, ein ständiger Begleiter für alle, die am Fluss lebten, schien zur Landschaft zu gehören und niemand wunderte sich mehr. Ja, wenn sie einmal verreist waren in dem kleinen Land, zu Bekannten und Verwandten in die Berge oder an die Küste, und sie kamen zurück, dann atmeten sie den Elbedunst wie etwas Heimatliches ein und freuten sich zu Hause zu sein. Diejenigen aber, welche es abstoßend fanden oder gar dagegen protestierten, waren eine kleine verlachte Minderheit, Umweltspinner, nicht ernst zu nehmen. Die Häuser am Fluss wie alles andere in der Stadt, grau und traurig, hatten diesen Geruch längst in ihre Wände aufgesaugt; im Sommer bei großer Hitze atmeten sie diesen Dunst wieder aus und so roch es denn immer und überall nach dem alten, belasteten Fluss. Die Straßenbäume in ihren Alleen reckten in trostlosem Starren ihre Äste gen Himmel, so als flehten sie um Gnade und jetzt im Herbst, da sie ohne Blätter waren, verstärkte sich dieser Eindruck von Traurigkeit und Wehmut nur noch mehr.
Könnten die Nachrichten aus Berlin von gestern da nicht Hoffnung sein? Die Hoffnung nämlich, dass sich endlich ein Fenster auftun, der alte Mief abziehen könne und endlich frische Luft, Farbe und Sonne auch bis hier an die Elbe käme…
Auf der Autobahn A 71, aus dem tiefen Süden, aus München kommend, näherte sich dem Grenzübergang Henneberg an der niederbayrisch-thüringischen Grenze ein großer grauer mattglänzender Wagen. Es war ein Mercedes 600 SL. Ein Mann, mittelgroß, sportlich, etwas über die Mitte Fünfzig, mit vollem weißgrauen welligen Haar, saß am Steuer. Schon konnte er die Grenzanlagen sehen, und, je näher er kam, entdeckte er die Menschentraube, die sich zu beiden Seiten drängte. Er ließ die Scheibe der Fahrertür herunter, lehnte sich lässig heraus, hob grüßend und jovial die Hand, die in einem gelben Rennfahrerhandschuh steckte. Die Leute lachten ihm entgegen. Herzlich willkommen! Ein Zivilist, er stand mit einer Gruppe anderer halb auf der Straße, winkte ihn lachend durch. Dann kam ein ostdeutscher Grenzer heran - von den Bundesbeamten sah er niemanden - und auch der schien froher Stimmung. Er nickte lachend, flüchtig warf er einen Blick auf die ihm entgegengestreckten Papiere. Schon in Ordnung, mein Herr!, versuchte er den Lärm zu überbrüllen. Viel Spaß in der Deutschen Demokratischen Republik! Gute Reise! Der Mann im Mercedes gab Gas und fuhr zügig durch die jubelnden Menschen. Auf der Fernstraße ging es flott vorwärts. Kaum Verkehr. Ein paar Kilometer links ragten die Schornsteine eines Kraftwerkes in den Himmel. Dunkler Rauch stieg auf. Und, als er gerade die Scheibe an der Fahrerseite wieder hochdrehen wollte - er hatte vergessen sie zu schließen - da flog ihm ein Rußpartikel ins Auge. Scheiße! Wann wird das bloß aufhören?, fluchte er und wischte sich das Auge mit einem Taschentuch.
Der Mann im Mercedes heißt Tankred Kraatz.
Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Münchner Immobilienfirma „United-County-GmbH“. Das verschlungene „U“ und das „C“, die Initialen der Firma, als prunkende übergroße grellrote Lettern an den beiden vorderen Türen des Wagens, vermitteln den Eindruck, eine Weltfirma oder gar ein Hollywood-Team sei unterwegs. Gestern Abend, gleich nach der ersten Meldung von den offenen Grenzen, hat der Unternehmer Kraatz seinen Teilhaber angerufen und gesagt:
Hast du gehört?
Die haben die Grenzen aufgemacht. Eine Riesendummheit, so unkontrolliert. Mensch, Eberhardt! Los! Wir müssen rüber. Sondieren und die Filetstücke sichern. Werde zuerst in meine alte Heimat fahren. Nach Sachsen. Da kenn ich mich ein bisschen aus. Du weißt, wer zuerst kommt… der frühe Vogel fängt den Wurm, ha, ha…
Indes im sächsischen Pirna. Es steht vor dem Spiegel im oberen Badezimmer seiner Villa ein Mann. Halbglatze, Bauchansatz. Um die Fünfzig. Er hat den Bademantel vorn offen gelassen. Seine Brust, fett und hängend, ist unbehaart. Die Geschlechtsteile, unter dem Bauch halb verborgen, sieht man kaum. Aber auch dort wenig Haare. Der Mann lächelt in den Spiegel, zieht die schlaffen Lider herab, kräuselt die Nase, streckt die Zunge heraus. Eine blaurote Zunge mit gelblichweißen Belägen kommt zum Vorschein. Dann winkt er ab, lässt einen verächtlichen Laut hören und entkleidet sich, stellt sich unter die Brause, seift sich ein, duscht sich ab. Dazu pfeift er ein Liedchen. Wenn man genau hinhört, erkennt man ein altes Arbeiterlied. Aber er pfeift es falsch, die Töne und der Rhythmus stimmen nicht. Nachdem er sich in ein hellblaues Badetuch gewickelt hat, geht er, mit seinen gelben Fersen aus den Galoschen schlappend, hinunter in die große Küche, den Kaffee aufzusetzen; danach setzt er sich mit einem Ächzen an eine Eckbank neben dem Riesenherd, nimmt die Zeitung, die ihm seine Frau hingelegt hat, und blättert darin. Wieder pfeift er das Arbeiterlied. Wieder klingt es falsch. Kaum dass man die Melodie erkennt. Plötzlich erscheint eine kleine dickliche Frau, die Lockenwickler im rötlich gefärbten Haar. Sie tritt an den Mann heran, beugt sich zu herab, küsst ihn auf die Stirn.
Na, was sagst du nun?, fragt sie und deutet auf den Leitartikel.
Doch der Mann winkt nur verächtlich ab. Knallt die Zeitung auf den Tisch. Ich möchte wissen, was die sich in Berlin dabei gedacht haben! Jetzt wird der ganze Laden unbeherrschbar. Der Mann blickt zu seiner Frau hin. Er lächelt nicht. Sein Blick ist undurchdringlich und hart und in eine unbestimmte Ferne gerichtet. Ich sage dir, Lisa: Wir werden Riesenprobleme kriegen.
Das ist das Ende!
Aber, Gott sei Dank, ich habe vorgesorgt, es gibt für einen wie mich nach dem Tode immer noch ein Weiterleben.
Der das sagt, dieser Mann um die Fünfzig, mit dem hellblauen Badetuch um die Hüften, das ist Egon Karrenbusch, Zweiter Sekretär der SED-Kreisleitung Pirna, Absolvent der Parteihochschule in Kleinmachnow, seit fünfundzwanzig Jahren im Parteiapparat, gelernter Bankkaufmann…
Im Untersuchungsgefängnis Bautzen II, offiziell dem Ministerium des Innern unterstellt, in Wahrheit aber der sogenannte und berüchtigte Stasi-Knast im „Gelben Elend“, da schrillt an jenem 10. November morgens gegen acht Uhr auf dem oberen Gang, im sogenannten Block D, dort, wo die „harten Politischen“ weggeschlossen sind, der auf- und abschwellende Ton der Alarmtröte, wie der Signalgeber auf jedem Gang unter den Gefangenen genannt wird. Die Vollzugsbeamten eilen von Zelle zu Zelle, der Leiter telefoniert mit der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit, die Wachmannschaft, aufgeschreckt in ihrem Pausenraum, schnallt sich Knüppel und Pistole um.
Um sieben Uhr fünfundvierzig Uhr hat der Untersuchungsgefangene Jörg Knispel von Zelle 453 dem diensthabenden Feldwebel Kroppkötter das Frühstück mitsamt Plastikbecher und Besteck vor die Füße geworfen.
Mit dem Fraß könnt ihr euch selber beköstigen! Das fressen wir nicht mehr.
Seit gestern wären nun Gottseidank andere Zeiten, hat er hinzugefügt. Wir verlangen Revision, wir wollen normale Besuchszeiten und Bedingungen, politische Gefangene darf es jetzt nicht mehr geben… Erst hat der Beamte noch sagen können: Sie, Knispel, sitzen hier nur zum Teil politisch. Das wissen Sie. Und Ihren Prozess kriegen Sie schon noch. Nur Geduld…
Doch er hat nicht ausreden können, der Feldwebel Kroppkötter. Im selben Moment ist ein Riesentumult losgebrochen. Aus Dutzenden Zellen hat es geschrien, gebrüllt, getrommelt, gesungen:
„Freiheit!“ Freiheit!“ „Freie Ausreise!“ „Freie Wahlen!“ „Weg mit dem SED-Staat!“
Unter den gelbroten Klinkermauern des hoch gelegenen Gefängnisses lag malerisch ausgebreitet die Stadt Bautzen. Ein historisches Kleinod. Das Tor zur Oberlausitz. Bis in die Fenster der nahen Häuser drang der Tumult: „Freiheit!“ „Freiheit!“ Bald erklang dazu ein unüberhörbares Trommeln. Die Gefangenen, wütend und entschlossen, rammten ihre Schemel gegen die Eisentüren.
Durch die Gänge liefen die Vollzugsbeamten, die Stasioffiziere, in Zivil und uniformiert, versuchten durch die noch geschlossenen Türen mit den Aufrührern beruhigend zu reden.
Noch vor Wochen hätte es eine Prügelorgie gegeben, hätte es Strafen geregnet, Haftverschärfungen, Haftverlängerungen. Jetzt, nach dem historischen 9. November und den vorausgegangenen Runden Tischen, den Veränderungen im Politbüro, der plötzlich ausgebrochenen Presseoffenheit, ist man auf einmal vorsichtiger und zugänglich.
Seid doch vernünftig!, reden die Bewacher durch die Türen, bald wird sich alles regeln. Für einen jeden von euch wird gesorgt werden. Vielleicht schon im Dezember gehen die Tore auf. Doch ihr müsst vernünftig sein. Sonst können wir für nichts garantieren. Hört doch mit dem Lärm auf!
Langsam, wie ein abziehendes Gewitter, schwillt der Lärm ab, legt sich die Aufregung. Es sickert durch die eisernen Türen und die Mauern die Aussicht, bald dieses „Gelbe Elend“ verlassen zu können; endlich wieder blauer Himmel, endlich jetzt nach drüben fahren, endlich wieder richtig leben. Die letzten Aufrührer, die keine Ruhe geben wollen, die nichts glauben wollen, die den Stunk lieben, werden in die Arrestzellen gesperrt.
Da! Genießt die Gemütlichkeitein letztes Mal! Hier könnt ihr weitertoben! Keiner hört euch!
Die schweren doppelten Eisentüren der Arrestzellen fliegen krachend zu.
Jörg Knispel, der zu diesen letzten Aufmüpfigen gehört, ballt die Fäuste.
Wartet nur, ihr Stasi-Hunde! Auch, wenn wir frei sind, werden wir nicht aufhören. Wir finden euch überall. Und dann: Wehe euch! Rache! Rache!
Pfarramt Leubnitz-Neuostra. 10. November, nachmittags gegen fünfzehn Uhr. In einem Hinterzimmer, das sonst vom Jugendkreis für Spiele und eine Singegruppe genutzt wird, sitzen ein paar junge Leute zusammen. Es sind sechs. Keiner ist älter als fünfundzwanzig. Vier junge Männer, zwei Mädchen. Aber die Stimmung ist gedrückt und zugleich aufgeladen. Die sechs gehören zu einer eigenen Arbeitsgruppe im Stadtverband des Neuen Forums. Es ist die Arbeitsgruppe „Grundsatzfragen“. Eigentlich müssten sie neun sein. Drei fehlen. Von einem wissen sie, er ist noch gestern Abend nach Westberlin gefahren. Er wollte unbedingt die offene Grenze sehen. Die anderen beiden fehlen unentschuldigt.
Wir wollen, sagte ein Lockenkopf, der in der Mitte saß, wir wollen zuerst darüber reden, wie wir die entstandene Lage bewerten. Hört zu, hört zu, rief er schnell, als er sah, dass sich zwei seiner Leute zu Wort melden wollten, ich sage, dass jetzt die Grenzen offen sind, schadet uns mehr, als es uns nützt. Alle werden in den Westen wollen, den Glitzerglimmer zu sehen, und was hier geschieht, ist ihnen erst einmal egal…
Genau, genau, fiel ihm nun der eine, der sich zu Wort gemeldet hatte und es nun nicht mehr aushielt, in die Rede, genau, ich wette, diese Grenzöffnung ist ein Schachzug der neuen SED-Oberen. So wie man ein Ventil öffnet, um Dampf abzulassen, wenn der Druck im Kessel zu groß wird, so haben sie einfach, mir nichts, dir nichts, die Grenzen aufgemacht – und die Hammel rennen aus dem geöffneten Pferch und haben vergessen, dass der Bauer, der sie einsperrte, das eigentliche Übel ist…
Ein schönes, stimmiges Bild, sagte eines der Mädchen, ein Rotblonde in einem ziemlich neuen Jeansanzug, ein schönes Bild, was du da entworfen hast, aber es trifft genau die Lage.
Leute, Ruhe!, rief jetzt wieder der Lockenkopf in der Mitte, wir müssen überlegen, wie wir reagieren sollten.
Ich bin dafür, aufzuklären, dass die Grenzöffnung ein gemeiner Schachzug ist, rief jetzt das andere Mädchen, eine ziemlich lange Blondine mit glatten Haaren.
Da wirst du aber schief landen, meine Liebe, entgegnete einer.
Ja, das glaub ich auch. Wir können jetzt nicht dagegen sein, die Leute laufen uns davon.
Sehe ich auch so. Und außerdem: Ich will auch mal rüber, und zwar möglichst schnell, sagte der, welcher sich zuerst zu Wort gemeldet hatte.
Da sieht man es wieder. Der Egoismus blüht. Alle laufen sie davon… und wir, wir sitzen hier und kriegen die Reformen nicht durch, die wir im Auge hatten…
Im Deutschlandfunk sagten sie heute, die Bundesregierung erwäge für alle, die die BRD besuchten, eine Art Begrüßungsgeld auszuzahlen. Direkt, bar auf die Hand.
Na dann, Scheiße, dann rennen die Hammel wirklich los. Die ganze DDR auszahlen? Haben die so viel Geld?
Die? Die haben zu viel davon. Das Begrüßungsgeld zahlen sie aus der Portokasse.
Da sieht man es! Der Westen zahlt Geld, damit sie alle rüber kommen. Keiner denkt mehr daran, dass wir vorhatten, die DDR auf Vordermann zu bringen. Der Westen und die SED-Führung ziehen am gleichen Strang. Und die Stasi und die korrupte SED-Bande können inzwischen in aller Ruhe ihr Schäflein ins Trockene bringen…
Ja, so ist es! Da hast du Recht. Verdammte Scheiße.
Leute! Ruhe! Wir kommen so nicht weiter – der Lockenkopf versuchte die anderen zu überbrüllen. Ich habe hier eine Tagesordnung… wir sollten… eh, hallo, kommt ihr mal zur Ruhe. Bitte! Da können wir auch gleich Schluss machen und den nächsten Zug in den Westen nehmen… Es war ein ziemlicher Tumult entstanden. Jeder redete mit jedem. Warum sie gekommen waren, was sie eigentlich wollten, schien vollkommen vergessen.
Der Lockenkopf ist von seinem Stuhl aufgesprungen. Leute! Hört mir jetzt bitte mal zu!
Für einen Moment ist es still. Alle schauen auf ihren Anführer, aber man sieht die Skepsis. Was würde er ihnen schon bieten können? Die Lage ist verfahren, sie sind von den Ereignissen überrollt worden…
Hört zu! Bitte! Leute! Der Lockenkopf, er ist Student der Theologie im vierten Semester, aber er will umschulen, will jetzt Politikwissenschaften studieren; der Lockenkopf, er heißt Torsten Schrempf, hat sich größer gemacht, ist auf einen Stuhl gestiegen, damit ihn alle hören und er nicht übersehen werden kann, er sagt: Wir sollten aufhören uns in Spekulationen zu üben und rüber über die offene Grenze kann jeder. Auch wir. Das ist klar. Jetzt geht es aber darum, dass wir unsere Arbeit hier in der Stadt nicht vernachlässigen. Ihr wisst, am 9. Dezember wollen wir, wie die Berliner am 5., auf dem Theaterplatz unsere große Demo machen.
Da gibt es viel Arbeit. Am wichtigsten ist die Liste mit den Rednern…
O.k.!, rief einer dazwischen, die Rednerliste ist wichtig. Vor allem müssen wir aufpassen, dass nicht wie bei einigen der letzten Veranstaltungen Stasileute oder alte Parteikader sich unter die Redner mischen…
Da bin ich anderer Meinung, rief die lange Blonde, wir sollten die nicht ausgrenzen, so wie sie es mit uns gemacht haben. Wir sollten die reden lassen. Ihr werdet sehen, das Volk wird wachsam sein und nicht drauf reinfallen…
Du bist ja neublau!, schrie einer von den Jungs, so naiv… typisch Weib!
Was hat das mit Weib oder Mann zu tun? Du hast ja eine uralte Auffassung.
Es entstand aufs Neue ein Tumult. Jeder wollte zu Wort kommen. Und, obwohl nur sechs Menschen in diesem abgelegenen Raum des Jugendkreises waren, klang es von draußen, als tobe ein vollbesetzter Saal.
Der Pfarrer, der sich aus seinem stillen Arbeitszimmer aufgemacht hatte, um sich zu den jungen Leuten zu gesellen, blieb vor der Tür stehen. Er lauschte ein paar Sekunden, die Hand auf der Klinke, dann lächelte er und trat ein.
Was macht ihr denn für einen Lärm?
Das ist gut, Herr Pfarrer, dass Sie kommen, da können Sie gleich den Schiedsrichter spielen. Es geht darum, sprach der Lockenkopf, der von seinem Stuhl herabgestiegen war, ob wir zur Demo am 9. auch Stasileute und Parteikader reden lassen sollten…
Der Pfarrer wiegte den Kopf. Oh, das ist keine leichte Frage. Wir sollten das Für und Wider gründlich beraten…
1. Kapitel
Im Neubauviertel. Die junge Frau war erwacht.
Die Arme hinter dem Kopf verschränkt, blickte sie zum Fenster. Noch dachte sie an nichts Bestimmtes, genoss den kurzen, entschlusslosen Zustand nach dem Aufwachen, beobachtete das Fenster.
Die Gardine hing schlaff und bewegungslos herunter. Es waren neue Gardinen. Geraffte. Der neueste Schrei. Sie hatten sie erst im letzten Monat angeschafft. Im Centrum-Warenhaus. Viel Geld bezahlt. Hinter der Gardine, das angekippte Fenster ließ den Bau- und Straßenlärm herein. Plötzlich erzitterte die Scheibe. Ein großer Kipper fuhr unten vorbei.
Die junge Frau, um die Vierzig, wusste nicht genau, welche Zeit es war; nach den Geräuschen konnte es acht oder neun Uhr sein. Eigentlich brauchten sie heute gar nicht aufzustehen. Sie waren beide krankgeschrieben, sie wegen des Kindes und er hatte es mal wieder im Bauch, Durchfall und so weiter. Dabei wusste sie, er war nicht wirklich krank, er hatte sich nur krank gemeldet, weil die Verhältnisse in seiner Firma unerträglich geworden waren. Ach, dachte sie, jetzt hatte sie auch den Namen „Firma“ verwendet, einen Begriff, den er immer für seine SED-Kreisleitung gebrauchte, in der er als Instrukteur und stellvertretender Abteilungsleiter arbeitete. „Firma“ – so was Blödes! Heute wollte er endlich reinen Tisch machen, wie er sich ausgedrückt hatte. Trotz Krankenschein wollte er hinfahren und den „Krempel“ hinhauen. Das hatte er gestern nach den Meldungen von den offenen Grenzen gesagt. Ob er wirklich den Mut haben würde? Sie wusste es nicht. Und sie wusste auch nicht, ob es gut und richtig wäre, jetzt schon aufzugeben. Sich diese Leute zu Feinden zu machen. Solange sie noch die Macht hätten. Außerdem war da noch die Altersversorgung der Partei. Immerhin eine Art Zusatzrente. Dreihundert Mark im Monat würden sie opfern. Die würden sie ihm kappen. Ganz klar. Und dann? Vielleicht kämen die wieder in Tritt, vielleicht würde wirklich alles besser. Und, wie plötzlich so offen über alles geredet wurde, das war doch schon Hoffnung genug. Funktionäre, denen man das niemals zugetraut hätte, die redeten jetzt frisch von der Leber weg und noch nicht einmal blödes Zeug. Und die Aktuelle Kamera war richtig spannend geworden. Ach, es wäre schade, wenn es anders käme. Ja, sie hatte Angst vor Veränderungen, Angst, dass diejenigen, die jetzt einen schnellen Anschluss an den Westen verlangten und die immer lauter wurden, dass diese Leute die Oberhand gewännen. Was würde dann werden?
Sie hörte wieder auf die Geräusche, die jetzt aus dem Haus kamen. In Abständen von wenigen Sekunden wummerte und kreischte eine Schlagbohrmaschine. Einer bohrt immer. Es ist zum Verrücktwerden. Diesmal kam es aus der Wohnung über ihnen. Würden die denn nie fertig?
Sie warf einen Seitenblick auf ihren Mann. Doch der schien immer noch fest zu schlafen. Gut, sie waren ja auch erst kurz nach Mitternacht ins Bett gekommen, hatten diskutiert und im Fernsehen eine Diskussionsrunde nach der anderen angeschaut. Fast eineinhalb Flaschen Balkanfeuer hatten sie leer getrunken. Richtig benebelt war sie ins Bett gesunken. Er hatte zwar noch Sex gewollt, aber nein, dazu war sie einfach nicht mehr in der Lage gewesen… Du hast es doch im Bauch, hatte sie abwehrend und ein wenig spöttisch gesagt. Er war nicht zudringlich geworden. Er wusste, wenn sie nicht wollte, dann war nichts zu machen.
Jetzt beobachtete sie den Schlafenden. Halbnackt wie er war, sah er schön aus, mit kräftigen Muskeln und den blonden Härchen auf der Brust und auf den Schultern bis hinten zum Halsansatz, das Kopfhaar zerwühlt; nie braucht er einen Kamm, dachte sie, die Haare wollen sich einfach nicht in bestimmte Bahnen zwingen lassen, immer richten sie sich wieder auf, wie sie gerade wollen. Gleichmäßig geht die Atmung des Schlafenden. Ein ganz klein wenig schnarcht er sogar. Ach, du lieber Franz, lieber Junge, dachte die junge Frau, wenn du nur nicht immer so unüberlegt und aufbrausend wärest, wenn du nur nicht vor sechs Jahren in diesen verfluchten Apparat gegangen wärest, diesen Parteiapparat, aus dem du dich jetzt befreien möchtest und aus dem man, einmal hineingeraten, so schwer wieder herauskommt. Ein Instrukteur von da - ein ehemaliger Kollege von Franz, sie kennt ihn und sie denkt mit Schaudern an den unsympathischen dicken Siegfried Uhlerich - der hatte ihn überredet, ihren Franz. Das schaffst du mit links, hatte ihn Uhlerich beschworen, du kannst reden, du kannst dich schriftlich ausdrücken - manch anderer hat damit Schwierigkeiten - und du wirst einen Überblick kriegen, den du sonst niemals bekommen würdest. Aus dem Stand gleich Stellvertreter des Abteilungsleiters. Das gibt es so gut wie niemals. Das ist selten und fast eine Auszeichnung. Was sollte er da sagen, er musste einfach „Ja“ sagen. Franz ist für Lob immer sehr empfänglich gewesen. Vielleicht, weil er es als Kind von der strengen Mutter niemals oder nur ganz selten ein Lob bekam. Also hat er auf der Kreuzstraße angefangen. Im Oktober vor sechs Jahren. Das Prozedere des Wechsels – kein Problem. Sein Betrieb musste ihn delegieren. Das war Ehrensache. Abschiedsprämie inklusive. Und es war ja auch am Anfang alles gut gegangen, es hat ihm sogar Spaß gemacht, er hat viel dazugelernt, und es wäre ja gar nicht so politisch, hat er zu seiner skeptischen Mutter gesagt, es wäre mehr eine fachliche Tätigkeit, eine Art Anleiterfunktion. Und viel mehr verdient hatte er ja auch als in seinem vorherigen Betrieb. Über eintausendachthundert Mark im Monat. Und noch ein paar hundert Mark an Zulagen. So viel bekam man nicht einmal als leitender Ingenieur in der Wirtschaft.
Ja, das liebe Geld. Es deckt so Vieles zu. Es macht unkritisch. Es vernebelt die Sinne.
Sie beobachtete den Schlafenden, ihren Franz, und sie zweifelte, ob er bei dem, was er heute vorhatte, Erfolg haben würde. Er lag so ruhig, so friedlich und naiv wie ein kleines Kind. Nein, sie würden ihn wieder zu bekehren versuchen, ihn überzeugen wollen, gerade jetzt, in dieser schweren Zeit bei ihnen zu bleiben, nicht von der Fahne zu gehen.
Ja, sie hatte Angst um ihren Franz. Große Angst. Sie ahnte, er käme wieder und alles wäre umsonst gewesen, außer, dass sie ihn, ihren Franz, nun nur noch intensiver beobachteten, dass er ein Häkchen hinter seinen Namen bekäme: Ein Unzuverlässiger, ein Wackelkandidat. Nein, er wäre denen nicht gewachsen, ihr Franz, bestimmt nicht, keinesfalls…
Wie war es denn damals gewesen, als er eines Tages hinter die jämmerlichen Intrigen gekommen war, hinter die Machtversessenheit, die bornierte Dummheit und abscheuliche Verbohrtheit, hinter die stalinistisch-militärische Struktur des Ganzen? Das war vor etwa zwei Jahre nach seinem Eintritt gewesen. Wie war es denn, als er dann beschlossen hatte, so könne es nicht weitergehen? Als er endlich festgestellt hatte, wie groß die Kluft war, die Kluft zwischen dem Volk, den Arbeitenden, den einfachen Genossen in ihren Grundorganisationen und dem Machtapparat, der Nomenklatura dieser Partei? Freilich, er begann sich zu schämen, war unsicherer geworden, stiller, wurde von Woche zu Woche unzufriedener. Und dann? Was war dann gewesen? Als er schließlich im vergangenen Sommer, im Juli 88, seinen ersten Abberufungsantrag gestellt hatte, mündlich und dann schriftlich - was war daraus geworden? Er hatte ihn zurückgezogen. Ja, zurückgezogen hatte er ihn! Ein langes Gespräch mit der Genossin von der Kontrollkommission war vorausgegangen. Ja, er hätte begriffen, man verließe seine Genossen nicht so einfach. So das Fazit.
Wenn er nun diesmal wieder an die Alte von der Kommission geriete? Was dann?
Nein, sie, seine Frau, sie glaubte nicht, dass er diesmal erfolgreicher wäre. Warum ausgerechnet jetzt? Jetzt wären die sicherlich noch schärfer, noch prinzipieller – und was hätte er dagegen zu setzen? Ihr so stark erscheinender und in Wahrheit doch so schwacher Franz. Was würde schließlich herauskommen? Sie wusste es nicht. Sie konnte sich nichts vorstellen, was von Vorteil für sie beide wäre. Die junge Frau fror. Eine unbestimmte Angst hatte sie ergriffen. Eine Angst, die allgemeine Angst dieser schrecklichen, alles zerstörenden Tage…
Schlaf, mein Lieber, schlaf!, dachte die junge Frau und streichelte dem Mann über die schweißnasse Stirn. Liebevoll, zärtlich betrachtete sie den Schlafenden. Schlaf!
Plötzlich. Der Mann schlug die Augen auf, drehte sich auf den Rücken. Ein kleiner Unwille stand ihm auf der Stirn. Er öffnete den Mund, sagte: Hören denn die Tannerts mit dem Bohren nie auf. Sogar am frühen Morgen dieser Krach…
Es ist schon zehn vor neun, mein Lieber, sagte die Frau.
Was? Schon so spät? Um zehn Uhr wollte ich in der „Firma“ sein. Das schaff ich ja gar nicht mehr…
Auf die Minute wird es wohl nicht ankommen. Komm, ich wasch die Kleine und zieh sie an. Bitte fang du mit dem Frühstück an. Statt Kaffee würde ich gern einen Tee trinken…
Der Mann war mit einem Ruck hoch, er streckte die Arme nach der Frau aus. Ach, Eva, wenn ich dich nicht hätte… Ja, schon gut. Sie küssten sich.
Eine Viertelstunde später, zum Frühstück. Man hatte sich an den runden Wohnzimmertisch gesetzt. Die Kleine, ein vierjähriges Mädchen, saß bei der Mutter auf dem Schoß und ließ sich füttern. Während der Mann sein Brötchen aufschnitt, sagte er: Das muss nun aber bald alleine gehen. Sie ist schon vier. Da wird nicht mehr gefüttert…
Lass nur, so geht es schneller. Du willst doch fort.
Der Mann lächelte seiner Frau dankbar zu. Sie fing seinen Blick auf, sagte: „Wenn ich dich nicht hätte!“, ich weiß schon. Dein Standardsatz.
Nach dem Essen ging alles ziemlich schnell. Nur Augenblicke später war er in Schuhen und Jacke, setzte seine “Schapka“ auf - eine altmodische Schiebermütze aus dunkelgrauem Flanell; er hatte sie von seinem Vater - dann gab er Frau und Tochter ein Küsschen. Die Kleine lachte, wischte sich mit ihrem Händchen die Stirn. Nass!
Ich nehm den Trabi, sagte der Mann noch, dann klappte die Tür.
Die Frau seufzte auf und begann den Frühstückstisch abzuräumen.
Franz Malef war seit seiner Krankschreibung, also seit zehn Tagen nicht mehr in der Innenstadt gewesen. Hatte sich etwas verändert? Konnte man diese Veränderungen sehen?
Er wollte sich umschauen und, nachdem er seinen grasgrünen Trabi-Kombi auf dem Parkplatz seiner „Firma“, der SED Kreisleitung Dresdner Landkreis, geparkt und dabei verwundert festgestellt hatte, wie viele Parkplätze doch heute frei wären, lief er vom Hof nach vorn auf die Straße, wo die Kreuzkirche mächtig und unerschütterlich ihren Schatten verbreitete, den kleinen Umgebungsstraßen jede Sonne nahm. Und tatsächlich, auf den Stufen vor der Kirche sah man die Reste Tausender Wachskerzen. Heruntergebrannt und zu einem Brei zerlaufen.
Vor vier oder fünf Wochen noch, als die sogenannten Montags-Demos, die jedes Mal vor der Kirche begannen, ihren Anfang genommen hatten, als es sich eingebürgert hatte, dass jeder eine Kerze mitbrachte und als findige Ladenbetreiber dann schnell sogenannte Demo-Sets anboten hatten: Zwei Kerzen, eine Packung Streichhölzer. Damals hatte die Stadt noch die Kerzenreste wegräumen lassen. Sogar mit einer gewissen Gründlichkeit war das geschehen. Man wollte Spuren beseitigen, mit Schrubber und Wasserschlauch. Es sollte am nächsten Tag nichts mehr von diesen Demonstrationsresten zu sehen sein. Jetzt aber, nachdem alles mächtiger und unübersehbarer, ja beinahe unaufhaltsam und unbeherrschbar geworden war, nachdem die allgemeine Stimmung zu kippen drohte - jetzt ließ man die Wachsreste einfach auf den Kirchentreppen liegen. Sollte die Kirche doch, dachten die alten Kader in der Stadtverwaltung, sollten die, wenn es sie störte, ihren Dreck selber wegräumen.
Franz sah die Wachsreste, die wie eine grauweiße Kruste die Stufen bedeckten, er sah sogar vergessene oder absichtlich liegen gelassene Spruchbänder und Pappplakate mit Aufdruckemn wie „Neues Forum“ „Freiheit“ „Ausreise für Jedermann“ „Stasi in die Produktion“ und so weiter. Ein Gefühl der Unsicherheit, des ohnmächtigen Staunens, ja sogar der Scham ergriff ihn. Dann ging er weiter. Da war die Auslage eines Buchladens, einer „Volksbuchhandlung“, wie sie noch immer hieß. Schon in einem halben Jahr würden solche Läden phantasievollere Namen tragen, „Lesewut“, „Lesens-Art“, „Lesepoint“ etwa oder „Paradies der Bücher“. Jetzt waren hier nur die roten Dietz-Bände verschwunden und natürlich Marx´ Gesammelte Werke oder Honeckers Reden und Aufsätze, stattdessen sah man in üppiger Auswahl Bände des neuen Heilsbringers, Michail Gorbatschow. Sogar das Konterfei des sowjetischen Staats- und Parteiführers war in verschiedenen Größen und Rahmungen aufgestellt. Die Bilder von Honecker und Hager oder vom „Lila-Drachen“, der Margot Honecker, aber waren verschwunden.
Malef dachte daran, wie er Gorbatschows „Perestroika“ sozusagen unter dem Ladentisch, nämlich vom Agitpropsekretär der Kreisleitung, dem ewig sarkastischen Genossen Blumentritt, zu seinem vierzigsten Geburtstag überreicht bekommen hatte, überreicht mit der höhnischen Anmerkung, er bekäme dieses Buch, weil er es unbedingt hätte haben wollen, aber es sei ein Buch für die Gartenlaube, in der DDR ohne Relevanz und eigentlich nur für den Westen geschrieben. Malef hatte es genommen, sich bedankt, doch als er es gelesen, kam ihm das Ganze seltsam gestelzt und künstlich vor. Seine Frau hatte es nicht gelesen. Der lügt doch, hatte sie gesagt. Ich hab drin geblättert. Ein Schönredner. Weißt du, sagte sie, ich wette, seine Russen halten ihn für einen totalen Spinner. Es ist so wenig russisch, und ich glaube, dein Genosse Blumentritt hat recht, es ist für den Westen geschrieben.
Malef hatte die Achseln gezuckt. Jetzt lag das Buch irgendwo in seinem Bücherregal, er wusste nicht einmal mehr wo.
Malef schaute weiter. In einer Ecke der Buchladen-Auslage entdeckte er noch andere Bücher; fast ein wenig verschämt lagen sie da, Bücher von Max Frisch und Milan Kundera. Sogar ein Liederbuch von Wolf Biermann. War das nicht erstaunlich und fast ein Wunder? Wo waren diese Bücher auf einmal hergekommen? Noch vor knapp zwei Monaten, im September, wäre es nahezu unmöglich gewesen, sie offiziell zu kaufen.
Malef spazierte weiter. Er war „in Zivil“, das heißt, er hatte das Parteiabzeichen nicht angesteckt. Schon lange hatte er das nicht mehr getan. Seit ihn einmal zwei Jugendliche im Sommer letzten Jahres, als er im dunklen Anzug mit dem Abzeichen am Revers über die Prager Straße stolziert war und sie ihn angepöbelt hatten.
Scheißpartei! Scheißgenosse!, riefen sie. Er war weiter gegangen, als ob sie jemanden Anderen gemeint hätten. Indes, er wusste, ein anderer als er, zum Beispiel der Abteilungsleiter der Kreisleitung Jürgen Kanopke, der wäre wahrscheinlich wütend geworden, hätte die Jugendlichen festgehalten und die Polizei geholt.
Jetzt, in diesen Zeiten, fürchtete er Ähnliches, fürchtete angepöbelt zu werden, wenn er sich als Parteigenosse outete. Misstrauisch sah er die Menschen an, die an ihm vorüberliefen. Was waren das für welche? Dafür oder dagegen? Gespalten war die Gesellschaft, gespalten die Bürger, die darin lebten. Von keinem wusste man, ob er nicht der DDR, der Partei und allem, was damit zusammen hing, den Untergang wünschte. Aber wäre das im Grunde nicht immer schon so gewesen?, dachte er. Was hätte diese Partei von ihrem Volk gewusst? Für dessen Wohl sie angeblich arbeitete. Geschah es ihnen nicht recht, dass sich jetzt das Volk von ihnen abwandte? Das Volk? War es auch wirklich das Volk? dachte Malef. Wer oder was ist eigentlich das Volk? Wären es nicht vielmehr immer bloß ein paar Aufwiegler? Ein paar Stimmungsmacher? Lassen wir uns nicht alle so leicht aufwiegeln und anstiften? Steht das Volk nicht wie immer hinter der Gardine und wartet ab?
Malef ertappte sich bei diesen Gedanken, während er an den Geschäften entlanglief. Waren dies nicht aber Gedanken, überlegte er, die allesamt auf Rechtfertigung aus wären? Gedanken, die die wirklichen Ursachen verdrängten?
Malef blieb stehen. Er sah einen Mann, der kleine handtellergroße Zettel an die Ladenscheiben klebte.
Das war doch!? Klar, das war Friedel Zielke.
Zielke aus seinem alten Betrieb. Brigadier der Baubrigade. Ein windiger Typ, immer dabei, wenn es galt, der Leitung Schwierigkeiten zu machen, immer Fürsprecher seiner Leute, wenn sie es mit der Disziplin nicht so genau nahmen, wenn sie sich während der Arbeit betranken, wenn sie ihre Abrechnungen fälschten. Trotzdem, er hatte Unterstützer; vielleicht hatte er sie in der Hand, den Technischen Direktor zum Beispiel, diesen Daniel Borkhusen, und damit auch den Alten, den Direktor Schneider. Dem Zielke war noch nie was passiert. Der konnte treiben, was er wollte. Vor ein paar Jahren war er sogar Aktivist geworden, mit frisierten Leistungsnachweisen, wie er, Malef, nachgewiesen hatte. Aber er war trotzdem „durchgerutscht“ und hatte das Geld und den Orden bekommen. Zur Betriebsfeier, auf der Toilette hatte er dann gefeixt: Na, Malef, du und deine Partei, da habt ihr wieder Pech gehabt. Weil so einer wie ich, weil der Zielke eben schlauer ist und früher aufsteht, ha, ha – und er hatte sich rumgedreht, ihn angerülpst, seinen Pimmel geschwenkt und dreckig gefeixt, rotzbesoffen wie er war…
Und jetzt klebt der Zielke hier Zettel an die Scheiben!
Malef geht hin, ein paar Scheiben weg von ihm, und liest die Zettel. Weg mit allen SED-Funktionären! Für die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes! Malef liest zweimal, runzelt die Stirn. Er hat den Friedel Zielke als unpolitischen Menschen in Erinnerung. Nie hat er sich politisch geäußert. Freilich, Stunk gegen die staatliche Leitung, die Partei und die Gewerkschaft, da ist er immer ganz vorne gewesen. Aber da ist es ihm, so hat Malef bisher gedacht, um Geld und um ein bisschen Auffallen gegangen. Fußball, sein Camping an der Ostsee und Weiber – mehr hat der Zielke doch früher nie gewollt. Warum ist er jetzt zum Zettelkleber und Protestierer geworden? Zielke ist näher gerückt, eine Ladenscheibe zwischen Malef und ihm ist noch frei geblieben. Er ist ganz beschäftigt mit seinen Zetteln und dem Leimtopf. Plötzlich aber sieht er den Malef. Er stutzt, stellt den Leimtopf und die Zetteltasche auf den Fußweg, entschlossen und schnell kommt er heran.
Jaa!, ruft er aus und klopft mit einem Finger bedeutungsvoll auf einen der angeklebten Zettel, damit bist du gemeint, Genosse! Hätten dich schon früher zum Teufel jagen sollen. Aber da hattest du ja deine Partei im Rücken. Jetzt kann sie dich nicht mehr schützen vor dem Volkszorn…
Volkszorn!? Wusste gar nicht, dass Sie den Volkszorn verkörpern, Herr Zielke? Malef hat den Zielke ganz bewusst mit „Sie“ und „Herr“ angesprochen. Er bringt sogar noch ein ironisches Lächeln zustande.
Friedel Zielke läuft rot an. Wahrscheinlich hat er heute früh schon ein paar Biere getrunken, er riecht aus dem Maul, furchtbar, denkt Malef. Der Zielke schnappt nach Luft.
Das ist ja…das ist ja, keucht er, anstatt sich still und leise zu verdrücken, riskiert der Kerl noch ne Lippe. Hast du noch nicht kapiert, Malef? Deine Zeit ist vorbei. Aus. Abgelaufen. Schluss mit führender Rolle und so. Schluss mit Parteitagsgeplapper und Leitartikel im ND.
Komm, zieh Leine!, sagt er ein wenig friedlicher. Ich muss weitermachen.
Ein paar Passanten sind durch Zielkes Brüllerei stehengeblieben. Sie starren auf die Zettel, an denen sie vorher wie alle anderen achtlos vorbeigelaufen sind. Ein älterer Herr rückt an seiner Brille, liest, nickt, sagt: Sehr richtig! Ich bin auch dafür. Sehr richtig!
Die anderen gehen schweigend weiter. Eine Frau hat den Kopf geschüttelt.
Siehste, Malef, ruft Zielke triumphierend aus, so reagiert das Volk. Zustimmung, wohin man blickt. Die Zweifler überzeugen wir auch noch.
Malef will sagen: Das war aber nur einer! Die Mehrheit schweigt. Wie immer. Aber er sagt nichts, er murmelt nur, wenn das Volk auf solche wie Sie, Zielke, zählen muss, dann wird es schon ein Erfolg werden… Zielke hat das nicht gehört, er klebt wieder seine Zettel an die Scheibe. Malef geht ohne Gruß weiter. Sie gehen auseinander, die beiden Männer, aber sie werden bald wieder aufeinander treffen…
Vor dem Eingang zur Kreisleitung bleibt Malef stehen.
Man sieht, die roten Glastafeln mit der Beschriftung „SED-Kreisleitung Dresdner Land“ sind mit Farbe beschmiert gewesen. Mit Mühe hat man es abgekratzt und gereinigt, aber der alte unbefleckte Glanz ist weg; man sieht es ganz deutlich, hier hat es eine Schmiererei gegeben. Malef zieht die schwere Tür auf und schrickt zurück. Was ist das? Gleich hinter der Tür sind von innen schwere graugestrichene Eisengitter angebracht worden. Sogar doppelte. Eine Gittertür und ein Scherengitter. Vor 14 Tagen, als er das Haus verließ, gab es das noch nicht.
Malef tritt an die Loge der Wachhabenden heran. Auch hier – Veränderungen. Früher wurde der Einlassdienst und die Objektbewachung von zwei Uniformierten der Polizei ausgeübt. Jetzt, sind die Uniformen verschwunden. Aber es sind noch dieselben Wachhabenden, der dicke Oberwachtmeister Friedhelm Schetzik und der ältere, etwas vertrottelte Wachtmeister Wolfgang Müller; nun sitzen sie in Zivil in ihrem Kabuff hinter der Glasscheibe. Und sie sehen ohne Uniformen, in Strickjacke und Wollpullover ganz harmlos aus, wie ganz normale Leute, beinahe wie zwei Rentner oder so, als wären sie von der Straße weggefangen und hier hereingesetzt worden.
Na, ihr beiden?, grüßt Malef und zieht ordnungsgemäß seinen Dienstausweis, den er immer noch bei sich trägt. Ohne Uniformen? Inkognito?
Der Oberwachtmeister in Zivil Schetzik aber schüttelt den Kopf. Brauchen wir nicht mehr. Uniformen. Dienstausweise auch nicht. Wir wissen ja auch so, wer du bist, Franz. Willst wohl einen Besuch machen? Wirst sehen, manches ist in den zwei Wochen anders geworden und er zeigt zu dem Scherengitter am Eingang. Seine Stimme klingt müde und lustlos. Nun wird aus seiner Beförderung zum Polizeimeister wohl nichts mehr, sagt sich Malef und nickt ebenso traurig, wie die Stimme des Wachhabenden geklungen hat.
Geht der Fahrstuhl?, fragt er. Außer Betrieb!, sagt der zivile Schetzik.
Und Franz Malef beginnt die sehr steile Treppe zum obersten Stockwerk hinaufzusteigen. Dort will er seinem Abteilungsleiter, dem dicken Kanopke, oder noch besser, dem Sekretär Eberhardt Grünow sein Abschiedsgesuch überreichen. Aber der Grünow wird wohl kaum am Schreibtisch sitzen, der wird draußen in einer Grundorganisation sein und den Genossen ins Gewissen reden, Trost zusprechen, sie sollen nur ja den Mut nicht verlieren.
Und so ist es auch. Der Grünow ist abwesend.
Der Dicke hockt hinter seinem Schreibtisch wie ein riesiger Fleischberg und schneidet sich die Fingernägel. Er sieht kaum hoch, als Malef eintritt.
Rot Front!, sagt der Schurzki, der wie immer beim Dicken sitzt und gerade an irgendeinem Bericht bastelt. Er kaut auf seinem Stift herum, die Ohren sind gerötet.
Malef antwortet nicht. Er legt dem Kanopke sein Schreiben auf den Tisch und wartet. Der Dicke aber denkt gar nicht daran, den Brief in die Hand zu nehmen. Seine Fingernägel sind ihm wichtiger. Dass du dich auch mal wieder sehen lässt?, knurrt er und ruft zur Sekretärin durch die offene Tür hinaus: Sophie, mach mal drei Kaffee!
Mach mal bitte drei Kaffee!, korrigiert Malef und setzt sich an den Tisch, der längs vor Kanopkes Schreibtisch in den Raum ragt. Nanu?, fragt der Dicke, Kurs in Höflichkeit belegt?
Wieder antwortet Malef nicht, zeigt nur auf seinen Briefumschlag. Solltest du mal lesen!
Sollte ich bitte mal lesen!
Lach, lach, toller Witz.
Was steht denn da drin?
Wirste schon sehen. Lies nur. Ich wette, du rennst damit gleich zur Isolde.
Ach so, mault der Dicke, ich weiß schon. Der Herr Genosse will sich aus dem Staub machen? Wenn´s uns dreckig geht, da hat man keine Lust mehr für die politische Arbeit. Ein Fall für die Isolde Degenhardt also? Bravo!
Lies erst mal und quatsch dann. Ist auch eine Begründung dabei.
Ach so, Kündigung mit Begründung, die noble Tour – und der Genosse Kanopke greift sich Malefs Brief, faltet ihn umständlich auseinander, liest. Schon bei den ersten Zeilen grient er, er blickt über den Briefrand zu Malef, sein Blick verändert sich, die dichten Brauen schieben sich zusammen - sein böser Blick ist das. Ein giftig hinterhältiger Blick. Malef kennt diesen Blick, er verheißt nichts Gutes…
Wo ist denn Grünow?, fragt Malef, er fragt ohne eigentliches Interesse, nur, um etwas zu fragen und ein bisschen abzulenken.
Der Grünow? Der Dicke grunzt, legt den Brief zur Seite. Der Grünow ist bei seinen Genossen, draußen an der Basis. Will sich wahrscheinlich gut Wetter machen, damit sie ihn, wenn´s ernst wird, nicht aufhängen.
Glaub ich nicht, sagt Malef, der meint es ernst, der will wirklich wissen, wie die Leute ticken. Die mögen ihn auch, draußen, glaub ich.
Jaa, die lieben ihren Sekretär. Den Schleimer. Mehr als mich, was?
Dich? Dich lieben sie nicht, das ist klar. Vor dir haben sie immer Angst gehabt.
Weil ich die Beschlüsse eisenhart durchgesetzt habe. Weil ich Prinzipen hatte. Weil bei mir nicht gemauschelt wurde.
Mauscheln. Prinzipien. Eisenhart. Wurde? Warum in der Vergangenheitsform? Jedenfalls: Pass nur auf, dass dir deine eisenharten Prinzipen keiner übel genommen hat.
Ich hab keine Angst. Noch hab ich meine Makarow im Panzerschrank.
Makarow. Das ist deine letzte Weisheit, was?
Malef ist zum Fenster getreten, er will nicht weiterreden. In ihm kocht es. Dieses arrogante Machtschwein. Ja, auch wegen Kanopke hat er seinen Abschied eingereicht, denkt Malef, wegen all dieser Kanopkes…
Dieser hat sich inzwischen wieder in den Brief vertieft. Sein feistes Gesicht rötet sich mit jedem Satz, er beißt sich auf die Unterlippe, atmet schwer, schwitzt.
Schurzki hat mit dem Berichteschreiben aufgehört. Er starrt neugierig zu seinem Chef, brennt sich eine neue Zigarette an. Seine Hände zittern. Wer weiß, die wievielte heute? denkt Malef. Schurzkis Finger sind gelbbraun wie bei einem Färber.
Kanopke hat jetzt den Brief zu Ende gelesen. Er schnauft. Und er scheint erfreut, dass die Sekretärin hereingekommen ist und den Kaffee serviert. So wird die Situation für einen Augenblick entspannter. Er kann sich ablenken. Schweigend ergreift er seine Kaffeetasse, spitzt die Lippen, trinkt einen Schluck.
Zu heiß, verdammt! Sophie!! Viel zu heiß, verdammt! brüllt er ins Vorzimmer.
Kalten Kaffee kann ich nicht kochen!, kommt es von dort zurück.
Und, einen Augenblick später, springt der Kanopke auf, sagt im Hinausgehen: Eine tolle Sache, Franz! Das muss ich schon sagen. Du hast recht, das ist etwas für die Kontrollkommission. Isolde wird sich freuen. Die hat sowieso in diesen Tagen viel Freude. Massenweise Austritte und Parteiverfahren. Da passt dein Scheiß genau mit hinein.
Er geht. Kaum ist draußen die Tür zugeschlagen, steckt die Hildi, Anfang Dreißig, Abteilungssekretärin, ihren Kopf in die Tür.
Was is´ n los? Warum dreht der Dicke durch?
Erst Schweigen, dann Schurzki: Der Franz hat seinen Abschied eingereicht. Der Dicke macht bei der Isolde Meldung.
Hildi seufzt. Wieder einer weniger. Es macht langsam keinen Spaß mehr.
Schurzki schaut Malef an. Na los, sag mal, was hast du denn da geschrieben. Muss ja eine mordmäßige Bombe sein.
Doch Malef zuckt nur mit den Achseln. Wirste schon noch sehen…
Inzwischen, eine Viertelstunde ist vergangen, kommt der Dicke zurück. Ohne ein Wort setzt er sich, greift nach seiner Kaffeetasse. Scheiße, jetzt ist er zu kalt.
Dann blickt er auf - er hat immer noch seinen bösen Blick - sagt zu Malef:
Du! Hör zu! Du gehst jetzt in dein altes Dienstzimmer und wartest dort… die Isolde wird dich dann rufen lassen.
Malef steht auf. Der Stuhl scharrt über den Fußboden. Schweigen herrscht. Ohne Gruß geht er hinaus, geht eine Tür weiter, zu seinem Dienstzimmer, sieht den leeren Schreibtisch, die vertrockneten Blumen auf der Fensterbank, setzt sich, nimmt den Kopf in die Hände, wartet… wilde Gedanken wuseln in seinem Kopf. Wie wird es werden, jetzt?
Das Telefon schrillt. Ein Anruf über die Hausleitung von der Ursel. Sie ist Tippse bei der Vorsitzenden der Kreisparteikontrollkommission, der berühmt-berüchtigen Isolde Degenhardt. Genossin Gnadenlos wird sie genannt, weil, wer in ihren Fängen landet, immer das Nachsehen hat und Schaden nimmt. Also die Ursel, ein harmloses älteres Frauchen, teilt Franz Malef hochamtlich mit, er solle Punkt zehn Uhr bei ihrer Chefin erscheinen. Worum es ginge, wisse sie nicht. Malef schaut auf die Uhr.
Es war jetzt kurz nach neun…
Wie befohlen, Punkt zehn trat Franz Malef bei der gefürchteten Genossin Gnadenlos ein.
Hinter ihrem mächtigen Schreibtisch, der bedeckt war mit Akten, Zetteln in verschiedenen Farben und einem aufgeschlagenen Neuen Deutschland, thronte sie auf einem ledernen Drehsessel. Massig, ältlich mit kurzem blonden Bubikopf, die Lesebrille an einem Kettchen vor der Brust. Sie beugte sich leicht vor, kniff die weitsichtigen, wässrigen, blauen Augen zusammen, maß den Eingetretenen mit ihrem scharfen Prüfblick. Doch dann entspannte sie sich, wurde weich, fast freundlich, wirkte wie eine nette, alte Dame als sie ausrief:
Franz, na komm setz dich. Nein, nicht dort in die Sesselgruppe, komm an meine Seite, gleich hier neben dem Schreibtisch. Ich bleib hier, du weißt doch, meine Hüfte. Jede Bewegung schmerzt. Ach, man wird alt. In acht Wochen soll die Operation sein. Künstliches Hüftgelenk. Oh, es wird auch Zeit. Ich halt es ja gar nicht mehr aus vor Schmerzen. Das zieht und hackt und schneidet in einem fort. Ohne Rewodina geht´s gar nicht mehr. Und sie verzog ihr faltiges, gelbes Gesicht zu einer Grimasse des Leidens und des Schmerzes.
Malef versuchte teilnahmsvoll zuzuhören, schwieg aber und wartete darauf, dass sie weiterredete.
Sag mal, Franz, fuhr sie denn auch fast ohne Pause fort, wie geht es dir denn? Man sieht sich ja so selten in diesen Tagen, nur ab und bei Sitzungen und im Sekretariat, mal in der Kantine oder auch flüchtig im Gang, da draußen. Man arbeitet jahrelang zusammen, aber voneinander weiß man eigentlich nichts. Schade, nicht? Du bist zur Zeit krank, hörte ich?
Malef nickte und zugleich kroch ihm eine angstvolle Ahnung die Brust hinab.
Was wollte die denn? Warum so eine gefühlsdusselige Tour? Man war derartige Einleitungen, in denen es um Privates ging, in diesem Hause nicht gewohnt. Es war einfach nicht üblich. Gewöhnlich steuerte man sofort auf das Thema zu, das man behandeln wollte, ohne Umschweife. Wie geht es mir? Was fragt die denn da? Was soll ich sagen, wo anfangen, wo aufhören? Was sag ich nur? Malef spürte, wie ihm eine Eiseskälte zum Kopfe stieg, ihn schwindelte. Er versuchte tief Luft zu holen.
Ach, ich vergaß, dass du ja ein Kaffeetrinker bist.
Die Degenhardt rief nach ihrer Ursel und bestellte zwei Tassen Kaffee. Erst wollte er ablehnen. Hatte er doch eben erst Kaffee getrunken, doch dann nickte er, sagte: Danke, Isolde! Aber Malef schöpfte zugleich Verdacht, dass sie seine Unsicherheit bemerkt haben könnte. Sie will mir Zeit geben und sich auf weiteres vorbereiten, dachte er. Sie verfolgt einen ganz bestimmten Plan, dachte er ängstlich. Was sag ich nur. Schließlich beschloss er, solange es ging, unbestimmt zu bleiben und nur über Allgemeines zu reden.
Mir geht es zeitgemäß, versuchte er zu scherzen, sparte die jetzige Lage vollkommen aus.
Wieder kniff Isolde Degenhardt ihre blauen Äuglein zusammen, hielt den kurzgeschorenen Kopf ein wenig schief und fragte:
Und deiner Frau? Geht es ihr auch zeitgemäß? Ihr seid doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, schon über zwölf Jahre verheiratet? Und nach einer kleinen Pause, in der sie angestrengt ihre rosa lackierten Fingernägel betrachtete: Ihr habt doch Kinder?
Nein, nicht Kinder! Bisher nur eines… ein Mädchen.
Dunkles Haar wie du nicht wahr?
Wieder nickte Malef zuerst nur und versuchte möglichst unbefangen und ein klein wenig überrascht dreinzuschauen bei so viel banaler Fragerei.
Doch im Inneren wuchsen Unsicherheit und Angst. Ein Attacke von Panik ergriff ihn: Wie Watte hinter der Stirn war es ihm. Einen Ausweg. Wo ist der Ausweg? Doch im nächsten Moment: Was will die mir denn? Gar nichts. Ihre Uhr ist doch abgelaufen. Und ihm fiel ein - blöder Vergleich - wie sie zum Kriegsende bis zuletzt Todesurteile verhängt und vollstreckt hatten. Ein Prinzip der Macht. Noch nach Zwölf so tun, als sei man noch in ihrem Besitz.
Wieder hörte er die Genossin Degenhardt mit ihrer etwas heiseren dunklen Stimme:
Weißt du, Franz, dass ich in diesem Jahr fünfunddreißig Jahre verheiratet bin. Eine lange, eine ewige Zeit fast. Was man da alles miteinander erlebt hat. Unvorstellbar. Und in meiner Generation, da gab es den Krieg und den Nachkrieg, und vorher der Widerstand. Das schweißt zusammen, wenn man das alles miteinander durchgemacht hat. Durch dick und dünn ist man gegangen, wie man so sagt, ha, ha. Da trennt man sich nicht und wenn es noch so stürmt…
Sie lachte ein kurzes, heißeres Lachen. Aber plötzlich verengten sich ihre Augen und sie presste heraus:
Aber wir sind immer anständig geblieben. Immer sauber. Wir können uns ansehen in jeder Lage. Jeder weiß vom anderen alles. Das Kleinste. Bis ins Kleinste, verstehst du? Und weil wir so waren, so sind, deshalb sind wir unangreifbar für den Gegner. Weißt du? Unangreifbar... und sie dehnte das Wort, sprach es dabei metallisch hart aus, kniff wieder die Augen zu und lehnte sich ruckartig zurück in ihren schwarzen, ledernen Drehsessel.
Das ist das Wichtigste für uns Parteiarbeiter. Du bist doch auch… sie brach ab.
Was nur will sie? Worauf läuft das hinaus? Malef konnte nicht mehr klar denken. Es krampfte hinter der Stirn: Nichts sagen, nichts verraten. Normalität vorspielen. Bleib ruhig, Franz, ganz ruhig. Sie muss ja heraus mit der Sprache…
Und weiter redete die Genossin Gnadenlos:
Es kommt ja immer mal was vor. Wir haben alle unseren inneren Schweinehund. Und vom Wege kann man schon abkommen, wenn man nur wieder draufkommt. Das ist es.... Man darf nicht vom Wege abkommen. Man kann doch nicht einfach wegschmeißen, was einem viele Jahre, ja ein ganzes Leben teuer gewesen ist. So ein Lump kann man doch nicht sein. Aber… natürlich, es gibt solche Lumpen. Und jetzt, wo es schwierig ist, wo unsere Partei in einer echten Bewährungsprobe steckt, müssen wir erst recht zusammenhalten. Jetzt zeigt sich, wer Charakter hat und wer nur ein Konjunkturritter gewesen ist. Weißt du, im Sonnenschein zu lachen ist leicht, man muss aber auch bei Sturm und Regen lachen können.
Du weißt, Franz, warum ich dich habe rufen lassen?
Ich kann es mir denken.
Dann ist es ja gut. Weil wir da diese Sache klären müssen, die von großer Wichtigkeit ist. Für dich, für deine Frau, für deine Familie... und für uns, die Partei. Nun liegt uns dein Abberufungsantrag vor. Hier hab ich ihn… und sie hielt meinen Brief hoch.
Ich weiß. Malef nickte brav wie in der Schule.
Wir sind zwar hier im Hause der Partei und die Kirche, na ja, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Also die Kirche; das heißt, in der Bibel steht: Wenn der Prophet nicht zum Berge kommt, dann muss der Berg zum Propheten kommen! Ja, ich bin bibelfest. Ha, ha, ha... will sagen, warum hast du denn nicht früher schon den Weg zu uns gefunden? Wir hätten doch reden können, wenn dir was nicht passt, so von Genosse zu Genosse. Wir wollen dir helfen. Auch jetzt noch wollen wir das. Ich kann nämlich einfach nicht glauben, dass du uns wirklich verlassen willst. Gerade du… aber sie ließ offen, warum gerade Franz Malef etwas Besonderes wäre. Wirklich und wahrhaftig helfen wollen wir dir. Glaubst du das?
Nein, nicht mehr. Dazu ist es zu spät. Und, wobei wollt ihr mir helfen? Rettet euch lieber selber. Jeder muss jetzt an sich selber denken, an seine Familie, an seine Zukunft. Nein, Isolde, schau aus dem Fenster, geh auf die Straße, schalt den Fernseher ein. Die Grenzen sind offen. Bald werdet ihr kein Volk mehr haben. Es ist euch davongelaufen. Es ist aus, Isolde!
Die Genossin Gnadenlos war aus ihrem Drehsessel aufgesprungen und fing jetzt an zwischen der nussbaumfarbenen Büroschrankwand und ihrem Schreibtisch hin und her zu laufen. Sie trat ungleichmäßig auf, schonte ihr krankes Hüftgelenk. Die Vasen und Nippes, alles Ehrengeschenke irgendwelcher Parteiorganisationen, Betriebe, Bürgermeister und von wer weiß wem, klirrten leise dazu.
Ungewohnt laut rief sie, geradewegs auf ihr Möbel zuhinkend, den Kopf mir abgewandt, so dass ich ihre Stimme wie aus der Wand kommend vernahm:
Soweit ist es also schon! Der Genosse Malef spricht von „ihr“, wenn er seine Genossen meint, das „wir“ hat er vergessen, und wie von einer Feder angetrieben, stand sie plötzlich vor meinem Stuhl und sah mir forschend ins Gesicht:
Ein Wandler zwischen den Welten. Ein Wendehals womöglich. Zur SED zu gehören, zu diesem Staat zu gehören bringt ja jetzt keine Vorteile mehr. Einen alten Lappen kann man ablegen. Er gehört in die Lumpensammlung. Oh, Franz, eine Kanaille bist du geworden. Weißt du, als ich vorhin deinen Brief las, da wollte ich es nicht glauben, da wollte ich mir nicht vorstellen, dass unser Genosse Franz Malef einfach so von Bord gehen will, einer, der… und wieder ließ sie offen, was an mir so lobenswert gewesen wäre. Gerade jetzt, seufzte sie, wo wir einen wie dich dringend brauchen, wo es um neuen Elan geht. Wir weichen doch nicht zurück, nein, wir weichen nicht… noch nicht.
Isolde Degenhardt war zu ihrem Schreibtisch zurückgehumpelt, sie stützte sich mit beiden fleischigen Fäusten auf die Schreibtischkante. Das Ganze nahm sie offenbar mehr mit, als sie selber gedacht hatte. Sie atmete hörbar aus, schniefte dabei, hielt den Kopf ein wenig schief und blickte Malef aus ihren wässrigen Äugelein fast mütterlich an. An dem Kettchen vor ihrer Brust pendelte die Lesebrille. Dann hinkte sie die drei Schritte zu ihrem Drehsessel zurück und warf sich mit der ganzen Last ihres rundlichen Altweiberkörpers hinein. Ein Ächzen und Fiepen war zu hören. Sie brauchte eine ganze Weile, ehe sie ihren Gast fragte:
Und dein Entschluss ist unwiderruflich? Da ist nichts mehr zurückzunehmen? Und seit wann…? Seit wann bist du dahintergekommen, nicht mehr zu uns zu gehören? Jetzt erst… nach dieser Konterrevolution oder…?
Sie schien keine Antwort zu erwarten, beugte sie sich zu Malef vor, hob die Hand an die Wange, so als ob sie flüstern wollte und sagte tatsächlich mit verhaltener Stimme:
Natürlich sprechen wir hier vertraulich. Ich bin ja schon von Amtswegen dazu verpflichtet. Ich könnte Deinen Brief…? und sie versuchte ein Lächeln, hob den Brief hoch und deutete an, ihn zu zerreißen.
Malef machte ein abwehrendes Gesicht. Zugesperrt. Er schwieg, die Hände vor der Brust gekreuzt, schob die halbvolle Kaffeetasse von sich weg.
Ein Schweigen entstand. Es dauerte ein paar Minuten. Schließlich wandelte sich das Gesicht der Genossin Degenhardt von einem mütterlichen, vertraulichen in ein dienstlich strenges Gesicht und sie sagte:
Du verstehst, dass wir über deine Abberufung hier im Hause, im Sekretariat, noch beraten müssen. Immerhin bist du stellvertretender Abteilungsleiter, … gewesen, hast Zugang und Kenntnis interner Vorgänge gehabt. Du bist sozusagen Geheimnisträger gewesen. Ob du dann zu dieser Sekretariatssitzung geladen wirst, wo über Deinen Antrag entschieden wird, werden wir dir noch mitteilen. So lange bleibst du aber noch berufener Mitarbeiter. Und erhältst selbstverständlich deine Bezüge…
Ach so… sie unterbrach sich. Über deine Ansprüche zur Altersversorgung unserer Partei wird gesondert entschieden. Aber… wieder machte sie eine Pause, aber du bist ja krankgeschrieben. Wie lange wird die Krankschreibung noch andauern? Ist da schon Krankengeld geflossen oder bekommst du noch Geld von uns? Und… sie hob ihre Brille an die Augen und starrte ihr Gegenüber an: Du bleibst aber doch noch Mitglied unserer Partei? Du willst doch nicht auch noch…?
Malef zuckte zusammen. Diese Frage hatte er befürchtet, er hatte sie umgehen wollen, deshalb schwieg er jetzt und senkte die Augen.
Aber die Degenhardt ließ nicht locker: Wirst du Mitglied unserer Partei bleiben, Franz? Sprich ehrlich.
Nein!Das Wort schoss aus seinem Mund wie eine Kanonenkugel.
Jetzt war die Alte zusammengezuckt, sie krümmte sich wie unter einem Peitschenschlag.
Sie stöhnte, flüsterte: Oh, was einem in diesen Zeiten alles zugemutet wird. Dann laut und ein bisschen wütend: Na dann, Franz, oder es wäre ja jetzt besser, Herr Malef zu sagen, dann erübrigt sich ja jedes weitere Wort… schade, sehr schade… und leiser fügte sie hinzu:
Für mich ist das Verrat.
Sie machte eine kleine Pause, notierte irgendetwas und fuhr fort:
Was nun deine Ehe angeht, da musst du vollkommene Klarheit schaffen. Du hast noch nicht mit deiner Frau gesprochen? Ich meine über deinen... Antrag und den Austritt. Sie ist doch, wie ich mich erinnere, auch Mitglied unserer Partei.
Malef wollte sich empören. Was ging die Alte denn seine Ehe an? Was mischt sie sich in Privates? Eine Frechheit! Aber er sagte nichts, er schwieg, hielt den Kopf weiter gesenkt. Hat ja doch keinen Zweck… wozu jetzt noch Streit. Wenn er der Alten jetzt noch sagen würde, dass seine Frau alles wüsste, ja, dass sie sogar cder treibende Keil wäre… dann, oh dann bekäme die Genossin Gnadenlos noch einren Herzanfall.
Gut. Leb wohl! Alles Gute, Franz. Und: „Trotz alledem!“, wie unser Karl Liebknecht gesagt hat…
Isolde Degenhardt rutschte auf ihrem Sessel nach vorn, sie blieb aber sitzen und streckte Malef die Hand über die Schreibplatte, über all ihre Akten, über die aufgeschlagene Zeitung entgegen. Noch einmal sah sie ihn prüfend an.
Adieu!
Auf Wiedersehen!
Draußen im Vorzimmer gab Malef der Ursel die Hand.
Mach´s gut. Sie lächelt verlegen.
Malef, während er zur Tür ging, überlegte: Wahrscheinlich hat sie über die Mithörtaste ihres Telefons alles abgelauscht. Das hat sie doch sonst auch immer gemacht. Bei jedem beschissenen Parteiverfahren. Ach was, egal…
Ja, mach´s gut.