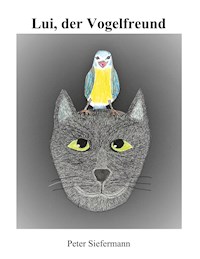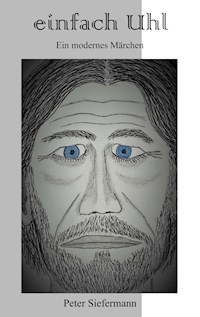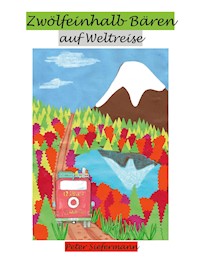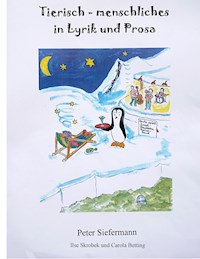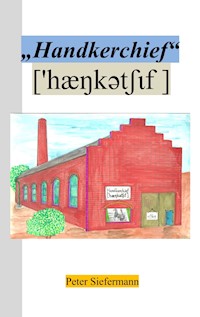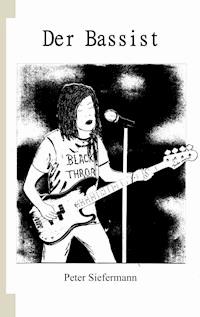Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kurzgeschichten und Gedichte, nicht alle ganz wahr, und doch zum Teil mit einem wahren Hintergrund, aus dem total unaufgeregten Leben des Autors und seiner Frau. Augenzwinkern ist nicht nur durchaus erlaubt, sondern unbedingt auch gern gesehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzgeschichten und Gedichte, nicht alle ganz wahr, und doch zum Teil mit einem wahren Hintergrund, aus dem total unaufgeregten Leben des Autors und seiner Frau. Augenzwinkern ist nicht nur durchaus erlaubt, sondern auch unbedingt gern gesehen.
Für meine Ilse
Inhaltsverzeichnis
D-Zug
Ne me quitte pas - (Verlass´ mich nicht)
Die Libelle
Fehlkonstruktion
Der Schorf
Digitaler Schock
Bicycle-Union
Der Prephot
Latein
Fischstäbchen
Der Pholisiph
Horatius´ Schatten
Zahlen
Der Alafent
Ich, autonom?
Stadtflucht
Herbststimmungen
Avalon
Die Fensterputzerin
Die Sachenfinderin
D-Zug
Mitte der Siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts arbeitete ich beruflich als Zugbegleiter bei der Deutschen Bahn. Genauer gesagt war ich Zugführer, doch ich wurde damals auch häufig als Zugschaffner zur Fahrausweiskontrolle eingesetzt. Ich war noch jung, Anfang bis Mitte zwanzig, und weil ich noch nicht sehr lange bei der Bahn beschäftigt war und zudem eine Probezeit zu absolvieren hatte, gab ich mir Mühe, meine Aufgaben zu aller Zufriedenheit zu erledigen.
Das war nicht immer einfach und nur allmählich lernte ich, mit den besonderen Verhältnissen bei der Bahn zurechtzukommen, denen man am ehesten im direkten Kontakt mit den Kunden, aber auch mit den eigenen Kollegen begegnete.
Es gab damals ein striktes Zwei-Klassen-System. Es verkehrten Züge erster Klasse und Züge zweiter Klasse, und es gab Kunden erster Klasse und zweiter Klasse, aber auch Personal erster Klasse und zweiter Klasse. Dazwischen war Niemandsland. Ich mag mich noch an die ersten IC-Züge erinnern. Das waren Zugeinheiten bestehend aus lediglich drei oder vier Sitzwagen erster Klasse und einem Speisewagen, alle mit Magnetbremsen ausgerüstet. Gezogen wurden diese Züge von den tollen Loks der Baureihe 103, zugkräftige und schnelle Sprinter für die damalige Zeit, aber einhundertsechzehn Tonnen schwer. Die Lokführer dieser Züge hielten sich für eine elitäre Gemeinschaft, einen Klüngel, in den Außenstehende keinen Einblick und Zutritt fanden. Entweder sie waren so hochnäsig, dass sie einen Tagesgruß zu entbieten für unter ihrer Würde hielten, oder sie waren so übertrieben heuchlerisch jovial, dass man den Unterschied zwischen „Ihr-da-unten zu Wir-da-oben“ mit Löffeln essen konnte.
Das gleiche galt für die Zugführer der IC-Züge. Die Bahn-Insider kennen natürlich den Unterschied zwischen Lok- und Zugführer. Kurz gesagt, hat, im Gegensatz zum Lokführer, der Zugführer wenig mit der Lokomotive zu tun. Der Zugführer ist Chef und Verantwortlicher für den ganzen Zug. Ihm untersteht, außer dem Lokführer, das übrige Zugpersonal, wie zum Beispiel die Schaffner, und er ist für den reibungslosen und sicheren Ablauf der Zugfahrt und für die Fahrkartenkontrollen im Zug zuständig. Die Zugführer der IC-Züge verhielten sich dermaßen abgehoben, dass sie selbst mit dem Lokführer nur schriftlich verkehrten, und zwar in Form des sogenannten Bremszettels, den für den Lokführer zu erstellen eine Pflichtaufgabe für den Zugführer darstellte, und wenn es nicht Pflicht gewesen wäre, hätten sie selbst diese Kommunikation unterlassen. Die Zugführer redeten kaum mit den ihnen unterstellten Zugschaffnern. Einige verwendeten eine Art Zeichensprache, mittels derer sie die Schaffner an ihre Aufgaben scheuchten, andere ließen sich in ihrem Abteil, das als Büro diente, wie Könige von Bittstellern hofieren. Mit Zugführern niederklassigerer Züge wurde aus Prinzip nicht geredet. Man würdigte sie keines Blickes. Wir nannten diese IC-Züge im Jargon „Bonzenschleudern“.
Ehefrauen von Lokführern und Zugführern ließen sich gerne mit Frau Lokführer oder Frau Zugführer ansprechen. Man erzählte sich im Kollegenkreis von Zickenkriegen zwischen Frau Lokführer und Frau Zugführer, weil die eine vor der anderen behauptete, ihr Mann sei jeweils dem anderen gegenüber höhergestellt. Wie borniert war das denn?
Es kam einem Sakrileg gleich, als die Deutsche Bahn dazu überging, die reinen Erste-Klasse-Züge als klassengemischte Züge zu betreiben:
Die erste Klasse an der Zugspitze, dann folgte der Speisewagen als Klassentrenner, danach kamen die Wagen der zweiten Klasse. Lok- und Zugführer wurden praktisch degradiert. Aber auch die Kundschaft fühlte sich betroffen. War man zu den vorherigen Zeiten in den Erste-Klasse-Zügen eine arrogante Gemeinschaft für sich, als Gleiche unter Gleichen, fürchtete man nun, man könnte sich im Speisewagen auf unangenehme Weise mit dem Pöbel der zweiten Klasse vermischen. Huch, wie ekelhaft.
Es war dem Zugpersonal der zweiten Klasse zuzuschreiben, dass alle Versuche, das Ansehen der Deutschen Bahn auf das Niveau der Deutschen Lufthansa zu heben, scheitern mussten. Irgendwie hatte man bei der Lufthansa das Gefühl, dass sie gediegener war. Wer sich den Ambitionen verschrieb, wie ein Vogel durch die Luft zu fliegen, musste bestimmte Fähigkeiten besitzen, das auch zu können. Ein menschlicher Fehler, ein menschliches Versagen musste drastische Folgen nach sich ziehen, weswegen man an das Personal höhere Ansprüche stellte, als das bei der erdgebundenen Bahn der Fall war. Man fischte von Seiten der Bahn das in der Masse arbeitende Personal mehr oder weniger von der Straße. Besondere schulische Qualitäten oder Qualifikationen wurden nicht verlangt. Die Bahn war Rettungsanker und letzter Ausweg auf ein geregeltes Einkommen für manche anderweitig gescheiterte Existenz. Man steckte sie in eine Uniform, jagte sie durch einen kurzen betrieblichen und tariflichen Lehrgang, und ließ sie dann auf die Kunden los, ob sie nun soziale Mindestumgangsformen beherrschten oder nicht. So auch geschehen mit mir selbst. Im ersten Anlauf zu einem Beruf aus persönlicher Fehleinschätzung grandios gescheitert, und nach einem knochenharten Notjob als Hilfskraft im Hausbaugeschäft, landete ich gerade noch als Zugführer für die zweite Klasse bei der Deutschen Bahn, und, wie gesagt, um nicht wieder zu scheitern, gab ich mir reichlich Mühe.
Was ich hasste, waren die Pendlerzüge am frühen Morgen und am Abend. Nahverkehrszüge, die an jeder Milchkanne Station machten und aus fünfzig bis sechzig Kilometer Entfernung Menschen aus den Dörfern morgens in die Stadt zur Arbeit und abends wieder nach Hause karrten. Menschen, die unausgeschlafen und mürrisch vor, und müde und mürrisch nach der Arbeit waren. Menschen, die jede Fahrausweiskontrolle als persönlichen Angriff auf ihre Freiheit betrachteten und zum Teil bösartig oder aggressiv reagierten. Menschen, die absichtlich beim Einsteigen in den letzten Wagen am Bahnsteig die letzte aller Wagentüren offenstehen ließen, wenn sie einen auf dem Kieker hatten und sich klammheimlich freuten, dass der doofe Schaffner sich gerade beim ersten Wagen befand. Menschen, die zur Winterzeit boshaft alle Fenster eines Großraumabteils öffneten, bevor sie den Wagen verließen, damit der Schaffner sich nur nicht langweilte.
Nach solchen Touren war ich regelmäßig geschafft, erledigt. Meine Füße waren geschwollen, die Schuhe muffelten feucht vom hineingetretenen Schweiß, der Rücken schmerzte, der Kopf war leer. Solche Züge nannten wir „Proletenbagger“.
Mitte der Siebziger gab es noch D-Züge.
Hauptsächlich waren das Fernverkehrszüge der zweiten Klasse, mit wenigen Erste-Klasse-Abteilen. Ellenlange Lindwürmer mit bis zu fünfzehn/sechzehn Wagen. Ganz besonders gefiel mir der D-Zug 376 Hispania-Express, der von Port Bou an der spanisch/französischen Grenze über Genf und Basel bis nach Hamburg-Altona fuhr. Ein Bild von einem Zug. Ich liebte es, im letzten Wagen zu stehen und aus dem geöffneten Fenster zu schauen und in einer Kurve die imposante Wagenreihe vor mir zu sehen. Wagen in den Farben gelb, rot, blau, grün, bunt gemischt. Damals konnte man die Zugfenster durch Ziehen nach unten noch öffnen. Wenn man als Schaffner in diesem Zug unterwegs war, hatte man am Feierabend bestimmt mehrere Kilometer Fußweg, oft im Laufschritt, zurückgelegt. Es gab noch weitere D-Züge dieser Art: Züge mit Kurswagen nach Moskau, Züge nach Amsterdam. Und dann gab es noch die D-Züge nach Italien. Nach Mailand, nach Florenz und Rom. In diesen D-Zügen fand man eine ganz andere Art von Kunden. Diese Kunden waren in der Regel Reisende. Menschen, die per Zug weite Strecken überwinden wollten. Man war teils gespannt, gelassen, voller Vorfreude, aufgeregt, vielleicht weil man in den Urlaub fuhr. Manchmal traf man traurige Menschen, die eventuell gerade hatten Abschied nehmen müssen und in Gedanken noch bei ihrer Familie zu Hause weilten. Es war eine angenehme Aufgabe für Schaffner, diese Menschen zu betreuen, manchmal sogar sie zu begleiten, wenigstens ein Stück ihres Weges.
Am stärksten in Erinnerung geblieben sind mir allerdings die Sonderzüge, und von denen wiederum die Sonderzüge nach Italien.
Es gab Züge, die speziell für italienische Bürger eingesetzt wurden, um in der Heimat ihre Stimme abgeben zu können. Wahl-Sonderzüge aus Deutschland nach Italien. Aber die meine ich nicht. Ich meine die Sonderzüge nach Italien, die vor Weihnachten für die Hinreise und nach Weihnachten für die Rückreise eingesetzt wurden. Züge bis nach Reggio di Calabria an der Stiefelspitze von Italien, von wo aus man leicht nach Sizilien kam. Züge für Menschen, die die Feiertage daheim bei ihren Familien verbringen wollten.
Die Bahnsteige in Frankfurt am Main zum Beispiel, oder auch in Dortmund, waren jeweils schwarz vor lauter Menschen, wenn der Sonderzug von einer Rangierlok in den Bahnhof geschoben wurde. Wenn der Zug zum Einsteigen bereit war, begann ein heftiges Treiben. Geriet man aus Versehen mitten in diesen Tumult, stand man jedem und allem im Weg, denn alle wollten und mussten mit jedem und allem in diesen Zug. Es ging zu wie in einem Ameisenhaufen. Frauen und ältere Kinder stürmten zuerst die Flure und Abteile, besetzten sie für jetzt und für alle Zeit, verteidigten die Plätze mit vielen Gesten und Geschrei. Männer stemmten von außen Babys durch die Fenster den Frauen entgegen, andere wuchteten Fernsehgeräte hoch, die ihnen von den Frauen abgenommen wurden. Koffer und Kartons folgten hinterher. Kühlschränke, Waschmaschinen und andere Geräte wanderten durch die Wagentüren in die Bereiche der Wagenübergänge vor den Zugtoiletten. Dann bestiegen zuletzt die Männer den Wagen, die Familien drängten sich an die Fenster um von denen Abschied zu nehmen, die hierbleiben mussten.
Eine Fahrkartenkontrolle in solchen Zügen war aussichtslos. Es gab einfach kein Durchkommen. Hatte man bei der Abfahrt des Zuges das Pech oder das Glück, nicht in der Nähe des Dienstabteiles zu sein, verblieb man meistenteils dort, wo man eingestiegen war. Möglich, dass man an einem der Unterwegsbahnhöfe den Wagen wechseln konnte. Man hatte immerhin für eine gewisse Sicherheit am Zug bei den Halten zu sorgen, wobei in solchen Fällen geschlossene Türen das wichtigste waren. Dann war man gezwungen, bis zum nächsten Halt zwischen Kühlschränken, Kartons, Koffern und enthusiastischen Menschen auszuharren, ohne die Chance auf das Dienstabteil in Erwägung ziehen zu brauchen.
Pech hatte man, wenn man sich selbst unnahbar verhielt, den Leuten die kalte Behördenschulter zeigte, sich über die empfundenen unhaltbaren Zustände mokierte und einem baldigen Feierabend entgegenhoffte. Die Reisenden hatten ein feines Gespür für derartige Überheblichkeiten.
Wogegen man Glück hatte, wenn einem nach überstandener Hektik mit einem breiten Lächeln, einem warmen italienischen Wort, plötzlich ein gebratenes Hähnchenbein offeriert wurde, dazu roter Wein in einem Plastikbecher, der beim ersten Schluck eine eindeutige Samtpantoffelspur den Hals hinunter hinterließ. Glück, wenn einem wildfremde Kinder am Hosenbein hingen und sie, mit dem Fahrkartenentwerter ausgestattet, alles bedruckten, das irgendwie zwischen die schmale Zange passte, manchmal auch die Fahrkarte der Familie. Ich gebe zu, dass ich mich in allen derartigen Zügen am liebsten fern des Dienstabteiles aufhielt.
Ja, die Stimmung in den Zügen nach Italien vor Weihnachten war stets euphorisch. Ganz anders als in den Zügen nach Weihnachten, wenn man sich auf der Rückreise von Italien befand.
Meistens hatten die Reisenden bereits einen ganzen Reisetag in den Knochen, beziehungsweise auf dem Sitzfleisch. Frühmorgens waren sie in Reggio di Calabria oder in Catania in Süditalien eingestiegen. Wir übernahmen die Züge in Basel meistens mitten in der Nacht, um sie dann durch Deutschland bis zu ihren Endzielen zu begleiten.
Die Züge waren nicht mehr so vollbeladen wie bei der Hinreise. Man konnte bequem durch die Flure und von einem Wagen zum anderen gehen. Auf eine Fahrkartenkontrolle verzichteten wir sowieso, denn in den Abteilen herrschte Ruhe. Alle waren müde. Eine Spur von Traurigkeit hing stets in der Luft, ein letzter Hauch von Abschied, der vor vielen Stunden stattgefunden hatte.
Auf den Fluren hielten sich oft die Männer der Familien auf, das Ende der Reise herbeisehnend, unrasiert, nach Nikotin riechend, und nach Grappa. Manche Abteiltür stand offen, nur die Vorhänge waren vorgezogen. Drinnen lagen die Familienmitglieder, rührend, auf den zusammengezogenen Sitzbänken. Es roch göttlich-köstlich nach Menschenschlaf, nach Familienbanden, nach bedingungslosem Vertrauen, nach Liebe, und ein bisschen nach Träumen. Dazwischen mochten sich Düfte mengen von Ziegenkäse, von Schinken und süßen italienischen Backwaren. Die Männer blickten freundlich, boten eine Zigarette an.
Es war sehr kalt in jenem Jahr nach Dreikönig. Auf den Schienen knackte der Frost. Das Wagenmaterial der Sonderzüge war nicht immer erste Wahl. Wir hatten es mit alten italienischen Schnellzugwagen zu tun.
Als ich auf meinem Durchgang in den Wagen kam, schlug mir die Kälte ins Gesicht. Hier funktionierte allem Anschein nach die Heizung nicht. An den Rahmen der Zugfenster hatte sich eine dicke Reifschicht gebildet. Es zog durch undichte Dichtungen. Vor den Mündern der Leute gefror der Hauch.
„Hallo Cheffe, Cheffe“, rief der erste der Männer, dem ich über den Weg lief. „Brrrrrr, kalt, kalt. Cheffe, mach´ Heizung an!“
An den Mittelkonsolen der Wagen befand sich eine Klappe, hinter der eine manuell zu bedienende Notfallpumpe für den Heizungskreislauf steckte. Mit einem angebrachten Hebel, den man aufschrauben musste, konnte man die Pumpe bewegen. Das Prinzip war das einer Schwengelpumpe. Ich montierte den Hebel also auf und bewegte die Pumpe auf und ab, auf und ab, unter strenger Beobachtung der interessierten Männer. Nun war es so, dass die Wagenheizungen der einzelnen Wagen nicht von der Lokomotive aus mit heißem Wasser oder Wasserdampf beschickt und gespeist wurden, sondern das Heißwasser wurde elektrisch in jedem Wagen produziert. Mein Bemühen an der Pumpe war demnach überflüssig, doch um meinen guten Willen zu zeigen, pumpte ich noch eine Minute weiter, bevor ich aufgab.
Ich radebrechte, dass das Problem nicht an der Pumpe liegen musste, sondern an der elektrischen Technik des Wagens. „Technik kaputt“, sagte ich. „Carozza italiana,“ und klopfte verstärkend mit der Hand gegen die Wagenwand.
Aber ich hatte die Rechnung ohne den cleveren Italiener gemacht. „Aber Cheffe“, sagte er listig, „Cheffe, isse deutser Strom.“
Alles blieb still. Jeder hielt den Atem an. Spannung lag in der Luft. Wäre sie auf den Boden gefallen, wäre sie in tausend Eisscherben zersprungen.
Dann kam er. Der erlösende Augenblick, an dem alle begannen schallend zu lachen.