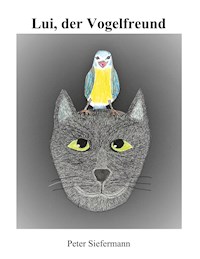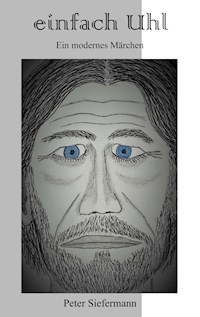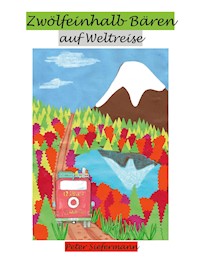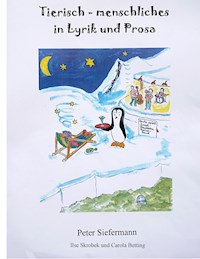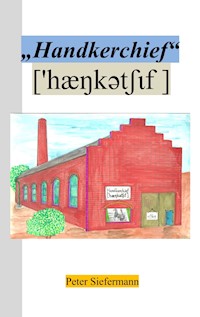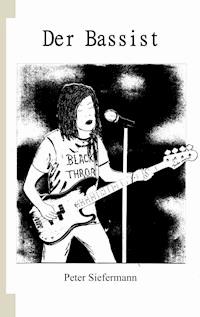Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Freunde, beheimatet in der deutsch-schweizerischen Grenzregion um Basel, die sich dem Mississippi-Blues verbunden fühlen, müssen ihrem Wunsch, an die Wiege des Blues in die USA zu reisen, wegen Flugangst eines Mitglieds des Trios eine Absage erteilen. Alternativ entschließen sie sich, statt dessen mit dem Auto an den naturbelassenen Fluss Saône in Ostfrankreich zu fahren und dort mit einem Hausboot den Fluss hinunter zu schippern. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten beim Umgang mit dem ungewohnten Vehikel, verlieren sie ihren Spaß keineswegs und erfahren bereits in der ersten Woche auf dem Wasser ihr persönliches Blues-Feeling. Von der Reise angetan, buchen sie für das Jahr darauf eine weitere, zweiwöchige Hausboot-Tour auf der Saône und lassen sich neu von dem speziellen Flair des Flussreviers einnehmen. So unterschiedlich die drei Männer charakterlich sein mögen, so finden sie stets in ihrer Art, den Blues zu spielen, einen gemeinsamen Nenner, auch dann, als eine zweifelhafte Befreiungsaktion einer französischen Stopf-Gans die Freundschaft auf eine unerwartete Probe stellt. Doch zum Schluss: Ente, beziehungsweise Gans gut, alles gut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Drei Freunde, beheimatet in der deutsch-schweizerischen Grenzregion um Basel, die sich dem Mississippi-Blues verbunden fühlen, müssen ihrem Wunsch, an die Wiege des Blues in die USA zu reisen, wegen Flugangst eines Mitglieds des Trios eine Absage erteilen. Alternativ entschließen sie sich, stattdessen mit dem Auto an den naturbelassenen Fluss Saône in Ostfrankreich zu fahren und dort mit einem Hausboot den Fluss hinunterzuschippern. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten beim Umgang mit dem ungewohnten Vehikel, verlieren sie ihren Spaß keineswegs und erfahren bereits in der ersten Woche auf dem Wasser ihr persönliches Blues-Feeling. Von der Reise angetan, buchen sie für das Jahr darauf eine weitere, zweiwöchige Hausboot-Tour auf der Saône und lassen sich erneut von dem speziellen Flair des Flussreviers einnehmen. So unterschiedlich die drei Männer charakterlich sein mögen, so finden sie stets in ihrer Art, den Blues zu spielen, einen gemeinsamen Nenner, auch dann, als eine zweifelhafte Befreiungsaktion einer französischen Stopf-Gans die Freundschaft auf eine unerwartete Probe stellt. Doch zum Schluss: Ente, beziehungsweise Gans gut, alles gut.
Für Ilse
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2: Saône
Freitag, 13. September 2002
Samstag, 14. September 2002
Sonntag, 15. September 2002
Montag, 16. September 2002
Dienstag, 17. September 2002
Mittwoch, 18. September 2002
Donnerstag, 19. September 2002
Freitag, 20 September 2002
Dienstag, 29. Oktober 2002
Kapitel 3
Kapitel 4: Saône 2003
16.05.2003, Freitag
17.05.2003, Samstag,
18.05.2003, Sonntag
19.05.2003, Montag
20.05.2003, Dienstag
21.05.2003, Mittwoch
22.05.2003, Donnerstag
23.05.2003, Freitag
24.05.2003, Samstag
25.05.2003, Sonntag
26.05.2003, Montag
27.05.2003, Dienstag
28.05.2003, Mittwoch
29.05.2003, Donnerstag
30.05.2003, Freitag
Nachbetrachtet
Kapitel 5
Kapitel 1
Weil am Rhein, Mai 2002
Renatostüble, 22.00 Uhr
Das „Renatostüble“ war mal wieder proppenvoll, wie immer an jedem zweiten Mittwochabend, aber unsere Plätze im Aquarium waren reserviert. Auch wie immer. Es hatte schon Tradition, dass wir dort saßen.
Die Sitzplätze wurden deswegen im Aquarium genannt, weil sie in einer Ecke des Restaurants lagen und man von außen von zwei Seiten her durch raumhohe Fenster nach innen schauen konnte. Natürlich konnte man von innen genauso gut nach draußen sehen. Von der Decke wucherten Grünlilien und an den Fenstern standen Farne auf steinernen Säulen, was diesem Teil des Raumes mit etwas Fantasie einen leicht tropischen Eindruck verlieh. Es gab nur einen Tisch in dieser Ecke, etwas abseits von den anderen Tischen im Lokal, weswegen die Plätze eigentlich ziemlich begehrt waren. Aber jeden zweiten Mittwochabend, wie gesagt, gehörten sie uns. Es war eine stillschweigende Übereinkunft zwischen Renato, dem Wirt, seines Zeichens Italiener, und uns, von der sowohl er als auch wir profitierten.
Zum Lokal „Renatostüble“ gehörte ein kleines Nebenzimmer, das aber nur zu besonderen Anlässen bewirtet wurde. Ansonsten waren Tische und Stühle auf die Seite geräumt. Seit etwa eineinhalb Jahren trafen wir uns dort regelmäßig alle vierzehn Tage mittwochabends zum Spielen; besser gesagt zum Proben. Wir, das sind Herbert, Gerd und ich, genannt Pit.
Wir spielten seit drei Jahren zusammen. Anfangs allerdings nur gelegentlich in Gerds Wohnung in Weil am Rhein, was aber von den meisten Bewohnern seines Hauses nicht gut geheißen wurde. Gerd musste als Vermieter Rücksicht nehmen, hatte er immerhin sieben Mietparteien unter Vertrag. So war er es dann folgerichtig auch, der mit dem Wirt des „Renatostüble“ übereingekommen war.
Es war der „Blues“, der uns zusammengeführt hatte. Unkomplizierte, erdige Musik, mit der man zur Not auch als Solist ganz gut zurechtkommen konnte. Musik, die nicht wir, sondern die uns gefunden hatte und die im Laufe der Zeit eine immer passendere Rolle für unsere persönlichen Situationen einnehmen sollte. Musik, die von Dramen und von Traurigkeit handelte, die vor Melancholie nur so triefte. Die von verlorener Liebe erzählte, von sklavischer Arbeit, von Trostlosigkeit, Whiskey und Bier, aber auch von Trotz und Aufbegehren. Wir wählten hauptsächlich Songs aus, die unserer Instrumentierung entgegenkamen, als wir auf zwei Gitarren (Holz-Resonator-Gitarre von Gerd, akustische Konzertgitarre von Pit), sowie Blues-Harp (Mundharmonika), Snare-Drum und Querflöte von Herbert zurückgreifen konnten. Songs von Muddy Waters, Charley Patton, Bukka White und John Lee Hooker, um die wichtigsten Interpreten zu nennen. Gerds Vater, der nach seinem abgeschlossenen Studium viele Jahre in den USA lebte, hatte von dort eine ansehnliche Sammlung alter Tonträger mitgebracht, die in Deutschland Raritätenstatus besaß. Für uns eine wahre Schatzgrube. Wir interpretierten die entdeckten Songs auf unsere Art und Weise, und Herbert schnodderte mit seiner großartigen Rumpelstimme die Texte hinzu. Bald schrieben wir im Stile des „Delta Blues“ eigene Stücke, die beinahe authentisch klangen. Es hatte sich mit der Zeit so eingespielt, dass wir nur noch zu Beginn unserer Proben einen oder zwei der Klassiker anstimmten, quasi als Huldigung an die alten Meister, den Rest der Abende aber aus unseren eigenen Kompositionen gestalteten. Den Schluss bildete aber stets eine Nummer der Rolling Stones, um Gerds Slide Guitar zu hören. Wir erweiterten unser Repertoire jedoch spaßeshalber um entsprechende Country- oder Rock-Titel.
Nach einigen Wochen Probe im Nebenzimmer des „Renatostüble“ stellte sich heraus, dass das Lokal an unseren Probeabenden immer besser besucht war als an anderen Tagen. Renato nun wäre ein schlechter Geschäftsmann gewesen, wenn er den Grund dieses Gästezulaufs erstens nicht erkannt, und zweitens nicht zu nutzen gewusst hätte. Er bot uns folgenden Deal an: Ihr kriegt die Getränke (in der Regel Bier) den ganzen Abend gratis, dazu ab zehn Uhr den Tisch im Aquarium, und er darf im Gegenzug die Tür zum Nebenzimmer offenstehen lassen.
„Dann können wir ja gleich im Lokal spielen“, hatte Gerd gemeint.
„Eben nicht“, lächelte Renato. „Wenn ihr im Lokal spielen würdet, müsste ich als Veranstalter eines öffentlichen Konzerts GEMA-Gebühren abführen und die Liste der Musiktitel angeben. Capito? Nein, bleibt ihr mal schön im Nebenzimmer, und ich lasse aus Versehen die Tür offen stehen. Die Gäste hören euch auch so bestens. Basta.“
Dabei ließen wir es bewenden. Wir bekamen unser Gratisbier und Renato seine volle Hütte. Er und seine Bedienung wussten mittlerweile, dass wir mit dem Titel Sister Morphine von den Rolling Stones jeweils unser Programm beendeten. Dann war es in der Regel zweiundzwanzig Uhr, für Renato das Zeichen, drei Biere auf den Tisch im Aquarium zu stellen. Wie gesagt: Wir profitierten alle.
Herbert und ich wohnten und arbeiteten in Basel in der Schweiz, keine fünf Kilometer von Weil am Rhein entfernt. Ich stand gerade ein Jahr vor dem fünfzigsten Geburtstag und Herbert war ungefähr gleich alt. Was sind schon ein paar Tage mehr oder weniger.
Herbert leitete die Küche in einem Alters- und Pflegeheim in der Basler Innenstadt, war verantwortlicher Chefkoch und hatte, seinen Worten nach, seinen Traumjob gefunden. Nicht damit einverstanden war hingegen seine Lebensgefährtin Pia, mit der er eine Tochter hatte, Noemi, gerade fünfzehn Jahre alt geworden.
Wichtig für Herbert war, mit seiner Arbeit anderen Menschen helfen zu können. Er hatte den Ehrgeiz, mit seiner Kochkunst seinen Gästen, wie er die alten und behinderten Menschen nannte, etwas besonders Gutes, etwas Gesundes, etwas Schmackhaftes auf den Teller zu bringen, und die mannigfaltigen begeisterten Rückmeldungen von Seiten der Gäste gaben ihm Recht. Er liebte seinen Job, auch wenn er von der Bezahlung her nicht gerade der Ausreißer nach oben war und er wegen des vielen Stehens unter Rücken- und Gelenkschmerzen litt.
Pia wollte mehr. Sie sah in ihm den Sternekoch par excellence und versuchte, anfänglich noch mit sanftem Druck, später auch mit systematischer Erpressung, ihn in die Selbstständigkeit zu drängen. Sie wollte ein eigenes Restaurant mit gediegenem Ambiente, und sah sich selbst als Souschefin repräsentativ das Regiment über Personal und Restaurant führen.
Es war zum unausweichlichen Eklat gekommen. Pia hatte Herbert praktisch ein Ultimatum gestellt. Entweder kündige er seine Stelle im Alters- und Pflegeheim, oder er könne ausziehen. Selbstverständlich würde sie, Pia, mit Noemi in der bisherigen Wohnung verbleiben.
Herbert war vor vier Wochen ausgezogen und hatte sich eine wirklich kleine Ein-Zimmer-Wohnung in Basel genommen. Er war ziemlich am Boden zerstört, denn Noemi war sein Augenstern, sein Ein und Alles.
Kein Riese von Statur, war Herbert mit ein Meter dreiundachtzig doch vier Zentimeter größer als ich. Er ähnelte im Aussehen dem deutschen Schauspieler Charly Hübner, brachte aber sicher einige Kilos mehr auf die Waage. Aber er wirkte keinesfalls plump. Zudem hatte Herbert das Gemüt eines Teddybären und strahlte eine unerschütterliche Ruhe aus, was nicht bedeutete, dass er unangreifbar war.
Gerd war mit sechsundvierzig Jahren der Jüngste von uns dreien. Er wohnte mit seiner Mutter im eigenen Mehrparteienhaus in Weil am Rhein. In früheren Jahren hatte er als Repräsentant einer global agierenden Kosmetikfirma praktisch die ganze Welt bereist. Er sprach fließend Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Nach dem Tod seines Vaters kehrte er nach Hause zurück und unterstützte die Mutter bei der Verwaltung des Hauses, wobei er zugab, dass seine Mama auch gut ohne ihn zurechtkommen würde. Er hatte jedoch einfach ein besseres Gefühl, für die Mutter ständig verfügbar zu sein und organisierte stets, für die Zeiten, an welchen er selber längere Zeit nicht zugegen sein konnte, seinen Bruder aus Wiesbaden als Vertretung. Das funktionierte zu seiner vollsten Zufriedenheit.
Gerd war eine Nachteule. Viel seiner Zeit verbrachte er abends und nachts in Bars und Kneipen, um morgens und mittags ausgiebig zu schlafen. Traf man ihn tagsüber nicht zu Hause an und war er nicht gerade als Natur- und Tierschützer unterwegs, hielt er sich in der Regel im Wochenendhaus der Familie außerhalb von Todtmoos im Schwarzwald auf.
Er war nie fest mit einer Partnerin liiert gewesen und ging auch nur sporadisch lockere Verbindungen mit dem weiblichen Geschlecht ein, was ihn nicht daran hinderte, fleißig und häufig zu flirten. Der Ausdruck Womanizer traf jedoch nicht auf ihn zu, denn dafür war er viel zu sehr ein Gentleman. Er war eine richtige Charmeschleuder, schaute unter seiner bolzengeraden Karottenfrisur stets vergnügt aus den kleinen Knopfaugen, und für mich war er das ungewürdigte Vorbild für Smiley Grinsgesicht. Darüber hinaus war er der hilfreichste Mensch der Welt.
Was ihn ferner auszeichnete, war sein Einsatz gegen das Unrecht an Tieren, im Besonderen für die gefiederten Arten, was sich unter anderem darin ausdrückte, dass er als führendes Mitglied der kleinen Naturschutzorganisation „Weiße Feder“ des Bereichs Markgräfler Land fungierte. Seiner Meinung nach vertrug sich sein Engagement hierfür ausgezeichnet mit seinem Hobby, dem Angeln, wobei sich mir persönlich die angeblich dahintersteckende Logik entzog. Für mich bedeutete Tierschutz, dass man die Tiere am Leben ließ anstatt sie zu töten. Gerd konterte in aufkommenden Diskussionen zu diesem Thema stets mit: „Aber du isst gerne Fisch und Fleisch. Also erzähl mir keine Stories von Logik.“ Ende der Debatte.
„Weiße Feder“ hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Kampagnen gegen Massentierhaltungen von Hühnern, Truthähnen, Enten und Gänsen zu lancieren und, gemeinsam mit der französischen Schwesterorganisation „Plume Blanche“, das gewaltsame Stopfen von Gänsen zur Herstellung von Gänseleberpastete, der „Foie Gras“, anzuprangern. Die Verbreitung von heimlich aufgenommen Filmen im Internet über die Käfig- und Batteriehaltung von Geflügel und von der Praxis des Gänsestopfens war eine der schärfsten Waffen. Aber auch gezielte Plakataktionen unter namentlicher Nennung von Produzenten und Verbrauchern gehörten dazu. Gegen beide Tierschutz-Gruppierungen waren aktuell Unterlassungsklagen vor Gericht anhängig, angestrengt von den Gänsestopfleber herstellenden Betrieben und den Restaurants, die diese sogenannten „Spezialitäten“ auf ihrer Speisekarte anboten, und zwar zu beiden Seiten des Rheins. Gerd indes schreckte dies nicht, im Gegenteil, betrachtete er die Gerichtsverfahren doch als die perfekte Bühne für ihre Anliegen. „Bessere Werbung können wir nicht kriegen“, sagte er. Und: „Wir haben unser Pulver noch lange nicht verschossen“, und konnte dabei hintergründig lächeln.
Ich arbeitete seit fünfundzwanzig Jahren als Zolldeklarant bei einer der großen Basler Speditionsfirmen. Der geographischen Lage und der politischen Situation der Schweiz war es gedankt, dass mein Beruf einer der krisensichersten im Lande war. Die Schweiz war eine Insel im weiten EU-Raum, und alle Waren, ob ein- oder ausgeführt, mussten an der Grenze deklariert werden. Die schweizerische Bevölkerung lehnte regelmäßig, gottseidank, kategorisch einen EU-Beitritt ab.
Was Herbert gerade an privater Tragödie bevorzustehen drohte, hatte ich im Groben und Ganzen hinter mir.
Vor ungefähr einem halben Jahr ging eine langjährige Partnerschaft mit einer ehemaligen Kollegin in die Brüche, und noch immer verbrachte ich viel Zeit mit Anstrengungen, verloren gegangene Kraft und Energie wieder zu gewinnen, Wunden zu lecken und Vertrauen wieder herzustellen, besonders zu mir und meinem Urteilsvermögen selbst. Schluss zu machen war die Konsequenz aus einer sich abzuzeichnen beginnenden Schieflage von Werten. Schleichend erst, dann konkreter werdend, nahm das „Wie viel“ zunehmend den Platz ein, den die Gleichberechtigung vorher innehatte. Reziproke Zweifel an der Aufrichtigkeit ergaben keine lösenden Gespräche mehr, sondern gebaren nur neue Vorwürfe. Vorwürfe, die in der gegenseitigen Erkenntnis gipfelten, dass der jeweils andere in Wirklichkeit gar nicht der war, von dem man so lange ausgegangen war, er sei es. Verschenkte Jahre, betrogene Jahre im Prinzip. Fehlinvestiert, um es nüchtern auszudrücken, obwohl das viel zu monetär und zu technisch klingt.
Aber war da auch nicht mal etwas gut gewesen? Konnte man sich so getäuscht haben?
Nein, war es nicht; und ja, man konnte.
Es war eine vorhersehbare Entwicklung mit den üblichen, nicht mal besonders kryptischen Warnsignalen gewesen, die ich geflissentlich zu überhören und zu übersehen pflegte, als ich das Streichholz bereits in den Fingern hielt, scheinbar unaufhaltsam in seinem Vorwärtsdrang. Aber es gehörte zum Drehbuch, zu reizen, wie weit ich gehen konnte, bis ich mir die Finger verbrenne. Unversehens stand das Herz in Flammen, und geblendet vom gleißenden Feuer, einhergehend mit der Ignoranz gegenüber allen Gefahrenhinweisen und Warnungen und jeden besseren Wissens, gab ich immer noch reichlich Öl hinzu. Es dauerte seine Zeit, aber alles folgte einer unabwendbaren, stringenten Logik, wonach es nicht ausbleiben konnte, dass das ganze Haus in Brand geriet und, allen Löschversuchen zum Trotz, als kümmerlichen Rest ein unscheinbares Häufchen grauer Asche hinterließ.
Hatte ich wirklich löschen wollen, wo alles so schön brannte?
Davor war ich einmal verheiratet gewesen und habe aus jener Ehe zwei mittlerweile erwachsene Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Scheidung lag schon lange zurück und aus den Wunden waren Narben geworden. Mit den Kindern verstand ich mich ganz gut und so ist es heute noch.
Ich wohnte nun in einer hübschen Wohnung an der Peripherie der Stadt. Selbstzweifel plagten mich noch immer, und dennoch war ich irgendwie froh, als wäre ich aus einer Falle entkommen. Meine Devise im Umgang mit Frauen hieß seither „Vorsicht“, und ich fühlte mich am wohlsten, wenn ich das Thema Frauen erst gar nicht in Betracht zu ziehen brauchte. Das gäbe doch wieder nur Verwirrung.
Herbert, Gerd und ich planten einen gemeinsamen Urlaub. Mal raus aus dem Trott, raus aus der Mühle. Eine Woche mal was anderes machen und sehen.
Zwei Wochen vorher, gleicher Ort, gleiche Zeit.
Zwei gelungene Stunden Musik lagen hinter uns. Renato hatte eben die zweite Runde Bier an unseren Tisch im Aquarium gebracht. Wir beobachteten, wie wir von den Gästen beäugt wurden; lauschten, was über uns hinter vorgehaltenen Händen getratscht wurde.
„Wir sollten mal hinfahren“, sagte Herbert so daher, mit Bierschaum auf der Oberlippe.
„Was meinst du damit?“, stutzte Gerd wohl darüber, dass es Herbert war, der ein Gespräch begann, was man von ihm sonst nicht gewohnt war.
„Emaijesesaijesesaipipiai“, buchstabierte Herbert im Stakkato. „Mississippi. Wir sollten mal hinfahren.“
„Und wie kommst du auf diese glorreiche Idee“, fragte Gerd mit hochgezogenen Augenbrauen.
„Na hör´ mal. Wir spielen den Blues, als wären wir dort geboren. In unseren Adern fließt Mississippiwasser. Wir spielen ihn schwärzer als die Schwarzen in New Orleans. Drei – vier Wochen. Mindestens.“
„Da schau sich mal einer diesen Phönix an“, sagte Gerd mit gespielter Hochachtung. „Kaum hat er seine Ehe in Schutt und Asche gelegt, will er frei wie ein Vogel über den Großen Teich fliegen. Und dann gleich für einen Monat.“
„Red´ keinen Stuss“, wehrte sich Herbert. „Ich hab´ meine Ehe nicht in Schutt und Asche gelegt. Ich bin nur aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen.“
„Das kommt doch aufs Gleiche raus“, meinte Gerd. „Und jetzt, da du dich endlich von deiner Frau befreit hast, findest du den Mut für weitere Schritte.“
Es wurde Zeit, dass ich mich in die Kabbelei zwischen den beiden einmischte. Gerd konnte manchmal so sensibel sein wie ein Nashorn beim Mikado-Spiel. Herbert hatte echt eine harte Zeit hinter und bestimmt noch einige schwarze Tage vor sich. Wer wie Gerd noch nie in einer festen Beziehung gesteckt hatte, konnte davon keine Ahnung haben. „Daraus wird sowieso nichts“, intervenierte ich also. „Ich meine aus USA und Mississippi. Weder für vier, noch für drei, noch für zwei Wochen.“
Beide schauten mich mit großen Augen an, dicke Fragezeichen als Pupillen.
„Es liegt über den Atlantik“, sagte ich. „Ich fliege nicht.“
„Ja wie?“, fragte Herbert. „Hast du keine Zeit oder kriegst du keinen Urlaub?“
„Nein, ich fliege nicht. Ich steige in kein Flugzeug“, erklärte ich.
„Versteh´ ich nicht. Verstehst du das, Gerd?“
Ich rang mit den Händen: „Ich habe Flugangst. Ich fliege nicht. Nicht dorthin und auch nicht irgendwo anders hin.“
„Jetzt brauch ich einen Schnaps“, schnappte Gerd. „Herbert, du auch? Und du, Pit? Renato, bring´ bitte mal drei Schnäpse. Doppelt.“
Das war vor zwei Wochen.
Trotzdem waren wir überein gekommen, dass wir gemeinsam eine Woche Ferien machen wollten. Herberts Vorschlag mit dem Mississippi hatte mich auf eine Idee gebracht.
Jeder hatte sein Glas Bier geleert und wir bestellten bei Renato drei neue. Ich hatte einen Katalog der Firma Crown Blue Line über Hausbootferien in Frankreich mitgebracht. Keiner von uns hatte schon jemals ein Hausboot gesteuert. Der einzige, der einigermaßen Erfahrung mit Wasserfahrzeugen hatte, war Gerd. Er besaß einen Segelschein. Nach der Beschreibung im Katalog müsste es ein Kinderspiel sein, mit einem Motorboot zu fahren. Auf den Hochglanzfotos waren nur fröhliche, glückliche Menschen an Bord zu sehen.
Gerd hatte sich im Voraus bei seinem Bruder erkundigt, wann dieser die Vertretung bei Mutter übernehmen könnte. Es stand die Woche vom sechzehnten bis zweiundzwanzigsten September zur Debatte, das heißt, er könnte am vierzehnten bereits Gewehr bei Fuß stehen. Für Herbert und mich günstig, weil wir vierzehn Tage Ferien im September angemeldet hatten.
Wir entschieden uns im Katalog für einen Bootstyp der preisgünstigsten Klasse. Ein Boot namens „Riviera“. Buchbar ab sofort, für dreizehnten September bis einschließlich zwanzigsten. Gerd meinte, seine Mutter würde einen Tag auch mal alleine über die Runden kommen. Ab vierzehnten wäre dann der Bruder da.
Wir einigten uns dahingehend, dass ich die Buchung erledigen würde, und dass wir nach Bestätigung des Termins in definitive Planung übergehen würden, also: Was nehmen wir alles mit; was brauchen wir; was wollen wir.
Am Tag darauf, Donnerstag, setzte ich morgens noch vor Arbeitsbeginn unsere Buchung ab. Und als ich abends wieder zu Hause war, fand ich die Bestätigung bereits im Computer. Na klasse. Es konnte losgehen. Wir würden zu unserem „Mississippi“ kommen.
Kapitel 2
SAÔNE
Die „Saône“ ist der größte Nebenfluss der Rhone in Ostfrankreich. Sie entspringt in einer Meereshöhe von dreihundertsechsundneunzig Meter bei Vioménil in den Vogesen, mündet in der Nähe von Lyon in die Rhone und ist ab dem Ort Corre im Département Haute-Saône auf einer Strecke von dreihundertsiebzig Kilometer schiffbar, wobei sie eine Gesamtlänge von viehundertachtzig Kilometer aufweist.
Die „Saône“ ist über mehrere Kanäle mit den wichtigsten Wasserstraßen verbunden. Über den Canal de l’Est, abzweigend bei Corre, erreicht man die Mosel und somit Deutschland. Richtung Nordfrankreich und Belgien geht es ab Henilley über den Marne-Saône-Kanal. In St. Symphorien stößt man auf den Rhein-Rhone-Kanal und gelangt somit ins Elsass oder Richtung Nordschweiz. Ferner beginnt in St. Jean-de-Losne der Burgunder-Kanal, welcher ins Seine-Becken führt, und in Chalon-sur-Saône der Mittelfranzösische Kanal, der hauptsächlich die Bergbauindustrie in Mittelfrankreich sowie die Landwirtschaft dort an das Wasserstraßennetz anschließt.
Bereits ab der Antike wurde die „Saône“ auf ihrem schiffbaren Abschnitt zum Transport von Menschen und Waren genutzt und ermöglichte das Entstehen von Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft. Es entwickelte sich ebenso eine an Kultur reiche Region, ganz besonders deutlich nachvollziehbar an vielen Gebäuden entlang des Flusses.
Heute hat die Frachtschifffahrt so gut wie keine Bedeutung mehr. Eisenbahn und Lkw haben den Gütertransport weitgehend übernommen. Dafür sorgt der Binnenschifffahrtstourismus nicht nur für neue Impulse auf und entlang des Flusses, sondern er trägt auch hauptsächlich zum Erhalt des Wasserstraßensystems bei und ist zu einem nicht unerheblichen wirtschaftlichen Faktor für die gesamte Region Haute-Saône geworden.
Die weite, flache Talsenke und ein relativ geringes Gefälle machen die „Saône“ zu einem auch für Ungeübte ziemlich einfachen Bootsfahrer-Revier. Die kaum spürbare Strömung und der durch gelegentliche Schleusen regulierte Wasserstand lassen genügend Zeit und Raum, die großartige Landschaft und die Natur in Ruhe und Stille zu genießen.
Eine Reihe von Anlegestellen und Versorgungsstationen ermöglichen dem Bootsfahrer eine stressfreie, erholsame Fahrt.
Freitag, 13. September 2002
Das fängt ja gut an.
Kaum sind wir zweihundert Meter mit unserem Kahn aus dem Hafen gefahren, dümpeln wir im Motorleerlauf vor der geschlossenen Schleuse von Fontenoy-le-Château von einer Kanalseite auf die andere. Die Schleuse ist in Betrieb und hebt ein gerade entgegenkommendes Boot auf unser Pegelniveau, und wir werden just dann mitten im Weg liegen, wenn dieser Gegenverkehr aus der Schleuse ausfahren möchte. Bei uns bricht Hektik aus. Um mit Rückwärts- bzw. Vorwärtsgang unser Schiff auf die Seite manövrieren zu können, sind wir noch viel zu unerfahren. Zudem hatte unser Funkpiepser, der unsere Schleusung anmelden sollte, beim Funkempfänger keinerlei sichtbare Reaktion hinterlassen, und nun sitzen wir, oder besser gesagt, schwimmen wir da. So ein Zinnober aber auch.
Als unser Bug mal wieder zufällig an die rechte Kanalseite anschlägt, springt Gerd gewagt ans Ufer und hält das Boot dort mittels einer Leine fest. Herbert klettert, weit weniger elegant, ebenfalls an Land und ich werfe ihm die Heckleine zu. Damit zieht er auch das Bootshinterteil aus der Fahrrinne des Kanals. Wir sehen zu, wie der Gegenverkehr an uns vorbeifährt und uns zuruft, wir sollten beim nächsten Mal besser hundert Meter vor dem Schleusentor warten. Ich winke verständnisgrüßend zurück und denke: „Gut gebrüllt, Löwe.“
Wer gedacht hätte, dass nun wir mit dem Schleusen an der Reihe wären, hat sich getäuscht. Mistpiepser. Wir müssen noch eine weitere komplette Gegenschleusung abwarten, bis das Schleusentor offen bleibt und das Einfahrtsignal für unseren Kahn „grün“ anzeigt.
Mit Hilfe eines drei Meter langen Enterhakens und wenig Motorantrieb stochern wir das Schiff schließlich in die Schleuse und sind heilfroh, als sich hinter uns endlich die Tore schließen. Wie war das noch mal mit dem Kamel und dem Nadelöhr?
Gespannt verfolgen wir, wie sich der Wasserspiegel in der Schleusenkammer senkt und wie die Wände links und rechts des Schiffes in die Höhe zu wachsen scheinen. Ich schiele verstohlen zu meinen Kumpeln. Ihre Gesichter sehen aus, als wären sie unterwegs zu einem Himmelfahrtskommando. „Pit, du siehst aus, als wären wir auf dem Weg in die Hölle“, stänkert Gerd. Ich schau also auch nicht glücklicher aus der Wäsche. Langsam öffnen sich vor uns die beiden Flügeltore und sie entlassen uns und das Boot auf unser erstes, offenes Stück Kanalstrecke. Die Ausfahrt gelingt unter ständigem Abstoßen von den Schleusenwänden mit Händen, Füßen und Enterstange ganz leidlich, und dann gebe ich gaaanz vorsichtig Gas, und brause mit festem Blick nach vorne, kräftig am Steuerrad hin und her drehend, geradeaus, denn ich bin schließlich der Kapitän, jawolll.
Und es geht doch. Wenn auch deftig mit dem Heck schlingernd, gewinnen wir bald an Fahrt und rasch habe ich den Bogen raus. Der Drehpunkt des Bootes ist der Bug und gesteuert wird über das Heck, was beileibe nicht bei allen Schiffen gleich ist. Der Steuerstand auf unserem Boot befindet sich nämlich ziemlich weit vorne, was den leidigen Nachteil hat, dass man Richtungsänderungen erst mit Verspätung erkennt, will heißen, für Anfänger oft zu spät. Unter Berücksichtigung der Trägheit der Masse und einer verzögerten Reaktion auf die Steuerbewegungen kann man den Kahn aber ganz ordentlich in der Spur halten.
Wir tuckern betulich mit bescheidener Bugwelle, schneller als ein Fußgänger, langsamer als ein Jogger, auf dem Canal de l’Est dem Abend entgegen. Gerd lümmelt auf dem Vorderdeck herum und hat bereits die Badehose angezogen. Der Himmel ist strahlend blau und die Temperatur sehr angenehm. Herbert kocht in der Kombüse einen Kaffee. Es ist sechzehn Uhr.
Heute Morgen um zehn Uhr standen Herbert und ich auf der Fußmatte vor Gerds Wohnung, um ihn abzuholen. Schnell hatte er seine Siebensachen gepackt und zu unseren Habseligkeiten im Auto verstaut. Laut Wetterbericht konnten wir auf eine Schönwetterperiode bis mindestens Sonntag hoffen und mit reichlich Vorfreude ausgestattet starteten wir in Weil am Rhein unsere Reise nach Frankreich. Über Altkirch, Belfort, Lure, Luxeuil-les-Bains fahrend, verfolgten wir interessiert, wie sich Landschaften und Baustile veränderten. Dank einer verpassten Straßenabzweigung dirigierte uns Gerd mit Hilfe einer Straßenkarte über den Kurort Plombières-les-Bains, und schau mal einer an, welches Kleinod sich da für uns auftat. Malerisch gelegen zwischen grünen, bewaldeten Hügeln, liebevoll nachlässig gepflegt und versehen mit nostalgischem Charme, ruhte das Städtchen vermutlich gerade die ersten paar Jahre des hundertjährigen Dornröschenschlafs. Nicht der große Pomp und die monumentalen Bauten hätten es sein können, welche den Reiz des Bades ausmachten, sondern eher die Zierlichkeit und doch Gediegenheit bis ins Detail. Gerd klebte mit der Nase am Autofenster und war fast fassungslos angesichts dieser Perle praktisch vor seiner Haustür.
Wenig später erreichten wir mit Fontenoy-le-Château unseren Starthafen. Nach der Übernahme der Bordpapiere im Büro der Hausbootgesellschaft sahen wir unseren Dampfer am Kai festgemacht liegen. Alle waren wir von den Abmessungen, also Breite und Länge, überrascht. Als wir dann an Bord gingen und uns den Salon, die Küche und die Kajüten anschauten, konnten wir ein kollektives „Aber hallo“ nicht verkneifen. Gerd hielt, an unseren Ansprüchen gemessen, die Ausstattung für den puren Luxus. Ich selbst wollte soweit zwar nicht gehen, aber es war alles da, was man für ein unbeschwertes Leben auf einem Schiff brauchte.
Dann erschien Regis, der Instruktor von Crown Blue Line, und erklärte uns, wo was auf dem Boot zu finden war und wie es funktioniert. Anschließend erteilte er uns eine kurze, praktische Fahrlektion: Einmal den Motor starten, Vorwärtsgang, vorwärts ablegen, eine Wende fahren, Rückwärtsgang, rückwärts anlegen, Motor abstellen. Und tschüss, Regis. Hach, war das aufregend.
Und dann hieß es: Leinen los, wir fahren auf den Kanal.
Gerd klopft an die Frontscheibe und deutet auf ein Verkehrsschild: Weißes Quadrat, rot umrandet mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Ich suche in meiner Tabelle nach dem entsprechenden Zeichen. Darunter steht: hupen. Also lasse ich unser Horn ertönen und kann mir auch denken, warum. Gleich nachdem wir Fontenoy-le-Château hinter uns gelassen haben, windet sich der Kanal in engen Schleifen durchs Gelände. Felswände treten für eine kurze Strecke dicht ans Wasser. Dann wieder sind es ufernahe Bäume, die ihre Äste weit in das Profil des Kanals strecken. Hupen heißt also: Achtung Gegenverkehr, wir kommen.
Über uns wölben sich die Baumkronen zu einem Dach und wir haben das Gefühl, durch einen dunkelgrünen Tunnel zu gleiten.
Herbert hat den Kaffee fertig und serviert ihn uns im bordeigenen Service. Er setzt sich neben mich auf die Bank und gemeinsam bestaunen wir die sich ständig wechselnden Bilder. Minutenlang glauben wir, uns in einem überdimensionalen Kaleidoskop zu befinden. Wo ist derjenige, der es für uns dreht?
Der Kanal wird wieder etwas breiter, die Bäume drängen nicht weiter so sehr an die Ufer, der Himmel über uns wird lichter und die Sonne hat uns wieder erblickt. Die nächste Schleuse naht. Wir suchen und finden den Funkempfänger und piepsen ihn mit unserem Sender an. Im Prinzip funktioniert es wie bei einer Garagentoranlage, nur dass die Schleuse, je nachdem ob sie gefüllt oder geleert ist, erst vorbereitet werden muss. Aber das läuft automatisch ab. Tatsächlich blinkt uns diesmal der Empfänger „ gelb“ zurück, das heißt, unser Kommen ist angemeldet.
Ich gehe sozusagen auf „Halbe Kraft voraus“ und schleiche auf die noch geschlossenen Schleusentore zu. Die Ampelanlage leuchtet „ rot-grün“ und wir können davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauern wird und wirklich, Sesam öffne dich, bewegen sich die Tore hydraulisch, das Signal springt um auf „grün“, und es gelingt uns eine butterweiche Schleuseneinfahrt. „Yohooo, give me five!!“
Herbert sichert das Boot mit einer Leine an einem Eisenring am Schleusenrand, damit es nicht in der Schleusenkammer hin- und herschlägt oder vor- und zurücktreibt, denn es entstehen innerhalb der vier Wände enorme Kräfte. Gerd bedient die blaue Schaltstange, die das Schließen der Tore bzw. das Öffnen der Fluter einleitet. Alles geht so glatt, als wären wir schon alte Profis.
Als ich allmählich kapiere, dass ich mit weniger heftigen Lenkbewegungen am Steuerrad auch weniger Arbeit habe und dafür größere Kursgenauigkeit erziele, klebe ich mit einem Heftpflaster eine Merkhilfe ans Steuer, deren Position den Geradeauslauf markieren soll. Aber als Gerd mich nach zehn Minuten am Ruder ablöst, hat er trotz dieses „Faulenzers“ die gleichen Anfangsschwierigkeiten wie ich. Heftig schleudernd stampft unser Kutter plötzlich von links nach rechts, rasiert an Zweigen vorbei, wühlt in den landnahen Zonen braunen Schlamm vom Grund auf, und Gerd kurbelt sich am Steuerrad einen ab. Mit der linken Schiffsseite rauschen wir gefährlich dicht an den stählernen Spanten der Kanalbefestigung entlang und auf einmal bockt unser gutmütiges Bötchen wie ein wilder Mustang, der vom Lasso eingefangen wurde, und im wahrsten Sinne des Wortes ist es so. Ein spitzer Baumast hat sich in einen der Fender gebohrt und den Kahn aus voller Fahrt herumgerissen und zum Stehen gebracht. Fender sind die Ballons, die seitlich an den Booten hinunterhängen, um die Rümpfe vor Beschädigungen, wie sie zum Beispiel beim Anlegen im Hafen oder beim Durchfahren enger Passagen entstehen können, zu schützen. An Stelle der Ballons sieht man häufig auch alte Autoreifen.
Mit vereinten Kräften befreien wir unser „Pferdchen“, streicheln es artig und wischen Gerd den Schweiß von der Stirn.
Eine Aufregung kommt selten allein, und nicht viel später steht auch Gerd eine Schleusenfahrt bevor. Mit dem bekannten Procedere funken wir uns an, doch erwischen wir diesmal wieder eine besetzte Schleuse und zudem liegt bereits ein anderes Hausboot vor den Toren in Wartestellung. Gerd muss Fahrt wegnehmen und schließlich sogar hinter dem anderen Schiff anhalten. Mit dem Halten haben wir einfach noch Probleme. Wieder treiben wir steuerlos und unkontrolliert vor der Schleuse her. Gerd probiert es mutig mit vor- oder rückwärtsdrehender Schiffsschraube, aber leider vergebens. Nachdem der vor uns wartende Skipper seinen Kahn sorgfältig eingeschleust hat, wären wir an der Reihe, doch wir liegen quer vor der Einfahrt. Per Hand, Fuß und Leine zerren, stoßen und schieben wir unser Schiff quasi von Land aus hinter das andere Boot in die Schleuse wie einen störrischen Gaul in den Stall. Gerd meint, es sei durchaus seine Absicht gewesen zu probieren, ob das Boot nicht doch quer in die Schleuse passen würde. Ein Lacher zur rechten Zeit.
Laut Streckenplan steht uns bis zu unserem heutigen Tagesziel noch eine Schleuse ins Haus. Frohgemut schippern wir weiter Richtung untergehende Sonne und ein phantastisches Licht über einer grandiosen Landschaft entschädigt uns für jedwede gehabten Befürchtungen. Herbert erweist sich als Goldjunge, indem er eine Schale mit Obstschnitzen herumreicht: Äpfel, Pfirsiche. Und wir gehen hinaus auf Deck, blicken zum Himmel und weit über die Hügel zur Linken und sagen, wie aus einem Munde: „So schön, so schön.“
Wie auf einer Superbreit-Kinoleinwand zieht in Zeitlupe ein majestätischer Landschaftsfilm an unseren Augen vorbei. Nicht spektakulär und atemberaubend, aber ergreifend und tiefgehend, ehrfurchtverlangend. Wir fühlen, wie in uns eine Saite anfängt zu schwingen, wie ein warmer, weicher Ton entsteht, und wir wissen, dass uns dieser Ton begleiten wird auf unserer Reise, unhörbar, aber zuversichtlich stimmend. Oder melancholisch?
Für mich persönlich sehe ich insoweit keine Gefahr, und für Gerd gleich zweimal nicht. Doch Herbert, der introvertierte Grübler, wird diese von außen zugetragenen Stimmungen aufsaugen wie ein Schwamm. Nun gut, er wird Gerd und mich zur Gesellschaft haben. Da wird er sich hoffentlich damit begnügen, nur an den oberen Rand seines tiefen Loches gekrallt nach unten zu schauen, anstatt gleich hinabzuspringen. Ich werde es bemerken. Gerd ist da weit pragmatischer. „Es wird seinem Blues nur gut tun“, wird er sagen.
Die nächste Schleuse meistern wir wieder prächtig. Der Skipper von vorhin hat in der offenen Kammer auf uns gewartet, damit zwei Boote gleichzeitig abgesenkt werden können. Nun ist es nicht mehr weit bis zur geplanten Anlegestelle. Als wir