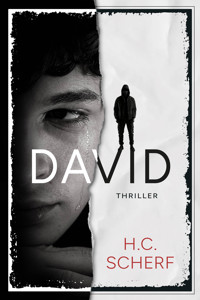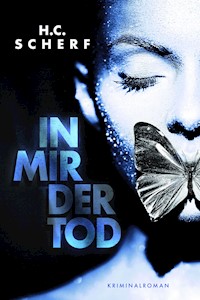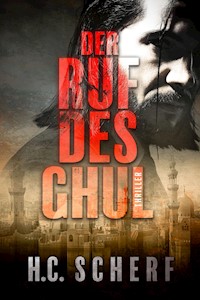2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als drei Kinder aus der Nachbarschaft nicht von der Schule heimkommen, ahnt Veronika Kay noch nicht, dass sich auch ihr Kind im Fokus eines Unbekannten befindet. Als hätte die kleine Leonie nach einem tragischen Unfall noch nicht genug gelitten, muss sie das Zerwürfnis ihrer Eltern verkraften. Halt gibt ihr die Freundschaft eines mysteriösen Nachbarn, dessen Vergangenheit Grund zur Besorgnis liefert. Neben der Polizei ermittelt auch ein Fremder, dessen Beweggründe im Dunkeln bleiben. Erst als das Leben der Kinder auf dem Spiel steht, scheint die Rettung möglich. Ein bewegender Thriller, der besonders das Leiden und die Konflikte der Eltern spüren lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Fremder Freund
Von H.C. Scherf
Psychothriller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Fremder Freund
© 2022 H.C. Scherf
Ewaldstraße 166, 45699 Herten
https://www.scherf-autor.de
Alle Rechte vorbehalten
Aktives Mitglied im Selfpublisher-Verband e.V.
Covergestaltung: VercoDesign, Unna
Bilder von:
Shutterstock / fotoslaz
shutterstock / The WashingLine
Shutterstock / Stockr
clipdealer / nemar74
Lektorat/Korrektorat: Heidemarie Rabe
Dieses E-Book ist geschützt und darf ohne Genehmigung des Autors nicht
vervielfältigt oder weitergegeben werden.
Fremder Freund
Von H.C. Scherf
Besser man riskiert,
einen Schuldigen zu retten,
als einen Unschuldigen zu verurteilen
© Voltaire
1
»Nein, sie darf es nicht tun. Die Kinder sind unschuldig und es darf ihnen nichts geschehen.«
Mit schmerzverzerrtem Gesicht presste er seine Hand auf die stark blutende Schulterwunde und spürte doch, dass mit jedem Pulsschlag das Leben mehr aus seinem Körper wich. Seine Worte waren nur geflüstert und doch glaubte er, dass sie das gesamte Kellergewölbe erfüllten.
Warum hast du das nur getan? Wir hatten doch Pläne. Jetzt ist alles verloren und du wirst dafür in der Hölle schmoren. Leonie darf nichts geschehen. Auf keinen Fall.
An einem Mauervorsprung Halt suchend, zog er sich hoch und wartete ab, bis sich der Kreislauf normalisierte. Er konnte keinen Schritt tun, bevor nicht auch dieses Schwindelgefühl vergangen war. Zu groß war die Gefahr, dass er starb, bevor er die Kinder erreichte. Ihm war völlig klar, wohin sie sich gewandt hatte. Oft genug waren sie gemeinsam an diesem Ort gewesen und hatten stundenlang diskutiert über das, was sie schon ihr ganzes Leben belastete und nun zu einem Ende geführt werden sollte. Schon die Vorstellung, dass sich Leonie in ihrer Hand befand und Teil ihres Plans werden würde, trieb ihn in den Wahnsinn. Meter für Meter bewegte er sich in der völligen Dunkelheit vorwärts, ignorierte den zusätzlichen Schmerz, wenn er sich an Gegenständen stieß und verletzte, die man in den verwinkelten Gängen abgestellt hatte.
Seine jetzt von Tränen des Zorns geröteten Augen, die tief in den Höhlen lagen, irrten umher, versuchten, die tiefschwarze Finsternis zu durchdringen. Immer wieder fuhren seine blutbeschmierten Hände durch das klatschnasse Haar, verteilten den darin enthaltenen Schmutz weiter über sein Gesicht. Die Kälte zerrte an ihm, ließ ihn zittern, was das angstgetriebene Beben seines geschundenen Körpers noch verstärkte, zumal er nur dieses dünne Hemd über der Jeans trug. Auch geringste Geräusche ließen ihn zusammenfahren und ständig nach der Ursache forschen. Irgendetwas war anders. Er war nicht allein. Doch nichts geschah. Lediglich das heftige, immer stärker werdende Klopfen in seinen Ohren drohte, ihm den Verstand zu rauben. Das Herz trieb unentwegt das Blut durch die Adern – er lebte zumindest noch. Dass dieser Zustand nicht mehr lange andauern würde, wusste er genau, da die Patrone fast sein komplettes Schlüsselbein zerschmettert und eine Ader verletzt hatte. Auf keinen Fall durfte er ihr seine Position verraten. Sie sollte weiter glauben, dass er längst tot war. Die einzige Chance, Leonie zu befreien, lag in dem Überraschungsmoment.
Ich schaffe das. Ich muss es schaffen und das Schlimmste verhindern.
Wieder stoppte er, da er glaubte, eine Bewegung vor sich oder ein Geräusch vernommen zu haben. Er hielt die Luft an. Da war es. Schwach hörte er sie – Kinderstimmen.
Gott sei Dank – sie leben noch. Ich kann sie eventuell davon abhalten, sie zu opfern.
Nur mühsam gelang es ihm, sich weiter vorwärtszuziehen. Immer wieder glitten seine Finger über die kalten, bemoosten Wände, um sich zu orientieren. Irgendwo dort vorne musste die letzte Biegung sein, bevor er in den großen Raum kam. Den Gedanken, dass er zu spät kommen könnte, verwarf er, unterdrückte die Angst um Leonie. Er tastete sich weiter voran und überwand den Ekel, den er empfand, wenn er die Schleimspur einer Schnecke oder ein Spinnennetz berührte.
Da war Licht. Ein schwacher Schein von einer Taschenlampe, die bewegt wurde? War sie das, die zurückkam, um sich von seinem Tod zu überzeugen?
Sein Atem stockte. Sein Körper erstarrte, wobei die Sinne immer wieder falsche Signale aussendeten. Stille, nichts als bedrohliche Stille umgab ihn. Wieder einmal hatte er sich geirrt. Das Licht erstarb, wie auch das Geräusch von sich nähernden Schritten.
Verdammt, reiß dich zusammen. Es hilft dir nicht, wenn du dich von deiner Angst treiben lässt. Sie soll es sein, die Angst bekommen wird, denn ich werde ihr das Leben nehmen. Quälen werde ich sie, die mir das Kind nehmen will. Ihr Tod wird alles hier beenden und mir mein Leben zurückgeben.
Er löste mit einem tiefen Seufzer und zu allem entschlossen die Hand von der Wand und folgte den Stimmen, die ihn zusammenfahren ließen. Da war plötzlich diese Männerstimme, die ihm so bekannt vorkam und doch in diesem widerhallenden Raum so fremd klang. Sie stritt sich mit diesem Fremden, was ihm Zeit verschaffte. Immer schneller verließ der Atem seinen offen stehenden Mund, da er es kaum erwarten konnte, endlich die Hand um den Hals dieser Teufelin legen zu können.
Beruhige dich! Du darfst jetzt nichts überstürzen, so kurz vor dem letzten Hindernis. Reiß dich verdammt noch mal zusammen und warte ab, was dieser Mann dort bewirkt. Alles, was Zeit brachte, vergrößerte die Chance, diese Kinder zu retten.
Endlich war die letzte Biegung geschafft und er wusste, dass er sich genau vor dem Eingang zur großen Halle befand. Immer lauter wurden die Gespräche geführt. Der Mann wollte sie von der Sinnlosigkeit ihres Tuns überzeugen.
Nein, mein Freund, das habe ich schon viel zu oft versucht. Das wirst auch du nicht schaffen. Du kannst den Tod der Kinder nur dadurch verhindern, indem du diese Frau tötest. Schick sie in die Hölle! Tu es für die Kinder!
Am liebsten hätte er es in den Raum gerufen, wenn er nicht sicher gewesen wäre, dass er damit die Katastrophe nur beschleunigen würde. Vorsichtig lugte er um die letzte Ecke und erstarrte, als er ein Bild des Grauens in sich aufnahm. Nur schwach erkannte er den Rücken dieses Unbekannten, der bis über die Waden in dieser schlammigen Brühe stand und wie zum Sprung bereit weiter versuchte, das Unvermeidliche abzuwenden. Die Hand dieser verfluchten Frau umschloss den Hebel, der allen den Tod bringen würde. Sein Schrei ließ alle herumfahren.
2
... Nur als schwarzer Schatten hob sich das Profil von Martins Gesicht gegen den stahlblauen Himmel ab, als Veronika die Augen öffnete. Sie blinzelte in die Sonne. Den langen Grashalm, mit dem er sie gekitzelt und aus dem Schlaf geholt hatte, wischte sie lachend beiseite. Sie umfasste dafür seinen Kopf, zog ihn näher zu sich heran und küsste diesen Mund, der sie schon vom ersten Moment ihrer Begegnung an fasziniert hatte. Lippen, die an Sinnlichkeit kaum zu übertreffen waren, lagen verlangend auf ihren und ließen es zu, dass sich Veronikas Zunge zwischen sie schob. Sie spürte dieses Gefühl aufsteigen, sich dem Mann hinzugeben, der es immer wieder verstand, sie zu verzaubern – selbst jetzt noch, wo sie schon acht Jahre verheiratet waren. Die kleinen Hände an Veronikas Füßen rissen sie beide aus ihren Träumen und holten sie zurück in die Realität, die daraus bestand, dass die kleine Leonie um ihrer beider Aufmerksamkeit buhlte. Manchmal überkam Veronika das Gefühl, dass es eine gewisse Portion Eifersucht war, die diesen süßen Wirbelwind immer dann in ihre Nähe trieb, wenn Martin und sie sich umarmen wollten. Es blieb wieder einmal keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn Leonie wusste, wie man geschickt Aufmerksamkeit erlangte. Ihr Lockenkopf schob sich direkt neben Martins und zeigte ein verschmitztes Grinsen. Strahlend blaue Augen funkelten die Eltern an. Ihre bezaubernde Stimme regte zum Lachen an. Man konnte diesem Kind einfach nicht böse sein.
»Hunger – Hunger – Hunger! Ihr habt mir versprochen, dass es heute Blaubeerpfannkuchen gibt. Und jetzt sagt mein Bauch, dass es Zeit dafür ist. Hört mal genau hin.«
Demonstrativ rückte sie noch näher heran und bemühte sich um ein Geräusch, das einem Bauchgrummeln gleichkommen sollte. Dabei streckte sie den beiden ihren Bauch keck entgegen. Sie zog ihn erst lachend zurück, als Martin sie kitzeln wollte.
»Komm, Mama, lass uns in die Küche gehen. Du hast jetzt lange genug hier im Garten gefaulenzt. Ich habe einen Bärenhunger!«
Ein weiteres Mal betonte sie dieses letzte Wort besonders und zog energisch an der Hand Veronikas, die jetzt ergeben mit den Schultern zuckte und sich auf der Liege aufrichtete. Jetzt ebenfalls lachend verdrehte Martin die Augen und widmete sich wieder dem Unkrautjäten, das er lediglich für den kleinen Scherz mit Veronika unterbrochen hatte. Sein Blick folgte den beiden Wesen, die er über alles auf dieser Welt liebte.
»Die Pfannkuchen schmecken köstlich. Dein Rezept solltest du dir patentieren lassen. Einfach grandios.«
Leonie nickte heftig zu Papas Kompliment, das Veronika mit einem Lächeln auf den Lippen wegwischte.
»Das ist ganz simpel. Du musst nur ein paar Eier ...«
»Stopp, Veronika, nicht verraten«, unterbrach Martin. »Ich will das nicht wissen, sonst kommt ihr noch auf die Idee, dass ich sie irgendwann für euch backe. Jedem seine Aufgabe in diesem Haus.«
»Ich will auch etwas tun, Mama.«
Veronika bemühte sich darum, einen ernsten Gesichtsausdruck zu zeigen, als sie der Kleinen antwortete.
»Ich wüsste, was du übernehmen könntest, Liebes. Du könntest von heute an dein Zimmer selber aufräumen, dann hätte ich viel mehr Zeit, um zum Beispiel Pfannkuchen zu backen. Was hältst du davon?«
»Finde ich richtig doof, Mama«, widersprach der Lockenkopf vehement. »Papa, sag du doch mal was. Ich würde gerne den Teig für die Pfannkuchen rühren oder so was Ähnliches. Ja, das könnte ich machen.«
Laut jauchzend warf Leonie die Arme hoch und vergaß dabei, dass sich noch einige Beeren auf der Gabel befanden. In hohem Bogen flogen sie durch die Luft und verfehlten nur um Haaresbreite Veronikas Gesicht.
»Ups. Das wollte ich nicht, Mama. Ich hebe sie schnell wieder auf.«
»Bleib sitzen, Leonie, ich mach das schon. Iss weiter und pass zukünftig besser auf, was du tust, während du isst. Das kann üble Flecken auf der Wäsche verursachen.«
Leonie hatte längst wieder den Mund vollgestopft und versuchte, mit prall gefüllten Backen das Essen runterzuschlucken, was jedoch gründlich schieflief. In hohem Bogen spuckte sie das halbgekaute Essen wieder zurück auf den Teller und rang nach Luft. In Sekundenschnelle stand Martin neben ihr und sah ihr ins Gesicht.
»Das Spray, Veronika. Hol schnell das Cortison. Sie hat wieder einen Anfall.«
Nur wenige Sekunden später tauchte Veronika mit dem Inhalator auf und drückte der Kleinen das Mundstück zwischen die Lippen. Der erste Druck verteilte das Medikament im Rachen des Kindes und verschaffte Leonie eine merkliche Besserung, jedoch nur für kurze Zeit. Als Veronika ein weiteres Mal drücken wollte, wurde ihr schnell klar, dass kein weiteres Cortison nachlief. Immer wieder versuchte sie es weiter, drückte fassungslos auf den Knopf – ohne Erfolg.
»Es ist leer, Martin. Hol das Ersatzgerät. Du wirst es sicher in die linke Schublade gelegt haben.«
»Wieso sollte ich das getan haben? Für die Medikamente bist du doch zuständig. Was ist nun mit dem Ersatzgerät, Veronika?«
»Verdammt, Martin. Ich hatte dir doch am Dienstag den Zettel auf den Schreibtisch gelegt, dass du das Rezept von Dr. Kelvin abholen und in die Apotheke fahren solltest. Ich war doch zum Lehrgang eingeladen. Du solltest ...«
»Einen Dreck sollte ich. Warum hast du mir das nicht gesagt, anstatt einen bescheuerten Zettel zu schreiben? Hol das Telefon und ruf sofort den Rettungswagen. Sie bekommt keine Luft mehr. Beweg dich doch endlich. Ich werde versuchen, ihr zu helfen.«
Während Veronika die Küche verließ und in Richtung Dielenschrank eilte, begann Martin mit der Herzmassage. Immer wieder unterbrach er, um eine Mund-zu- Mund-Beatmung durchzuführen. Tränen strömten über sein Gesicht und verteilten sich auf dem Körper der Kleinen, die nun mit weit aufgerissenen Augen ins Leere starrte. Nur vage vernahm Martin die Worte Veronikas, die versuchte, dem Rettungsdienst die Sachlage zu erklären.
»... Asthma ... keine Luft ... kommen Sie schnell ... das Kind ... bitte.«
Martin sah nicht einmal auf, als Veronika neben ihm auf die Fliesen sank und damit begann, Leonies Körper zu schütteln. Fassungslos stieß er ihre Hände beiseite und schrie: »Nimm deine verfluchten Finger von ihr! Siehst du jetzt, was du angerichtet hast? Verdammt, ich kann ihr Herz, ihren Puls nicht mehr spüren – sie stirbt uns unter den Händen weg. Du hast unser Kind getötet. Du und deine Zettelwirtschaft. Ich verfluche dich dafür.«
Als wäre ein Blitz eingeschlagen, wich Veronika zurück und starrte sprachlos auf den leblosen Körper ihrer Tochter, bevor sie in das vertraute, jetzt jedoch von Hass verzerrte Gesicht des Mannes blickte, der bis zu diesem Zeitpunkt alles Schöne für sie darstellte. Nichts war mehr von dem vorhanden, was sie als begehrenswert angesehen hatte. Seine Augen besaßen eine beängstigende Kälte, als er das Ohr auf Leonies Brust legte und erneut damit begann, sie im immer schneller werdenden Rhythmus einzudrücken. Seine Augen richteten sich wie im Fieber starr auf Leonies Gesicht. Selbst das abklingende Martinshorn und das Klingeln an der Tür stoppten ihn nicht. Erst die kräftigen Arme der Rettungssanitäter konnten ihn davon abhalten, dem Kind sogar weiteren Schaden zuzufügen. Die beruhigende Stimme des jungen Mannes nahm Martin nicht wahr, als er weinend und laut aufstöhnend auf den kalten Fliesen der Küche zusammenbrach.
Mittlerweile war auch der Notarzt eingetroffen und hantierte in geübter Routine an den Gerätschaften herum. Während Leonie eine Sauerstoffmaske aufgesetzt wurde, zog der Arzt eine Spritze auf und verabreichte sie der Kleinen in die Vene. Der dritte Sanitäter hatte wieder mit der Herzmassage begonnen, während der Kollege den Defibrillator vorbereitete. Die drei Männer hielten inne, als einer die erlösenden Worte flüsterte.
»Moment – wartet. Sie kommt zurück. Ich spüre Puls.« Einen Moment wartete er noch, bevor er es mit Gewissheit herausstieß: »Wir haben sie wieder zurück. Gott sei Dank, sie atmet. Ich hole die Trage und dann ab ins Klinikum.«
Weder Veronika noch Martin schienen begriffen zu haben, welches Wunder gerade geschehen war, und dass Leonie wieder Lebenszeichen zeigte. Beide hingen ihren Gedanken nach und wischten lediglich ihre Tränen weg, während sie mit leeren Blicken den Abtransport verfolgten. Der Notarzt trat zu Veronika heran und schüttelte sie.
»Frau Kay, hören Sie mich? Ihr Kind ist wieder bei Bewusstsein. Wenn Sie uns ins Krankenhaus begleiten wollen, müssen Sie sich beeilen. Sie muss so schnell wie möglich behandelt werden, um Risiken und Spätfolgen ausschließen zu können. Kommen Sie jetzt bitte.«
»Ich fahre mit«, fuhr Martin dazwischen, der sich in der Zwischenzeit wieder aufgerappelt hatte und den Arzt zur Tür drängte. »Meine Frau kann nachkommen, wenn sie wieder bei Verstand ist und ein paar Sachen für die Kleine eingepackt hat.«
»Wer von Ihnen mitfährt, ist mir eigentlich egal. Nur es muss sofort sein, sonst fahren wir ohne Sie ab. Steigen Sie jetzt endlich ins Auto. Ich rufe in der Klinik an, dass wir mit einem Notfall kommen.«
Fassungslos blickte Veronika dem schnell davonfahrenden Rettungswagen hinterher. Sie zuckte nicht einmal zusammen, als sich eine Hand auf ihre Schulter legte.
»Was ist mit der Kleinen geschehen, Frau Kay? Kann ich helfen? Kommen Sie, lassen Sie uns ins Haus gehen, damit Sie mir alles erzählen können.«
Erst jetzt erkannte Veronika das Gesicht des Nachbarn, der vor etwa sechs Monaten neben ihrem Haus eingezogen war und sich immer intensiv und liebevoll mit Leonie unterhielt, wenn sie im Garten spielte. Mit sanfter Gewalt drückte er sie Richtung Eingang und geleitete sie in die Küche, wo er kurz entschlossen ein Glas Wasser für sie einschenkte, so, als würde er sich hier schon hervorragend auskennen. Am Tisch saßen sie sich gegenüber.
»Erzählen Sie. Es wird Ihnen bestimmt helfen.«
3
»Gerne würde ich Ihnen eine andere, eine erfreulichere Diagnose für Leonies Zustand geben, aber wir können an der Wahrheit nun einmal nicht rütteln und sie schönreden. Ihre Tochter wird nicht mehr die sein, die sie mal war. Dafür war das Gehirn zu lange ohne Sauerstoffversorgung. Sie werden sich nun noch stärker um sie kümmern müssen. Sie braucht in Zukunft all Ihre Liebe, Zuwendung und Ihr Verständnis. Nachdem diverse Regionen im Gehirn zu lange unterversorgt waren, werden zumindest im motorischen Bereich Defizite vorhanden sein. Wir mussten bei diversen Tests feststellen, dass sie auf bestimmte Reize nicht mehr in gewohnter Weise reagiert.«
Veronika unterbrach den Neurologen an dieser Stelle, da sie es einfach nicht mehr zurückhalten konnte. Sofort spürte sie Martins strafenden Blick, der bisher geschwiegen und den Kopf in beide Hände gestützt hatte. Sein Blick war ausschließlich auf die Schreibtischplatte gerichtet.
»Soll das bedeuten, Doktor Reinders, dass Leonie nie wieder normal laufen, mit anderen Kindern spielen kann?«
»Das habe ich damit nicht sagen wollen, Frau Kay. Ich schilderte lediglich den Zustand, in dem sich Leonie derzeit befindet. Keiner kann ...«
»Was soll diese dumme Frage?«, fuhr ihm Martin einmal mehr ins Wort und wandte sich dabei an Veronika. »Hast du überhaupt zugehört? Er hat doch deutlich genug gesagt, was du mit deiner Nachlässigkeit angerichtet hast. Sie wird dich dafür hassen, so wie ich es bereits tue. Hast du gehört? Niemals werde ich es dir verzeihen, was du meiner Tochter angetan hast. Niemals!«
Dr. Reinders hob beschwichtigend beide Hände und versuchte, die entstandene Schärfe aus dem Gespräch herauszunehmen.
»Nun beruhigen Sie sich bitte, liebe Familie Kay. Niemandem kann hier eine Schuld gegeben werden. Das menschliche Gehirn ist ein sehr komplexer und empfindsamer Teil unseres Körpers und kann ...«
»Das, lieber Dr. Reinders, glaube ich Ihnen unbesehen«, unterbrach Martin erneut den Arzt. »Ich meine damit, dass die Ursache für dieses Versagen nicht in der Krankheit selbst zu suchen ist, sondern in dem oberflächlichen und verantwortungslosen Handeln dieser Frau, der Mutter dieses armen Kindes. Wäre sie ihren Aufgaben nachgekommen, würde Leonie heute lachend vor uns stehen und könnte mit anderen Kindern auf der Wiese herumtollen. Diese Frau da trägt die Schuld daran, dass meiner Tochter ein normales Leben vorenthalten bleibt.«
Martins ausgestreckte Hand zeigte auf Veronika, die in Sekundenschnelle kreidebleich wurde und nach Luft rang. Doch Martin war gerade erst in Fahrt gekommen. Seine Stimme erhielt eine nie gekannte Schärfe.
»Den Rest deines Lebens wirst du mit dem leben müssen, was du angerichtet hast. Glaube nur nicht daran, dass ich das jemals vergessen werde. Jeden Tag werde ich dich daran erinnern, abgesehen davon, dass es Leonie ebenfalls tun wird. Jedes Mal, wenn du ihr in die Augen siehst, wirst du den Vorwurf darin lesen können: Das hast DU mir angetan. DU hast einen Teil von mir getötet. Das kann kein Mensch einem anderen verzeihen.«
Dr. Reinders war aufgesprungen und sah mit strengem Blick auf Martin hinab. Seine Fäuste stemmte er auf die Schreibtischplatte, als er sich an ihn wandte.
»Diese verabscheuungswürdigen Worte, Herr Kay, kann und werde ich nicht gutheißen. Ich gestehe Ihnen heute zu, dass Sie diese nur benutzten, weil Sie sich in einer sicher sehr schwierigen Situation befinden und unter Stress stehen. Selbst wenn Ihre Frau wirklich eine Mitschuld an dieser Tragödie tragen würde, rechtfertigt das nicht eine derartige Reaktion von Ihnen. Ich bin entsetzt. Keine Mutter würde das einer Tochter bewusst antun wollen. Ihr Kind wurde nicht getötet, Herr Kay – es wird lediglich vorerst mit Einschränkungen leben müssen. Und wir Mediziner ebenso wie Sie als Eltern dürfen niemals die Hoffnung aufgeben, dass Leonie eines Tages wieder wie ein völlig normaler Mensch leben kann. Immer wieder werden wir von kleinen Wundern des menschlichen Geistes überrascht und sehen Patienten in diesem Haus wieder, die wir längst als unheilbar entlassen hatten. Niemals dürfen Sie als Eltern die Hoffnung aufgeben, dass ihr Mädchen wieder gesund wird. Ich kann Ihnen nur den Status quo darstellen. Was in zwei oder drei Jahren passiert, kann keiner von uns voraussagen. Reißen Sie sich also zusammen und hoffen Sie mit mir, dass auch hier ein kleines Wunder geschehen wird. Eines Tages möchte ich diesem Mädchen in die Augen sehen können, wenn es auf mich zugelaufen kommt. Und wenn ich das als Außenstehender schon so sehe, sollten Sie das erst recht als Vater hoffen. So, das wollte ich loswerden. Sie beide müssen nun eng zusammenhalten, damit Leonie Ihre Liebe und nicht die Zerstrittenheit zu spüren bekommt.«
Reinders prüfender Blick auf Martin bestärkte seine Zweifel, die sich schon bei ihm eingestellt hatten, als dieser Mann in das Zimmer trat und seiner Frau den Rücken zukehrte. Die Liebe beider Eltern war durch den Zwischenfall mit Leonie weitestgehend zerbrochen und würde mit großer Wahrscheinlichkeit nie mehr in der ursprünglichen Form wiederhergestellt werden können. Schon des Öfteren hatte er Eltern schlechte Nachrichten überbringen müssen. Doch nur sehr selten geriet das Gespräch dermaßen außer Kontrolle wie in diesem Fall. Hier tauschte das Schicksal momentan die einstige Liebe gegen tiefsitzenden Hass, der durch Schuldzuweisungen massiv gestärkt wurde. Genau das würde sich schädlich auf den Gesundungsprozess des Kindes auswirken.
»Wann können wir Leonie nach Hause holen, Herr Doktor?«, riss ihn die schwache Stimme von Veronika Kay aus seinen Gedanken. Bevor er eine Antwort geben konnte, fuhr ihm der Ehemann schon wieder dazwischen.
»Das wird noch einige Tage dauern, da wir erst klären müssen, was ihr neues Zuhause sein wird. Ich werde es nicht ertragen können, dass du dich weiter um sie kümmerst. Aus diesem Grund muss ich nach einer Lösung suchen, wie und von wem meine Tochter zukünftig versorgt wird. Einen weiteren Fehler können wir uns nicht leisten. Das Kind gehört jetzt in professionelle Obhut. Und das, Veronika, kann nur bedeuten, dass ich dich von ihr fernhalte. Ich ziehe noch heute aus, damit das zwischen uns klar ist. Sobald ich eine Bleibe gefunden habe, kümmere ich mich um Leonie. Und eines rate ich dir schon jetzt: Komm mir dabei besser nicht in die Quere.«
Ohne eine Reaktion abzuwarten, erhob sich Martin und knallte die Tür hinter sich zu. Noch lange starrte Veronika auf die geschlossene Tür und reagierte erst, als Dr. Reinders hinter sie trat und beruhigend auf sie einsprach.
»Bleiben Sie bitte noch einen Moment sitzen. Ich gebe Ihnen etwas, was Sie beruhigen wird.« Im Weggehen sprach der Arzt weiter und öffnete den Medikamentenschrank. »Geben Sie ihm Zeit, denn er muss lernen, das alles zu verarbeiten. Ich glaube nicht, dass er seine Worte so gemeint hat, wie er sie äußerte. Er steht unter einem Schock, der aber allmählich abklingen wird. Bald können Sie wieder normal mit ihm reden. Sie müssen jetzt für Leonie die Person sein, die Stärke zeigt. Warten Sie, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Machen Sie bitte Ihren Arm frei.«
Noch lange stand Veronika an der Scheibe, hinter der sie den süßen Lockenkopf ihrer Tochter auf dem Bett erkennen konnte. Kabel zogen sich vom Bett in diverse Geräte, verschwanden hinter Bildschirmen, auf denen ein hämodynamisches Monitoring über ihren Zustand Auskunft gab. Ein ständiges Piepsen und Pulsieren erfüllte den Raum, was bis auf den Flur zu vernehmen war und Veronika einen Schauer über die Haut jagte.
Niemals werde ich dich aufgeben, mein Kind. Keiner wird dich mir wegnehmen können. Verzeih mir, Kleines, sollte ich wirklich einen Fehler gemacht haben, als ich Papa den Zettel schrieb. Das werde ich mir niemals verzeihen können. Doch ich mache es wieder gut, auch wenn es das Letzte ist, was ich für dich tun kann. Und habe Papa weiter lieb, denn er leidet sehr darunter, was mit dir geschehen ist. Niemals werden wir dich im Stich lassen.
4
»... verkünde ich somit das Urteil im Sorgerechtsstreit zwischen Frau Veronika Kay, geborene Stiller, und ihrem von ihr getrennt lebenden Ehemann Martin Kay. Die gemeinsame Tochter Leonie Kay verbleibt weiterhin in der Obhut der Mutter, da das Gericht zu der Überzeugung gelangen musste, dass dem Kind dadurch die größtmögliche Fürsorge zukommt. Da Frau Kay ganztägig zur Verfügung steht und keiner Tätigkeit nachgeht, ist für eine ununterbrochene Beaufsichtigung hinreichend gesorgt. Der Ehemann Martin Kay erhält das Recht, die gemeinsame Tochter Leonie alle 14 Tage für einen Tag zu sich zu holen. Die Termine können intern zwischen den Parteien festgelegt werden. Sollte das zu keiner befriedigenden Lösung führen, wird der jeweilige Termin seitens des Gerichtes festgelegt. Gegen das Urteil können innerhalb der gesetzlichen Frist Rechtsmittel eingelegt werden. Die Sitzung ist hiermit geschlossen.«
Obwohl Martin Kay schon im Verlauf der Verhandlung davon überzeugt war, dass genau dieses Urteil gegen ihn ergehen würde, schlug er mit der Faust auf den Tisch und schrie seinen Frust heraus, bevor ihn sein Anwalt zurückhalten konnte.
»Dieses Urteil erkenne ich nicht an. Das ist ein abgekartetes Spiel und benachteiligt wieder einmal uns Männer, so als wären wir nicht in der Lage, einem Kind die notwendige Fürsorge zu bieten. Nur durch die Nachlässigkeit dieser Frau dort ist meine Tochter in diese Situation geraten. Sie allein trägt die Schuld am Zustand meiner Tochter – sie allein. Dem Kind wird es an Liebe fehlen, die es gerade jetzt dringend braucht. Ich hatte angeboten, dass ich eine Fachkraft für Leonie einstelle. Warum in Gottes Namen wird das nicht berücksichtigt?«
Mehrfach schlug der Vorsitzende Richter Schopper mit dem Holzhammer auf die Schale und stoppte so Martin Kays Einspruch.
»Ich fordere Sie auf, sich zu beherrschen, da ich ansonsten eine Ordnungsstrafe wegen Missachtung des Gerichts verhänge. Ihre Einwände wurden im Laufe der Verhandlung hinreichend berücksichtigt und sind in das Urteil eingeflossen. Herr Anwalt, bitte belehren Sie Ihren Mandanten über die rechtlichen Folgen, sollte er weiterhin in der Art und Weise dem Gericht gegenüber auftreten.«
Richter Schopper erhob sich und verließ den Sitzungssaal. Noch hatten die wenigen Zuhörer den Saal nicht komplett verlassen, als Martin Kay losstürmte und erst kurz vor Veronika stoppte. Ihre Anwältin, Marianne Kleber, hatte ihn kommen sehen und sich schützend vor sie geschoben. Sie stellte sich Martin Kay tapfer entgegen.
»Lassen Sie das, Herr Kay. Sie haben schon genug Porzellan zerschlagen und das Urteil gehört. Es bringt nichts, wenn Sie jetzt Ihre Frau angehen. Lassen Sie uns das weitere Vorgehen bezüglich der Besuchszeiten in aller Ruhe, aber an einem anderen Ort besprechen. Worte sind für heute genug gewechselt. Gehen Sie und überdenken Sie Ihr Tun noch einmal. Noch kann alles gut werden.«
»Glauben Sie das wirklich, Frau Anwältin? Sind Sie tatsächlich der Meinung, dass Ihre Mandantin in der Lage ist, ein behindertes Kind großzuziehen? Sie ist gerade einmal in der Lage, morgens unfallfrei aus dem Bett zu kriechen und sich einen Kaffee zu kochen. Um meiner Tochter eine gute Mutter zu sein, bedarf es schon etwas mehr als das. Sie wird Leonie in die Obhut einer geeigneten Therapie geben müssen. Das, sehr geehrte Frau Kleber, hätte ich auch tun können.«
»Im letztgenannten Punkt bin ich auch Ihrer Meinung. Das hätten Sie ebenfalls tun können. Doch besteht immerhin die Befürchtung, dass Sie dieses Vorhaben ebenso in den Sand setzen wie die damalige Aufgabe, ein Medikament zu besorgen.« Frau Kleber hob die Hand, um Martin Kay daran zu hindern, aufzubrausen. »Außerdem widerspreche ich vehement Ihrer Behauptung, Frau Kay wäre eine schlechte Mutter. In den vielen Gesprächen zuvor habe ich den Eindruck gewonnen, dass Ihre gemeinsame Tochter – das gemeinsam möchte ich an dieser Stelle besonders betonen – es niemals besser hätte treffen können. Auch das Gericht hat sich dieser Meinung in allen Punkten angeschlossen. Niemand hier im Saal will Ihnen absprechen, dass Sie alles geben würden, um Ihrer Tochter ein gutes Zuhause zu bieten. Doch vergessen Sie für einen Augenblick Ihren Drang, dieser Frau ein Schuldgefühl einzuimpfen. Sie haben einst aus Liebe zueinander geheiratet, ein Kind gezeugt. War das alles Lüge? Ist dieses wertvolle Gefühl in dem Moment verloren gegangen, als es zu diesem fatalen Irrtum mit dem vermissten Zettel kam? Und bitte vergessen Sie nicht, dass Sie tagsüber einem Beruf nachgehen. Wann wollen Sie für Ihre Tochter außerhalb der Schule und der Therapie da sein?«
An dieser Stelle unterbrach Frau Kleber bewusst ihren Monolog und beobachtete Martin Kay, der sich mit einer ruckartigen Bewegung von der Hand seines Anwaltes befreite, die auf seinem Arm lag und ihn zurückhalten wollte. Allerdings bemerkte sie freudig, dass ihre Worte diesen erregten Mann zumindest nachdenklich gemacht hatten. Sie nutzte die Gelegenheit und legte noch mal nach.
»Denken Sie an die schönen Stunden zurück, die Sie gemeinsam mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter in trauter Zweisamkeit verbrachten. Glauben Sie wirklich, dass Veronika Kay von jetzt auf gleich zu einem Monster mutierte, das sich nun gegen die eigene Tochter wendet? Überdenken Sie bitte noch einmal in aller Ruhe, ob es nicht besser wäre, zum Wohl Leonies an einem gemeinsamen Strick zu ziehen. Gerne biete ich mich als Mittlerin an, obwohl ich eigentlich als geschiedene Frau nicht unbedingt zur Paartherapeutin taugen sollte. Dürfen wir nun den Saal friedlich verlassen, Herr Kay? Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und genügend Einsicht – zum Wohl des Kindes.«
Erstaunlich friedfertig trat Martin Kay einen Schritt zurück. Das Wilde war einem Blick gewichen, der nachdenklich auf Veronikas Gesicht ruhte. Ihre Augen drückten jedoch noch immer Unsicherheit und Restangst aus, da sie noch nicht verstand, was momentan in seinem Kopf vor sich ging. Erst als sie den Arm der Anwältin um ihre Schulter spürte, fühlte sie sich sicherer und ließ sich aus dem Saal führen. Martin folgte den beiden und schob sich durch das Spalier der Zuhörer, die immer noch darauf hofften, dass es zu weiteren Eskalationen zwischen den Parteien kam.
Noch ein letztes Mal drehte sich Veronika ihm zu, bevor sie in das Auto der Anwältin einstieg, das bald im dichten Verkehr verschwand. Eine Unsicherheit, die er hatte um jeden Preis vermeiden wollen, ergriff ihn und ließ die traurigen Augen Veronikas vor seinem geistigen Auge auftauchen. Darunter mischte sich das fröhliche Lachen Leonies, was ihm Tränen in die Augen trieb.
Ich werde dich niemals aufgeben, meine Kleine. Papa ist immer an deiner Seite. Das verspreche ich dir.
5
Veronika konnte nicht hören, worüber sich die beiden im Kinderzimmer unterhielten. Nur eines stand für sie fest: Die zwei waren auf eine besondere, unerklärliche Art miteinander verbunden. Leonie schien seine wenigen Worte, die er noch nicht in korrektem Deutsch aussprach, trotzdem gut zu verstehen. Schon seit Wochen erschien ihr liebenswerter Nachbar fast täglich, um sich nützlich zu machen. Doch die meiste Aufmerksamkeit erhielt Leonie, sobald sie von der Reha nach Hause gebracht wurde. Stundenlang saß Mason neben ihrem Rollstuhl, sprach und spielte mit ihr. Erstaunlicherweise arbeitete sie sogar mit ihm die Schulaufgaben ab, die ihr eine Mitschülerin stets vorbeibrachte. Er begründete dies Veronika gegenüber, dass er dabei selbst dazulernte. Frau Valentin, Leonies Lehrerin, die hin und wieder vorbeischaute, lobte die beiden sogar dafür und äußerte sich zufrieden mit den Ergebnissen.
Wenn Mason und Leonie miteinander spielten, ging es zumeist um das Erraten von Gegenständen und Begriffen, die einer von beiden beschrieb. Veronika erinnerte sich daran, das auch mit ihrem Vater gespielt zu haben. Es hieß damals: Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ... Die Freude über eine gelungene Antwort äußerte sich oftmals bei Leonie in überlautes Kreischen und Händeklatschen. Obwohl es manchmal nervig für Veronika war, verdrängte ein Lächeln jedes Mal den Unmut über den Lärm. Leonie war überglücklich, wenn Mason in ihrem Zimmer auftauchte. Neuerdings schloss sie neben Mama und Papa auch ihn in ihr Nachtgebet ein. Anfangs irritierte dieser Wunsch. Doch nachdem Veronika davon überzeugt war, dass dieser freundliche Mann ihrem Kind guttat, warf sie alle Bedenken über Bord und ließ die beiden sogar allein, wenn sie etwas außerhalb zu besorgen hatte. Was ihr viel mehr Sorgen bereitete, war die Tatsache, dass Martin sich schon seit vier Wochen nicht mehr gemeldet hatte. Auch das letzte Treffen mit Leonie ließ er verstreichen, ohne dafür eine Erklärung zu liefern. Den ganzen Nachmittag hatte Leonie geweint, da sie sich immer auf die Tage mit ihrem Vater freute. Sein Ausbleiben hinterließ Fragen, zumal er auch nicht ans Telefon ging. Besonders schlimm empfand es Veronika, dass er sogar den siebten Geburtstag seiner Tochter vergessen hatte.
Mit großer Freude beobachtete Veronika, wie bemüht Leonie war, die Übungen aus der Reha zu Hause zu wiederholen. Mason half tatkräftig mit und lobte die Kleine unablässig, wenn sie eine Übung erfolgreich beendet hatte. Tränen der Rührung traten Veronika in die Augen, als Leonie ihren besten Freund spontan umarmte und ihm ins Ohr flüsterte, dass sie ihn sehr lieb habe. Danach schlief sie in ihrem Bettchen ein. Mason hatte sie vorsichtig rübergehoben und sie zugedeckt. Nun erschien er in der Küche und beobachtete Veronika beim Putzen der Schnittbohnen.
»Setz dich, Mason. Ich bin gleich fertig, und dann machen wir uns einen Tee.«
»Das kann ich doch übernehmen. Mach ich doch gern. Earl Grey oder Friesentee? Oder möchtest du etwas zur Beruhigung?«
»Egal, Mason. Schön, dass wir einmal wieder Zeit haben, miteinander zu sprechen.«
Still arbeitete Mason am Wasserkocher weiter und platzte mit der Frage heraus, ohne sich dabei umzudrehen.
»Darf ich dich etwas fragen? Ich wollte es schon vor einiger Zeit tun, habe mich aber nicht getraut.«
»Aber natürlich Mason. Nur raus damit. Du solltest wissen, dass du mich immer alles fragen darfst. Das scheint ja etwas besonders Wichtiges zu sein. Ich höre.«
»Einen kleinen Moment noch, Veronika. Bin sofort fertig. Ich möchte dir dabei gerne ins Gesicht sehen.«
»Ups, jetzt machst du mich aber neugierig. So schlimm?«
Eine Antwort blieb ihr der Nachbar so lange schuldig, bis er die heißen Teetassen endlich auf dem Tisch abgestellt und Kandis hineingelegt hatte. Veronika drängte nicht weiter und wartete ab, was es so Dringendes an Fragen gab. In die Stille hinein ließ Mason die Katze aus dem Sack.
»Vertraust du mir, Veronika?«
Mit einer so direkten Frage hatte sie nicht gerechnet und versuchte auf die Schnelle, einen Sinn dahinter zu erkennen. Es gelang ihr nicht auf Anhieb. Sie wagte jedoch einen Versuch.
»Bezieht sich diese Frage auf den Umgang mit mir oder mit Leonie?«
»Eigentlich betrifft es euch beide. Schließlich vertraust du mir deine kleine Tochter an, während du abwesend bist. Bedenkt man, dass wir uns erst wenige Monate kennen, ist das ein erstaunlicher Vertrauensbeweis.«
Mason ertrug geduldig den jetzt nachdenklichen und forschenden Blick seiner Nachbarin.
Warum in Gottes Namen stellt mir Mason diese Frage? Ich habe ihm keinen Anlass dazu geliefert. Gibt es etwas, was er bisher vor mir verborgen hat? Ein düsteres Geheimnis?
»Ich muss gestehen, dass du mich im Augenblick stark verunsicherst. Tu mir den Gefallen und lass raus, was du mir unbedingt erzählen musst. Ja, zugegeben, allzu viel weiß ich nicht von dir. Frage mich bitte nicht, warum ich dir keine Fragen gestellt habe. Ich weiß es selber nicht. Aber ich habe mich in meinem Leben bisher immer auf mein Bauchgefühl verlassen, und das sagt mir, dass ...«
»Ein solches Gefühl kann oftmals täuschen. Bitte verstehe mich nicht falsch, aber hättest du deinem Mann zugetraut, dass er sich so gegenüber dir und Leonie verhalten würde? Es geht mich auch gar nichts an, was zwischen dir und Martin passiert ist oder auch noch passieren wird. Für mich ist nur wichtig, dass du keinen falschen Eindruck von mir bekommst, sollten dir einmal Gerüchte zugetragen werden.«
»Moment, Mason«, unterbrach Veronika, wobei sie aus ihrer plötzlichen Verunsicherung kein Geheimnis machte. Ihre Hände strichen jetzt Falten aus der Tischdecke, die nicht vorhanden waren, ihre Augen suchten die von Mason.
»Was sollte mich daran stören? Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich plötzlich an dir zu zweifeln beginne. Ist es so schlimm, dass du es unbedingt loswerden möchtest, bevor ich es von anderer Stelle erfahre?«
Die jetzt entstehende Pause ließ Angst in Veronika aufsteigen, die sie sich nicht erklären konnte. Nur mit Mühe ertrug sie das momentane Schweigen dieses Mannes, dem sie bisher absolutes Vertrauen entgegengebracht hatte.
Was weiß ich überhaupt von ihm? Ja, er war von Anfang an freundlich zu ihnen und hatte auch sofort Leonies Vertrauen gewonnen. Als er sich vorstellte, erfuhren sie schon beim ersten Tee, dass Mason ein Kiwi, besser gesagt ein Maori aus Neuseeland war. Dass er sich die Schuhe beim Betreten ihrer Wohnung auszog, war von ihnen anfangs nur als höfliche Geste angesehen worden. Besonders stolz war er auf seine Heimatstadt Rotorua, da dort die Wurzeln der Maoris liegen. Doch es musste noch etwas geben, was er bisher vor ihnen verborgen gehalten hatte.
»Mason, bitte mach es nicht so spannend. Du glaubst gar nicht, was du mit deiner Geheimniskrämerei momentan bei mir anrichtest. Es macht mir Angst, wenn du dich so benimmst. Hat es etwas in deiner Vergangenheit in Neuseeland gegeben, was für mich, ich meine damit auch Leonie, von Bedeutung ist? Du kannst über alles mit mir reden. Wenn ich eines in meinem bisherigen Leben gelernt habe, ist es die Tatsache, dass niemand von uns perfekt ist und wir alle eine Leiche im Keller haben. Das möchte ich allerdings bei dir nicht im wörtlichen Sinne verstanden wissen. Was also ist so unglaublich wichtig?«
Nur kurz blitzte etwas in Masons Augen auf, was jedoch sofort wieder verschwand. Doch es war Veronika nicht entgangen. Gespannt wartete sie auf eine Erklärung. Die kam jedoch auf eine Art, wie sie es nie erwartet hätte.
»Bitte entschuldige, wenn ich für einen Moment irritiert war. Aber du hast unbewusst genau den Punkt berührt, der wie ein Damoklesschwert über mir schwebt.«
Wieder entstand eine dieser Pausen, die Veronika fast in die Verzweiflung trieb. Mason befreite sie sofort von dieser Ungewissheit, als er weitersprach. Allerdings folgte der Schock postwendend.
»Ich hatte tatsächlich eine Leiche im Keller.«
Sofort griff Mason nach Veronikas Hand, als er bemerkte, dass sie diese zurückziehen wollte. Er hielt sie fest und beugte sich vor.
»Siehst du, genau das habe ich gemeint, als ich dir sagte, dass dieses Schwert über mir schwebt. Auch du glaubst sofort, dass ich eine Schuld daran trage. Beruhige dich und lass mich erklären, was damals geschah.«
»Bitte Mason, ich weiß nicht, ob ich darüber etwas hören möchte. Ein Toter in deinem Keller trägt nicht unbedingt dazu bei, dass ich mich beruhige.«
Fester umklammerte er ihre Hand und rückte noch näher heran, was Veronika mit einem gewissen Unbehagen erfüllte.
»Du musst mir einfach zuhören – bitte tu das, damit du verstehen kannst, welche Last auf mir liegt.«
Veronika blieb eine Antwort schuldig, wehrte sich aber nicht weiter, da sie in seinen Augen dieses Flehen erkannte, das ihr schließlich ein schwaches Nicken abrang.
»Es war vor sieben Jahren, während wir wieder einmal einen heißen Sommer durchlebten und eine Menge Tiere wegen der Dürre verloren. Ich hatte mir auf der Nachbarfarm neben meinen Eltern eine eigene Existenz mit Schafen aufgebaut und wusste, dass sie sich rührend um ein Waisenkind kümmerten. Auch ich mochte den kleinen Noah, zumal er als Adoptivkind mein Halbbruder war. Er half auch fleißig auf der Farm. Eines Tages wurde ich angerufen, dass die Gebäude meiner Eltern nach einem heftigen Gewitter in Brand geraten waren und alles in Schutt und Asche gelegt wurde. Meine toten Eltern fand man zwischen den Trümmern und verendeten Tieren. Mein Vater soll wohl noch versucht haben, mit Wassereimern aus dem Brunnen die Flammen zu bekämpfen. Nach zwei Tagen, als die letzten Glutnester gelöscht waren, durchsuchte man die restlichen Trümmer und man fand im Keller den toten Noah. Zuerst hieß es, dass der Junge durch eine Rauchgasvergiftung, also durch Kohlenstoffmonoxid, ums Leben gekommen war. Da der Körper weitestgehend unversehrt im Keller lag, untersuchte man ihn näher. Dabei fand man zwei Verletzungen. Eine nicht erklärbare Beule am Hinterkopf und ungewöhnliche Verletzungen im Analbereich des Jungen.«
»Und die Polizei vermutete, dass dein Vater den Kleinen ... missbraucht hat?« Veronika wartete einen Moment ab, bevor sie weitersprach. »Und? Hat er?«
»Um Gottes willen. Das hätte mein Vater niemals tun können. Er liebte zwar Kinder, aber doch nicht so. Nein, Veronika. Es kam noch anders. Man stellte neben Vaters auch DNA am Körper meines Halbbruders fest, die den Verdacht auf mich lenkte. Man stelle sich das vor. Nur weil meine DNA bei ihm gefunden wurde, fiel ein gefährlicher Verdacht auf mich, obwohl ich fast täglich mit ihm zusammen war. Als dieser Verdacht auf welche Weise auch immer an die Öffentlichkeit geriet, wandte sich jeder gegen mich und stellte mich als Pädophilen hin. Bevor man über die Absurdität nachdachte, vorverurteilte man mich schon.«
Obwohl die Erzählung Veronika schockte, regte sich in ihr gleichzeitig der Widerspruch.
»Hat man denn weiter keine Spuren gesichert. Ich meine, wenn man einen solchen Verdacht äußert, müssen doch Belege vorhanden sein. Ich habe mal gelesen, dass man dann auch nach Spermaspuren sucht. Waren die denn ...?«
»Nein, nein, man hat seltsamerweise nichts dergleichen gefunden. Man ging folglich davon aus, dass der Täter, falls es überhaupt einen Übergriff gab, zumindest so vorsichtig war und ein Kondom benutzt hat.