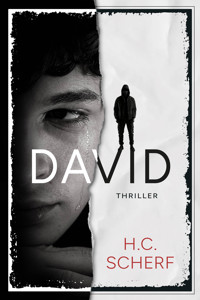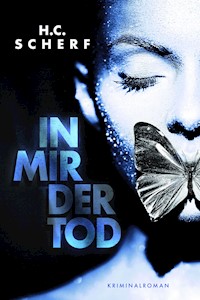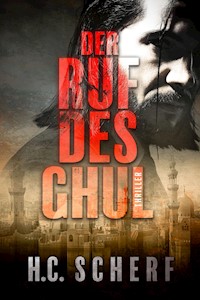3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Monate der Schwangerschaft hatten die Liebe zu dem Wesen geschaffen, das in ihr heranwuchs. Doch sie wird ihr Kind niemals kennenlernen. Man findet Daniela Feige irgendwo am Straßenrand abgelegt, medizinisch gut versorgt. Niemand kann ihr sagen, was mit ihrem Kind passierte, das man fachmännisch entbunden hatte. Doch sie wird nicht die Einzige bleiben, die dieses Schicksal teilt. Eine speziell dafür eingerichtete Essener Soko ermittelt in einem Fall, der einen global eingerichteten Babyhandel vermuten lässt. Alle Recherchen führen die engagierten Ermittler in Sackgassen. Das Darknet gibt seine Geheimnisse einfach nicht preis. Niemand glaubt mehr an einen Erfolg, bis ihnen ein weiteres grausames Verbrechen erste Hinweise liefert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Geraubte Seelen
Von H.C. Scherf
Thriller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Geraubte Seelen
© 2021 H.C. Scherf
Ewaldstraße 166, 45699 Herten
Alle Rechte vorbehalten
Aktives Mitglied im Selfpublisher-Verband e.V.
Covergestaltung: VercoDesign, Unna
Bilder von:
Maximillian Cabinet / Shutterstock
Serkan Mutan / Shutterstock
Yiannisscheidt / Shutterstock
Ollyy / Shutterstock
Lektorat/Korrektorat: Heidemarie Rabe
Dieses E-Book ist geschützt und darf ohne Genehmigung des Autors nicht
vervielfältigt oder weitergegeben werden.
Geraubte
Seelen
Von H.C. Scherf
Kinder, die man nicht liebt, werden Erwachsene, die nicht lieben.
© Pearl S. Buck
1
Der dunkle Schatten hob sich kaum gegen den Hintergrund ab, da das Mondlicht von den dicht stehenden Bäumen eingefangen wurde. Trotzdem bewegte sich der Mann trittsicher durch den Wald, als würde er diesen Weg täglich gehen. Die Last auf seinem Rücken schien ihn kaum zu stören. Nur mit einer Hand verhinderte er, dass der Körper auf seiner Schulter verrutschte. Ab und zu blieb er stehen, sah sich um, als würde er Witterung aufnehmen oder prüfen, ob man ihm folgte. In diesem Zeitraum schienen sogar die nachtaktiven Tiere den Atem anzuhalten, so als würden sie befürchten, von diesem Besucher entdeckt zu werden. Als für einen kurzen Augenblick der Mondschein den Weg durch eine Lücke zwischen den Baumkronen fand, war die Silhouette der Frau erkennbar, die wie ein Sack auf seiner Schulter lag. Ihr Kopf wippte mit jedem Schritt, der den Mann immer tiefer in das Dunkel führte. Ein letztes Mal stoppte er und betrachtete den Waldrand. Er stand vor einer kleinen Lichtung, auf der der Schatten einer Holzhütte verriet, dass er wohl sein endgültiges Ziel erreicht hatte.
Ohne dass eine Bewegung beim Besucher erkennbar war, schob sich die schwere Holztür zur Seite. Das Haus verschluckte die beiden Personen förmlich, bevor die Tür wieder wie von Geisterhand gelenkt zurückfuhr. Dunkelheit umhüllte weiter dieses geheimnisvolle Haus, das nur aus nächster Nähe und mehr durch Zufall von Wanderern entdeckt werden konnte. Kein Weg führte hierher, keine Wanderkarte wies auf das Vorhandensein hin. Zwischen den Ritzen zweier Blendladen blitzte nur kurz schwaches Licht auf. Es war nicht stark genug, um den Waldboden erreichen zu können. Kein Geräusch erklang aus der Hütte. Tiefe Stille erfüllte wieder diesen Komplex des Waldes, selbst das wenige Licht erlosch nach einer Weile.
Die hölzerne Abdeckung neben dem Teppich schloss sich fast geräuschlos und präzise, zeigte kaum eine Fuge, an der man sie hätte auf dem Boden zwischen den wenigen Möbelstücken entdecken können. Es schien, als würde hier schon seit langer Zeit keine Menschenhand mehr gewirkt haben. Dafür entstand Bewegung in dem riesigen Raum, der sich bis weit über die Außenwände der Hütte hinaus unter der Erde erstreckte. Nach und nach entzündete der Fremde dicke Kerzen, die im flackernden Licht erkennen ließen, welch grausige Welt sich hier unten präsentierte. Die Regale an den Wänden waren mit sauberen weißen Decken abgehängt und verdeckten die Gegenstände, die dahinter aufbewahrt wurden. Der Lichtschein der Kerzen drang jedoch nicht in alle Bereiche des verwinkelten Raumes, ließ nur erahnen, dass der Gang tiefer in den Waldboden hineinführte. Für einen Moment verschmolz der Schatten des Mannes mit dem dunklen Hintergrund, zumal er in eine Starre zu verfallen schien. Nur seine Lippen bewegten sich ganz leicht, ließen jedoch keinen Ton heraus. Seine stechenden Augen waren auf den Körper der Frau gerichtet, die nun still auf einem Tisch lag und den Anschein erweckte, dass sie längst nicht mehr unter den Lebenden weilen würde. Fast in Zeitlupentempo bewegte sich der Mann auf den Tisch zu und begann, die Frau zu entkleiden. Sorgfältig legte er die Stücke neben sich über die Lehne eines Stuhls. Er entnahm aus dem Regal daneben einen weißen Umhang, den er ihr stattdessen über den jetzt nackten Leib zog. Erst als er damit fertig war, legte er ihr um Hals, Fuß- und Handgelenke breite Ledergurte, die er unter dem Tisch schloss. Ohne fremde Hilfe würde sie sich daraus niemals mehr befreien können. Genau das lag vermutlich auch in der Absicht des Fremden, dessen Kopf von einer Baumwollmaske verdeckt wurde, in der lediglich die Augenbereiche freigeschnitten worden waren. Für kurze Zeit blitzte dort etwas wie Traurigkeit oder Mitleid auf, das jedoch schnell wieder verschwand. Mit geübtem Griff entnahm er einer seitlich neben ihm stehenden Kiste eine breitklingige Schere. Fast liebevoll drang er damit in das herrlich lockige, dunkelbraune Haar der Frau ein und durchtrennte die einzelnen Strähnen kurz über der Schädeldecke. Große Teile des Haares fielen auf den Boden. Die jetzt durch Stoppeln verunstaltete Kopfhaut nahm dieser Frau einen wesentlichen Teil ihrer Attraktivität. Natürlich blieb der klare Ausdruck einer vorhandenen Schönheit, doch fehlte nun ein dominierendes Element ihrer Weiblichkeit. Zufrieden mit seiner Arbeit verstaute der Mann sämtliches Haupthaar der Frau in einer Tüte und sortierte diese in einen besonderen Bereich innerhalb des Regals direkt neben der schmalen Holztreppe, die zurück in den oberen Raum führte.
Als würde er befürchten, unnötige Geräusche zu verursachen, war der Entführer mittlerweile barfuß und schritt fast feierlich auf den Tisch zu. Seine Hände hatte er wie zum Gebet zusammengelegt und seine Lippen formten Worte, die unausgesprochen blieben. Seine Augen besaßen wieder diese außergewöhnliche Traurigkeit, als er den gewölbten Bauch der schwangeren Frau betrachtete. Er zog sich einen Holzstuhl heran und stellte ihn neben den Tisch. Während er geduldig darauf wartete, dass ihre Betäubung nachlassen würde, legte er das Ohr an ihren Bauch und lauschte. Immer wieder fuhren seine gepflegten Hände äußerst zärtlich über den Leib der Frau, wobei er sogar hin und wieder die Augen schloss. Er nahm den Kopf erst vom Körper seiner Gefangenen, als er Bewegungen spürte, die auf ihr Erwachen hindeuteten. Während er eine Hand weiter auf dem Bauch beließ, rückte er den Stuhl näher an den Kopfbereich der Frau, beobachtete unentwegt das Flackern ihrer Lider. Unvermittelt riss sie ihre Augen weit auf, um sie angsterfüllt im Raum umherirren zu lassen. Nur ein kaum hörbarer erstickter Schrei entfuhr ihren Lippen, als sie endlich den Mann mit der schwarzen Maske erblickte. Ihr Kopf ruckte hoch. Erst als sie aufspringen wollte, bemerkte sie mit Erschrecken die Fesselung. Die Panik, die in ihr aufstieg, war unverkennbar. Immer wieder zerrte sie an den Gurten, bis sie einsah, dass es zwecklos war. Die Verzweiflung in ihren Augen wurde ersetzt durch ein flehendes Bitten.
»Was ... warum bin ich hier? Was tun Sie da? Ich kenne Sie nicht und habe Ihnen nichts getan – warum tun Sie mir das an?«
Die Stimme verlor immer mehr an Kraft, versagte zum Schluss gänzlich. Sie drehte ihr Gesicht weg, als der Fremde versuchte, darüber zu streichen. Es war spürbar, dass sich ihr Körper versteifte, als seine Finger über ihre Stirn strichen. Selbst das Atmen hatte sie für einen Moment eingestellt. Als er die Hand wieder von ihrem Gesicht entfernte, suchte sie vorsichtig den Blickkontakt und schien sich allmählich zu beruhigen.
»Bitte, lassen Sie mein Kind in Ruhe. Nehmen Sie Ihre Hand da weg. Tun Sie meinem Kind nicht weh.«
Mit anwachsender Angst verfolgte die Frau, wie der Fremde erneut sein Ohr auf ihren Bauch legte und horchte. Das Beben ihres Körpers konnte sie nicht verhindern, gab es schließlich auf, sich dagegen zu wehren. Stattdessen überfiel sie ein Weinkrampf, der ihren gesamten Körper erschütterte. Sie konnte nur die letzten Worte des Mannes verstehen, als er auf sie einredete.
»... nichts tun. Sie müssen sich nicht vor mir fürchten. Ich musste es tun, glauben Sie mir. Aber Ihrem Kind wird nichts geschehen.« Nach einigen Sekunden des Schweigens überraschte er sie mit einer Frage. »Es ist ein Junge, nicht wahr? Und Ihr Name ist Daniela. Ich weiß alles über Sie und Ihre Familie.«
»Sie ... Sie wissen, wer ich bin? Wieso sagen Sie so was? Das können Sie nicht wissen, erst recht nicht, dass es ein Junge ist. Ich habe es noch niemandem gesagt und habe es selbst erst vor wenigen Tagen erfahren. Sie lügen mich an oder haben geraten. Das konnten Sie nicht wissen.«
Es klang unter der Maske wie ein kurzes Lachen, bevor sie wieder seine Stimme vernahm.
»Machen Sie sich keine Gedanken darüber, woher ich das alles weiß. Nehmen Sie es einfach als gegeben hin. Nichts würde sich ändern, wenn ich es Ihnen verraten würde, außer, dass ich Sie dann töten müsste. Verstehen Sie mich? Ich müsste Sie zum Schweigen bringen, um mich zu schützen. Also lassen Sie es gut sein und warten einfach ab.«
Daniela, wie sie tatsächlich hieß, schluckte mehrfach und versuchte, ihren Hörsinn zu schärfen, um den Mann möglicherweise an seiner Stimme erkennen zu können. Sie hatte sich in ihrem Beruf als Logopädin angewöhnt, Menschen allein an ihrer Körpersprache und der Klangfarbe zu unterscheiden, da sie von Kindheit an Probleme hatte, sich Namen einzuprägen. Doch nichts an diesem Mann kam ihr auch im Mindesten vertraut vor.
Ich brauche Zeit. Diesem Kerl bin ich niemals begegnet. Wie kann ich ihn nur dazu bringen, mich und mein Kind zu verschonen? Warum hat er uns überhaupt entführt? Er wirkt nicht wie ein Wahnsinniger, der mich quälen und anschließend töten will.
»Es muss doch einen Grund geben, warum Sie gerade mich ausgesucht haben.«
Verzweifelt versuchte Daniela, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Sie wollte sich auf keinen Fall ihrem möglicherweise schlimmen Schicksal ohne Gegenwehr ergeben.
»Wie darf ich Sie nennen. Wie heißen Sie? Immerhin kennen Sie meinen Namen und ich finde, dass ich ein Recht darauf habe, zu wissen, wer mir das alles antut. Also – nennen Sie mir Ihren Namen. Sie bringen mich doch sowieso um.«
Sie glaubte, ein Flackern in den Augen des Fremden erkannt zu haben, kurz bevor er ein leises Lachen ausstieß.
»Sie gefallen mir, Daniela. Wirklich, es gefällt mir, wie Sie versuchen, etwas über mich herauszufinden. Nennen Sie mich einfach Klaus ... oder warten Sie ... besser noch Michael. Was sagt Ihnen mehr zu? Mir ist es egal. Suchen Sie sich einen von beiden aus. Sagte ich Ihnen nicht schon zuvor, dass ich Ihnen etwas antun müsste, wenn Sie wüssten, wer ich wirklich bin? Seien Sie vernünftig und ...«
»Michael ... ich werde Sie Michael nennen. Der Name gefällt mir. Also, Michael, warum halten Sie mich gefangen? Es ist doch nicht normal, dass man eine hochschwangere Frau entführt und ihr gleichzeitig versichert, dass Sie den Tod nicht zu befürchten habe.«
Lange glaubte Daniela, der Mann habe ihre Frage einfach überhört und würde sie schlichtweg ignorieren. Trotz ihrer misslichen Lage nahm sie erfreut seine Erklärung zur Kenntnis, die zumindest einen Einstieg in einen Dialog bedeuten könnte.
»Normal? Sie wollen mir andeuten, dass ich nicht normal bin?«
»Nein, nein, Michael. So habe ich es nicht gemeint. Ich meinte nur ...«
»Schweigen Sie, Daniela! Mir sagt das Wort normal nichts. Wer bestimmt in Teufels Namen, was auf dieser Welt normal ist? Meiner Meinung nach existieren Milliarden von Normalitäten, weil jeder Mensch eine eigene Vorstellung davon hat. Ich lehne es ab, so zu sein, wie man mich gerne sehen möchte. Glauben Sie mir, dass ich aus meiner Sicht völlig normal bin. Sie mögen das anders sehen. Von mir aus. Es ist mir ... verzeihen Sie ... scheißegal. Wir werden uns die nötige Zeit nehmen, damit Sie meine Normalität erkennen können.«
Aus Michaels Stimme konnte Daniela sehr gut heraushören, dass er innerlich erregt war. Sie wollte ihn nicht zu unbedachten Handlungen provozieren und überlegte sich, wie sie mehr aus ihm herausholen konnte. Seine plötzliche Frage löste in ihr, ohne dass sie es logisch erklären konnte, Panik aus.
»Ist es nicht um den Fünfundzwanzigsten herum, an dem Sie gebären würden? Fühlen Sie sich gut?«
»Woher wissen Sie ...? Sie machen mir Angst, Michael. Das können Sie doch gar nicht wissen. Das weiß nicht einmal der Vater. Woher ...?«
Die nun anschwellende Stimme ihres Entführers mahnte Daniela, jetzt vorsichtig zu sein und besser abzuwarten.
»Hören Sie endlich damit auf, mich auszuhorchen. Ich werde es Ihnen eh nicht verraten. Alles geht seinen Weg – alles.«
Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte Daniela jede Bewegung des Mannes. Sie bemerkte auch die Spritze, die er hinter einem Vorhang hervorholte, eine Flüssigkeit aufzog und sich ihr damit näherte.
Oh Gott, hilf mir. Verschone mein Kind, denn es hat verdient zu leben.
2
Das grelle Licht blendete, obwohl Daniela ihre Augen noch immer geschlossen hielt. Viele Hände berührten ihren Körper und Stimmen im Raum sendeten ihr Signale, dass sich eine Menge Menschen um sie bemühte. Der typische Geruch eines Krankenhauses weckte in ihr die letzten Lebensgeister, sorgte dafür, dass sie die Augen weit aufriss.
»Sie ist wieder da, Herr Doktor. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank, der Blutdruck steigt an und der Puls ist regelmäßiger. Wo bleibt das Blut? Wie lange sollen wir noch auf die Transfusion warten?«
Das ungewöhnlich helle Licht sorgte dafür, dass Daniela ihr Umfeld kaum erkennen konnte. Gestalten in grünen Kitteln bewegten sich scheinbar unkontrolliert durch einen weiß gefliesten Raum und steckten Nadeln in ihren Körper. Sie war nicht in der Lage, sich dagegen zu wehren, wusste jedoch gleichzeitig, dass dies nicht ohne wichtigen Grund geschah. Sie schloss ihre Augen wieder und ergab sich willenlos der Situation.
Ich lebe. Er hat mich nicht getötet. Michael hatte sein Wort tatsächlich gehalten.
Ganz weit zurück gingen ihre Gedanken, drangen ein in ein Gewirr von Bildern und Tönen, die ihr die Erinnerung lieferte. Eine schwarze Kapuze – diese ihr unbekannte Stimme – der geheimnisvolle Raum, in dem es nur sie, den Mann und Regale gab. Nichts davon ergab einen Sinn. Fragmente, die lediglich weitere Fragen aufwarfen. Eine von ihnen stach besonders hervor: Wie komme ich hierher, in ein Krankenhaus? Mit müden Bewegungen fuhren ihre Hände über die Unterlage, auf die man sie gebettet hatte. Sie konnte nicht direkt sagen, warum sie es tat. Es geschah aus einem inneren Antrieb. Schließlich blieben sie auf ihrem Unterleib liegen. Es möge nur Sekunden, vielleicht sogar Minuten gedauert haben, bis sie es bemerkte. Er war weg. Unterhalb ihres Busens gab es nicht mehr diesen gewaltigen Hügel, in dem der Kleine heranwuchs und auf die Geburt wartete. Woher Daniela die Kraft nahm, den Kopf zu heben und mit weit aufgerissenen Augen auf ihren Bauch zu starren, konnte sie sich nicht erklären. Sie spürte nur die Hände, die versuchten, ihren Kopf wieder herunterzudrücken. Gleichzeitig drangen schwach die Worte einer Frau wie durch einen dichten Nebel an ihr Ohr.
»Beruhigen Sie sich. Sie befinden sich in Sicherheit. Wir kümmern uns um Sie. Ich gebe Ihnen jetzt etwas, das Sie beruhigen wird. Sie werden danach eine Weile schlafen.«
»Ich ... ich will nicht schlafen«, versuchte Daniela sich zu wehren, spürte jedoch gleichzeitig eine gewaltige Müdigkeit, die in ihr jede Gegenwehr erstickte.
»Wo ist mein Kind? Ich will sofort ...«
Weiter kam sie nicht, da die Wirkung des Beruhigungsmittels prompt einsetzte.
Sie schaffte es nicht, ihre Hand wegzuziehen. Etwas hinderte sie daran.
Krankenhaus, ein Fremder, Maske, Ärztin ... wo ist mein Kind?
Alle Gedanken überfielen sie gleichzeitig, konzentrierten sich allerdings am Ende auf das Kind, das sie scheinbar geboren und es nicht einmal bewusst mitbekommen hatte. Sie riss ihre Hand mit aller Kraft zurück und befreite sie aus der von Rico, der erst entsetzt, schließlich aber verständnisvoll und gütig auf sie herabsah.
»Was tust du hier, Rico? Wo bin ich? Gebt mir mein Kind. Ich will sofort meinen Sohn sehen, ihn in meinen Arm nehmen. Gib ihn mir, Rico!«
»Beruhe dich bitte, Schatz. Du musst noch einen Moment warten, bis die Ärztin kommt. Sie wird dir alles erklären. Du darfst dich nicht aufregen und solltest erst einmal zur Ruhe kommen. Alles wird wieder gut.«
»Nichts ist gut, Rico! Verstehst du? Nichts!«
Daniela versuchte, sich aufzurichten, während sie mit aller Kraft ihre Angst, ihren inneren Schmerz herausschrie. Schlagartig drangen wieder die Bilder aus diesem fürchterlichen Raum in ihr Bewusstsein und befeuerten ihre aufsteigende Panik. Etwas in ihr signalisierte, dass Schreckliches mit ihr passiert sein musste. Um sie herum bemerkte sie nur noch Gesichter und Stimmen, die sie beruhigen wollten. Der Grund konnte nur mit ihrem Kind im Zusammenhang stehen.
Wo bist du, Kleiner? War es eine schwierige Geburt, sodass er noch versorgt werden musste? Ihm ist nichts geschehen. Ihm geht es gut. Warum sieht mich Rico so mitleidig an?
Bevor sie eine Frage an ihren Mann richten konnte, sprang der erschrocken auf, als Dr. Schön nach vorsichtigem Klopfen ins Zimmer trat.
»Sieh an, unsere Patientin ist wach.«
Mit ausgestreckter Hand eilte die Ärztin auf das Bett zu und griff nach Danielas.
»Mein Name ist Dr. Elvira Schön. Ich habe Sie gestern bei der Einlieferung erstversorgt und freue mich darüber, dass es Ihnen wieder besser geht. Wir haben uns zuerst schon Sorgen gemacht, als man Sie einlieferte. Aber Sie können sich später noch bei dem älteren Herrn bedanken, der Sie noch rechtzeitig gefunden hat. Die Adresse hat die Polizei schon. Die Herrschaften möchten übrigens mit Ihnen reden. Ich soll denen Bescheid geben, wenn Sie dazu in der Lage sind. Doch zuerst einmal die Frage an Sie: Wie fühlen Sie sich heute, Frau Feige?«
Absolut verständnislos starrte Daniela auf die Ärztin, um sich wenig später auf Rico zu konzentrieren.
»Man hat mich gefunden? Polizei? Ein älterer Herr? Was soll das alles? Möchte mir jemand endlich erklären, was geschehen ist? Wo ist mein Kind?«
Die letzte Frage schrie Daniela ihrem Mann ins Gesicht und krallte ihre Finger in seinen Arm.
»Was habt ihr mit meinem Kind gemacht?«
»Beruhigen Sie sich, Frau Feige. Wir wissen ...«, versuchte Dr. Schön einzuwerfen, wurde jedoch von Danielas Weinkrampf unterbrochen.
»... der Kleine ist tot. Ihr wollt es mir nur nicht sagen. Ist es nicht so? Rico, sage mir, dass ich mich irre. Er darf nicht tot sein. Das verbiete ich ihm. Holt ihn endlich her.«
Wieder vergrub sie ihr Gesicht in dem weichen Kissen. Sie spürte kaum, wie die Hand der Ärztin immerwährend über ihren Ärmel strich und sich der Arm Ricos um ihren Kopf legte. Er küsste sie auf das kurzgeschnittene Haar und wischte für Daniela nicht erkennbar die eigenen Tränen aus dem Gesicht. Soeben vernahm er das Flüstern der Ärztin, bevor sie wieder den Raum verließ.
»Bleiben Sie jetzt unbedingt bei ihr und zeigen Sie ihr, dass sie nicht allein ist mit dem Kummer. Ich sage den Beamten Bescheid, dass sie morgen wiederkommen sollen. Ihre Frau braucht noch viel Ruhe. Sie bekommt später noch ein Beruhigungsmittel von mir. Morgen wird hoffentlich alles anders aussehen.«
»Was soll morgen anders aussehen, Rico? Was meint sie damit? Glaubt ihr wirklich, dass ich euer Getuschel nicht gehört habe?«
Energisch fuhr sie mit dem Ärmel des Hemdes über die Augen und funkelte ihren Mann an, der erschrocken zurückwich. Es war mehr eine Verlegenheitsgeste, als er mit der freien Hand durch sein Haar fuhr und den Blick senkte. Er spürte das fordernde Augenpaar Danielas auf seinem Gesicht. In Sekundenschnelle musste er eine Entscheidung treffen, deren Auswirkungen für ihn kaum einschätzbar waren. Schließlich ergab er sich seinem Schicksal und ergriff ihre Hand. Erst fast tonlos, später jedoch mit fester Stimme verkündete er die unumstößliche Wahrheit.
»Sie haben dich gestern gefunden. So wie man mir verriet, hat dir jemand aus Decken und alten Kleidungsstücken quasi ein Bett bereitet und dich auf dem Autobahnparkplatz an der A2 abgelegt.«
Rico hielt einen Moment inne, um das Gesicht zu studieren, in dem er derzeit keine Regung feststellen konnte. Völlig ausdruckslos waren Danielas Augen auf ihn gerichtet, forderten ihn auf, fortzufahren.
»Derjenige, der das getan hat, informierte gleichzeitig den Rettungsdienst und gab denen die Koordinaten durch. Als die mit dem Einsatzwagen eintrafen, hatte sich schon ein Pärchen um dich gekümmert. Es war zufällig sogar ein Arztehepaar, das wenige Meter entfernt sein Fahrzeug abgestellt hatte. Sie leisteten erste Hilfe, da du noch immer Blut verloren hast.«
»Was geschah mit meinem, ich meine, mit unserem Kind? Du verheimlichst mir etwas. Ich will wissen, ob der Kleine ... ob es ihm gut geht. Sag es mir endlich!«
Danielas Fingernägel bohrten sich heftig in Ricos Arm, der sich jedoch nichts anmerken ließ. Er schien den Schmerz nicht zu spüren, da ihn selbst in diesem Augenblick wieder der eigene, innere Schmerz über den Verlust überwältigte. Auch er drückte jetzt das Gesicht in das Kissen, direkt neben dem seiner Frau. Als er Danielas Hand in seinem Haar spürte, riss er sich zusammen und richtete seinen Oberkörper wieder auf. Es war mehr ein heiseres Krächzen, mit dem er die Wahrheit freigab.
Ich muss jetzt unbedingt Stärke zeigen. Sie erwartet das von mir.
»Da war kein Kind, Daniela. Ich würde dir gerne sagen, dass es ihm gut geht und wir uns keine Sorgen machen müssen. Aber das steht in den Sternen. Nur Gott und dein Entführer wissen, was mit unserem Kind geschehen ist. Ich weiß nicht, ob es dich beruhigt, aber die Ärzte meinen, dass du scheinbar eine völlig normale Geburt hattest. Sachkundige Hände müssen dir bei der Geburt geholfen haben. Sogar die Plazenta wäre entfernt worden. Du wurdest professionell versorgt. Was dem Ärzteteam mehr Sorgen bereitete, waren die Verletzungen an den Hand- und Fußgelenken. Du hast viel Blut verloren. Das hat man hier schnell erkannt und dir neues Blut zugeführt.«
Rico wies auf die Infusionsvorrichtung, der Daniela nur einen flüchtigen Blick schenkte. Sie überraschte ihn in diesem Moment mit der Frage, deren Beantwortung er zum jetzigen Zeitpunkt vermeiden wollte.
»Sucht man schon nach ihm? Ich hörte gerade, dass die Polizei hier im Haus war. Was tun die, um den Kleinen zu finden. Ich will mit denen sprechen.«
Bevor Rico eine Antwort liefern konnte, erschien Dr. Schön in der Tür, in der Hand ein Spritzenbesteck. Keines Wortes fähig folgten Danielas Augen der Ärztin und beobachtete sie dabei, wie sie eine Flüssigkeit in den Schlauch drückte, der in eine Infusionsnadel in Danielas Arm mündete. Nur Sekunden später fiel sie in einen erlösenden Schlaf, der sie zumindest für den Moment von den schlimmsten Gedanken befreite.
3
– Vier Jahre später –
Gespannt betrachtete Manuela Stricker die Darstellung ihres Ungeborenen auf dem Bildschirm. Deutlich waren die Bewegungen des kleinen Linus zu erkennen, dessen Herztöne aus den Lautsprechern direkt in Manuelas Kopf drangen. Der Name des Jungen war bereits nach heftigen Diskussionen bestimmt worden, wobei sie in diesem Fall den Vorschlag des Vaters akzeptiert hatte. Im Gedenken an einen Onkel, einen verdienten Umweltaktivisten, sollte er dessen Namen erhalten. Ein unglaubliches Glücksgefühl erfüllte sie, als sie den Blick des neben ihr sitzenden Vaters suchte. Lennard Kohland versuchte zumindest, ein zufriedenes Leuchten in seine Augen zu zaubern, was ihm nur ansatzweise gelang. Schließlich war er von Anfang an bemüht, Manuela das Austragen dieses Kindes auszureden. Vor allem für sie stand die berufliche Karriere auf dem Spiel, wenn der kleine Linus das Licht der Welt erblicken würde. Das Studium zur Kinderärztin würde zumindest für eine längere Zeit unterbrochen werden. Doch hatte Manuela ihm klargemacht, dass sie das Kind um jeden Preis haben wollte. Eine Abtreibung kam für sie niemals in Frage. Schockierend deutlich war ihre Aussage, dass sie dazu sogar die Trennung von ihm, dem erfolgreichen, aber auch noch verheirateten Unternehmer riskieren würde. Die Frage, ob sie auf Unterhalt bestehen würde, hatten sie erst gar nicht aufgeworfen, schwebte jedoch wie ein Damoklesschwert über ihm. Mitten in seine Gedanken drang die Stimme von Dr. Askari Berrada, der währenddessen neues Gleitgel auftrug und die Sonde des Ultraschallgerätes über Manuelas Bauch gleiten ließ.
»Hören Sie das kleine Herz, wie schnell es schlägt? Ich kann mich nur wiederholen, wenn ich Ihnen sage, dass der kleine Linus alles mitbringt, um ein gesunder, strammer Kerl zu werden. Ich finde, dass er für den achten Monat schon eine kräftige Statur zeigt. Er ist sehr gut entwickelt. Ich bin zufrieden.«
»Danke, Herr Doktor. Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich bin. Das ist aber noch so lange hin, bis ich ihn in den Armen halten kann.«
»Das geht jetzt schnell, Frau Stricker. Ich kenne diese Ungeduld bei meinen Patientinnen. Und doch höre ich immer wieder, wie überrascht die Eltern später sind, wie schnell die Zeit der Schwangerschaft doch vorbei war. Lassen Sie sich bitte vorne den nächsten Termin geben. Wir sehen uns dann bald wieder. Hat es eigentlich mit der Hebamme geklappt, von der ich Ihnen die Telefonnummer gegeben habe?«
»Aber sicher, Herr Doktor. Dafür muss ich mich bei Ihnen bedanken. Sie sagte mir, dass sie eigentlich total ausgebucht ist. Aber ich hatte Glück, obwohl man es nicht so nennen darf, wenn eine ihrer Kundinnen eine frühe Fehlgeburt hatte und somit ein Termin frei wurde. Eine schreckliche Vorstellung, so was als Mutter durchmachen zu müssen. Ich würde wahnsinnig.«
»Ja, Frau Stricker, das kann ich gut nachvollziehen. Leider erlebe ich immer wieder mal, dass so was geschieht, und weiß an manchen Tagen nicht, wie ich den Betroffenen Mut machen soll. Da fehlen selbst mir die Worte. Das Leid muss unglaublich sein.«
»Sind wir für heute durch, Dr. Berrada? Ich habe noch einen wichtigen Geschäftstermin und muss unbedingt jetzt abbrechen. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder.« Lennard Kohland drückte Manuela noch flüchtig einen Kuss auf die Stirn, bevor er nach seinem Diplomatenkoffer griff und sich der Tür zuwenden wollte. Manuelas Frage hielt ihn noch einen Moment zurück.
»Sehen wir uns heute Abend bei mir?«
»Oh, Verzeihung, Schatz. Ich hatte ganz vergessen, dass ich heute noch ein Geschäftsessen habe. Ich hatte dir doch von dem Unternehmen aus Grafenau berichtet. Das muss heute Abend noch in trockene Tücher gepackt werden. Vorher muss ich den Mitarbeitern den neuen Mann für die Ausbildungsabteilung vorstellen. Ich rufe dich an, Schatz.«
Lennard wartete die Antwort Manuelas nicht ab und verschwand eilig durch die Tür. Dr. Berrada entsorgte vorerst schweigend seine Instrumente, während Manuela sich ankleidete. Er besaß ein feines Gespür für Spannungen zwischen Paaren, wobei alle bemüht darum waren, sie vor ihm geheim zu halten. Seine Worte ließen Frau Stricker innehalten.
»Eigentlich geht es mich ja nichts an, Frau Stricker, aber wie ich von Ihnen erfuhr, werden Sie ja in einigen Jahren eine Kollegin sein. Insofern erlaube ich mir, diese Frage zu stellen. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie Ihr Kind nicht auch allein großziehen können?«
Die Worte klangen immer wieder nach, während Manuela versuchte, den Grund für diese Frage herauszufinden. Sicher hatte sie Dr. Berrada von ihren beruflichen Zielen erzählt, doch nichts über ihre zugegebenermaßen schwierige Beziehung zu Lennard.
Wieso stellt mir Dr. Berrada diese Frage, nach deren Antwort ich schon lange suche.
Darum bemüht, ihn ihre Überraschung nicht anmerken zu lassen, drehte sie sich dem Arzt zu und schloss gleichzeitig ihren BH.
»Sie haben recht, Dr. Berrada, es geht Sie wirklich nichts an. Aber warum stellen Sie mir überhaupt diese Frage? Wir haben doch nie über mein Verhältnis zu Herrn Kohland gesprochen. Sicher, seine Begeisterung hält sich in Grenzen, was Sie höchstwahrschein zu der Annahme verleitet, dass er das Kind nicht möchte und einen schlechten Vater abgeben könnte. Doch das kann ja auch eine unbewusste Reaktion bei ihm sein.«
»Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hätte das nicht fragen dürfen. Meine Aufgabe ist, mich um Ihr ...«
»Nein, nein, Herr Doktor, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich gebe sogar zu, dass ich froh darüber bin, dass jemand mit mir über meine diesbezüglichen Gefühle spricht. Ich ... ich bin mir selbst nicht sicher darin.« Manuela knöpfte ihre Bluse zu und setzte sich auf eine an der Wand stehenden Liege. »Merkt man mir meine Zweifel denn so deutlich an? Lennard, ich meine damit Herrn Kohland, ist ein sehr charmanter, zärtlicher Mann. Doch seine Vorstellung von Familie unterscheidet sich schon von der, die ich habe. Er wollte kein Kind. Es ist einfach geschehen.«
Dr. Berrada hatte auf einem Hocker Platz genommen und die Arme vor der Brust verschränkt. Seine Augen ruhten in Manuelas, versuchten, in ihrem Gesicht zu lesen.
»Ist das Ihrer Meinung nach ein zwingender Grund, seine Lebensplanung auf jemanden zu stützen, der sichtlich nicht ihre Traumvorstellung von einem idealen Partner abbildet? Sie haben das Recht und die Pflicht, darüber nachzudenken – besonders im Sinne Ihres Kindes. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin kein Eheberater und mag mit meiner Meinung völlig danebenliegen. Doch da steht nach meinem Gefühl etwas zwischen Ihnen und Herrn Kohland. Fragen Sie mich nicht, was ich damit meine. Das kann ich selbst nicht erklären. Doch ich war der Meinung, dass ich es Ihnen auf jeden Fall sagen sollte. Sie können mich jetzt deshalb hassen, aber damit muss ich dann leben. Doch tun Sie mir einen Gefallen: Denken Sie zumindest über Ihre eigenen Zweifel nach, wenn Sie schon meine nicht ernst nehmen möchten. Sie sind es sich selbst und dem Kind schuldig.«
Noch lange blieb Manuela nachdenklich hinter dem Steuer sitzen und strich gedankenverloren über ihren Bauch, unter dessen Haut sie die Bewegungen des Jungen deutlich spüren konnte.
»Na, was denkst du, Kleiner? Wie würdest du deinen Papa finden? Kommst du mit ihm zurecht, auch wenn er dich nicht so richtig gewollt hat? Das sollten wir zwei noch einmal ausdiskutieren, mein Schatz. Nun müssen wir los. Ich will noch nach dem Kinderbett sehen, das ich im Katalog gesehen habe.«
Als könnte das ungeborene Kind sie verstehen, hatte Manuela die Fragen laut ausgesprochen. Ihr Lächeln war eingefroren und Zweifel waren deutlich in ihrem Gesicht abzulesen, als sie den Motor des Passats startete und sich in den Verkehr auf der Kaulbachstraße eingliederte.
4
»Was soll das heißen, Sie können Frau Stricker nicht erreichen? Haben Sie es auch bei ihr zu Hause über das Festnetz versucht? Versuchen Sie es weiter, Frau Hermes, sie muss doch irgendwann und irgendwo auftauchen.«
Lennard Kohland warf seiner Sekretärin einen Blick zu, in dem ein versteckter Vorwurf klar erkennbar war. Obwohl sie gerade einmal knapp die eins fünfundvierzig überschritten hatte, schrumpfte sie noch um wenige Zentimeter und verschwand mit zusammengezogenen Schultern in dem langen Flur, von dem auch ihr kleines Büro abzweigte.
Ich sollte besser seine Frau anrufen und sie aufklären, was sich hinter ihrem Rücken abspielt.
Voller Zorn ließ sie sich in ihren Drehstuhl fallen und starrte auf das Display ihrer Telefonanlage. Mindestens zwölfmal hatte sie es schon versucht, die Geliebte des Chefs zu erreichen. Jeder im Haus wusste von seiner Beziehung, doch nur sie allein besaß die Kenntnis über die bestehende Schwangerschaft. Schon mehrfach hatten sie beide darüber diskutiert. Warum er ausgerechnet ihr davon erzählt hatte, entzog sich ihrer Vorstellungskraft, zumal sie kein so inniges Verhältnis pflegten, wie man es als Voraussetzung zwischen Chef und der Sekretärin erwartete. Siegrid gab zu, dass sie seine Art, damit umzugehen, als verwerflich einstufte. Offen äußerte er sich ihr gegenüber, dass er sogar Zweifel daran hätte, tatsächlich der biologische Vater zu sein und dass er sich ernsthaft überlegte, das später auch überprüfen zu lassen. Sie, die ihr bisher einziges Kind damals nach sechs Monaten verloren hatte, war von Abscheu erfüllt. Sie und Ernst hatten daraufhin beschlossen, keine zweite Schwangerschaft anzustreben. Sie wollte nicht ein weiteres Mal mit der Ungewissheit leben, ob es gesund geboren werden könnte.
Kohland, du bist ein mieser Dreckskerl. Du hast nur Angst davor, dich scheiden zu lassen, da du dann nicht mehr auf das Vermögen deiner Frau hoffen darfst.
Siegrid Hermes kannte die Geschichte der Firmeninhaber und wusste, dass das Grundkapital dieses Unternehmens aus dem Erbe der Familie Schleidig stammte. Wenn Lara ihr Kapital abziehen würde, war Lennard Kohland erledigt. Das Fatale an der Sache war nur, dass sie alle hier ihren Job verlieren würden. Darin lag einer der Gründe, warum Siegrid das Spiel überhaupt mitspielte. Begleitet von einem tiefen Seufzer drückte sie die Wiederholungstaste und bekam lediglich die automatische Durchsage, dass der Teilnehmer derzeit nicht erreichbar wäre. Auf der Festnetznummer gab es nur das Freizeichen. Sie gab auf und widmete sich ihren restlichen Aufgaben.
Erst als sie der melodische Ton der Anlage aufsehen ließ, warf sie einen Blick auf das Display. Eine ihr unbekannte Nummer wurde angezeigt. Nachdem sie sich mit der üblichen Ansage gemeldet hatte, vernahm sie die etwas harte Stimme einer Frau, die sich als Kriminalkommissarin des örtlichen Morddezernates vorstellte.
»Ich bin mit einer Kollegin auf dem Weg zu Ihnen und möchte fragen, ob sich Herr Kohland im Haus befindet? Wenn ja, sagen Sie ihm bitte Bescheid, dass wir in etwa zehn Minuten bei Ihnen sind und ihn gerne befragen möchten.«
»Darf ich ihm zuvor eine Information zukommen lassen, worum es genau geht? Herr Kohland ist viel beschäftigt und hat schon in knapp einer halben Stunde ein erneutes Meeting. Sollten wir nicht besser einen Termin vereinbaren?«
»Sagen wir es einmal so. Es ist dringend und es betrifft ihn persönlich. Wir möchten ihn also unbedingt darum bitten sich die Zeit zu nehmen. Mehr möchte und darf ich Ihnen dazu nicht sagen. In zehn Minuten also.«
Die Kommissarin hatte die Verbindung ohne Erklärung unterbrochen. Nachdenklich betrachtete Siegrid Hermes das jetzt fast leere Display.
In was war Kohland denn nun wieder verwickelt? Schon früher gab es hier und da Ermittlungen, bei denen die Mitarbeiter zur Sache befragt wurden. Doch in den Fällen handelte es sich lediglich um den Verdacht von Drogenhandel oder Körperverletzung. Das kam schon einmal vor, wenn diese nicht immer hochanständigen Angestellten im Einsatz waren. Doch so wie ich verstanden habe, gehörten die beiden Beamten zur Mordkommission.
»Was gibt es, Frau Hermes? Haben Sie Frau Stricker erreichen können?«
Kohland holte seine Sekretärin aus ihren Überlegungen.
»Noch nicht, Chef. Aber da wäre etwas anderes. Soeben erhielt ich einen Anruf von der Polizei. Zwei Kommissarinnen der Mordkommission befinden sich auf den Weg hierher und werden in wenigen Minuten eintreffen. Man will unbedingt mit Ihnen reden. Die Anruferin sagte, dass es sich nur um eine Befragung handelt. Mehr konnte ich nicht herausfinden. Soll ich das Meeting mit den Abteilungsleitern verschieben?«
Während der Pause, die darauf folgte, trommelte Siegrid Hermes ungeduldig mit den Fingerspitzen auf der Tischplatte, erschrak jedoch, als die Stimme von Kohland wieder erklang.
»Lassen Sie den Termin bestehen. Das kann nichts Wichtiges sein. Die sind schnell wieder weg. Haben Sie das auch wirklich richtig verstanden? Die sind von der Mordkommission? Was wollen die ausgerechnet von mir? In den letzten Tagen habe ich niemanden beseitigt.« Die Pause war nur kurz, bis sich Kohland wieder meldete. »Oh, entschuldigen Sie, Frau Hermes. War nur ein schlechter Scherz von mir. Wenn die Damen da sind, führen Sie die in den kleinen Besprechungsraum.«
»Soll ich was zu trinken bereitstellen?«
»Ach was. Dann kommen die womöglich noch des Öfteren vorbei. Lassen Sie nur.«
Siegrid Hermes kam nicht dazu, über den Scherz nachzudenken, da sich wieder ein Anrufer meldete. Diesmal war es die Zentrale.
»Ich habe hier Leute von der Kripo. Die Damen meinten, sie hätten einen Termin mit dem Chef. Soll ich die beiden raufschicken?«
»Ist schon in Ordnung. Ich hole sie vom Aufzug ab und bringe sie zu ihm.«
Siegrid Hermes musste nicht lange warten, bis sich die Edelstahltür des Aufzugs öffnete und zwei Frauen auf sie zukamen.
»Frau Hermes, wenn ich richtig rate? Haben Sie Ihren Chef erreichen können?«
»Aber sicher. Wenn Sie mir folgen möchten. Ich bringe Sie direkt zu ihm. Denken Sie bitte daran, dass er einen baldigen Termin wahrnehmen muss. Hier entlang bitte.«
Siegrid Hermes hielt die schwere Holztür weit auf, um die beiden Damen einzulassen. Sie nahm sich die Zeit, die Besucherinnen, besonders die Sprecherin, genauer zu betrachten, wobei ihr das ungewöhnlich kurze, blondierte Haar ebenso ins Auge stach, wie der schwach ausgeprägte Oberlippenbart. Passend dazu war die Beamtin mit einem strengen, leicht gestreiften Hosenanzug bekleidet, unter dessen Oberteil sich klar das Waffenholster abzeichnete. Im Unterschied zu ihrer eher zart wirkenden Kollegin verzichtete sie auf jegliches Make-up. Lediglich ein zarter Hauch von Chanel No 5 umschwebte sie. Die zweite Person stellte ein krasses Gegenstück dar, da sie wesentlich femininer in ihrer engen Jeans und der locker darüber hängenden Lederjacke wirkte. Sie hielt sich bisher wortlos im Hintergrund.
»Setzen Sie sich bitte. Ich sage dem Chef Bescheid.«
Den Moment bis zum Erscheinen des Inhabers nutzten die beiden Frauen, um das edle Holz-Interieur und die ausgesprochen hübschen Accessoires des Raumes zu bewundern. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis durch eine kaum wahrnehmbare Öffnung in der gegenüberliegenden Wand ein großer, zugegeben gut aussehender Mann eintrat und ihnen mit ausgestreckter Hand entgegenkam.