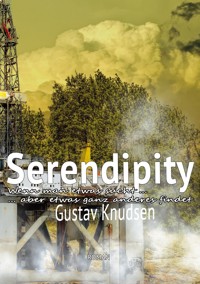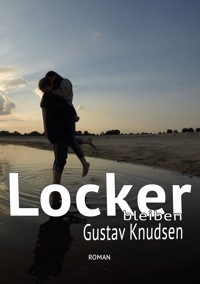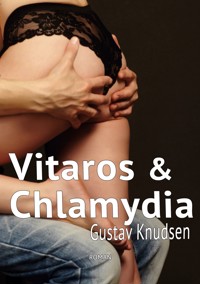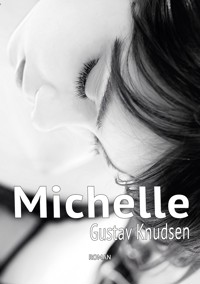Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die frühen 1980er Jahre - prägend und einprägend
- Sprache: Deutsch
Nach dem plötzlichen Kindstod der kleinen Willeke kämpfen Wilma und Gustav mit ihrer tiefen Trauer. Auf Rat der Hausärztin entschließen sich Gustav und Wilma zu einer Therapie. Auf der Suche nach einem Traumatherapeuten und den damit verbundenen negativen Erlebnissen reift in Gustav der Gedanke, sich Hilfe bei der gemeinsamen Freundin und Psychologin Ingrid in Norwegen zu suchen. Dort angekommen zeigt Ingrids Therapie gute Erfolge, bis sich plötzlich die Ereignisse überschlagen. Michelle wird mit Wehen ins Krankenhaus eingeliefert und entbindet die kleine Torid per Notkaiserschnitt. Die Mitteilung des Arztes, dass eine Rückreise in die Niederlande bis auf Weiteres ausgeschlossen ist, stellt Gustav vor neue Herausforderungen. Durch das Auslaufen ihres Mietvertrages muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden, so dass Gustav beschließt zunächst den alten, sanierungsbedürftigen Bauernhof, den er mit Ingrid erworben hat, bewohnbar zu machen. Schlaflose Nächte, harte Arbeitstage auf dem Bauernhof und finanzielle Sorgen fordern ihren Tribut. Als Ingrids Vater Gustav überraschenderweise das Angebot macht, in Norwegen zu bleiben und für ihn bei Shell zu arbeiten, willigt Gustav ein, ohne vorher mit Michelle Rücksprache gehalten zu haben. Steuert Gustavs und Michelles Beziehung nun in eine ernsthafte Krise oder bedeutet es vielleicht sogar die entgültige Trennung?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 887
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nach dem plötzlichen Kindstod der kleinen Willeke kämpfen Wilma und Gustav mit ihrer tiefen Trauer.
Auf Rat der Hausärztin entschließen sich Gustav und Wilma zu einer Therapie.
Auf der Suche nach einem Traumatherapeuten und den damit verbundenen negativen Erlebnissen reift in Gustav der Gedanke, sich Hilfe bei der gemeinsamen Freundin und Psychologin Ingrid in Norwegen zu suchen.
Dort angekommen zeigt Ingrids Therapie gute Erfolge, bis sich plötzlich die Ereignisse überschlagen.
Michelle wird mit Wehen ins Krankenhaus eingeliefert und entbindet die kleine Torid per Notkaiserschnitt. Die Mitteilung des Arztes, dass eine Rückreise in die Niederlande bis auf Weiteres ausgeschlossen ist, stellt Gustav vor neue Herausforderungen.
Durch das Auslaufen ihres Mietvertrages muss schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden, so dass Gustav beschließt zunächst den alten, sanierungsbedürftigen Bauernhof, den er mit Ingrid erworben hat, bewohnbar zu machen.
Schlaflose Nächte, harte Arbeitstage auf dem Bauernhof und finanzielle Sorgen fordern ihren Tribut.
Als Ingrids Vater Gustav überraschenderweise das Angebot macht, in Norwegen zu bleiben und für ihn bei Shell zu arbeiten, willigt Gustav ein, ohne vorher mit Michelle Rücksprache gehalten zu haben.
Steuert Gustavs und Michelles Beziehung nun in eine ernsthafte Krise oder bedeutet es vielleicht sogar die entgültige Trennung?
Inhaltsverzeichnis
„Prolog“
„Candid Camera“
„Kantongerecht“
„Sedativum“
„NCC 1701“
„Adler“
„Tränendämme“
„Sinn des Lebens“
„Ingeborg“
„Pfui Teufel“
„Künstlicher Diamant“
„Abend“
„Ätzend“
„Warum?“
„Ganz bestimmt“
„Protokoll“
„Walross“
„Anzeige“
„Das Blech“
„Femke“
„Horizont“
„Johannes“
„Vorraum zu Hölle“
„Jacket“
„Kurze Zeit“
„Frau Scheissegal“
„Nicht schon wieder“
„Quackstrand“
„Zwarte Kip“
„Mèkkerstee“
„Schnurr“
„Ja. Ne.“
„Honk“
„Frans“
„Druck“
„Master“
„Viktig“
„Under Pressure“
„Frozen inside“
„Corinne“
„Serotonin“
„Bewegung“
„Erwtensoep“
„Dann … Irgendwann“
„Obsession“
„Eemshaven“
„Kristiansand“
„Haukeli“
„Håra“
„Kaminfeuer“
„Beknackte Idee“
„Endlich“
„Ingeborg ficken?“
„Wimpernschlag“
„Nichts. Gar nichts“
„Fisketorget“
„Våganeset“
„Enge Kiste“
„Katzenjammer“
„Einstellung“
„Ein Traum“
„Trolle“
„Familiensitzung“
„Håkon Håkonsson“
„Marina“
„Osterøy“
„Derbe“
„Konfliktkommunikation“
„Der König“
„Ardenner“
„Ein Traum“
„Schubser“
„Breiviken“
„Vättä“
„Deswegen“
„Kaltblut“
„Auf meine Freunde“
„Strohballen“
„Haukeland“
„Skogheim?“
„Und jetzt?“
„Blöd“
„Auf gar keinen Fall“
„Just one minute“
„Mietverträge“
„Identifikationsnummer“
„100 Prozent“
„Löffelchen“
„Ausländisch“
„Geht das?“
„Åsane“
„Bestandsaufnahme“
„Hedvig“
„Nur so? Oder mehr so?“
„Gottheit“
„Vorzeitig“
„Tante Ingrid“
„Airstream“
„Selbstauferlegter Druck“
„Bronco. Puma.“
„Ohne Hindernisse“
„Norsk furu“
„Luftaufnahmen“
„Dreckspatz“
„Unvergesslich“
„Ja Mama“
„Beides“
„Liebesbrief“
„Superman“
„Zunge“
„Natur? Norwegen?“
„Installateur“
„Auf den Fugen?“
„Epilog“
„Prolog“
Ich parkte den Ford Escort in der Hofeinfahrt. Betrat das Haus, ging direkt hoch in unser Schlafzimmer. Hockte mich vor das Bett. Blickte hinein. Hatte ich wirklich erwartet mich dort liegen zu sehen? Mich bei meinem eigenen Traum beobachten zu können? Wie sollte das gehen? Zumal es ja kein Traum war, sondern der grösste Albtraum den ich seit Jahren erlebt hatte.
Ein Arzt, ein Gott in Weiss, hatte mir eröffnet, dass mein Kind, unser Kind tot ist. Meine Freundin Wilma – meine Frau wie ich es im Krankenhaus immer wieder betont hatte – lag ruhiggestellt in einem Krankenzimmer.
Bevor ich zurück ins Wohnzimmer ging warf ich einen Blick ins Kinderzimmer. Hilflos gingen meine Augen über die Wände. „Könnte mal jemand den Dolch aus meiner Brust nehmen? Oder zumindest so tief reinrammen, dass der Schmerz aufhört? Für immer?“
Schnell kritzelte ich ein paar Worte für Michelle auf einen Zettel. „Bitte komm’ sofort ins Krankenhaus. Nach Spijkenisse. Frag’ nach Wilma. Da findest du mich“.
Was sonst hätte ich noch tun sollen? Tun können? Ausser mich sinnlos zu betrinken? Mich besinnungslos zu trinken? Wozu? Ohne Sinn war ich doch bereits. War mein Leben nicht schlagartig ohne Sinn? Sinnlos geworden? „Mein Kind ist tot“. Mehr konnte ich nicht denken. Ohne zu realisieren was das jetzt genau bedeutete.
Vor dem Medisch Centruum in Spijkenisse parkte ich ein. Diesmal gar nicht mehr so überstürzt. Einfach den Escort irgendwo abstellen. In einer richtigen Parkbucht. Ging auf direktem Weg in die Klinikabteilung. Ohne Anmeldung an der Rezeption.
„Candid Camera“
Meine eiligen Schritte wurden jäh von einer Krankenschwester gestoppt, die mir auf dem grell erleuchteten Gang entgegenkam. „Würden Sie bitte mit ins Arztzimmer kommen? Der Professor möchte mit Ihnen einiges besprechen“.
„Prof. Bas van Teylingen – Kinderafdeling“ war auf dem milchigen Glas, das den oberen Teil der Türe vom Rest des Türblatts trennte, zu lesen. Zaghaft klopfte die Krankenschwester an die Türe bevor sie öffnete. Mir freundlich die Türe aufhielt, mich bat einzutreten. Ein glatzköpfiger Mann mit leichtem Vollbart sass hinter dem Schreibtisch. „Nehmen Sie bitte Platz“ zu mir schauend, im Aufstehen seine Hand entgegenstreckend. Zu der Krankenschwester nur kurz „Danke Schwester Tineke“ sagend. Tineke schloss leise die Türe.
Platz nehmen, das war so gar nicht was ich wollte. Platzen schon eher. Jede einzelne Faser meines Körpers war angespannt. Spürte bereits beim Hinsetzen, dass ich das nicht wollte. Nicht sitzen, nicht ruhig bleiben, nicht ruhig sein. So tun als wäre ich ruhig. Denn das war ich nicht. Ganz und gar nicht.
„Sie haben vorhin ja noch mitbekommen, dass ich Ihnen gesagt habe, dass sich ein Arzt gekümmert hat. Das war aber ein Arzt hier vom Krankenhaus. Der aber nur den Kindstod bestätigt hat“. Ruckartig erhob ich mich aus dem Stuhl, hatte nicht einmal richtig Platz genommen. „Wie? Nur? Bist du noch ganz dicht?“ entfuhr es mir.
Der Arzt, der Professor, sprach ruhig weiter. „Bei Kindstod müssen wir die Staatsanwaltschaft benachrichtigen. Die entscheidet über weiteres Vorgehen. In der Regel wird die Leiche dann innerhalb von vierundzwanzig Stunden freigegeben. Es sei denn …“ Hatte er das jetzt wirklich alles gesagt? Staatsanwaltschaft? Vierundzwanzig Stunden?
Freigegeben? Mit beiden Händen hatte ich mich auf den Schreibtisch des Professors gestützt, mich schon leicht zu ihm herüber gebeugt. „Was heisst das? Freigegeben? Was ist mit meinem … mit unserem Kind?“ Sah ihm fest ins Gesicht. „Was ist mit Wilma?“
„Eventuell muss eine Obduktion durchgeführt werden. Aber das entscheidet der vom Gericht bestellte Rechtsmediziner. Das ist Sache der Staatsanwaltschaft“.
Ich spürte meine Arme nach oben wandern, in Richtung Professor. Hielt aber in der Bewegung inne, ging um den Schreibtisch herum. Eigentlich war es mehr stürmen als gehen. „Du meinst so wie in so einem Scheiss-Krimi? Obduktion? Mit Aufschneiden und so?“
Schon hatte ich den Professor am Kragen seines weissen Kittels. „Wenn du das machst … meine Willeke aufschneidest … dann mach’ ich dasselbe mit dir. Bei lebendigem Leib. Ich schneid’ dir dein verdammtes Herz raus. Das brauchst du eh nicht mehr. Du hast ja nicht mal eins. Du willst mein Kind aufschneiden?“
Mit einer Hand befreite sich der Professor aus der Umklammerung. „Das entscheide ich nicht. Das ist eine Prozedur, die jetzt automatisch abläuft“. Strich seinen Kittel glatt. „So hören Sie mir doch zu. Bitte“.
Es klopfte leise an der Türe. „Herein“ rief der Professor kurz angebunden. Die Tür schwang auf, Schwester Tineke lugte herein, hinter ihr erkannte ich Michelle, die sich direkt an ihr vorbeidrängte und das Arztzimmer betrat. Direkt auf mich zukam, mich flüchtig umarmte. „Was ist los? Was machst du hier? Wo ist Wilma? Was ist mit Wilma?“ Sah nur kurz zu dem Arzt hinüber, dann direkt wieder zu mir. „Was ist mit Willeke? Ist was mit Willeke?“
Ich schloss sie noch fester in meine Arme. „Willeke ist tot. Sie ist gestorben. Plötzlicher Kindstod. Hat man mir gesagt. Wilma ist …“. Michelle glitt in meiner Umarmung einfach hindurch. An meinem Oberkörper entlang. Sackte zu Boden. „Oh nein. Nein. Nein“ schluchzte sie.
Tineke stützte sie, half ihr aufzustehen. Sah ihren Professor an. „Ein Glas Wasser bitte“. Dann direkt wieder zu Michelle. „Setz’ dich. Trink’ etwas“.
Auf seinem Schreibtisch schob Professor van Teylingen ein Glas herüber. „Wollen Sie mir jetzt bitte zuhören? Kann ich Ihnen jetzt alles erklären? In Ruhe?“
Während Michelle sich langsam auf den Stuhl niederliess schaute sie mich an. Flehentlich. So als würde sie erwarten, dass irgendwoher eine Person hervortrat und rief „Welcome to Candid Camera. It’s just a joke“. Aber es kam niemand.
Von der Wand zog ich mir einen weiteren Stuhl heran, setzte mich zu Michelle, nahm ihre Hand, drückte sie fest. Wortlos. Ohne Worte.
Der Arzt rückte seinen Stuhl an den Schreibtisch, zog sich ebenfalls ein Trinkglas von einem auf dem Tisch bereitstehenden Tablett heran, goss sich etwas Wasser ein. „Wenn ich Ihnen dann jetzt das Prozedere erläutern darf? Zum allgemeinen Verständnis? Dass es eben ganz und gar nicht in meiner Entscheidung, in meinem Ermessen liegt. Ich mich auch an die uns auferlegten Vorgaben halten muss“. Ganz kurz schaute er zu mir. „Natürlich verstehe ich, dass Sie aufgebracht sind. Sehr sogar“. Ich erwiderte seinen Blick. „Entschuldigen Sie …“. Was er mit einer Handbewegung abschmetterte. „Ist schon okay, schon vergessen“. Michelle schaute mich von der Seite an, schien genau zu wissen was vor ihrem Erscheinen abgelaufen war.
„Kantongerecht“
„Nach den gesetzlichen Vorgaben sind alle Rechtsmediziner gehalten alle Kinder unter sechs Jahren, bei denen die Todesursache nicht zweifelsfrei erkennbar ist, zu untersuchen“ begann der Professor. „Das Gesetz soll Kindestötungen entlarven“ fuhr er fort, schaute zu uns herüber. „Das kann natürlich auf trauernde, unschuldige Eltern ein wenig, sagen wir mal traumatisierend wirken“. Wieder erhob ich mich ruckartig aus meinem Stuhl. „Was soll das heissen? Kindestötungen? Glaubst du ernsthaft wir … Wilma hat unser Kind getötet? Spinnst du jetzt total? Sie liebt unser Kind. Sie hat es unter Schmerzen geboren. Warum sollte sie die kleine Maus umbringen?“
„Natürlich glaube ich das nicht, aber es ist nunmal so – wenn die Staatsanwaltschaft das … eine Obduktion anordnet, müssen wir uns dem fügen. Wenn die Todesursache und eventuelle Misshandlungen möglichst zweifelsfrei festgestellt sind … oder eben auch nicht … wird der Leichnam freigegeben. Und unser Stationsarzt hat keinerlei Fremdeinwirkung festgestellt“. Der Professor trank einen Schluck Wasser. „Sie können natürlich beim Kantonrechter ein hooger beroep gegen diese Entscheidung einlegen“.
„Das kann ich nicht nur, das werde ich. Und zwar sofort. Ich will … wir wollen sofort zu Wilma“. Der Arzt sprach in sein Telefon hinein. „Schwester Tineke, kommen Sie bitte“. Mit einer Hand fasste ich zu Michelle. „Ich fahr’ jetzt zum Amtsgericht, du gehst zu Wilma“. Drückte ihre Hand ganz fest. „Und kein Wort von dieser ganzen Obduktions-Scheisse. Kein Sterbenswort. Nichts. Gar nichts“. Sah sie fest an. „Ich meine gar nichts, verstehst du? Gar nichts“.
„Schwester Tineke wird Sie begleiten“ liess der Professor im Aufstehen wissen. Die Tür schwang nach einem leisen Anklopfen auf. Noch einmal setzte ich nach. „Michelle, bitte, kein Wort zu Wilma. Hast du mich verstanden?“ Michelle nickte stumm. Für einen Moment blieb ich im Türrahmen stehen. Wandte mich an den Professor. „Ich fahre zum Gericht. Und wenn dieser Mediziner schon hier ist und an meinem Kind rumschnibbelt sagen Sie im dasselbe was ich Ihnen gesagt habe. Ich stech’ ihn ab, ich schneid’ ihm sein verdammtes Herz raus, wenn er Willeke auch nur anrührt“.
„Das mach’ ich lieber nicht. Und Sie sollten das auch nicht machen. Machen Sie sich nicht noch unglücklicher als Sie sowieso schon sind“. Der Arzt hielt mich kurz an der Hand. „Ich informiere, dass Sie zum Kantongerecht unterwegs sind. Das sollte genügen“. Michelle griff ebenfalls zu meiner Hand. „Schatz, du machst nichts Unüberlegtes. Komm’ schnell zurück. Zu Wilma. Sie braucht dich“.
Hastig lief ich den Gang der Krankenabteilung hinunter, blieb auf halber Strecke stehen, drehte um. Michelle war bereits mit der Krankenschwesetr auf dem Weg zu Wilma. Zögernd klopfte ich an die Türe zum Arztzimmer. „Entschuldigung, wo ist eigentlich dieses Kantongericht? Wo muss ich überhaupt hin?“ Der Professor blickte auf. „Kennen Sie sich aus? Wissen Sie wo der Rijnhaven ist?“ „Ja“ unterbrach ich seine Fragestellung. „Ich arbeite in Pernis, im Hafen kenne ich mich aus“. Er schob mir einen Zettel herüber, auf dem er „Wilhelminaplein 100“ notiert hatte.
Hielt ihn einen Moment in seiner Hand fest, gab ihn nicht frei. „Sie haben schon gehört was Ihre Frau gesagt hat? Das ist doch Ihre Frau, oder?“ Wortlos nickte ich. Er legte seine Hand, nachdem er den Zettel losgelassen hatte, auf meine Schulter. „Ich kann Sie verstehen … es tut mir sehr leid für Sie … Machen Sie nichts Unbedachtes. Und …“ Er legte eine kurze Pause ein. „Bleiben Sie höflich. Und freundlich. Das hilft bei Gericht. Garantiert“. Warum ich auf seine Ansage mit „Yes Sir“ reagierte erschloss sich mir nicht.
Meine Gedanken rasten in meinem Kopf mit einem ähnlichen Tempo mit dem ich auch fuhr. An Charlois vorbei, an Rotterdam Ahoy vorbei. Richtung Feijenoord. War das Zufall, dass das Gericht ausgerechnet am Wilhelminaplein lag? An einem Ort, der so hiess wie meine geliebte Wilma? Eigentlich ja Wilhelmina. Natürlich nicht. Zufall existierte nicht. Versuchte ich mir einzuhämmern.
Knappe zwanzig Minuten hatte ich für die Strecke benötigt. Auf alle geltenden Verkehrsvorschriften und Geschwindigkeitsvorgaben geschissen.
Hastig eilte ich in das Gerichtsgebäude. Trug an einem Pförtnerhäuschen mein Anliegen vor. Dass ich Einspruch gegen eine Obduktion einlegen wolle. „In welcher Sache genau?“ wollte der uniformierte Bemate wissen, suchte dann anhand meines vorgetragenen Namens Informationen heraus. „Der anwesende, diensthabende Richter entscheidet darüber. Zimmer 27. Zweite Etage“.
Geduldig – und gleichermassen ungeduldig - wartete ich auf dem Flur vor dem Richterzimmer bis mich eine Person aufrief. Mich bat ihm zu folgen. Beim Richter vorzusprechen.
Die vom Professor aufgetragene Ermahnung bezüglich freundlichkeit und Höflichkeit hatte ich noch im Ohr. Genau so trug ich auch dem Richter nach Betreten des Amtszimmers mein Anliegen vor. Dennoch mit reichlich Mühe nicht aus der Haut zu fahren.
Von einem riesigen Papierstapel kramte er ein paar Blätter hervor. „So wie ich das sehe ist eine Obduktion nicht vonnöten. Nicht angeordnet. Sehen Sie hier …“ Er hielt mir ein blass bedrucktes Papier entgegen. „Ein Telefax aus dem Medisch Centruum in Spijkenisse. Von Professor van Teylingen. So wie es hier steht gibt es keine Hinweise auf Unregelmässigkeiten“. Was bedeutete das jetzt? Unregelmässigkeiten? Also auch keine Obduktion? Und warum hatte der Professor mir gegenüber nicht ein Wort davon erwähnt? War ich die ganze Strecke nach Rotterdam einfach so gefahren? Ohne Grund? Um hier zu erfahren was Sache ist?
Sollte ich Lachen oder Weinen? Ich tat einfach beides. Vor Erleichterung. Vor Glück wäre jetzt nicht der passende Ausdruck. Ich war alles, nur nicht glücklich. Erleichtert, das war ich. Dass man meiner Willeke nichts antun würde. Selbst wenn sie davon natürlich nicht wieder lebendig würde. Sie blieb tot. Definitiv. Unwiderbringlich. Mein Lachen verschwand und wich Tränen. Tränen der Trauer.
Auf einer hölzernen Bank in dem langen Flur des Gerichtgebäudes sank ich nieder. Mein Kind war tot. Das drang jetzt so richtig in mein Bewusstsein. Jetzt wo ein Teil meiner Anspannung gewichen war.
Aus meiner Jackentasche nahm ich Tabak, drehte mir eine Zigarette. Lief das hellhörige Treppenhaus hinunter, verliess das Kantongerecht, stieg in meinen Ford Escort. „Du musst sofort zu Wilma“ schrie es förmlich in meinem Kopf.
War es verwunderlich, dass ich, erstmalig seit Jahren, während der Autofahrt die Selbstgedrehte rauchte? Nie zuvor hatte ich das gemacht. Egal wie angespannt oder aufgeregt, nervös ich auch war. Das hastige Einatmen des Nikotins zeigte mir wie sehr ich einer Situation ausgesetzt war, die ich niemals zuvor erlebt hatte. Der Blick auf meine zittrige Hand, in der sich der Glimmstengel bewegte, unterstrich das noch mehr.
Wo war überhaupt der Aschenbecher in meinem Auto? Gab es überhaupt einen Ascher? Ich aschte einfach zum geöffneten Fenster hinaus, schnippte die aufgerauchte Kippe einfach auf den Asphalt. Ohne grossartig nachzudenken. Worüber auch?
„Sedativum“
Alles in Allem hatte ich jetzt gut zwei Stunden benötigt um nicht einen Deut schlauer zu sein als vorher. Hatte das etwa damit zu tun, dass es mir, grundsätzlich, an Besonnenheit fehlte? Was war das überhaupt? Was bedeutete das? Besonnenheit? Grundsätzlich war mir das schon klar. Das war das was meiner Impulsivität gegenüberstand. Meine teilweise fehlende überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen oder heiklen Situationen den Verstand die Oberhand behalten lässt, um vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. War es das? Fehlte mir einfach die Besonnenheit? Ein gewisser emotionaler Anteil innerer Ruhe?
Die interne Fragestunde wischte ich aber sogleich fort. Wie sollte ich in Dreiteufelsnamen „Besonnen“ sein? Zurückhaltung, Selbstbeherrschung, Mäßigung, Anstand, Gehorsam, oder was auch immer an den Tag legen? Oder sollte ich doch lieber den Ausdruck „in Gottes Namen“ verwenden? Garantiert nicht! Dieser Gott hatte mir mein Kind genommen. Warum nur? „Aber garantiert nicht“ sprach ich es laut aus. Denn das waren doch genau meine Gedanken, meine Worte, die sich sofort nach Verkündung der schlimmen Nachricht formuliert hatten. „Warum hast du das getan? Was hast du uns angetan? Was hast du Wilma angetan? Wir sollen an dich glauben? Du willst unser Gott sein? Du bist der Teufel! Du bist der Teufel! Du verdammtes Arschloch. Du gottverdammtes Arschloch!“
Im Schwesternzimmer erfragte ich zur Sicherheit Wilmas Zimmernummer. Schwester Tineke war hilfsbereit zur Stelle, führte mich über einen langen Gang. „Bist du okay?“ wollte sie im Gehen wissen. Was sollte ich ihr darauf antworten? Was verstand sie unter „Okay“?
Noch bevor ich ihr antworten konnte kam uns Professor van Teylingen auf dem Gang entgegen. „Ihre Freundin hat nochmals ein paar Beruhigungsmittel bekommen. Aber …“ Er sah mich an. „… Es geht ihr gut“. Auch seinen Hinweis wusste ich nicht, oder nicht komplett einzuordnen. Was hiess denn gut? Ähnliches wie das von Schwester Tineke gemeinte „Okay“?
„Danke“. Etwas Besseres fiel mir nicht ein. Dann noch einmal. „Danke. Auch für das Telefax, dass Sie ans Gericht gesendet haben. Und ihre Einschätzung“. Der Arzt hatte wieder seine Hand auf meine Schulter gelegt. „Dafür müssen Sie sich nicht bedanken. Ich mache lediglich meine Arbeit. Komme meiner Aufgabe als verantwortlicher Leiter der Abteilung nach“. Kurz blickte er zur Schwester. „Ich begleite Sie noch kurz“.
Kaum hörbar klopfte Schwester Tineke an die Zimmertüre. War sie immer so rücksichtsvoll und zurückhaltend? Anzunehmen, ihr Klopfen bei Herrn Professor hatte ich auch nicht lauter in Erinnerung. Mehr so als würde sie das Türblatt streicheln.
Wilma und Michelle sassen auf der Bettkante. Wilma hatte ihren Kopf an Michelles Brustkorb gelehnt. Michelle strich ihr zärtlich und tröstend über den Kopf. Beide sahen auf, zu uns. Der das Zimmer betretenden Mannschaft. „Wie fühlen Sie sich?“ wollte der Arzt wissen. Wilma blieb stumm. Apathisch, lethargisch blickte sie ihn an. Der Professor nickte kurz in Richtung Schwester Tineke. „Wir lassen Ihnen etwas Zeit. Tineke kommt gleich und begleitet sie“.
Michelle schaute mich an. Ohne dass sie eine Frage gestellt hatte nickte ich stumm und formulierte mit den Lippen „Alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung“. Setzte mich neben Wilma, schloss sie in den Arm. Ihre Augen waren leer. Mit tiefschwarzen Pupillen. So hatte ich ihre Augen bisher nur gesehen, wenn wir gekokst hatten. Oder miteinander schliefen. Aber nicht so wie jetzt. Mir kam es so vor als würde ich in ein grosses schwarzes Loch schauen, das hinunter bis in ihre Seele reichte.
Michelle versuchte mir zu erklären, dass Wilma stark sediert sei. „Was heisst hier lädiert? Flüsterte ich ihr zu. „Das ist ja furchtbar was ich hier sehe“. Trotz der eigentlich nicht lustigen Situation schmunzelte Michelle. „Sediert. Nicht lädiert. Sie hat Beruhigungsmittel bekommen. Sedativum. Sediert nennt man das“.
Sie schob mir die auf dem Nachttisch liegende Medikamentenpackung herüber. „Midazolam“ war zu lesen.
Wilma war wie weggetreten, atmete flach, regaierte kaum auf mich oder Michelle. Glotzte einfach vor sich hin. „Verdammt noch mal, was haben die mit dir gemacht?“ Ihr Zustand war genau wie es auf dem Beipackzettel beschrieben stand. Wilma war in einer Art Dämmerzustand. War aber ansprechbar. Reagierte nur eben nicht. „Wilma. Schatz. Was ist eigentlich passiert?“
Leise begann Wilma zu sprechen. „Unsere Kleine hat sich so so gut entwickelt, war schon richtig kräftig, kerngesund. Ich war der glücklichste Mensch der Welt, dachte dass mir alles andere egal ist … Dann kam der heutige Tag, der schlimmste Tag meines Lebens. Willeke hat ein wenig geschlafen, alles war wie immer, sie war fröhlich, gut gelaunt, zufrieden. Wir sind spazieren gegangen, im Kinderwagen. Danach hat sie geschlafen, ich habe sie in ihr Bettchen gelegt. Wie immer. Als ich dann nach ihr schauen wollte war sie ganz blass. Und kalt. Was sollte ich denn tun? Also habe ich den Notruf gewählt. Die Ärzte und alle Helfer konnten sie nicht retten“.
Wilma legte ihren Kopf an meine Brust, weinte bitterlich. Schluchzend erzählte sie weiter „Ich mache mir Vorwürfe, was habe ich nur falsch gemacht? Oder anders gemacht …, als andere? Ich verstehe nicht was passiert ist. Ist Willeke wirklich tot?“ Lag das jetzt an den Medikamenten? Dass sie ernsthaft die Frage nach Wilekes Tod stellte? Hatte man ihr nicht die gleichen Informationen mitgeteilt die ich auch hatte?
Ich spürte die kalten Tränen die meine Wangen herunterliefen. Meine eigenen Tränen. „Ja, sie ist tot. Plötzlicher Kindstod hat der Arzt mir erklärt“. Dass ich mittlerweile wusste, dass so etwas „einfach passiert“ wollte ich gar nicht ausführen. „Es ist nicht deine Schuld, du konntest nichts tun, du konntest es nicht verhindern“.
Ob meine Worte jetzt ein wirklicher Trost für Wilma waren blieb fraglich. Aber was sollte ich sonst sagen? Was sollte ich überhaupt sagen? Machte es überhaupt Sinn ihr etwas zu erzählen? Sie schien absolut abwesend. Körperlich war sie zwar präsent, sass neben mir, aber eine Reaktion war nicht zu verspüren. Weder in ihrem Gesicht noch auf meine Umarmung hin. In ihren Augen erst recht nicht. Lediglich dieser tiefschwarze See war zu erkennen.
Mich vom Bett erhebend fluchte ich ganz leise vor mich hin. „Verdammt, verdammt, verdammt. Was hat man meiner geliebten Wilma angetan?“ Drehte mich kurz um, schaute zu Michelle. Hob meinen Kopf fragend an. Michelle schüttelte verneinend ihr Kopf. Kannte sie meine Frage? Wusste sie was ich wissen wollte? Ein paar Schritte wanderte ich im Krankenzimmer umher. Einmal mehr wurde mir klar wie sehr negativ Krankenhaus für mich behaftet war. Zu oft war ich hier bereits. Und bis auf das eine Mal, als Willeke geboren wurde, als Wilma Willeke gebar, war es nur Scheisse die ich in diesem, oder jedem anderen Krankenhaus erlebt hatte.
Die Tür schwang auf, ein Anklopfen hatte ich nicht vernommen. Es war Schwester Tineke. Aber ihr Klopfen war ja sowieso nur zu erahnen. „Möchten Sie … möchten Sie sich jetzt verabschieden?“ Fragend blickte ich sie an. „Wie verabschieden? Ich bin gerade erst gekommen“. Schwester Tineke legte ihre Hände ineinander. „Von ihrer Tochter. Möchten Sie jetzt in die Pathologie? Wären Sie soweit?“
„NCC 1701“
Michelle erhob sich ebenfalls vom Bett. Wandte sich an Schwester Tineke. „Magst du einen Moment warten? Draussen? Ich möchte Wilma kurz beim Ankleiden helfen. Sie muss ja nicht in dem Kittel durchs Haus laufen“. Mit Kittel meinte Michelle diesen grünen Lappen, den man Wilma umgebunden hatte. Der ihren Rücken und ihren Hintern frei sichtbar liess. Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall würde … musste Wilma so durchs Krankenhaus laufen.
Tineke führte uns durch den Gang der Station. Bis wir am Ende einen Aufzug erreichten. Unsere Dreiergruppe, Wilma, Michelle und ich, hielten uns an den Händen. Fest und leicht zittrig. Aufgeregt, Angespannt, Nervös. Tineke drückte auf den Schalter. U3. Langsam und ein wenig ruckelnd setzte sich der Lastenaufzug in Bewegung. Abwärts. Gleichzeitig begann Tineke zu erzählen. Dass die Pathologie in einem der Untergeschosse untergebracht sei. Dass die Schwesternschülerinnen und Schüler „hier unten“ gerne Parties feierten. Weil man dort so schön ungestört sei. Dass die Pathologen intern als Leichenuntersucher bezeichnet würden. Dass der Begriff Pathologie wörtlich übersetzt die Lehre vom „Leiden und Erdulden“ bedeute.
Ich sah sie an. „Tineke“. „Ja, bitte?“ „Kannst du mal bitte die Fresse halten“. Betretenes Schweigen. Von Tineke. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Nur das. Dass sie einfach ihr Maul hält.
Die Aufzugstür öffnete sich. Vor uns lag ein langer Gang. Graue Betonwände, keine Fenster. Logisch. Wir waren auf U3. Im Keller. Eigentlich im Keller unter dem Keller. Gerade mal so breit, dass zwei Krankenbetten nebeneinander passten. Im vorderen Teil des Ganges waren einige Betten dicht an der Wand „geparkt“. Leer. Ohne Bettwäsche. Wurden die Verstorbenen hier einfach abgestellt? Und dann in die Pathologie verbracht?
An der Decke verliefen Rohre. Kleinere und grössere. In verschiedenen Farben. Das kannte ich von der Raffinerie. Blau und Rot für Wasser. Kalt und Warm. Gelb für Gas. Und die grossen verzinkten Rohre gehörten zur Lüftung. Ein Band aus grellen Neonleuchten verlief mittig auf der Decke, liess erkennen, dass der Gang bestimmt einige zig Meter lang sein musste. Wir waren also im Versorgungstrakt, im Gedärm des Krankenhauses. Hier und da spielten einige Starter der Neonleuchten verrückt, liessen die Röhren heftig flackern. Wie ein Stroboskop des Todes.
Michelle war ruckartig stehen geblieben. Das merkte ich daran wie sie an meiner Hand zerrte. „Ich kann nicht weitergehen. Mir ist übel … Und ich habe Angst“. Mit einer Hand hielt sich sich ihren Bauch, der ja schon eine anständige Kugel abzeichnete. „Ausserdem … der Geruch … der Gedanke an die Toten … So als hat die Hölle seinen Parfümschrank geöffnet. Ich will nach oben“. Über meine Schulter drehte ich mich zu Schwester Tineke. „Wie weit ist das noch?“ „Noch etwa drei Türen. 07“. Ich fasste Wilma fester an die Hand. „Und du? Du bist okay?“ Wilma nickte wortlos. Wieder drehte ich mich zu Tineke. „Du bringst Michelle bitte nach oben“.
Noch einmal kurz über die Schulter blickend sah ich Michelle hinterher. Gemeinsam mit Wilma lief ich weiter. Durch den Gang, der auch locker auf der NCC-1701, der USS Enterprise aus der TV-Serie „Star Trek“ hätte sein können. Nur dass hier weder „Scotty“ noch „Captain James T. Kirk“ irgendwo zu sehen waren. Auch kein Doctor Leonard „Bones“ McCoy.
„Hier muss es sein“. Öffnete die schwere Stahltüre mit der aufgeklebten Zahl „07“. Leise Musik drang uns entgegen, wurde von den gefliesten Wänden reflektiert. War hier gerade eine dieser Parties, von denen Tineke erzählt hatte, im Gange?
An einem der Tische, ausnahmslos aus Edelstahl, sass eine Person. Stierte in ein Mikroskop. Sah auf als sie unsere Schritte vernahm. Stand auf, kam auf uns zu. Streckte uns ihre Hand entgegen. „Professor van Teylingen hat Sie bereits angekündigt. Kommen Sie doch durch“. Aus einem angrenzenden Raum kam uns ein Mann entgegen. Mit wehendem weissen Kittel. Seine Schritte hallten vom Fliesenboden, reflektiert durch die gekachelten Wände. „Professor Ruud Hoekstra, Gerichtsmedizin Rotterdam“. Der wehende Kittel hielt uns schon seine Hand entgegen bevor er uns erreicht hatte. „Das ist meine Assistentin Mila van der Meer“.
Genau so wie der Kittel erschienen war, drehte er sich auf dem Absatz, ging zurück an seinen Schreibtisch. Der war allerdings nicht aus Edelstahl, sondern ein pompöses Möbel, das wohl seine Macht und Position betonen sollte. Ganz kurz ging mir „Mann, du musst es ja nötig haben“ durch den Kopf. Die Tischplatte aus natürlichem Massivholz der Wildbuche ruhte auf zwei massiven Stahlrahmen. Minimalistisches Industriedesign nannte man das wohl. In seinem Minimalismus protzte. Von einem der auf der Tischplatte liegenden Stapel nahm er eine Aktenmappe. „Mila, wollen Sie dann bitte? Fach Vierundzwanzig Nullsieben Zwölf A“.
Mila ging zu einer Wand mit Schubfächern aus Edelstahl. Wie ein überdimensionales Sideboard. Silbrig glänzend. Mehr oder minder laut las sie die Beschriftungen ab. Sich selber. Verharrte in der mittleren Reihe mit ihrer entlangfahrenden Hand. „Ah, hier ist es ja“. Zog eines der Schubfächer heraus. Je weiter sie es öffnete umso mehr klappte automatisch ein Gestell mit Rollen herunter. Bis sie es bewegen konnte. Darauf lag irgendetwas, in weisse Tücher eingewickelt. Ein Würgereiz überkam mich. Das musste meine Willeke sein. Automatisch wurde mein Händedruck fester, umklammerte Wilmas Hand. Ein flehender Blick ging zu ihr. „Bist du okay? Bist du bereit? Bist du dir sicher?“
„Adler“
Wilma hatte bislang nichts, nicht ein Wort gesprochen. Seit wir ihr Krankenzimmer verlassen hatten. Sie fasste an meinen Oberarm. „Geh’ nicht weg. Halt mich fest“.
Sollte ich Wilma jetzt sagen, dass ich das was ich sie gefragt hatte – Okay? Bereit? - selber gar nicht war? Meine Knie schlotterten, innerlich vibrierte alles. Mila schlug das weisse Leinentuch zurück, der Blick auf unser Kind wurde freigegeben. Mila hielt das Tuch an einem Ende in ihrer Hand. „Sind Sie ganz sicher? Oder soll ich den Leichnam lieber wieder bedecken?“ Willekes Augen waren schon ganz trübe, milchig. Leicht gelblich. Haut und Lippen schon ziemlich ausgetrocknet, die Fingerkuppen rötlich-braun. Professor Hoekstra trat an den Tisch heran. „Durch die Autolyse entsteht der leicht wahrnehmbare Verwesungsgeruch“. Hinderte mich daran Willeke vom Tisch aufzunehmen. Konnte anscheinend meine Frage erahnen. Schüttelte seinen Kopf. „Nein, es wurde keine Obduktion durchgeführt“.
Wilmas Kopf fuhr herum. „Obduktion? Du hast das gewusst? Mir nichts gesagt?“
Von einer Sekunde auf die andere kippte ihre Gemütslage. Sie schrie mich an. „Du verdammter Mistkerl. Du Scheiss-Typ. Wo warst du? Wo warst du als Willeke dich gebraucht hat? Warum hast du nichts getan?“ Dabei trommelte sie mit geballten Fäusten auf meinen Brustkorb ein. Ihre Arme bewegte sich wie die gusseisernen Ärmchen einer Adler-Schreibmaschine aus den 50er Jahren. So als wolle sie jeden einzelnen Buchstaben ihrer Worte in mich hinein hämmern. Immer wieder mal unterbrochen von saftigen Ohrfeigen. Wilma prügelte ihre ganze Verzweiflung auf mich … in mich. Bis sie innehielt und einfach zu Boden sank. Nicht weinend – ihren Schmerz herausschreiend. „Meine Maus … mein geliebtes kleines Mädchen …“
Mila half ihr auf die Beine. Wilma nahm ihre Schläge sofort wieder auf. Beschimpfte mich aufs Übelste. Lautstark. Mit Ohrfeigen und Fausthieben durchsetzt. „So beruhigen Sie sich doch“ versuchte Mila sie an den Armen zu fassen. In ähnlicher Lautstärke, die Wilma auch hatte herrschte ich Mila an. „Lass’ sie los. Fass’ sie nicht an. Lass’ meine Frau los. Sofort“.
Zog Wilma in meine Arme. Ihre Hiebe, ihre Schläge wurden weniger. Weniger heftig. Weil ihr der Raum zum Schwungholen fehlte. Bis sie bitterlich weinend ihren Kopf an meinen Brustkorb legte. Ihre Vorhaltungen vermischten sich mit Schluchzen.
Nach einer Weile wand sie sich aus meiner Umarmung, meiner Umklammerung. „Geh’ mir bloss aus den Augen. Verschwinde aus meinem Leben. Ich will dich nie mehr sehen. Verschwinde einfach. Hau ab du Scheisskerl“. Drehte sich um, ging auf die Ausgangstür zu. Professor Hoekstra wies seine Assistentin an „Mila, würden Sie bitte. Begleiten Sie Frau De Ruiter zur Krankenstation“.
Wie angewurzelt, wie Karl Arsch von der Kompanie der Verdammten stand ich da. Fühlte mich auch so. Professor Hoekstra bedeckte Willekes Leichnam mit dem Leinentuch, wies mit dem Kopf zu seinem Schreibtisch. „Kommen Sie, setzen Sie sich einen Moment“.
Aus einer Schublade herausnehmend warf er eine Packung „Caballero Filter“ auf den Tisch. Suchte weitere Zettel aus seinem Papierberg. Zündete seine Zigarette an. „Auch eine?“ hielt er mir die Packung entgegen.
Jetzt bemerkte ich … wurde mir bewusst wie sehr ich zitterte. Am ganzen Körper. Nicht einmal das Feuerzeug konnte ich richtig greifen. Mein Gegenüber hielt mir die brennende Flamme entgegen.
„Das hier ist der Totenschein. Es ist bereits alles ausgefüllt. Damit können Sie zu einem Bestatter gehen. Damit können Sie den Leichnam … Ihr Kind abholen lassen. Alles weitere wird Ihnen sicherlich das Bestattungsunternehmen erklären“. Erneut beugte er sich an seinem Schreibtisch herunter. Stellte eine Flasche Cognac auf den Tisch. „Möchten Sie …?“ Hastig stürzte ich das mir eingegossene Glas herunter. „Danke“.
Bis zu der grossen Eingangstüre, jetzt die Ausgangstüre, begleitete der Professor mich noch. „Den Rest finden Sie? Einfach mit dem Aufzug nach oben fahren“.
Einen Moment blieb ich in dem Aufzug einfach stehen. Ohne auf einen Knopf zu drücken. Auf welchen auch? Kinderabteilung? Oder doch zur Abteilung in der Wilma stationiert war? Oder einfach Erdgeschoss? Empfangshalle? Was war überhaupt mit Michelle? Wo war sie? Durch den schmalen verglasten Schlitz blickte ich erneut in den betonierten Gang zur Pathologie. Hatte ich mich ja schon einmal gefragt wie jemand den Beruf eines Gynäkologen ergreifen konnte so war mir noch unklarer wie man Pathologe werden konnte. Sich zu Lebzeiten mit dem Tod zu beschäftigen? Täglich. Gegen Geld.
Ich entschied mich für Erdgeschoss. Empfang. Bat am Empfangstresen auf der Kinderabteilung anzurufen. Bei Schwester Tineke zu erfragen wo sich meine Freundin Michelle befand. Nach einem kurzen Telefonat hatte ich die Antwort. „Tineke hat schon lange Feierabend. Aber ihre Kollegin hat eine Nachricht für Sie. Ihre Freundin ist nach Hause gefahren“. Das überraschte mich nicht nur, es erstaunte mich. Ratlos schaute ich erst die Rezeptionistin an, dann auf die hinter ihr befindliche Wand. Dort zur Wanduhr. „Waas? Gleich drei Uhr? Nachts“. Kein Wunder also, dass Michelle nach Hause gefahren war. Was auch sonst?
„Und jetzt?“ stellte ich mir die Frage. Die Antwort hatte ich aber auch schnell parat. Ging wieder zum Aufzug. Drückte den Schalter „Frauenabteilung“.
Wilma sass auf ihrem Bett. Ihr Gesicht in die Handflächen gestützt. Schaute direkt auf. „Was willst du? Du sollst verschwinden. Aus meinem Zimmer. Aus meinem Leben. Hau endlich ab“.
„Nein. Oder ja. Aber ich will dir schon noch sagen, dass ich nichts tun konnte. Ob ich da gewesen wäre oder auch nicht. So wie du auch nichts tun konntest. Nichts verhindern konntest“.
Ich setzte mich zu Wilma auf das Bett. „Weißt du, dass du es warst der mir damals … als unsere Freundin Willeke verstorben ist … gesagt hast ‘Der Trick ist den Schmerz zuzulassen’. Weißt du das noch?“ Legte einen Arm um ihre Schulter. Wir haben keine Schuld. Du nicht. Ich nicht“. Ganz leise begann ich ein Lied anzustimmen.
I didn’t know what day it wasWhen you walked into the roomI said hello unnoticedYou said goodbye too soon
Breezing through the clienteleSpinning yarns that were so lyricalI really must confess right hereThe attraction was purely physical
I took all those habits of yoursThat in the beginning were hard to acceptYour fashion sense, Beardsley printsI put down to experience
The big bossed lady with the Dutch accent Who tried to change my point of viewHer ad lib lines were well rehearsed But my heart cried out for you
Wilma legte ihren Kopf an meinen Brustkorb. „Es tut mir leid. Alles. Es tut mir alles so unsagbar leid. Was passiert ist. Was ich gesagt habe“. Mit einer Hand strich ich durch Wilmas Haare. „Wir schaffen das. Zusammen. Wir schaffen das. Glaub’ mir“. Streichelte über ihre Wange. „Es sei denn … willst du, dass ich verschwinde?“
Wilma griff zu meiner Hand. „Nein. Lass’ mich nicht allein. Sing doch weiter. Das Lied ist so schön“.
You’re in my heart, you’re in my soulYou’ll be my breath should I grow oldYou are my lover, you’re my best friendYou’re in my soul
My love for you is immeasurableMy respect for you immenseYou’re ageless, timeless, lace and finenessYou’re beauty and elegance
You’re a rhapsody, a comedy You’re a symphony and a playYou’re every love song ever writtenBut honey what do you see in me
You’re in my heart, you’re in my soulYou’ll be my breath should I grow oldYou are my lover, you’re my best friendYou’re in my soul
Wilma unterbrach mich. „Dass du das jetzt für mich singst. Das ist doch von Rod Stewart, oder?“
You’re an essay in glamorPlease pardon the grammarBut you’re every schoolboy’s dreamYou’re Celtic, United, but baby I’ve decidedYou’re the best team I’ve ever seen
And there have been many affairsMany times I’ve thought to leaveBut I bite my lip and turn around‘Cause you’re the warmest thing I’ve ever found
You’re in my heart, you’re in my soulYou’ll be my breath should I grow oldYou are my lover, you’re my best friendYou’re in my soul
„Du solltest jetzt etwas ausruhen. Etwas Schlafen. Ich komm’ dich morgen abholen. Zuerst fahr’ ich zu einem Bestatter. Dann zum Pastor. Dann hole ich dich ab“. Wilma schaute mich an. „Meinst du denn, dass ich gehen kann? Das Krankenhaus verlassen darf?“ Das war für mich keine Frage, zumindest keine die jemand anderes ausser Wilma zu entscheiden hatte. „Du entscheidest das. Du bist nicht krank. Warum also solltest du hierbleiben. Und lass’ dich nicht weiter mit dem Zeugs vollpumpen“.
Wilma hielt mich für einen Moment an der Hand fest. „Dann hol’ mich vorher schon. Lass’ uns zusammen zum Pastor fahren“. Ein kleines Lächeln war in ihrem Gesicht zu erkennen. „Mach’ was du für richtig hältst, nur verschwinde bitte nicht aus meinem Leben“.
An der Zimmertüre blieb ich noch einmal kurz stehen. Schaute zu Wilma. „Niemals. Versprochen. Und jetzt erst recht nicht. Wir müssen zusammenhalten“.
„Tränendämme“
Leise, vorsichtig und extrem abgekämpft kletterte ich ein paar Trittstufen zu unserem Hochbett empor. Michelle schlief tief und fest. Mich zu ihr zu legen – mich überhaupt hinzulegen machte wenig Sinn. In Kürze würde der neue Tag anbrechen. Denn das war sicher, eine Konstante, die Sonne ging immer wieder auf. Liess sich durch keine, noch so arge Widrigkeit davon abhalten.
Aus dem Kühlschrank griff ich mir ein Bier. Dabei war es mir egal, dass es nicht einmal sechs Uhr am Morgen war. Setzte mich auf die Couch, drehte einen unterstützenden Joint. Stierte vor mich hin. Das war’s auch schon. Ich war am Ende. Wusste nicht wie mir geschieht, verlor die Fassung. Begann bitterlich zu weinen. Bilder blitzten vor meinen Augen auf. Willeke lag vor mir auf ihrer kleinen Decke. Brabbelte, lachte, strampelte mit ihren kleinen, speckigen Beinchen in der Luft. Es war alles wie im Traum, ein böser Alptraum, der nie mehr zu Ende gehen wollte. Mit dem kleinen Menschen zusammen war seine ganze Zukunft gestorben. Bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Wünsche, Träume, Hoffnungen – alles im Arsch, alles nichtig. Von einer Minute auf die andere war alles anders.
Da sass ich dann, allein mit der Dramatik, die sowohl Vater und Mutter betrifft und alles, was bisher normal und lebenswert war, außer Kraft setzte. Unendliche Trauer galt es jetzt zu bewältigen. Und ein weiteres Mal in meinem Leben war da wieder die schwerwiegende Schuldfrage zu überwinden. Eine eindeutige Antwort nach dem „Warum“ gab es sowieso nicht. Was aber nicht bedeutete, dass man sich das Hirn zermarterte ob es denn doch eine Antwort geben würde. Meistens nicht. Der Tod meines Kindes schien kaum überwindbar - und trotzdem musste das Leben – mein Leben - weitergehen. Das „Wie“ war im Moment allerdings nicht vorstellbar.
Michelles Frage und Begrüssung zugleich „Guten Morgen mein Liebling. Wie geht es dir?“ riss mich aus meinen Gedanken. „Frag’ mich nicht“ erwiderte ich ihre Begrüssung. „Guten Morgen mein Engel. Natürlich, fragen kannst du mich. Nur eine Antwort kann ich dir nicht geben. Ich weiss nichts. Nicht viel. Ausser …“ Ich zog sie an mich. „Ausser, dass ich froh bin, dass du da bist. Und es dir gut geht. Es geht dir doch gut?“ Michelle küsste mich auf die Stirn. „Naja … Sorry, dass ich einfach so abgehauen bin. Aber das hat mich alles überfordert. Mir war nicht gut. Ich habe mir Sorgen um unser Baby gemacht. Verstehst du das?“
Verstehen konnte ich das, zumindest das was sie sagte, also im akustischen Sinne. Aber von dem Rest wusste ich nichts. Wollte es aber auch gar nicht wissen. Das was ich aktuell „nicht verstand“ reichte mir komplett aus. Füllte meinen Horizont vollständig. Mit „Nichts“, mit einem riesigen Vakuum.
Während Michelle ein Fühstück für uns vorbereitete gab es, verständlicherweise, nur ein Thema. „Was für ein Schicksalsschlag“, so beschrieb sie es mit sehr geschönten Worten. Und dass sie sich vorstellen könne wie sich Wilma fühlen müsse. „Nichts, gar nichts kannst du dir vorstellen. Keiner. Keiner kann sich sowas vorstellen. Wer will sich sowas auch vorstellen? Nicht mal ich. Obwohl es mich auch sowas von heftig trifft. Aber auch ich habe nicht die mindeste Ahnung was in Wilma vor sich geht“. Michelle schaute mich an. „Schatz … Ich wollte doch nur …“. „Schon okay mein Engel. Danke für deine Anteilnahme. Nimm’s mir nicht übel … aber du hast echt keine Ahnung. Sei froh“.
Aus der Jackentasche meiner Jeans-Jacke zog ich den „Totenschein“ heraus. Erzählte Michelle was ich an Informationen noch erhalten hatte nachdem Wilma wutenbrannt die Pathologie verlassen hatte. Auch davon wie sich ihre Wut, ihren Schmerz, ihre Verzweiflung geäussert hatte. „Aber du kannst doch auch nichts dafür“. Damit hatte Michelle natürlich Recht, aber änderte nichts daran wie es war.
„Auch das ist okay Michelle. Wilma darf das. Sie darf alles. Alles wonach ihr der Sinn steht. Das verzeihe ich ihr“. Aus der Kaffeekanne goss ich mir Kaffee in eine Tasse. „Ausserdem gibt es auch gar nichts zu verzeihen. Zu entschuldigen. Es trifft ja auch keinen eine Schuld“. Mit leicht klingendem Ton des Kaffeelöffels verrührte ich den Zucker in der Tasse. „Ausser diesem Herrn Gott, diesem Arschloch. Der hätte doch die Macht gehabt das zu verhindern. Hat er aber nicht. Diese Drecksau“.
Hätte ich allein am Esstisch gesessen hätte ich garantiert alles mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt. Beherrschte mich aber. Strich den leicht verknüllten Totenschein glatt. „Ich muss mich gleich um einen Bestatter kümmern. Dann zu Wilma. Sie verlässt heute das Krankenhaus. Ich will nicht, dass sie dort noch länger bleibt. Und dann zum Pastor. Wir müssen Willeke beerdigen …“. Mitten im Satz brachen meine Tränendämme. „Verflucht, verdammt, kut“. Vergrub mein Gesicht im Michelles Schulter. „Das ist die zweite Willeke die ich beerdigen muss. Warum? Warum nur?“
Michelle strich durch meine Haare. „Willst du nicht erst Wilma abholen? Dann alles weitere mit ihr gemeinsam erledigen?“ Sie hob mein Gesicht an. „Soll ich …? Ach Quatsch, ich komme mit“.
Bevor wir uns auf den Weg machten wollte ich duschen und mich umziehen. Zumindest optisch frisch erscheinen, auch wenn ich das eigentlich ganz und gar nicht war. Immer wieder schüttelten mich kleinere und grössere Heulanfälle. Manche ‑ wenige – konnte ich überspielen. Die meisten allerdings bahnten sich ihren Weg. „Ich fahre“ entschied Michelle. Eine gute Entscheidung. „Genau so machen wir das. Alles. Was du gesagt hast. Auch erst Wilma abholen. Dann zum Pastor und alles weitere“.
„Sinn des Lebens“
Wenn nicht Wochenende wäre, wäre das alles nicht zu realisieren was jetzt anstand. Zumindest nicht so ohne Weiteres. Wie hätte das gehen sollen? Neben all dem privaten Kram jetzt auch noch pünktlich auf unseren Arbeitsstellen erscheinen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber woher wollte ich das wissen? Was war schon Möglich? Oder Unmöglich? War ich nicht einer endlosen Spirale der Unwägbarkeiten ausgeliefert? War es nicht eher so, dass ich mich „irgendwie“ durch dieses, mit jedem Tag neue Labyrinth der Herausforderungen manövrieren musste? Hatte ich mir so mein „erstes Leben“ vorgestellt? Würde das beim „nächsten Mal“ besser? Anders bestimmt. Aber besser? Wenn es denn ein „nächstes Mal“ für mich überhaupt geben würde. Umso mehr galt in diesem jetzigen Leben mein Bestes zu geben. So gut ich es wusste. Ich es konnte. Aber was wusste ich schon? Was konnte ich schon?
„Schatz. Wir sind da. Du kannst aussteigen“. Michelles Worte, die sie durch die von ihr geöffnete Beifahrertüre sprach, rissen mich aus meiner Denkspirale. „Träumst du?“ Leicht verstört blickte ich sie an. „Nein. Nicht träumen. Ich grübele. Ich kenne das irgendwie schon. Ich habe das alles schon einmal erlebt. Mit einer anderen Willeke. Der Schmerz wird nie weniger. Es ist ein Schmerz, der niemals aufhört“.
Bereits auf dem langen Gang der Klinikabteilung machten wir Wilma aus, die hier auf und ab spazierte. In ihrer privaten Kleidung. Mit wachen Augen, wacheren als gestern zumindest, kam sie auf uns zu. Innige Umarmung und Küsschen links, Küsschen rechts. „Geht das klar, dass du mich abholst?“ Ihr Blick wechselte zwischen Michelle und mir hin und her. „Dass ihr mich abholt meine ich natürlich“. Fest schloss ich Wilma in meine Arme. „Howgh“ beschrieb ich mit den Worten des Buchautors Karl May, die er auch seiner Romanfigur Winnetou in den Mund gelegt hatte, dass alles beschlossene Sache sei. Eine Zustimmung von niemandem ausser ihr fehlte.
„Wollen wir Kaffee trinken? In der Caféteria? Ich habe einiges zu erzählen“ nickte Wilma. „Ja, ist beschlossene Sache. Ich komme mit dir. Mit euch“.
Wilma erzählte. Dass sie am frühen Morgen nochmals mit Professor van Teylingen gesprochen habe. Ihm erklärt hatte, dass sie gestern mehr oder weniger die Kontrolle über sich verloren habe. Und ihn deshalb gebeten habe sich von ihrer Tochter Willeke zu verabschieden. Was ihr eben gestern so gar nicht gelungen war. Möglich war. Über den Tisch hinweg nahm ich ihre Hand. „So ist meine Wilma. Wenn du klar bist. Wenn man dich nicht ruhigstellt. Ich bin stolz auf dich“.
„Willeke war so kalt, so weit weg. Als ich ihr Gesicht gestreichelt habe war mir plötzlich klar, dass sie nicht mehr in dem kleinen Körper ist. Ihre Seele hat den Körper verlassen. Dieser kalte und blasse kleine Körper hat nichts mehr mit meinem Kind zu tun. Wir können sie beerdigen. Ihre Seele ist frei. Lediglich den Körper, den Leichnam begraben wir. Der Rest wird immer bei uns sein. In unseren Herzen“.
Ihre Worte lösten einen heftigen Schluckreiz bei mir aus, gefolgt von heftigen Tränen, die über meine Wangen herabliefen. War Wilma jetzt wirklich so gefasst? So gefestigt? Machte ihr das alles nichts aus? War das wirklich so nüchtern, so sachlich zu betrachten?
Mein Blick ging zu Michelle. Wie froh, erleichtert war ich, dass ich auf ihren Rat gehört hatte. Nicht vor dem Krankenhaus zu einem Bestatter gefahren zu sein. Nicht auszumalen, wenn er, in meinem Auftrag, unsere kleine Maus bereits aus der Pathologie abgeholt hätte. Ohne dass Wilma Gelegenheit bekommen hätte sich „wirklich“ von ihrer Tochter zu verabschieden. Hätte ich mir das jemals verzeihen können?
Hätte Wilma mir das jemals verziehen? Wortlos griff ich zu Michelles Hand, drückte sie ganz fest. Sah sie ebenso fest an.
„Wollen wir dann los?“ Michelle löste den Impuls aus. „Ja, wir haben jede Menge zu erledigen“. Bewusst oder unbewusst hatte sie, mich zumindest, aus einer gewissen Lethargie herausgerissen. Trauer ist wohl das Schwierigste, was wir im Leben ertragen müssen. Der Verlust ist unwiederbringlich - und das macht es so schwer begreiflich. Es kommt im Kopf nicht an, auch wenn man es weiß. Man wird auf eine bestimmte Art sehr eigen, wenn man trauert. Man kapselt sich ab, reagiert unvorhergesehen, ist oft teilnahmslos und abwesend. Alle Gedanken kreisen letztlich um den Verstorbenen. Das alles galt für mich zu hundert Prozent. Für mich war es so, als wäre ein Stück von mir gestorben. Wieder einmal. Ein Schmerz, der niemals aufhört. Wie oft müsste ich das noch erleben? Durchleben?
Wilmas Vorschlag lautete „Bitte zuerst zum Pastor“. Mit ihm reden, ihm alles erzählen. Auch das war mir recht, wusste ich doch so gar nicht welcher Bestatter? Und wo genau? Vom wie und was gar nicht zu reden. Ist das ja nun auch nicht gerade ein Thema, dass man mal eben so präsent hat. Und, so meinte ich jedenfalls, würde er doch bestimmt auch wissen wie so eine Bestattungsprozedur ablaufe. Hatte er doch garantiert des Öfteren damit zu tun. Öfter jedenfalls als wir. Insgeheim dachte ich sogar „Gott hat mir mein Kind genommen – soll er auch dafür sorgen, dass es seinen ewigen Frieden findet“. Musste mich aber sofort selbst ermahnen dem Pastor gegenüber nicht ausfallend zu werden. Ihm als Stellvertreter Gottes gegenüber. „Verdammter Mistkerl“ schloss ich meine Gedanken ab.
Jeroen, so hiess ja unser Pastor, empfing uns freundlich in seinem kleinen Büro. Nannte man das überhaupt Büro? Oder wie genau lautete die Bezeichnung? Ein kleines Zimmer. Absolut karg eingerichtet. Der einzige „Schmuck“ war ein an der Wand hängendes Kreuz. Und ein vollgeprödeltes Bücherregal. Ein schlichter Holztisch, darum vier Stühle. „Das ist ja eine Freude euch begrüssen zu dürfen. Was führt euch zu mir?“ Jetzt schon verspürte ich die aufsteigende Aggression in mir. Wilma kam bloss bis „Willeke ist tot“, brach sofort in Tränen aus.
Jeroen war sichtlich geschockt ob dieser Nachricht. Bemühte sich Trost zu spenden. „Das ist ja furchtbar. Das tut mir leid. Was ist denn passiert?“ Wilma schnäuzte sich in ihr Shirt hinein. „Ich habe sie wie immer in ihr Bettchen gelegt. Als ich dann irgendwann zur Kontrolle zu ihr gegangen bin …“ Wilma schluchzte. „… war nichts mehr in Ordnung. Willeke … mein Kind … unser Kind atmete nicht mehr. Hatte keinen fühlbaren Puls mehr. Wie ein Roboter legte ich meine Maus auf den Boden… Fing an, es zu beatmen… Herzdruckmassage…“ Wilma schaute mich an. Ich musste sie in die Arme schliessen, sie festhalten. „Dann bin ich zum Telefon, habe die Feuerwehr, den Notarzt gerufen“. Man habe ihr gesagt sie solle versuchen, Ruhe zu bewahren und mit der Ersten Hilfe weitermachen. Sie solle es immer weiter probieren, es würde ganz schnell jemand kommen.
Mein Blick ging zu Jeroen. „Und? Was hat sich denn dein Gott dabei gedacht?“ Seine, für mich lapidare, Antwort „Die Wege des Herrn sind unergründlich“ brachte mein Emotionsfass zum Überlaufen. „Was ist denn das für eine Scheiss-Antwort. Mann, du Arschloch. Dass wir sterben müssen – alle – ist klar. Aber doch nicht nach wenigen Wochen. Willst du mich mit so einer Scheiss-Erklärung abspeisen? Hast du nicht selbst bei ihrer Taufe ein Loblied auf diesen Herrn vorgetragen? Der uns jetzt unser Kind genommen hat?“
Trotz meiner aggressiven Anfeindung blieb Jeroen sehr ruhig mir gegenüber. „Ein verstorbenes Familienmitglied hinterlässt eine Lücke, die kaum wieder zu schließen ist und jedes einzelne Familienmitglied muss lernen mit diesem Verlust zurecht zu kommen. Ob der Tod des Kindes vorhersehbar war oder plötzlich kommt, spielt dabei keine Rolle, das Leid ist immer gleich groß. Ebenso oft auch die Wut und ein erdrückendes Ohnmachtgefühl“. Er sah mich an. „Ich kann deine Wut verstehen“. „Ach ja, kannst du? Hast du Kinder? Hast du ein Kind verloren? Wie kannst du es wagen von etwas zu reden von dem du keine Ahnung hast?“
Michelle zog mich am Ärmel, scheinbar spürte sie, dass ich kurz davor war einen Schritt nach vorne zu machen. Um Jeroen einfach eine reinzuhauen.
Der Pastor bat uns Platz zu nehmen. „Möchtet ihr reden? Dafür seid ihr doch gekommen, oder?“ Mit einer Hand zog ich erst für Wilma, dann für Michelle einen Stuhl heran. „Hör’ mir zu du Pastor, von mir hast du … und dein Gott so rein gar nichts mehr zu erwarten. Mit euch bin ich fertig“, Setzte mich ebenfalls. „Aber wenn dir danach ist, dann quatsch’ die beiden Frauen voll. Für mich seid ihr erledigt. Du und dein Gott. Für immer“.
Ob das was Jeroen jetzt erzählte ein Trost oder einfach nur eine wissenschaftliche Erklärung sein sollte konnte, und wollte ich nicht einordnen. Eigentlich wollte ich gar nichts mehr von ihm hören. „Kinder sterben fast immer während sie schlafen. Man vermutet, dass eine Atemstörung während des Schlafens eine Rolle spielt: Offenbar vergessen die Kinder zu atmen. Und diese Atemschwäche führt dann zu Sauerstoffmangel, einem verlangsamten Herzschlag. Weil keine frische Luft eingeatment wird, steigt die Konzentration von Kohlendioxid im Blut. Normalerweise ist dies der stärkste Anreiz für den Körper, um aufzuwachen und weiter zu atmen. Manche Kinder verfallen lediglich in eine Schnappatmung. Und nicht einmal dieses abrupte Schnappen nach Luft weckt die Kinder auf. Letztendlich ersticken sie, weil sie nicht aufwachen“.
Wilma und Michelle hörten ihm zu. Hörten ihm richtig zu. Er redete immer weiter. Ich hatte irgendwann einfach auf Durchzug geschaltet. Meine kleine Willeke wurde nicht einmal vier Monate alt. Sie lag mit ihren feinen Härchen einfach tot im Bett. Was für ein Schock für Wilma. Ein Moment, der das Leben für immer veränderte, ein nicht aufhörender Albtraum, aus dem es kein Entrinnen gibt. Nicht nur für Wilma. Am Abend zuvor hatte das kleine Mädchen noch mit mir gespielt, fröhlich gebrabbelt, mir seine Zuneigung bekundet. Ich hatte ihr noch eine Geschichte vorgelesen. Von der frechen Pippilotta. Und dann war sie einfach tot. Plötzlicher Kindstod, das war die einzige Erklärung der Pathologie. Sonst nichts.
War es da verwunderlich, dass ich in tiefster Verzeiflung war? Die Gefühle, die ich in voller Intensität durchlebte waren schier unerträglich. Trauer und Angst, Schuldgefühle, aber auch Wut und Ohnmachtsgefühle angesichts der Endgültigkeit des Todes. Alle Hoffnungen und Träume für die Zukunft wurden jäh zerstört. Der Sinn des Lebens schien plötzlich verloren gegangen. Und da wollte der Typ mir irgendwas von „unergründlichen Wegen des Herrn“ weismachen.
Abrupt schob ich meinen Stuhl vom Tisch ab. „Halt bloss die Fresse Mann“.
Jeroen schien nicht einmal sonderlich erstaunt über meinen neuerlichen Gefühsausbruch. „Ich geh’ … ich muss raus. Sonst verlier’ ich meine Contenence“. Schaute zu Jeroen. „Ja, ich geh’ raus. Ich kann dein Gelaber nicht weiter ertragen. Will es auch nicht. Gelaber, nichts als Gelaber ist das doch. Spar’ dir das für deine nächste Predigt“. Drehte mich vom Tisch weg. „Ich verspüre den Drang dich zu schlagen. Und glaub’ mir, nicht einfach so eine Ohrfeige“.
„Ingeborg“
Wie lange Wilma und Michelle noch beim Pastor blieben war schwer zu sagen. Lange jedenfalls. Mehrere Zigaretten lang. Erst war ich ungeduldig vor dem Pfarrhaus auf und ab gelaufen, hatte mich dann aber ins Auto gesetzt, hörte Musik.
„Warum warst du so aggressiv Jeroen gegenüber?“ wollte Wilma direkt von mir wissen als sie endlich kamen. „Das fragst du mich? Ernsthaft? Willst du eine Antwort darauf? Das meinst du doch nicht ernst, oder? Was soll denn diese beschissene Frage? Kannst du dir das nicht denken? Kannst du dir das nicht selber beantworten?“
Michelle zog sie an der Hand. „Lass’ ihn. Du kennst ihn doch auch. Lass’ ihn so wie er ist. Wenn Gus nicht so wäre hätte er dich garantiert nicht aus Willemstad geholt. Also lass’ ihn. Einfach so wie er ist“.
Geschickt lenkte Michelle das Gesprächsthema auf das, was sie erfahren hatten. Nämlich wie die weiteren Schritte auszusehen hatten, die wir jetzt in Angriff nehmen mussten. Nämlich die Bestattung. Jeroen hatte den beiden eine Adresse eines Bestattungsunternehmens genannt. In Abbenbroek. Zwischen Nieuwenhoorn und Heenvliet. Gut fünfzehn Minuten entfernt. In etwa dort wo Michelle ihre privaten Fahrstunden von mir bekommen hatte. „Magst du fahren mein Engel? Die Strecke kennst du doch“ hielt ich Michelle die Autoschlüssel entgegen.
Eine echte Holländerin mittleren Alters empfing uns. Blonde, kürzere Haare, blaue Augen. Um den Hals trug sie eine dezente Perlenkette. Ein schwarzes Kostüm, Rock und Blazer. Darunter eine fliederfarbene Bluse. Der obere Knopf geöffnet. Sehr züchtig. Natürlich wusste sie den Grund unseres Erscheinens direkt einzuordnen. Wer kommt sonst schon zu einem Bestatter? Garantiert keiner. Mit den Worten „Oft ist der Grund für einen Besuch bei uns eine traurige Situation. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen und Sie unterstützen können“. Damit lag sie richtig. Allerdings war mein Verständnis von „Besuch“ ein gänzlich anderes. Sie bat uns an einem Tisch Platz zu nehmen, fuhr fort. „Sie können sich während des gesamten Prozesses rund um die Beerdigung auf uns verlassen. Nicht nur in praktischen Fragen, sondern auch für ein nettes Gespräch oder um sich abzulenken“.
Was meinte sie jetzt genau mit „nettes Gespräch“? Oder „ablenken“? Mir persönlich war weder nach dem einen noch dem anderen zumute. Aber vermutlich sagte sie das jedem der hier auftauchte. Wieder so ein Berufsbild, dass ich absolut nicht nachvollziehen konnte. Schon merkwürdig womit manche Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und genau wie der Pathologe verdiente sie ihren „Lebensunterhallt“ mit dem Tod. Mit dem Tod anderer Menschen.
Sie schob eine Schale mit Gebäck über den Tisch. Erst jetzt stellte sie sich vor. „Ingeborg“ lächelte sie uns an. „Wenn ein geliebter Mensch stirbt, wird man mit vielem konfrontiert. Es ist ein emotionales Ereignis, das plötzlich alle möglichen Vorkehrungen erfordert. Wir begleiten Sie auf dem Weg zu einem würdigen Abschied, der sich an den Wünschen des Verstorbenen und der Angehörigen orientiert“.
Das alles klang so einstudiert. Und genau so leierte Ingeborg auch den Text herunter. Dann erst fragte sie nach der Todesursache. Und in welchem Verhältnis wir zum Verstorbenen stehen würden. Wilma übernahm das Gespräch. „Unser Kind …“ sie wies mit der Hand zu mir „…also unser Kind ist verstorben“. Legte eine Hand auf Michelles Unterarm. „Das ist unsere Freundin Michelle“.
Ingeborg reagiert flüchtig – und wahrscheinlich ebenso einstudiert – mit einer Beileidsbekundung. „Einer der schwersten Schritte, die Eltern jemals gehen müssen, ist die Beerdigung ihres eigenen Kindes. Und so furchtbar dieser Moment auch ist, so kann er doch, vor allem im Nachhinein betrachtet, auch wirklich wunderschön sein. Denn die Beerdigung ist die gemeinsame Verabschiedung von einem kleinen Leben, ein gemeinsames daran Denken und ein Wertschätzen der Zeit, die gegeben wurde“. Mit einem Schlag war ich wieder in einer Situation, die mich schier explodieren liess. Wilma fasste meine Hand. „Gus … Bitte“.
Ingeborg üernahm wieder das Gespräch. Erklärte „Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Ihr Kind bestattungspflichtig ist“. Sah kurz zwischen Wilma und mir hin und her. „Ihr Kind ist doch sicher im Krankenhaus verstorben, oder?“ Mit festem Druck umschloss ich Wilmas Hand. „Nein, sie ist zuhause verstorben. Plötzlicher Kindstod. Aber ja, sie ist natürlich im Krankenhaus“.
Ingeborg holte von einem kleinen Tisch einige Prospekte, die sie uns vorlegte. Dann erfuhren wir weitere Details. So zum Beispiel „Eine Überführung vom Krankenhaus darf ausschließlich in einem Leichenwagen erfolgen, auch jeglich weiterer Transport kann nur auf diese Art und Weise geschehen“. Und ob wir eine Erd- oder Feuerbestattung ins Auge gefasst hätten? Ob wir einen Friedhofsplatz hätten? Einen Grabstein?
Ich unterbrach Ingeborg. „Hören Sie. Unser Kind ist gestern verstorben. Wie lange kann das eigentlich im Krankenhaus … in dieser Pathologie bleiben? So schnell geht das alles nicht. Zumindest nicht bei uns … bei mir. Woher soll ich das alles wissen?“ Sah zu Wilma. „Oder hast du direkt die Antworten parat?“
War es jetzt eigentlich egal was ich gesagt hatte? Ingeborg redete unbeeindruckt einfach weiter. Setzte ihre Ausführungen fort.
„Wir können anbieten …“ Schob einen Prospekt herüber. „… Erdbestattung. die traditionelle, christliche Form der Bestattung. Die Beisetzung findet in den meisten Fällen recht schnell nach dem Tod des Kindes statt. Hier wird das Kind in seinem Sarg in das ausgehobene Grab vorsichtig heruntergelassen. Dies kann man selbst durchführen, oder man lässt es von Angehörigen, oder von dem Friedhofspersonal durchführen. Hierbei können auf den Sarg noch Blumen, kleine beschriftete Zettelchen oder andere Grabbeigaben geworfen werden. Hat sich die Trauergesellschaft verabschiedet, so wird der Friedhofsmitarbeiter das Grab mit Erde schließen und das Grabkreuz befestigen“.
Mit meiner Geduld und meinem Verständnis war es zu Ende. Egal wie sehr ich mich mühte freundlich zu bleiben. „Verflucht noch mal. Verdomme. Kut. Komm’ mir nicht mit christlicher Form. Gott ist ein Arschloch. Ist das klar? Der hat mir mein Kind genommen. Und wie eine Beerdigung abläuft weiss ich auch. Man verbuddelt den geliebten Menschen, bewirft ihn mit Dreck. Das ist es doch was du da mit netten Worten versuchst anzupreisen“.
Für einen Moment herrschte Schweigen. Auch bei Wilma und Michelle. Bei allen. Wie auf einer Beerdigung. „Müssen wir das jetzt entscheiden?“ nahm ich die Unterhaltung wieder auf. Ingeborg war aufgestanden. Legte einen weiteren Prospekt vor. „Nein. Vielleicht wollen Sie die Unterlagen mitnehmen?“ Wusste dann aber doch noch eine Information nachzuschieben. „Oder Feuerbestattung. Bei der Feuerbestattung wird das Kind mit seinem Sarg eingeäschert und die Asche in einer Urne beigesetzt. Die Beisetzung einer Urne muss nicht direkt im Anschluss an die Einäscherung erfolgen“.
Wilma schob die Unterlagen zusammen. „Wir schauen uns das alles an. Melden uns wieder“. Reichte Ingeborg die Hand. „Und entschuldigen Sie bitte … das meint er nicht perönlich“. Wie war sich Wilma da jetzt so sicher? Woher wollte sie das wissen?
„Pfui Teufel“
Dass ich Ingeborg jetzt als „Kut“, also als Fotze beschimpft hatte, tat mir leid. Aber das war, genau wie Wilma es betont hatte, nicht wirklich persönlich gemeint. Das war einfach so eine Redensart hier in den Niederlanden. Und es war mir eben einfach so in meiner Erregung herausgerutscht. Aber alles andere meinte ich genau so wie ich es gesagt hatte.
„Wir bringen dich jetzt nach Hause, oder?“ wollte ich von Wilma wissen. Dann könnten wir bei ihr unsere Unterhaltung, unsere Entscheidungsfindung fortsetzen. Ausserdem hatte ich Hunger. Auch deswegen schon war ich extrem reizbar. Aber nicht nur deswegen. Zu wissen, dass ich mein Kind nie mehr wiedersehen würde setzte mir dermassen zu. Brachte mich an den Rand der Verzweiflung.
Michelle fuhr erneut. Im Prinzip die gleiche Strecke zurück. Zu Wilmas Wohnung. In Nieuwenhoorn.
Eine bedrückende Stille, eine bedrückende Leere empfing uns. Obwohl die Wohnung eingerichtet war war sie leer. Nur die immer noch verstreut liegenden Spielsachen, Kuscheldecken erinnerten daran, dass hier ein Kind gelebt hatte. Diese Wohnung mit Leben gefüllt hatte. Jetzt war sie eben leer. Das Kind fehlte.