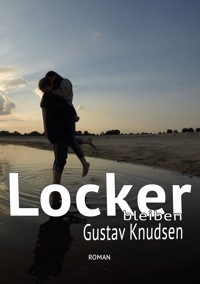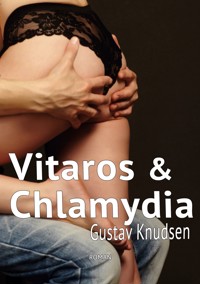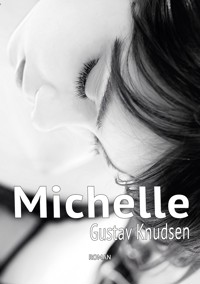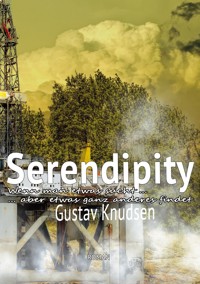
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die frühen 1980er Jahre - prägend und einprägend
- Sprache: Deutsch
Mit seiner Ankunft in den Niederlanden wird Gustav von Erinnerungen überwältigt. Resultierend daraus hat er mit Zweifeln zu kämpfen, die ihm das eine oder andere Mal suggerieren, dass der Neustart in Norwegen vielleicht doch nicht das Richtige ist. Auf der Suche nach einer vorübergehenden Bleibe quartiert sich die lebenslustige Linda, eine Freundin von Gustavs verstorbener Lebenspartnerin Willeke bei ihm ein. Ihre unkomplizierte und manchmal kindlich naive Art begeistert Gustav nicht nur, sondern sie trägt auch erheblich dazu bei, ihn aus seinem emotionalen Tief zu befreien. Schnell wird ihm klar, dass Linda durchaus eine erotisierende Faszination auf ihn ausübt, der er sich nicht entziehen kann. Es folgen Tage und Wochen voll leidenschaftlichem Verlangen, wobei aber beiden bewusst ist, dass es bei einer Affaire bleiben muss. Als der Tag der Abreise in greifbare Nähe rückt, gerät Gustav in den Zwiespalt, ob er Michelle von Linda erzählen soll oder nicht. Wird Gustav Michelle seine Affaire mit Linda beichten und damit seine kleine Familie vielleicht aufs Spiel setzen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit seiner Ankunft in den Niederlanden wird Gustav von Erinnerungen überwältigt.
Resultierend daraus hat er mit Zweifeln zu kämpfen, die ihm das eine oder andere Mal suggerieren, dass der Neustart in Norwegen vielleicht doch nicht das Richtige ist.
Auf der Suche nach einer vorübergehenden Bleibe quartiert sich die lebenslustige Linda, eine Freundin von Gustavs verstorbener Lebenspartnerin Willeke bei ihm ein.
Ihre unkomplizierte und manchmal kindlich naive Art begeistert Gustav nicht nur, sondern sie trägt auch erheblich dazu bei, ihn aus seinem emotionalen Tief zu befreien.
Schnell wird ihm klar, dass Linda durchaus eine erotisierende Faszination auf ihn ausübt, der er sich nicht entziehen kann.
Es folgen Tage und Wochen voll leidenschaftlichem Verlangen, wobei aber beiden bewusst ist, dass es bei einer Affaire bleiben muss.
Als der Tag der Abreise in greifbare Nähe rückt, gerät Gustav in den Zwiespalt, ob er Michelle von Linda erzählen soll oder nicht.
Wird Gustav Michelle seine Affaire mit Linda beichten und damit seine kleine Familie vielleicht aufs Spiel setzen?
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Maria Teresa
Blase
Esel
Pferdchen
Wolfgang
Frank
Heimat
Artikel 1
Hexe
Samurai
Inch
Kochwäsche
Gedanken einfach
Persönlich
Schiffswerft
Moloch
Windhauch
Ferrari
Besonders
Edelstahlgriffe
Partnermensch
Serendipity
Boerderij
Garantie
Schnepfe
Echt Kacke
Clit
Sentimental
Resopal
Finger. Spitzen. Gefühl
Anders
Rocko und Kocko
Traum
Sag‘ es nicht.
Oben
Irrational
Epilog
Prolog
Die ersten Kilometer schaute ich nur aus dem Fenster. Wortlos. Ab und an blickte ich zu Ingrid auf dem Fahrersitz herüber. Die mich anfänglich in meiner Wortkargheit liess. Der Hafen von Bergen war an uns vorbeigezogen. Natürlich war es andersherum, wir waren am Hafen vorbeigezogen. Wie sollte das auch gehen? Der Hafen hatte eine fixe Position. Ingrids Van nicht. Wir waren es doch, die sich bewegten. In einem Auto sitzend. Statisch und mobil zugleich. „Wie geht es dir mein Grosser?“ unterbrach Ingrid die Wortlosigkeit.
Bei jedem anderen hätte ich garantiert mit „Jo, prima. Alles Bestens, mir scheint die Sonne aus dem Arsch“ geantwortet. Nicht so bei Ingrid. Sie war nicht nur meine Freundin, mein Freund, mein Partner – sie war auch meine Psychologin. Kannte mich nur zu gut. Warum ihr also irgendeine Story auftischen? Ihre Frage war zwar recht lapidar formuliert, aber sie erwartete eine „echte“ Antwort von mir. Eine „offene und ehrliche“ Antwort.
„Ich fühl‘ mich so, als hätte ich mich irgendwie weggeschlichen“ begann ich nach einem Moment des Grübelns. Sollte ich Ingrid wirklich erzählen was in meinem Kof vorging? Aber wem sonst, wenn nicht ihr, konnte ich mich anvertrauen? Mal ganz abgesehen davon, dass im Moment niemand anderes als Ansprechpartner verfügbar war.
Es war der Abschiedsschmerz, der mich vorhersehbar und lautstark erwischt hatte. War das etwas „Anormales“? Trifft er doch garantiert einen jeden. Manchmal sogar mehrmals im Leben. Gehört er doch zu unserem Leben wie Blitz und Donner zum Gewitter. Und garantiert war keiner vor ihm sicher. Eingeladen hatte ich ihn nicht, wollte ihn auch nicht wirklich haben, dafür hasste ich ihn viel zu sehr. Mitleid mit ihm zu empfinden war nicht angebracht. Vergleichbar mit unliebsamen Verwandten. Er kommt, macht sich breit, gedenkt auch erst einmal zu bleiben.
Maria Teresa
Dieser Abschiedsschmerz hatte mich schon zu oft „kalt erwischt“. Jetzt war es so, dass ich mich von meinen Lieben verabschieden musste, zwar nur für kurz, für eine absehbare Zeit. Aber auch gleichzeitig gekoppelt an andere Umstände. Meinen Job hatte ich zwar nicht verloren im eigentlichen Sinne, nur einen neuen gefunden. Musste dafür aber alles Bekannte aufgeben. Eine sichere und bekannte Umgebung verließ. „Es ist doch für deine Karriere“ lenkte Ingrid ein. „Schlimmer wäre es doch, wenn du deinen Partner verlassen müsstest“.
Karriere, was hiess denn schon Karriere? Was für einen Wert hatte das Wort? Aber Ingrid hatte Recht, es gab schon schlimmere, härtere Situation, die den Abschiedsschmerz in mir ausgelöst hatten. Zwei geliebte Menschen hatte ich durch deren Tod für immer verloren. Hatte lange das Gefühl, nicht mehr zu leben, nur noch zu funktionieren. Und im Grunde auch gänzlich anderer Art. Diese Abschiede waren „für immer“. Definitiv. Endgültig. Was den physischen Aspekt anbelangte.
Der in Sichtweite kreisende Helikopter der SHELL durchbrach mit dem dumpfen Grollen seiner Rotorblätter meine, Ingrid gegenüber geäusserten Gedanken. Sie hatte, wie es ihre Art als Psychologin war, zugehört. Nur hier und da Anmerkungen eingestreut. Ratschläge, Sichtweisen geäussert. „Bist du schon mal in einem Heli geflogen? Hast du schon mal Norwegen von oben gesehen?“ Ingrid blickte kurz herüber. „Ja. Von oben ja. Aber nur aus dem Flugzeug. Aus einem Helikopter nicht“. Die Strassenbeschilderung unterstrich, dass wir in Kürze am Flughafen Bergen eintreffen würden. „Kokstad“. Auch weil ich schon hier war, war klar – „Nur noch ein paar Minuten“. Aufgeregt, ein wenig ungeduldig, rutschte ich auf dem Beifahrersitz hin und her. Schaute auf die Uhr im Armaturenbrett des Chevy Van. Gleich Zehn Uhr. Eine gute halbe Stunde blieb noch bis zum Check-In. Gepäck hatte ich keines aufzugeben, lediglich meinen Rucksack. Der aber als Handgepäck galt. Also kein Stress.
„Gehen wir noch irgendwo Kaffee trinken? Hast du noch Zeit? Oder musst du direkt weiter?“ Ingrid hatte zu meiner Hand gegriffen als wir duch das Terminal liefen. „Ja, passt. Ich muss erst mittags in Bergen sein“. Holte uns von einem der Coffee-Shops zwei Tassen Kaffee. Stellte sie auf dem Stehtisch ab. „Ich möchte dir noch etwas sagen. Aber nicht auf den letzten Drücker. Deshalb jetzt. Wenn du jetzt gleich fliegst … in Nederland angekommen bist … Zieh‘ dich nicht in eine Höhle zurück. Gib deiner Ohnmacht keine Gelegenheit. Wir haben so gut über deine Ängste geredet. Über deine Trauer. Du hast alles überwunden. Deine Streitereien mit Wilma. Eure Vorwürfe. Eure Wut. Eure Hilflosigkeit. Ihr habt zu euch gefunden. Zu euch selbst. Vertrau‘ weiter auf deine Stärke“.
Ingrid reichte mir zwei kleine Papiertütchen mit Zucker an. „Und jetzt gerne was anderes. Was möchtest du mir noch sagen? Was ist noch wichtig? Um was soll ich mich kümmern?“ Mir fiel genug ein, aber nichts davon hatten wir nicht bereits besprochen. „Du weißt schon … Ausserdem hat Wilma ja den Plan, sie hat alles im Griff. Unterstütz‘ sie einfach. Unterstützt euch einfach gegenseitig. Hast du mir nicht gesagt ich habe drei starke Frauen an meiner Seite?“
Mit einem Plastiklöffel, nicht einmal ein Löffel, nur ein weisses gerades Stäbchen, rührte ich den Zucker in den Kaffee, trank einen Schluck. „Aber vor allem pass‘ bitte auf Michelle und Torid auf. Machst du das?“ Ingrid kam um den Tisch herum, fasste um meine Taille. „Mach‘ dir keine Sorgen. Du wirst jetzt aber nicht auf den letzten Meter zur Heulsuse, oder? Wir haben alles im Griff. Du wirst sehen“. Ein bisschen war ich froh, dass Ingrid so reagierte. Losheulen hätte ich in der Tat können. Wollen. Genau das war ein Grund warum ich mich „überstürzt“ zuhause verabschiedet hatte. Mich der Verabschiedung entzogen hatte.
„Boarding for KLM to Amsterdam at Gate …“ Ingrid sprang von ihrem Stuhl bei der Durchsage auf. „Das ist dein Flug. Du musst los“. Natürlich hatte ich das auch mitbekommen, war aber bei Weitem nicht so aufgeregt wie sie jetzt. Nahm meinen Rucksck, warf ihn über die Schulter. „Also meine Süsse, wir sehen uns in ein paar Tagen. Drück‘ mir alle zuhause. Und grüss‘ noch mal. Und sag‘, dass ich jeden Tag anrufe. Am Besten wohl mittags, dann ist ja immer jemand auf dem Bauernhof, oder?“ Tastete mit einer Hand alle meine Taschen in Jacke und Jeans ab, zur Kontrolle. Mit der anderen zog ich Ingrid an mich.
Ingrid stellte sich ein wenig auf Zehenspitzen. „Küss‘ mich. So kommst du hier nicht weg. Gib mir einen Kuss. Wie sich das gehört unter Freunden“. Kurz drückte ich meine Lippen auf ihre. Was Ingrid aber nicht gelten liess. „Ne, nicht so. Richtig. Küss‘ mich richtig“. Hielt mich dabei an der Hand fest. „Pass‘ auf dich auf. Bis bald“. Langsam lösten sich unsere Hände. Nur noch unsere Finger hielten sich. „Du auch, pass‘ auf dich auf. Pass‘ auf alle auf“.
Eine Vierergruppe an Stewardessen der KLM begrüsste einen nach dem anderen Fluggast. Immer wieder löste sich eine von ihnen aus der Reihe, verschwand mit einem Pasagier in der Boeing 737 – um kurz drarauf zurück zu kommen. Alleine. Die netten, freundlichen Worte der Flugbegleiterin, als sie auf mein Flugticket schaute, liessen mich direkt das Gefühl bekommen ich würde nach Nederland zurückkommen. „Welkom bij KLM. Mag ik u begeleiden naar uw stoel“. Mein Blick ging an der jungen Frau entlang. Ihre Uniform entlang. Blauer Blazer, blaue Weste, blauer Rock. Im Schritt langgeschlitzt. Aus der hellblauen Bluse stach ein blau-oranges Tuch hervor. Erste Worte formulierten sich in meinem Kopf. „Wat ben jij toch een lekker wijffie. En hoe lekker je ruikt“.
Die Stewardess wies mir meinen reservierten Sitzplatz an, reckte sich ein wenig, um mein Handgepäck, meinen Rucksack, in der Ablage über den Sitzen zu verstauen. Ihr betörender Parfumgeruch schwebte zu mir herunter. Für einen Moment. Dann ging sie zurück zu ihren Kolleginnen, die bereits weitere
Passagiere am Eingang der Kabine begrüssten. Einige Augenblicke später erschien eine von ihnen in Begleitung einer Passagierin. Klappte die Armlehne des Mittelsitzes hoch, hantierte am Schloss des Sicherheitsgurts herum. Trat einen Schritt zurück. „Have a seat“ bat sie die Passagierin Platz zu nehmen. Jetzt war auch klar, warum sie die Armlehne hochgeklappt hatte. Anders hätte die Dame gar nicht Platz nehmen können. Sie hatte eine solche Leibesfülle, dass sie nahezu nicht nur ihren Sitz, sondern auch den daneben befindlichen Mittelsitz ausfüllte. Nicht minder gut riechend beugte sich die Stewardess herunter, führte eine Gurtverlängerung in das Schloss des Mittelsitzes ein, verzurrte die Dame.
Mein Blick ging zu ihr, an ihrem schwabbeligen Doppelkinn entlang. Einen Hals hatte sie nicht, der Kopf ging direkt in ihren Rumpf über. Direkt kam mir unser ursprünglich empfohlener Psychologe Frans in den Sinn. „Meine Fresse, wie kann man nur so fett sein?“ schoss es mir durch den Kopf. Zu meiner Verwunderung kam aus dem massigen Körper eine dünne, helle Stimme. „Hi, i’m Maria Teresa Lopez de la Vega“. Meine Sitznachbarin hielt mir ihre Hand entgegen. Plauderte direkt drauflos. Sie käme aus Madrid. Aus Spanien. Was mich aber nicht wirklich interessierte. Mit „Nice to meet you“ erwiderte ich ihren Händedruck. Das war aber auch schon alles. Von meiner Seite. Stattdessen kamen mir ein paar Zeilen eines Lieds von Marius Müller-Westernhagen in den Sinn. „Dicke haben schrecklich dicke Beine - Dicken ham 'n Doppelkinn - Dicke schwitzen wie die Schweine - Stopfen, fressen in sich 'rin - Dicke haben Blähungen - Dicke ham 'nen dicken Po - Und von den ganzen Abführmitteln - Rennen Dicke oft aufs Klo“. Allerdings fand ich das in dem Moment belustigend wie auch ebenso diskrimierend. Ich kannte diese Maria Teresa doch gar nicht. Warum also mir ein Urteil bilden? Sie verurteilen?
Leise war das „Boarding completed“ von der Einstiegsluke zu vernehmen. Unterhalb des Gepäckfachs leuchteten Hinweise auf. „Stop Smoking. Fasten seatbelts“. Dann erschien auch schon jeweils im vorderen und hinteren Bereich des Kabinengangs eine Stewardess und vollführte das mir bereits bekannte Pantomimenspiel. Mit Hinweisen auf Schwimmweste, Ausgänge im Notfall, Kotzbeutel und so weiter. Die Motoren der Boeing 737 drehten langsam, aber kontinuierlich hoch. Mit spürbarem Schub rollte das Flugzeug Richtung Startbahn. Die Stewardessen schritten den Gang ab, warfen mal mehr, mal weniger flüchtig einen Blick auf die Sicherheitsgurte der Passagiere. Um sich schlussendlich auf ihren Sitzen selbst anzuschnallen.
Wieviel hundert PS hatte wohl eine solche Maschine? Solch ein Flugzeug? Reichlich jedenfalls, das war zu spüren. An der Beschleunigung. Nicht einmal auf welches Tempo es beschleunigte, sondern mit welcher Kraft es nach vorne ging. Bis zum Abheben. Danach war das nur noch zu erahnen. Wie die zig Tonnen, wenn nicht gar hunderte von Tonnen in den Himmel aufstiegen. Obwohl ich ja schon einige Flüge hinter mir hatte, war es doch für mich immer wieder ein Wunder der Physik, dass dieses Konstrukt „einfach so“ abhob – und flog. Vor allem nicht einfach wieder herunterfiel.
Bergen wurde kleiner, Norwegen wurde kleiner. Entfernte sich mehr und mehr. Nicht nur optisch. Mit der Stirn an die Seitenscheibe gelehnt klebten meine Augen an der mehr und mehr entschwindenden Landschaft. Bis wir die Wolkendecke durchbrachen. Die Durchsage, die Stimme einer Stewardess „Sie können Ihre Sitzgurte jetzt öffnen“ riss mich aus meinen Gedanken. „Wir servieren Ihnen in Kürze gerne Getränke und Snacks“.
Maria Teresa bat mich ihr beim Öffnen ihres Gurtes behilflich zu sein. Zog sich mit beiden Händen an der Rückenlehne des Vordermanns in die Senkrechte. „Hoffentlich reisst die das Ding nicht entzwei“ dachte ich einen Moment. So sehr bog sich die Lehne unter dem Gewicht was sie bewegte.
Blase
Die Gelegenheit – dass Maria Teresa scheinbar die Toilette aufsuchte, was sonst? – nutzte ich, um meinen Rucksack aus dem Gepäckfach heraus zu holen. Fischte einige Papiere hervor, legte sie auf dem klappbaren Tisch vor mir aus. Den Rucksack verstaute ich im Fussraum. Viel zu lesen gab es auf meinem Notizblock nicht. Noch nicht. Das war ja mein ursprünglicher Gedanke – die sortierst deine Gedanken während des Flugs.
Die von der Stewardess abgefragten eventuellen Wünsche – „Broodje? Schinken? Oder Käse? Tee oder Kaffee?“ erwiderte ich mit „Geht auch ein Bier?“ Was sie schnumzelnd nickend mit „Heineken“ bestätigte. Die von dem Servierwagen entnommene Order stellte ich auf dem Klapptisch des Mittelsitzes ab. Hielt aber alles, insbesondere die Bierdose, gut fest, als sich Maria Teresa wieder in ihren Sitz zwängte. Eneut an der Rückenlehne des Vordermanns dermassen zerrte, dass dieser sich genervt über die Schulter drehte und Maria Teresa anraunzte. Gut, dass er niederländisch sprach – fluchte – und sie nicht verstand was er sagte. Wenn sie ihn so greifen würde wie die Rückenlehne, lief er Gefahr, dass sein Körper zu Hackfleich gepresst wurde.
Auch meine Sitznachbarin bestellte sich „Sandwich“. Fragte aber direkt bei der Stewardess nach, ob auch zwei möglich wären. Freundlich, aber dennoch enttäuschend – für Maria Teresa – war die Antwort „Sorry, one Sandwich each Person“. Mit ein paar grossen Bissen hatte Maria Teresa das Sandwich „eingeatmet“. Das war wohl das schon ein paar Mal von mir gehörte „Für den hohlen Zahn“. Mit einem Griff zum Heineken sicherte ich die Bierdose, schob Maria Teresa mein Broodje auf ihr Klapptischchen herüber. „Would you like my sandwich? Cheese“. Widmete mich wieder meinem Notizblock. Auch um mich dem von ihr versuchten Gesprächswunsch zu entziehen. „Only little English“ log ich sie an. Denn, wenn ich irgendwas jetzt nicht wollte – dann war es vollgequatscht zu werden.
Schon beim ersten notierten Punkt – Autovermietung – kam meine Überlegung ins Stocken. Ging den Ablauf im Kopf durch. Ankunft Schiphol. Interrent-Schalter aufsuchen. Papiere ausfüllen. Auto im Parkhaus suchen. Nach Rockanje fahren. Mietauto zurückgeben. In Rotterdam. „Was für ein Bullshit“ fasste ich meine Ablehnung gegen diese Idee zusammen. In Rotterdam wäre ich dann wieder ohne Auto. Müsste sowieso mit dem Bus zurück nach Rockanje. Die Alternative – und wahrscheinlich nicht nur zeitmässig günstigere Alternative lautete Zug. Von Schiphol nach Rotterdam Centraal. Würde vielleicht maximal 30 Minuten dauern. In etwa die Zeit die es brauchte, bis ich dann den Mietwagen in Empfang nehmen konnte. Ich wäre ja bald in Nederland. Einem kleinen Land. Nicht so wie Norwegen. Wo alles - egal von wo nach wo – ewig dauerte. Rotterdam war von Schiphol vielleicht irgendwas um die fünfzig Kilometer entfernt. Sechzig Kilometer in Norwegen könne mal schnell zwei Stunden Fahrtzeit benötigen. Nicht so in Nederland. Keine Berge, keine sich an Fjorden entlang schlängelnden Strassen. Einfach nur flach geradeaus. Am Gepäckband im Flughafen anstehen brauchte ich auch nicht. Lediglich meinen Rucksack nehmen. Gut ist.
Bevor ich nach der Landung die Maschine verliess wollte ich von der Stewardess die mich beim Boarding an den Sitz begleitet hatte eines wissen. Was mich eigentlich seit dem Moment beschäftigt hatte. „Danke für den angenehmen Flug“ begann ich etwas unsicher. „Eine Frage. Eine private Frage. Wie heisst das Parfum, dass Sie tragen? Dass Sie aufgetragen haben?“ Die Stewardess lächelte freundlich. „La Panthère. Eau de Parfum pour femme. Von Cartier“.
Das würde ich mir merken können. Wollte ich diesen Duft doch für Michelle haben. Und der Zusammenhang war leicht merkbar. War Michelle doch meine kleine Raubkatze. Mein Kätzchen. Mein Panter. Das war sie. Ein Raubtier. Mit scharfen Krallen. Die mich erlegt hatte. Genau wie eine Raubkatze es tat. Mit sanftem Biss in den Hals.
Was kam mir jetzt nicht alles in den Sinn. Wie ich meine Freundin beschreiben würde. Ein Raubtier, das sich auf dem Sofa, in unserem Bett, in meinem Herzen und Leben rollig Platz verschafft hatte. Ich hatte jetzt schon Sehnsucht nach ihr. Das wurde mir schlagartig bewusst. Dabei waren es doch gerade mal ein paar Stunden seit ich von ihr fort war.
Von der Ankunftshalle des Flughafens war es nicht weit bis zur Bahnhofshalle Schiphol. Von zwei Gleisen fuhren verschiedene Züge ab. Von der Anzeigetafel konnte ich entnehmen „Eurostar“. Alle dreissig Minuten. So oder so, Zeit genug um mir ein Ticket zu lösen. Der nächste Zug kam nicht nur bestimmt. Würde sogar im Bahnhof stehen. Immerhin war hier sozusagen „Endstation“ für ankommende Züge. Mit schlapp dreissig Gulden war der Fahrtpreis sehr überschaubar. Welches Auto hätte ich für den Preis mieten können? Den ganzen Rattenschwanz der daran hing mal ganz ausgeblendet. Abholen, Zurückbringen und so weiter.
Ein wenig Zeit bis zur Abfahrt blieb mir noch. Genug um mich mit einer Lektüre, dem aktuellen „Algemeen Dagblad“ einzudecken. Und zwei Blikjes Heineken. Musste auch sehr schnell feststellen, dass ich irgendwie „angekommen“ war. Ich verstand die Sprache – und konnte mich fliessend unterhalten. Kein Suchen nach Worten in meinem Kopf. Und einer anderen Sprache. Einfach so, Niederländisch floss über meine Lippen.
Nur ganz kurz hatte ich die Zeitung aufgeschlagen. Genau so schnell wieder zusammengefaltet. Hing am Fenster. Schaute auf die vorbeifliegende Landschaft. Ja, verdomme, ich war in Nederland. Nichts was die Sicht auf flache Polder versperrte. Man konnte weit schauen. Zum Teil sogar bis zur Nordsee. Ohne mir wirklich darüber im Klaren zu sein formulierte sich „Mann, was habe ich das vermisst“ in meinem Kopf. Leiden, Zoetermeer, Rotterdam. Ruckzuck war die schlappe halbe Stunde Reisezeit verflogen.
Was ich vermisst hatte wurde mir in Rotterdam noch bewusster. Kämpfte mich vor Rotterdam Centraal durch eine wahre Armada an Fahrrädern hindurch zum Busbahnhof. Blieb eine Weile einfach stehen. „Du bist im Begriff das alles aufzugeben. Ist dir das klar?“ Mehrmals fragte ich mich das. Aber klar war gar nichts. Mir nicht. Es war eher so wie in einem Film. Wo die Kamera auf mich gerichtet war, dann schwenkte und sich alles um mich herum drehte. Schnell. Immer schneller. Bis die Gebäude Kondensstreifen zogen. War das das was man mit „Freudentaumel“ bezeichnete? Oder lag das jetzt an den zwei Blikjes Heineken, die ich im Zug weggekippt hatte?
Mit dem Auto wäre die Weiterreise jetzt kein Problem. In Rotterdam kannte ich mich aus. Mit dem Openbaar Vervoer war das allerdings nicht so. Noch nie war ich mit dem Bus nach Rotterdam gefahren. Somit auch nicht in umgekehter Richtung. Ein wenig verloren lief ich am Busbahnhof umher. Schaute auf Anzeigentafeln und Busbeschriftungen. Rockanje war aber nirgends zu sehen. Bestieg einen x-beliebigen Bus, erkundete mich beim Fahrer. Der mir dann erklärte „Busverbindung Rotterdam nach Rockanje gibt es keine. Du musst mit der RET, der Lijn D, der Metro fahren. Bis Spijkenisse“. Erst ab da würde ein Bus verkehren.
Zwar war die Info nicht das, was ich mir erhofft hatte – aber immerhin eine Info. Also Augen auf und nach der Lijn D suchen. Gut, dass ich keine Koffer oder Taschen zu schleppen hatte. Was dann letztendlich bedeutete „Zurück in das Bahnhofsgebäude“. Am Ticketschalter bekam ich nicht nur einen Fahrschein, knappe zehn Gulden kostete die Fahrt. Bis Rockanje. Bekam zusätzlich noch einen Streckenplan. Mit dem Hinweis „Umsteigen in Spijkenisse“. Auf der Rückseite waren ein paar interessante Informationen aufgedruckt. „Lijn D, die erste U-Bahn-Linie der Niederlande. Auch bekannt als Noord-Zuidlijn. Verläuft von Rotterdam CS unter der Nieuwe Maas nach Spijkenisse“.
Jetzt konnte ich im Algemeen Dagblad lesen. Zu sehen gab es eh nichts. Ich war unter der Erde, unter der Maas. Ähnlich wie Jules Verne. Ein paar Meter unter dem Wasser. Blätterte die Tageszeitung flüchtig durch. Erfreute mich daran niederländische Worte zu lesen. Was genau war nebensächlich.
Sowieso kam in mir der Eindruck auf, dass ich in Norwegen, während der ganzen Bauernnhof-Phase so rein gar nichts vom Weltgeschenen mitbekommen hatte. Abgekapselt von allem. Ich mich in einer Blase befunden hatte. Einer Blase aus Arbeit, Problemlösungen und Familie. Die dafür umso strammer aufgeblasen war. Aber nicht platzte, sondern extrem dehnbar war.
Esel
Erst als wir hinter der Maasunterquerung wieder ans Tageslicht kamen faltete ich die Zeitung zusammen. Schaute aus dem Fenster. In Spijkenisse verliess ich die Metro. Endstation. Für meinen Geschmack war das jetzt auch eher eine Strassenbahn als Metro. Das letzte Stück der Strecke verlief oberirdisch. Egal. Hauptsache angekommen. In einer Gegend, die mir bekannt war – und mir deutlicher machte „Du bist bald zuhause“. Aber war das auch tatsächlich so? Kam ich Nachhause? War mein Zuhause nicht da wo Michelle und Torid waren? Auf mich warteten? Und hier wartete jetzt garantiert definitiv niemand auf mich.
Die Wartezeit auf den „Anschlussbus“ nutzte ich für einen Besuch einer Frituur. Mittlerweile machte sich mein Hunger bemerkbar. Das einzige Essbare seit meiner Abreise in Breiviken hatte ich verschenkt. An diese Maria Teresa. Mit Schwung öffnete ich die Türe des Eetcafé. Brauchte auch gar nicht lange überlegen. „Patat en Stoofvlees alstubelieft“ gab ich noch beim Betreten meine Bestellung auf. Aus einem Kühlschrank wollte ich mir gerade ein eiskaltes Bier herausnehmen. „Du hast jetzt, heute, schon mehr getrunken als die letzten Tage zusammen“ kam es mir in den Sinn. Hatte ich nicht versprochen eben genau nicht in meine alten Trinkgewohnheiten zu verfallen?
In Bergen hätten mich die paar Biere bestimmt schon mehr gekostet als meine bisherigen Reisekosten. Hier fiel das gar nicht so auf. Nicht so ins Gewicht. Bierchen – ein Gulden fuffzig. Also sechs Bier in Nederland etwa ein Bier in Norwegen. Stellte die Dose zurück, griff mir ein Seven-Up.
Meine Fresse, war das lecker. Die dick und sämig eingekochte Sosse. Bestellte direkt eine weitere Portion. Ohne Pommes. Nur Rindfleisch und Sosse. Aus dem Kühlschrank entnahm ich eine Dose Heineken. Auch hier ein ähnlicher Effekt. „Mein Gott, wie das zischt“. Quasi als Alibi sagte ich mir selber „Stoofvlees wird sowieso in Bier gegart“.
Die Fahrt mit dem Bus dauerte zwar, fast 45 Minuten, war dafür aber umso schöner. Liess mir Zeit und Raum mein Zuid-Holland noch einmal neu zu erleben. Von erhöhter Position drückte ich mir die Nase an der Seitenscheibe des Busses platt. Erst an Geervliet vorbei, dann Heenvliet, dann links ab, Richtung Hellevoetsluis. Am Voorne Canal entlang. Durch die Polderlandschaften, die für mich Zuid-Holland ausmachten. Felder und Landwirtschaft soweit das Auge reichte. Grasende Kühe, verschreckt auffliegende Vögel, kleine Wege die die Landschaft durchzogen. So viele Plätze, so viele Erinnerungen. Die Fahrt machte mich ein wenig sentimental. Liess mich an Vieles zurückdenken. Auch wenn der Sinn und Zweck meiner Reise ein anderer war – hier müssten wir wieder hin. Zumindest immer wieder mal. Als Urlauber. Als Touristen. Dieses Idyll bot so viel für die innere Ruhe. Für meine Glückseligkeit. Und war doch auch gleichzeitig der Grundstein für alles, was sich in meinem Leben ereignet hatte. Das dürfte ich nicht zulassen, dass dies aus meinem Herzen verschwindet.
Erst nach knapp zwanzig Minuten bog der Bus in einer Schleife in Heelvoetsluis ein. Erste Häuser wurden sichtbar. Auf der rechten Seite, in Sichtweite, lag Nieuwenhoorn. Wilmas Zuhause. Das ich in den nächsten Tagen räumen würde. Sollte. Müsste. „Nur knapp ein Jahr hat sie hier alleine gewohnt …“, ging es mir durch den Kopf, „… sonst war sie immer bei mir“.
Auch die Strecke durch Hellevoetsluis produzierte einen Flashback nach dem anderen in meinem Kopf. Aus meinem Rucksack zog ich einen Block samt Kugelschreiber. „Du musst einiges aufschreiben. Um es nicht zu vergessen“.
Das letzte Stück ging es parallel zum Haringvliet. Rüber nach Rockanje. Unser „Hausstrand“ kam in Sicht, meine Aufgeregtheit wurde grösser. Noch grösser. Der Bus fuhr in den Wendehammer am Alardusdreef ein. „Einde van de lijn. Allemaal uitstappen alstublieft“ forderte der Busfahrer durch das Mikrofon auf. Wen meinte er noch, ausser mir, mit „Allemaal“? War ich doch der letzte Passagier im Bus. Alle anderen Fahrgäste waren bereits am Marktplatz ausgestiegen.
Mein Herz pochte bis zum Hals. Jeder Schlag wanderte über meine Aorta noch weiter. Hörbar bis in meinem Kopf. Nur noch wenige Schritte. Erst die Hofeinfahrt, dann unser Haus. Dunkel und ruhig zwischen Polder und Dünenrand eingebettet. Aus dem Schuppen suchte ich aus dem alten Marmeladenglas den Hausschlüssel. Leer, menschenleer, ruhig, ohne Leben öffnete sich der Hausflur. Direkt führte mein Weg ins Wohnzimmer. Kalt, ausgekühlt. „Na super. Egal wo ich hinkomme. Ich muss Holz hacken. Den Kamin anfeuern“. Feuerte meinen Rucksack auf einen Stuhl am Esstisch. Drehte eine erste Runde durch alle Räume. So als müsste ich sicher gehen im richtigen Haus zu sein. Oder um zu sehen ob noch alles so war, wie wir es verlassen hatten. Das war es. Sauber und aufgeräumt. So wie wir es hinterlassen hatten. Wie Michelle es hinterlassen hatte. Das war ihre Arbeit. Sauberkeit und Ordnung.
Allzu viel Brennholz lag nicht mehr neben dem Schuppen. Klar, vor unserer Abreise hatten wir keines für den anstehenden Winter geordert. Warum auch? Woher sollten wir wissen, dass aus der geplanten 14-Tage-Therapie etwas ganz anderes entstehen würde? Mit einem Beil spaltete ich zwei kleinere Abschnitte eines Baumstumpfs, nahm noch ein paar Splinte aus Kiefer mit nach drinnen. Schnell entzündeten sich die dünnen Holzspalten, begannen knisternd den Raum aufzuwärmen. Erst jetzt zog ich meine Jacke aus, warf sie ebenfalls über eine Stuhllehne. Nahm aus einer Jackentasche noch schnell meinen Tabak, setzte mich an den Couchtisch. Wie es bislang, bis vor unserer Abreise war – zum Rauchen nach draussen zu gehen - entfiel komplett. Das war – zumindest für dieses Haus, für dieses Zuhause erledigt. Nicht mehr existent, nicht mehr relevant.
Mein Blick wanderte durch das Wohnzimmer. Langsam, fast so als müsste ich fotografisch festhalten was wo war. Auf der Uhr auf dem Kaminsims sah ich „Gleich Sechs Uhr“. Ich war jetzt also tatsächlich, seit ich Breiviken verlassen hatte, seit acht Stunden „unterwegs“. So schön die Fahrt mit dem Bus auch war, das stand jetzt bereits fest – „Keine Reise mehr mit öffentlichem Nahverkehr“.
Auf dem Couchtisch blieb mein Auge an der Mahagoni-Dopedose hängen. Automatisch griff ich danach, öffnete den Deckel, nahm eines der Dope-Stückchen heraus, drehte mir einen kleinen Joint. „Auch gerne ein Bier dazu“ hörte ich meinen Gedanken. Ging zum Kühlschrank. Das kleine Lämpchen erleuchtete den kühlen Innenraum. Leer, bis auf zwei Flaschen Grolsch. Das reichte mir. Vorerst.
Schon nach zwei Zügen an der Tüte war ich „breit wie ein Eimer“. Sackte in die Rückenlehne der Chesterfield-Couch. Schaute weiter im Zimmer umher. Nur brauchte ich jetzt meine Augen, meinen Kopf nicht bewegen. Es drehte sich von selber. Mein erster Joint nach Wochen. Entsprechend war meine Bekifftheit. Und als wäre das sich drehende Zimmer nicht genug, begannen meine Gedanken auch zu kreisen. „Was hast du getan? Was hast du entschieden? Du hast doch alles hier. War das wirklich nötig? Dein ganzes Leben auf den Kopf stellen? Und das von Michelle und Wilma auch noch?
„Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er auf‘s Eis.“ Dieser Spruch meiner Mutter fiel mir ein. Den sie gerne mal sagte, wenn wir Kinder wieder mal irgendeine Scheisse fabriziert hatten. Oder sowas wie „Übermut tut selten gut“. Überhaupt wusste sie mit Weisheiten dieser Art zu glänzen. Um uns, zwar nett formuliert - aber dennoch - eine moralisch reinzuwürgen. Sie hatte immer behauptet dieser Ausspruch, der mit dem Esel, käme aus einem Lied von Hildegard Knef. „Wenn's dem Esel zu gut geht, dann trabt er aufs Eis, um zu tanzen, wie jeder weiß, und er wiehert und trampelt, und dreht sich im Kreis, sucht Applaus um jeden Preis, und er dreht Pirouetten, weiß sich kaum zu retten, glaubt richtig wichtig zu sein: wenn's dem Esel zu gut geht, dann trabt er aufs Eis, ja und dann, dann bricht er ein“.
Später, irgendwann in den höheren Schulklassen, musste ich aber lernen, dass es nicht Hildegard Knef war, die auf diese Weisheit gekommen war, sondern Martin Luther. Der grosse Reformator Martin Luther. Der irgendwann um 1500 rum seine Weisheiten an eine Kirchentür getackert hatte. Und auch was mein Freund Rolf einmal gesagt hatte, kam mir in den Sinn. Der mich im Übrigen auch gerne – und des Öfteren mal als Egoisten bezeichnet hatte. Was bei der Entscheidungsfindung „Pro Norwegen“ vielleicht gar nicht mal so abwegig war. Ich hatte entschieden. Für andere mit.
Einen Moment musste ich grübeln. Dann fiel es mir wieder ein. Rolfs Worte. „Soweit ich mich erinnern kann, lebe ich zum ersten Mal und das ohne eine erkennbare Vorschrift. Da sind Fehler quasi vorprogrammiert. Ich bin kein Mathematiker aber die Wahrscheinlichkeit auch gröbere Fehler zu machen, liegt für mich auf der Hand. Sie sind vielleicht das Ergebnis einer gewissen "Abenteuerlust" und somit erwartbar und in gewisser Weise natürlich. Wer nur zu Hause im Sessel sitzt, kann am Schluß stolz sein auf wenige Fehler, hat sich dem Leben aber auch nicht gestellt“. Und da sass ich ja jetzt. Zuhause. Nicht in einem Sessel, dafür aber auf der Couch. Und wenn überhaupt Fehler, dann hatte ich sie ja schon gemacht. Vielleicht. Das würde sich herausstellen. Ein Zurück gab es jetzt sowieso nicht mehr. Nur nach Vorne. Und dieses „Vorne“ hiess in dem Fall Hylkje. Norwegen. Dort harrte meine Familie auf meine Rückkehr.
Über meine ganzen Überlegungen war ich scheinbar eingenickt. Das Klingeln des Telefons riss mich aus meinem Traum. Wenn ich denn geträumt hatte. Leicht verstört blickte ich durch das jetzt dunkle Zimmer. Musste mich orientieren. Realisieren wo ich mich befand.
Pferdchen
„Ja“ sprach ich kurzangebunden und mich in der Dunkelheit vortastend in den Hörer. „Hoi. Met Wilma“ klang es aus der Hörmuschel. Sie wolle eigentlich nur kurz hören ob ich gut angekommen sei. Und dass sie jetzt in der Telefonzelle in Breiviken sei. „Du weißt doch wie ich mich immer um dich gesorgt habe, wenn du unterwegs warst. Jetzt ist das wieder so. Alles okay bei dir?“ Sie habe keine Ruhe gehabt. Und sei eben deswegen nochmals raus gegangen. „Zu einem Spaziergang“ habe sie Michelle erklärt. Ihre Worte, ihre Stimme zu hören überwältigte mich ein wenig. Ein wenig mehr sogar. „Alles gut. Danke. Ich ruf‘ morgen Mittag bei euch an. Auf dem Bauernhof. Okay? Dann erzähle ich alles. Vor allem musst du jetzt nicht teuer Münzgeld in das Telefon stecken. Okay?“ Liess einen Moment Luft. Wortlosigkeit. „Wilma … das ist so lieb, dass du anrufst. Grüss alle. Bis morgen“.
Lange hielt ich den aufgelegten Hörer auf dem Telefonapparat fest. So war Wilma. Sie hatte sich immer um mich gesorgt, gekümmert. Insbesondere hier in der Wohnung. Hier im Haus. Hier hatte sie mich aufgepeppelt. Auf Vordermann gebracht. Als ich nach dem Unfalltod meiner Freundin Willeke am Boden zerstört war. Hier war unsere Liebe erwachsen. Hier hatte ich mich in meine Krankenpflegerin verliebt. Hier hatten wir zueinander gefunden. Erneut nahm ich den Telefonhörer auf. Sprach „Wilma, ich liebe dich. Du bedeutest mir so viel“ hinein. Als Antwort kam natürlich nur „Tuuut, Tuuut“. Drehte mich, stiess mir am Couchtisch das Schienbein an. „Verdammt, du kannst dich in deiner Wohnung nicht einmal mehr orientieren“. Tastete mich zur Zimmertür vor, den Lichtschalter suchend.
Ging dann nach oben. In unser Zimmer. In Michelles und mein Zimmer. Nur kurz. Suchte mir eine Kladde. Bei Xenos, einem Krims-Krams-Laden in Rotterdam, hatte ich irgendwann gleich einen ganzen Schwung davon gekauft. Schwarzer, stabiler Karton als Umschlag. DIN-A-4 Format. An den Ecken mit Rot abgesetzt. Karierte Blätter. Preiswerter China-Krempel.
Machte mir in der Küche Kaffee. Nescafé. Schaltete die komplette Festbeleuchtung im Haus ein. Alles an Lampen was verfügbar, schaltbar war. Setzte mich mit Kaffee und Kladde an den Esstisch. Begann meine Gedanke zu Papier zu bringen. Grob, unsortiert. Nur einfach nur Stichpunkte. Was zu tun sei. Was mir durch den Kopf ging. Friedhof, Spedition, Alle möglichen Verträge kündigen, Freunde besuchen, Tägliche Telefonate, Bankvollmachten, Einkauf, Hans, Ad, Koos, Boerderij, Wouter.
Sortieren konnte ich das immer noch. Und garantiert würde noch so einiges hinzukommen. Was aber der erste Punkt war – Friedhof – das wollte ich direkt morgen früh erledigen. Wie lange war ich jetzt nicht mehr an Willekes Grab? Im September waren wir nach Norwegen aufgebrochen – jetzt war November. Gedankenverloren drehte ich den Ring an meinem kleinen Finger. Den Ring, den Wilma mir angesteckt hatte. Schob ihn behutsam vom Finger, legte ihn auf dem Esstisch ab. In meinem Nacken öffnete ich die Halskette meiner Freundin Willeke. Legte sie neben den Ring. Betrachtete beide Schmuckstücke lange. Und traurig. So schön meine Erinnerungen an dieses Haus, an Rockanje auch waren. Die beiden funkelnden Diamanten waren das Einzige, was mir von diesen geliebten Menschen geblieben war. Das einzige Optische. Das einzige Greifbare. Stützte mein Gesicht in meine Hände. „Was für eine Scheisse. Was für eine unsagbare Scheisse“. Klappte die Kladde zu. „Morgen geht es los. Du musst das geregelt kriegen. Du hast es versprochen“.
Trank den letzten Schluck kalten Kaffee. Wollte mich ablegen. Mein Kopf rauchte. Mir war ein wenig schwindelig. Auch ohne Kiffen. So als würde jeder einzelne meiner Gedanken sich auf einem Karussel drehen. Auf einem, der sich auf und ab bewegenden hölzernen Pferdchen sitzen.
Wolfgang
Mein erster Gang führte mich zum Blumengeschäft in Rockanje. Frühstück fiel aus. Es gab ja nichts im Haus. Lediglich ein schneller Nescafé im Stehen war angesagt. Aber das kannte ich ja. So war es immer bevor ich zur Arbeit fuhr. Zur SHELL in Pernis. Jetzt war ich aber mit meinem Fahrrad unterwegs. Hatte mir auf dem Esstisch alle Papiere ausgebreitet. Platz dafür bot er ja reichlich. Locker acht Personen fanden an dem Tisch Platz, vielleicht sogar zehn. Wegräumen brauchte ich auch nichts. Ausser mir war keiner im Haus. Und Essen oder gar Kochen würde ich eh nicht. Nicht für mich alleine. Also konnte alles so liegen bleiben wie es jetzt war. Friedhof – das war der erste Punkt auf meiner Liste. Danach wollte ich nach Rotterdam rein. Zu Schenker. Zwischen diesen beiden Punkten hatte ich „Telefonanruf“ eingerückt. Mehr war für heute nicht vorgesehen. Würde aber unter Umständen auch vollkommen reichen.
„Guten Morgen“ begrüsste mich die Floristin sehr freundlich. Um aber direkt „Mann, du warst lange nicht hier“ nachzuschiessen. Sollte ich ihr jetzt meine Geschichte auf die Nase binden? Ging sie das etwas an? Musste ich mich ihr erklären? „Ja, ich war unterwegs. Beruflich. Im Ausland. Deshalb“. Und wolle jetzt natürlich einen schönen Strauss Margeriten. Für den Friedhof. Sie verwickelte mich in ein Gespräch während sie die Blumen steckte. Wie es Michelle gehe? Wie es Wilma gehe? Wo ich denn war? Und was weiss ich nicht noch alles. „Ja gut. Beiden“ versuchte ich das schnell abzuhandeln. Was ihr aber nicht genug war. Als Antwort. „Was heisst gut? Hat Michelle schon ihr Baby zur Welt gebracht? Was ist es denn? Ein Junge? Ein Mädchen?“
Je mehr sie mich mit Fragen löcherte desto mehr verzettelte ich mich in meinen Ausflüchten. Verfolgte jetzt eine andere Taktik. Nicht als Ausflucht, sondern weil sie mir spontan in den Sinn geschossen war. „Macht ihr eigentlich auch Grabpflege? Also, ich meine ab und an frische Blumen auf ein Grab bringen?“ Die junge Floristin schaute von ihrer Arbeit auf. Du weißt schon, dass wir keine Friedhofsgärtnerei sind? Wir haben ein Blumengeschäft. Du warst doch bei uns in der Gärtnerei. Wilma hat doch bei uns gearbeitet. Du kennst das doch“. Gab aber auch damit nicht Ruhe. „Was willst du denn genau fragen?“
„Yiihaaah“ warf ein kleiner Cowboy in meinem Kopf seinen Westernhut in die Luft. Konstruierte auf die Schnelle eine Geschichte für sie. Teilweise zumindest. Ich müsse in zwei Wochen wieder auf Montage. Und würde es toll finden, wenn jemand wie gewohnt zum Wochenende Blumen auf Willekes Grab auffrischen würde. War jetzt auch froh, dass sie nicht weiter nachbohrte. Zum Beispiel warum Michelle das nicht in dieser Zeit erledigen könne oder so. Sie hielt mir die gebundenen Margeriten entgegen. „Den Preis kennst du ja. Und wenn du mir etwas extra gibst mach‘ ich das gerne. Nach Feierabend. Wie lange denn? Wie oft?“
Ich nahm den Strauss entgegen. „Was verstehst du denn unter extra?“ Das Mädchen lächelte. „Sagen wir Zwanni. Insgesamt. Also mit Blumen“. Kurz blickte ich sie fest an. „Pro Woche dann? Oder wie?“ Sie lächelte. „Ja. Habe ich ein wenig extra Taschengeld. Aber bleibt unter uns, okay?“ Den Strauss liess ich mir noch in Papier einschlagen. „Ich sag‘ dir Bescheid. Ein paar Tage bevor ich los muss“.
Willekes Grabstelle sah nicht nur so aus – sie war verwahrlost. Ungepflegt. Hatte keine Aufmerksamkeit bekommen. Sofort machte ich mich daran kleine Triebe von Unkraut zu entfernen. Hier und da waren Flechten von Moos an der Oberfläche. Nur die Blumen, die Margeriten sahen nicht so aus als wären sie „Monatealt“. Zwar auch verwelkt – aber nicht so als stünden sie seit Wochen in der grünen Plastikvase. Zwischen den Stielen war eine Karte, ein Papier eingesteckt. „Meld‘ dich. Kuss, Amalia“ war zu lesen. Das konnte nur für mich bestimmt sein. Garantiert nicht für Willeke. Dass sie nicht lesen – und sich nicht melden konnte, war klar. Sicherlich auch