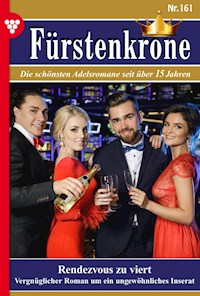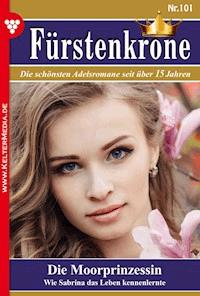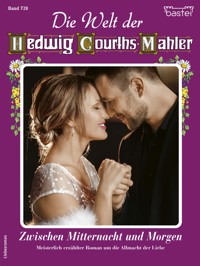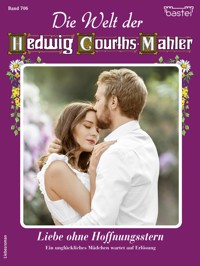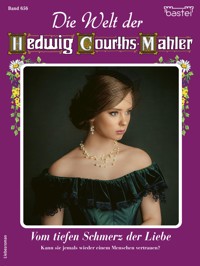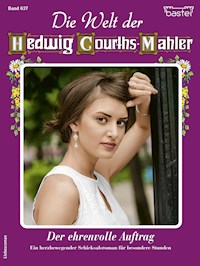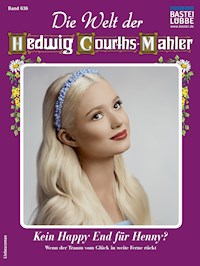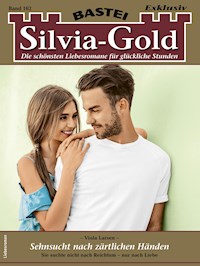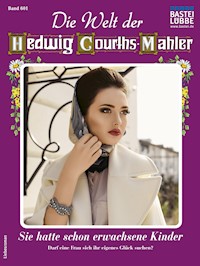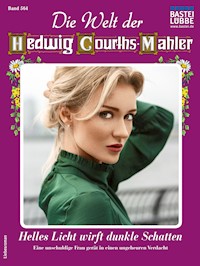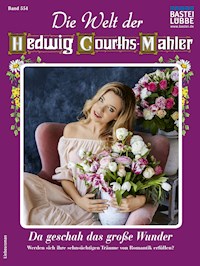Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gaslicht
- Sprache: Deutsch
In dieser neuartigen Romanausgabe beweisen die Autoren erfolgreicher Serien ihr großes Talent. Geschichten von wirklicher Buch-Romanlänge lassen die illustren Welten ihrer Serienhelden zum Leben erwachen. Es sind die Stories, die diese erfahrenen Schriftsteller schon immer erzählen wollten, denn in der längeren Form kommen noch mehr Gefühl und Leidenschaft zur Geltung. Spannung garantiert! Gezeichnet von den wüsten Spuren einer blutigen Meuterei ankerte Anno 1798 die Galeere »Gelatea« vor der Küste Louisianas. Käptn Francis, ein großer, schwerer Mann mit eisgrauem Haar und Bart, über dessen Stirn kreuzförmig eine kaum verheilte Narbe verlief, bot auf dem Sklavenmarkt seine Ware feil. Der Bursche, der ihn so übel zugerichtet hatte, war mit einer glimpflichen Strafe davon gekommen, weil er, jung und stark, teuer zu verkaufen war. Verzweifelt streckte seine schwangere Frau die Arme nach ihm aus, als er dem Käufer übergeben wurde. »Vergiß ihn«, herrschte Käptn Francis sie an. »Dich habe ich für mich gekauft. Du gehörst jetzt mir!« Just an der gleichen Stelle sollte über zweihundert Jahre später etwas Seltsames geschehen… Es geschah an einem schwülen Sommermorgen am Golf von Mexiko. Der durchdringende Duft der Hickoryblätter war wie eine Glocke über das kleine Fischerdorf gestülpt, das auf einer Landzunge lag, welche die Form eines Fisches hatte, weshalb das Dorf auch den Namen des Meeresfisches »Mojarra« trug. Auf dem etwas außerhalb des Ortes in einem Wald von Hickorybäumen gelegenen Seemannsfriedhof, der »Letzter Ankerplatz« genannt wurde, herrschte erhabene Stille, bis der kleine Noel Hannath mit seinem Schubkarren angetrabt kam. »Passe bitte auf, Noel!« mahnte seine Mutter Leslie, als der Karren über zwei Steine holperte und die Schaufel, die Gießkanne und der Eimer, mit denen der Karren beladen war, gegeneinander schepperten. »Du weißt doch, daß die Männer ihre Ruhe haben wollen!« Noel, ein Pfiffikus von sieben Jahren, schnitt eine Grimasse. »Wenn nie was los ist, das ist doch ätzend, Mummy?« »Nicht für die Männer!« ›Die
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaslicht – 1 –
Die Geistergaleere
Ruhelos unterwegs – denn die Schuld fand kein Vergessen
Viola Larsen
Gezeichnet von den wüsten Spuren einer blutigen Meuterei ankerte Anno 1798 die Galeere »Gelatea« vor der Küste Louisianas. Käptn Francis, ein großer, schwerer Mann mit eisgrauem Haar und Bart, über dessen Stirn kreuzförmig eine kaum verheilte Narbe verlief, bot auf dem Sklavenmarkt seine Ware feil. Der Bursche, der ihn so übel zugerichtet hatte, war mit einer glimpflichen Strafe davon gekommen, weil er, jung und stark, teuer zu verkaufen war. Verzweifelt streckte seine schwangere Frau die Arme nach ihm aus, als er dem Käufer übergeben wurde. »Vergiß ihn«, herrschte Käptn Francis sie an. »Dich habe ich für mich gekauft. Du gehörst jetzt mir!« Just an der gleichen Stelle sollte über zweihundert Jahre später etwas Seltsames geschehen…
Es geschah an einem schwülen Sommermorgen am Golf von Mexiko. Der durchdringende Duft der Hickoryblätter war wie eine Glocke über das kleine Fischerdorf gestülpt, das auf einer Landzunge lag, welche die Form eines Fisches hatte, weshalb das Dorf auch den Namen des Meeresfisches »Mojarra« trug.
Auf dem etwas außerhalb des Ortes in einem Wald von Hickorybäumen gelegenen Seemannsfriedhof, der »Letzter Ankerplatz« genannt wurde, herrschte erhabene Stille, bis der kleine Noel Hannath mit seinem Schubkarren angetrabt kam.
»Passe bitte auf, Noel!« mahnte seine Mutter Leslie, als der Karren über zwei Steine holperte und die Schaufel, die Gießkanne und der Eimer, mit denen der Karren beladen war, gegeneinander schepperten. »Du weißt doch, daß die Männer ihre Ruhe haben wollen!«
Noel, ein Pfiffikus von sieben Jahren, schnitt eine Grimasse. »Wenn nie was los ist, das ist doch ätzend, Mummy?«
»Nicht für die Männer!«
›Die Männer‹, das waren die Seeleute, die auf dem Kirchhof ihre letzte Ruhestätte gefunden hatten. Allzu viele der Gräber trugen namenlose Kreuze, andere waren mit prächtigen Monumenten geschmückt, auf denen ganze Familiengeschichten dargestellt waren, weshalb man sie im Volksmund auch ›Denkmäler‹ nannte. Die kleine, recht wohlhabende Gemeinde legte großen Wert darauf, daß alle Grabstätten gepflegt waren, denn der Seemannsfriedhof »Letzter Ankerplatz« war eine Touristenattraktion.
Mit der Gräberpflege verdiente Leslie Hannath sich ein bescheidenes Zubrot, denn es lebte sich nicht üppig von Robins Heuer. Er war Bootsmann auf einem Frachter, der unter panamesischer Flagge fuhr, und sein letzter Kartengruß war aus Schanghai gekommen.
Alle hatten Leslie davor gewarnt, Robin Hannath zu heiraten, weil er das unruhige Blut seiner frühen Vorfahren geerbt hatte und nicht seßhaft werden wollte, um sich sein Brot als Garnelenfischer oder Austernpflücker zu verdienen. Doch alle gut gemeinten Ratschläge hatten nichts gefruchtet.
Leslie und Robin waren als Nachbarskinder aufgewachsen. Robin stammte aus einer Fischerfamilie, Leslies Eltern waren Lehrer an der Dorfschule gewesen. Die Kinder waren zusammen groß geworden und ihre Liebe war mit ihnen gewachsen. Sie hatten beide ihre Eltern früh verloren und sehr jung geheiratet. Robin war von Anfang ihrer Ehe an zur See gefahren, Leslie war allein in dem alten Haus der Hannaths zurückgeblieben.
Sogar in ihrer schweren Stunde war Leslie allein gewesen. Der Junge war in einer Christnacht zur Welt gekommen, und deshalb hatte sie ihn ›Noel‹ genannt, das hieß ›der an Weihnachten Geborene‹ Seitdem wartete sie mit dem kleinen Noel zusammen, bis Robin wieder einmal heimkam, freilich nie, um lange zu bleiben.
Leslie hatte es sich bedeutend leichter vorgestellt, eine Seemannsfrau zu sein. Sie war jung und sehnte sich nach Robins Nähe, doch er war weit fort von ihr. Zuweilen ertrug sie den Trennungsschmerz, die ständige Angst um den Liebsten und das trostlose Warten auf ihn fast nicht mehr. In solchen dunklen Stunden rebellierte sie gegen ihr Schicksal, hätte am liebsten ihren Jungen genommen und wäre mit ihm auch weit fortgegangen. Nur – wohin?
»Wenn wir fertig sind, darf ich dann Pecans sammeln gehen, Mummy?« fragte Noel, während er den Schubkarren vorsichtig, um keinen Lärm zu machen, über die nächste Steinhürde balancierte. Obwohl, er wußte ja, daß die Männer schon froh darüber waren, wenn mal eine Nuß herunterfiel und ein bißchen Krach machte, hatten sie doch alle eine Menge Abenteuer erlebt und die Nasen voll von der Stille. »Also, darf ich?«
»Ja, aber nur Nüsse, die heruntergefallen sind!« erlaubte Leslie.
Das war nicht so gut. Herunter fielen natürlich die reifen Nüsse, aber die Unreifen brachten mehr Bares. Noel besserte sein mageres Taschengeld damit auf. Apako, der indianische Kneipier, zahlte einen guten Preis für die unreifen Pecans, aus denen er nach einem alten indianischen Rezept einen Likör braute, auf den die Leute ganz verrückt waren, was Noel absolut nicht verstehen konnte. Er hatte nämlich einmal heimlich von dem Likör probiert, und es war ihm speiübel geworden.
»Ich habe gesagt, nur die Pecans, die heruntergefallen sind!« wiederholte Leslie mahnend. Sie hielt die Zügel der Erziehung ziemlich straff, denn ein Junge, der vaterlos aufwuchs, brauchte wenigstens eine starke mütterliche Hand. »Ist das versprochen?«
»Ja, Mummy«, versicherte Noel treuherzig, doch insgeheim war er entschlossen, es mit diesem Versprechen nicht allzu genau zu nehmen.
Er war ein drahtiger blonder Bursche mit strahlend blauen Augen. Leslie war stolz auf ihn. Noel sah seinem Vater sehr ähnlich, auch besaß er Robins verwegenen Charme und dessen fröhliche Unbekümmertheit.
Noel hingegen bedauerte es insgeheim, daß er nicht seiner Mutter ähnlich sah, denn sie war, wie er fand, sehr schön, und das stimmte auch. Eine glatte, oberflächliche Schönheit war Leslie Hannath freilich nicht. Es war vor allem ihre Ausstrahlung, die sie so reizvoll und liebenswert machte. Sie hatte braunes Haar und hellbraune Augen. Ihre Stimme klang warm, und ihr freundliches Wesen gewann ihr die Sympathien der Menschen. Nur die wenigsten wußten, daß Leslie Hannath auch eine Rebellin sein konnte!
»Gehen wir erst zu uns, Mummy?« fragte Noel. Damit meinte er die Grabstätte der Hannaths.
»Heute, ja.«
Noel hatte es ja geahnt, weil die Schmierseife und die Bürste in dem Karren lagen, und das bedeutete, daß er Ur-Ur-Ur-Oma Talabi wieder mal die Zehen schrubben mußte, damit kein Moos darüber wucherte. Er fing fröhlich zu pfeifen an, und Leslie wehrte ihm nicht. Vielleicht hatte Noel ja recht, und die Männer langweilten sich wirklich in der eintönigen Stille zwischen den namenlosen Kreuzen und stolzen Monumenten des Kirchhofs?
Die Grabstätte der Hannaths war das prächtigste und wohl auch das ungewöhnlichste Denkmal. Es war das einzige Monument aus schwarzem Marmor und dies, so tuschelten die Leute, wohl aus gutem Grund. Die Namen der Hannaths, ihre Geburts- und Todesdaten standen in schlichter Reihenfolge nebeneinander, behütet von der Statue einer aus dem schwarzen Marmor gemeißelten, anmutigen Frauengestalt. Noel kam sie wie ein schwarzer Schmetterling vor, der davonfliegen wollte.
Eine unreife, spitze Pecannuß fiel von dem Hickorybaum herunter.
Bestürzt beobachtete Leslie, daß die Statue erschrocken zusammenzuckte, als die Nuß auf das Kindergrab zu ihren Füßen polterte. Natürlich war das eine Täuschung! Eine Marmorstatue bewegte sich nicht. Es mußte ein Schatten gewesen sein, der Leslie genarrt hatte.
Noel hob die Nuß auf und schob sie schnell in seine Tasche. »Sonst futtert Ajamun sie noch auf!« Er hatte es wichtig mit dem Kindergrab, schon weil der Name ihm riesig imponierte. Es war nur ein Vorname, der in die Grabplatte gemeißelt war: ›Ajamun‹, und das bedeutete ›der, der kämpft, um zu bekommen‹. Na ja, die grüne Nuß wäre Ajamun schlecht bekommen, dachte er, denn wer unreife Pecans futterte, bekam Bauchgrimmen, das wußte Noel aus schmerzlicher Erfahrung.
Leslie blickte wie gebannt auf die Statue, war es ihr doch, als habe sich diese verändert. Das beunruhigte sie. Ihr Herz klopfte schneller. Ein unheimliches Bangen beschlich sie.
Stimmte es, was die Leute sich über Talabi Hannath erzählten? Leslie war eher geneigt, die Geschichte für eine Legende zu halten.
Gewiß, Käptn Francis, dem Urahn der Hannaths, wurden sehr schlimme Dinge nachgesagt, und vielleicht war er ja wirklich ein böser Mensch gewesen. Allerdings hieß es auch, daß er ein starker und furchtloser Mann gewesen sei, doch das eine schloß das andere ja nicht aus.
Seiner bösen Taten wegen, flüsterte man sich zu, müsse er noch immer mit einer Geistergaleere über die sieben Meere kreuzen und gelegentlich sollte er sich eine junge, schöne Frau als Opfer seiner Lüste holen.
Leslies Blick suchte das Todesdatum von Käptn Francis erster Frau, die sehr jung gestorben war, nachdem sie dem Käptn drei Söhne geboren hatte. Krank sollte sie nicht gewesen sein, doch den Namen von Käptn Francis wagte in diesem Zusammenhang niemand auszusprechen. Man erzählte sich noch Schlimmeres, ohne den Namen des Käptn zu nennen. Leslie sah auf das Kindergrab und ein eisiger Hauch streifte sie, der sie erschauern ließ.
Erschrocken zuckte sie zusammen, als in diesem Augenblick deutlich ein leises Kichern zu vernehmen war.
»Hörst du es auch, Mummy?« fragte der emsig schrubbende Noel vergnügt. »Uroma Talabi kichert!«
»Rede keinen Unfug«, fuhr Leslie auf. »Eine Steinfigur kichert nicht!«
»Warum denn nicht? Es kitzelt, wenn ich Talabi die Zehen schrubbe. Dann muß sie kichern. Das hat sie schon öfter gemacht.«
»Was sagst du da?« Ein kalter Schauder überrann Leslie. »Sie hat schon öfter gekichert?«
»Ja, da bist du nur nicht dabei gewesen.«
»Warum hast du mir nichts davon gesagt?«
»Weiß nicht.« Ganz so war das eigentlich nicht. Noel hatte es seiner Mummy nicht gesagt, weil Talabi ihn darum gebeten hatte, es für sich zu behalten. Seine Mummy würde sich nur furchtbar aufregen und es doch nicht verstehen, hatte Talabi zu ihm gesagt. »War doch nicht wichtig, Mummy, oder?«
Leslie kannte ihren Sohn! Wenn er so treu blickte, war garantiert etwas im Busch. »Heraus damit, Noel!«
»Womit denn, Mummy?« Aber es half nichts, den Unschuldigen zu mimen, denn Leslie hatte so einen gewissen Blick, der bis in Noels Herz drang. »Na ja«, räumte er ein, »manchmal reden wir eben miteinander.«
Leslie stockte der Atem. »Mit wem redest du?«
»Mit Talabi«, antwortete Noel trotzig.
Da war der eisige Hauch wieder, der Leslie streifte. »Moment mal, mein Sohn!« Warum fror sie nur so entsetzlich? »Du behauptest allen Ernstes, daß du mit Talabi redest?«
»Nicht richtig«, beeilte Noel sich zu versichern.
»Was soll das nun wieder heißen?«
Wie sollte er ihr das erklären? Talabi hatte recht gehabt. Seine Mummy verstand es nicht. Noel versuchte, sich verständlich zu machen. »Also, das ist so, Mummy. Ich höre, was Talabi sagt, und sie hört, was ich sage. Aber wir bewegen die Lippen nicht. Ich meine, wir reden nicht laut miteinander.«
»Nicht so, wie wir zusammen reden, meinst du das?«
Genau das meinte Noel, und er war erleichtert darüber, daß seine Mummy ihn doch zu begreifen schien.
Aber sie fing nicht an, sich aufzuregen, sondern blieb ruhig. Nur sehr blaß wurde sie, richtig weiß im Gesicht.
Leslie nahm sich zusammen. Sollte sie dieses irrwitzige Gespräch vertiefen, oder war es nicht besser, wenn sie zur Tagesordnung überging? Kinder hatten manchmal merkwürdige Fantasien.
»Ich habe noch bei den Namenlosen zu tun«, sagte sie. »Wenn du hier fertig bist, Noel, kannst du mir dort helfen.«
»Mache ich, Mummy!«
Die Schwüle brach wieder über Leslie herein. Langsam ging sie davon. Nach ein paar Schritten blieb sie stehen. Mit beiden Händen fuhr sie sich zum Hals, weil sie keine Luft mehr bekam. Es mußten, sagte sie sich, die feuchte Schwüle und der durchdringende Duft der Hickoryblätter sein, die ihr den Atem raubten!
Was auch sonst hätte es sein sollen?
*
Der gleiche intensive Duft lastete auch über der Hickory-Plantage der Mannerings, drang durch Ritzen und Fugen in das herrschaftliche, alte Pflanzerhaus und verursachte Sheila Mannering quälende Kopfschmerzen.
An solchen Tagen fragte Sheila sich, warum ihre Vorfahren nicht etwas anderes angepflanzt hatten? Baumwolle, vielleicht, oder Mais oder Zuckerrohr oder was auch immer, jedenfalls irgend etwas, das nicht einen so durchdringenden Duft verströmte wie die Blätter der Hickorybäume.
Das war ungerecht, denn die Grundlage ihres Reichtums verdankten die Mannerings diesen Walnußbaumgewächsen, deren spitze Nüsse, die Pecans, vielfach verwendbar waren und deren Holz sich gut verkaufen ließ. Später waren noch andere Quellen des Reichtums wie das Erdöl und die Raffenerien dazu gekommen, und inzwischen war Mannering führend in der Petrochemie.
Darüber dachte Sheila freilich nicht nach. Sie war eine goldene Tochter, die es nie nötig gehabt hatte, über irgend etwas nachzudenken. Mit ihrer auffallend schmalen Figur, ihrem naturkrausen, rotblonden Lockenschopf und ihren grünen Augen war sie ein bezaubernder, jungenhafter Typ. Sie hatte Charme und Witz und eine erstaunlich tiefe, ein bißchen rauhe Stimme. Eine ›Schiffsjungenstimme‹, wie John Mannering, ihr Vater, gescherzt hatte.
Ihre Mutter hatte sie früh verloren und nach dem plötzlichen Herztod ihres Vaters war sie die Herrscherin über die Plantage, das Erdöl und die Petrochemie. Ein Erbe war in ihren Besitz übergegangen, dessen überwältigende Größe ihr gar nicht bewußt war. Die Geschäfte interessierten sie auch nicht, die Leitung des Mannering-Trusts überließ sie dem schon zu Lebzeiten ihres Vaters unentbehrlichen James Bennett.
Über ihn mußte Sheila an diesem Morgen allerdings nachdenken, denn in drei Tagen sollte sie ihn heiraten.
Hatte John Mannering seiner Tochter nicht hundertmal gesagt, sie müsse, wenn er einmal nicht mehr da sein würde, James Bennett unbedingt halten, weil sonst der gesamte Mannering-Trust verloren sei?
Genau damit hatte James Bennett sie unter Druck gesetzt! Oh, Sheila glaubte ihm ja, daß er sie liebte und es tat ihr leid, daß sie seine Gefühle nicht in dem gleichen Maße zu erwidern vermochte.
Aber was war überhaupt Liebe? Sheila wußte es nicht. Sie hatte auch hierüber nie nachgedacht, sondern ihren Spaß an amüsanten Flirts und flüchtigen Begegnungen gehabt. Eine ernsthafte Beziehung hatte sie nie gewollt und auf keinen Fall wollte sie sich mit dreiundzwanzig Jahren schon fest binden!
Dabei war James Bennett ihr absolut nicht zuwider. Sie fand ihn durchaus sympathisch und als Freund hätte sie ihn gerne ihr Leben lang behalten. Aber als Ehemann? Er war nun einmal nicht der Typ, der zärtliche Gefühle in ihr auslöste und ihr Herz schneller schlagen ließ.