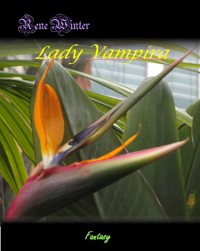2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Xenia Carver ist Autorin. Sie begeisterte ihre Leser mit den Abenteuern eines Privatdetektives. Bei ihrem letzten Buch ging es um einen Drogenhändler in Florida.
Rodrigo Meduci dagegen fand dieses Buch nicht gut, denn es war seine Schmuggelroute, die Xenia fast exakt beschrieb. Damit geriet sie in sein Visier und sie sollte beseitigt werden.
Den ersten Anschlag überlebte sie, wusste aber nicht, was wirklich passiert war. Sie zog sich auf eine Insel der Florida Keys zurück. Dort hat sie von ihrem Großvater ein Haus geerbt und ist gleichzeitig Miteigentümerin des ‚Dolphin and Shark Centers‘. Dieses DSC betreut ein privates Naturschutzgebiet mit einer Gruppe Männer und Frauen unter Führung von Dolph Corbin. Dolph, sein Bruder Benedict und die Schwester Joyce sind die anderen Eigentümer des DSC.
Xenia merkte schnell, dass sie nicht unbedingt willkommen war auf dieser Insel. Irgendetwas ging hier vor, über das niemand reden wollte. Sie erfuhr bei manchen Themen und Fragen nur eine Mauer des Schweigens.
Rodrigo findet ihren neuen Wohnort heraus und erneuert seinen Auftrag. Dass Xenia auch den überlebte, verdankte sie einem ungewöhnlichen Helfer. Allerdings veränderte sich dadurch auch ihre Beziehung zu Dolph und die neue Entwicklung gefällt ihr. Sogar das zufällige Entdecken des Geheimnisses der Inselbewohner schockierte und faszinierte sie.
Das unverhoffte Auftauchen ihrer Cousine Luana allerdings vereinfachte die Situation auf der Insel nicht. Damit bahnen sich Entwicklungen an, mit denen niemand gerechnet hat. Doch sind es die Veränderungen, die über die Zukunft entscheiden.
(für Erwachsene)
Leseprobe:
….
Plötzlich beruhigte sich das Wasser. Nun sah sie den Hai deutlicher knapp unter der Oberfläche. Fast bewegungslos trieb er in der festen Umschlingung durch das Netz. Starb er gerade?
Xenia betrachtete den riesigen Körper. Das war definitiv kein Delphin. Wenn sie jetzt die Schwanzflosse betrachtete, wunderte sie sich, wieso sie überhaupt falsch getippt hatte. Das sieht doch jeder, dass es unterschiedliche Flossen waren. Wieso habe ich übersehen, dass es keine waagerechte, sondern eine senkrechte Flosse war? War es nur die graue Farbe, die mich zu dem Fehlurteil verleitet hat?
Vor ihr lagen über vier Meter geballte Kraft im Wasser. Elegant und effektiv durch die Evolution. Ein als mörderisch verschrienes Tier, das auch vor Menschen nicht Halt machte. Ein Killer der Meere. Eine Fressmaschine.
Oder war es doch nur ein Lebewesen, dass allein seiner Natur folgte? Etwas, dass sich bewegte, sich ernährte, fortpflanzte, wie die Menschen, wie jedes andere Lebewesen auch? War es nur die Tatsache, dass nicht allein der Mensch anderes Leben für seinen Hunger auslöschen durfte, sondern hier ein Geschöpf war, das zurückschlagen konnte? Und weil sich der Mensch als Krone der Schöpfung ansah, durfte der Mensch nicht angegriffen werden? Wurde so das Töten wegen Nahrung beim Menschen als Notwendigkeit gesehen und das Gleiche beim Hai zum Mord?
Xenia wusste nicht sehr viel über Haie. Diesen hatte sie erkennen können durch Größe und Färbung. Sie hatte im Center etliche Bilder von verschiedenen Arten gesehen. Aber sie hatte gehört, dass Haie sterben konnten, wenn sie sich nicht bewegten. Bei Menschen ‚pumpte‘ die Lunge durch Muskelkontraktionen Sauerstoff hinein. Bei Haien mussten die Kiemen durchströmt werden.
Es brauchte etliche Sekunden für sie, um eine Entscheidung zu treffen. Wäre ich gekommen, wenn ich sofort gesehen hätte, dass es ein Hai ist? Wäre ich dann weggeblieben? stellte sie sich nun erneut die Frage nach der Verwechslung von Hai mit Delphin. Und die Antwort war schwer und doch auch leicht. Zusehen, wie dieses große und prächtige Tier elendig verreckte, konnte sie nicht. Wegfahren war jetzt auch keine Option mehr für sie, denn sie kannte nun das Schicksal dieses Lebewesens. Wegsehen blieb in ihrem Kopf ein Zusehen beim Krepieren.
„Wehe, du beißt nach mir“, flüsterte sie mit grimmigem Mut, während sie die Taucherbrille heraussuchte.
Gleich darauf war sie im Wasser. Sekundenlang starrten sich beide in die Augen. Allerdings konnte sie in dem schwarzen starren Auge nichts lesen. Nur die Bewegungslosigkeit des Fisches half ihr, die momentan fehlende Aggressivität zu erkennen. Aber wie konnte ein Hai verstehen, dass sie helfen wollte?
….
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Geliebter Hai
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Ich erzähle eine Geschichte, keinen Tatsachenbericht.
Wegen der expliziten Beschreibungen ist sie für Leser (m/w/d) ab 18 Jahren geeignet.
Alle hier vorkommenden Personen sind erwachsen und frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt.
Es werden auch Aktionen aus dem Bereich BDSM beschrieben.
Bitte denken Sie immer an die Grundsätze bei BDSM:
Gegenseitiges Einverständnis, bewusste Akzeptanz und vor allem Sicherheit.
Persönliche Ergänzung: wer einmal die Gelegenheit hat, mit Haien oder Delphinen zu schwimmen, sollte sie nutzen. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, diesen faszinierenden Tieren in der Natur zu begegnen und von ihnen akzeptiert oder toleriert zu werden. Man sollte ihnen mit dem Respekt begegnen, den sie verdienen. Sie sind weder Bestien noch Streicheltiere, sie sind neugierig oder ignorierend, sie haben einen eigenen Willen.
Es würde mich freuen, wenn diese Geschichte gefällt.
Turtle Island ist für diese Geschichte erschaffen worden, auch wenn es etliche schöne Inseln unter den Keys in Florida gibt.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Schatzjagd
Katastrophen
Inselleben
Fragen
Hai
Anfang
Erkennen
Luana
Session
Strafe
Lektionen
Wandel
Hochzeit
Suche
Showdown
Epilog
Schatzjagd
Don Leon de la Moreno sprang aus dem Beiboot. Die vier Ruderer hatten es mit Schwung so hoch auf den flachen Sandstrand getrieben, dass das Meerwasser ihm nicht mehr in die kniehohen Stiefel schwappen konnte.
Leon de la Moreno war ganz in schwarz gekleidet. Neben den schwarzen Stiefeln war es die schwarze Tuchhose und das schwarze Samtwams, dass den dunklen Eindruck hinterließ. Auf dem Kopf saß schräg ein Barrett, ebenso aus schwarzem Samt und mit einer langen Feder geschmückt. Der Mann war 47 Jahre alt und nur seine braunen, an den Schläfen angegrauten, schulterlangen Haare passten nicht ganz zu dem Schwarz. Auch die weiße, vielfach gefältelte Halskrause fiel auf.
Ebenso stach auch das goldene Kruzifix, dass über dem Herzen auf das Wams genäht war und die silberne Gürtelschnalle aus dem Schwarz seiner Gestalt hervor.
Kurz tastete sein Blick den breiten Sandstand ab. Bewegungen sah er keine. Feinde würde er früh genug sehen. Langsam drehte er sich um. Etwa 400 Meter weit draußen auf dem Meer ankerte die 35 Meter lange Karavelle ISABELLA, mit der er gekommen war. Zwei weitere Boote trieben kurz vor dem Strand und warteten auf seinen Befehl.
Mit einer ausholenden Handbewegung forderte er die Boote zur Weiterfahrt auf.
„Adelante, companeros!“ rief er laut und stapfte aus dem Flachwasser auf den trockenen Strand hinauf.
Wieder beobachtete er die Büsche. Obwohl er sich lässig und souverän gab, umschloss sein Linke fest den oberen Teil seiner schmalen Schwertscheide. Seine Rechte hatte den Daumen hinter den Gürtel nahe der Schließe geschoben. So war er schnell in der Lage, die Hand in den breiten, kunstvoll ziselierten Korb seines Schwertes zu schieben und es zu ziehen.
Hinter ihm sprangen nun vier bewaffnete Männer aus seinem Boot. Als die anderen Boote landeten, sprangen weitere Bewaffnete heraus und eilten zum Don. Auch die Ruderer stiegen aus und schoben das Beiboot wieder ins tiefere Wasser. Noch zweimal mussten alle drei Beiboote zwischen der ISABELLA und dem Strand pendeln, dann waren alle angeforderten Männer und die Ausrüstung angelandet. Erst jetzt zogen sie die Beiboote weiter den Strand hinauf und legten die Ankersteine aus. Weit oberhalb der Wasserlinie stapelten sie etliche Kisten, kleine Fässer und Tuchbündel auf.
Die Bewaffneten versammelten sich hinter Don Leon in einer lockeren, breiten Formation. Sie trugen einheitlich lederne Stiefel und braune Hosen. Das rote Leinenhemd war mit einem Kürass, einem Panzer für Brust und Rücken, bedeckt und den Kopf schmückte ein spanischer Helm in der typisch geschwungenen Form. Jeder trug eine Arkebuse auf der Schulter und war zusätzlich mit einem kürzeren Schwert ausgestattet. An den breiten Gürteln hingen Pulverflasche und kleine Beutel mit gegossenen Bleikugeln, in Wachspapier aufbewahrten Lunten für die Luntenschlösser der Waffen und auch Feuerstein und Zunder.
Das Schiff gehörte de la Morena. Er hatte es speziell für diese Reise ausgerüstet und die Männer waren während der verhältnismäßig kurzen Reise von Santiago auf Kuba eng zusammengepfercht gewesen. Jetzt waren alle froh, wieder Land unter den Füßen zu spüren und vor allem wieder Platz zu haben.
Leon de la Moreno war auf der Suche. Noch immer kreisten die Berichte über den Konquistador Juan Ponce de León in den Hafentavernen. Anno Domini 1513 war er in Florida an Land gegangen und dem Gerücht des Jungbrunnens nachgejagt. Gefunden hatte er nichts außer Indios, Moskitos, Alligatoren und Krokodilen, die seine Männer dezimiert hatten. Der große Süßwasserbereich, den man heute Everglades nannte, interessierte ihn weniger. Auch Gold und Edelsteine gehörten nicht zu seinen Erfolgen.
Aber die Gerüchte über den Jungbrunnen hielten sich. 67 Jahre waren seit Juan Ponce de Leons Besuch in Florida vergangen. Heute schrieb man den August 1580. Leon hatte den Geschichten seines Namensverwandten immer gebannt gelauscht. Derjenige zu sein, der seinem Souverän den lebensspendenden Trank bieten konnte, würde zu höchsten Ehren aufsteigen können. Jedes Gerücht hatte ein Körnchen Wahrheit, war sein Glauben.
Er hatte deswegen etliche in Florida gefangene Indios grausam gefoltert. Natürlich kannten sie den Jungbrunnen nicht, aber sie hatten von etwas berichtet, dass im Landesinneren von einem Indiostamm, den sie die Wächter nannten, vor allen versteckt und bewahrt wurde. Keiner wusste, was es war. Aber was sollte es anderes sein als der gesuchte Jungbrunnen? Und sie hatten ihm Hinweise auf den Weg gegeben, bevor sie sterben durften.
Nun stand er hier an der Küste Floridas. Mit ihm kamen 50 Söldner, angeworben durch Versprechungen und goldene Dublonen, die diesen Schatz für ihn finden und heimbringen sollten. Außerdem würden ihm 40 der insgesamt 60 Matrosen der ISABELLA folgen, die alle notwendigen Dinge zum Leben trugen. Dazu gehörten auch einige Tauschwaren, um einheimische Indios als Fährtensucher anzuwerben. Die Karavelle selber würde hier ankern bis zu seiner Rückkehr.
Diesen Abend verbrachten sie noch an der Küste. Während Wachposten für die Sicherheit sorgten, plante er seine weiteren Schritte anhand der Karte, die er nach den Angaben der Gefolterten erstellt hatte. Die Karte musste stimmen, denn er hatte jeden Gefangenen einzeln gefoltert und allen die gleichen Fragen gestellt. Eine gleiche Antwort war für ihn die Bestätigung der Richtigkeit gewesen.
Am nächsten Morgen brachen sie auf. Vorneweg marschierte eine kleine Gruppe zum Wegfinden, dann die Hälfte seiner Söldner mit ihm an der Spitze, gefolgt von den Matrosen mit dem Gepäck und die restlichen Söldner bildeten den Abschluss.
Leon de la Morena hatte die frühere Fahrt des Juan Ponce de Leon gut studiert und die Probleme besonders beachtet. Jede Gruppe der Söldner führte Sturmlaternen mit sich. Das diente nicht der Beleuchtung, aber es war permanentes Feuer, an dem die Söldner schnell die Lunten ihrer Arkebusen entzünden konnten. Erst mit Feuerstein und Zunder ein Feuer zu machen, dauerte zu lange. Geschwindigkeit war bei Angriffen oder in der Verteidigung sehr wesentlich.
Vier Tage kämpften sie sich durch Dickicht, Schilf, sumpfige Wasser und schmale Pfade. Die Moskitos waren für alle eine Qual. Nur abends an den rauchenden Lagerfeuern hatte man Ruhe vor diesen Blutsaugern.
Indios sahen sie dagegen keine, aber sie vermuteten, dass sie in der Nähe waren. Jeden Tag kreisten Seeadler über ihnen und Alligatoren und Krokodile tauchten aus Tümpel und dem Schilf auf. Sie bissen und verschleppten einige seiner Männer. Das Schreien hörten die anderen, bis es abrupt abbrach.
Nach vier Tagen hatte Leon ein Dutzend Männer verloren, sieben Söldner und fünf Matrosen. Dass sie dabei nur wenige Tiere töten konnten, zählte für ihn nicht. Meist waren die mit ihrer Beute bereits wieder im Dickicht oder Schilf verschwunden, bis die Arkebusen schussbereit waren. Nur der Einsatz von Schwertern versprach Hilfe bei diesen schnellen Angriffen. Die Natur hatte sich gegen ihn verschworen. Für ihn als spanischen Don war das inakzeptabel. Auch, wenn er nach außen kalt wirkte, kochte die Wut heiß in ihm. Diese Verluste waren nicht eingeplant. Doch er war sich sicher, dass er bald auf diese ominösen Wächter stoßen würde.
Zwei Tage später und nach fünf weiteren von Tieren getöteten Männern war es soweit. Gegen Mittag traf man eine Lichtung. Ein größeres Dorf mit sechs oder sieben Dutzend einfacher Hütten lag vor ihnen.
Um seine Wut loszuwerden, befahl Don Leon den sofortigen Angriff. Seine Männer schossen ihre Arkebusen auf die zwischen den Hütten auftauchenden Eingeborenen leer. Sie wollten die Verteidiger schwächen und demoralisieren. Da das Nachladen der Arkebusen zu lange dauerte, griffen die Spanier mit wildem Geschrei und gezogenen Schwertern an. Was dann allerdings geschah, überraschte alle. Nicht Krieger erschienen und verteidigten das Dorf, sondern von überall griffen Krokodile und Alligatoren an. Die Spanier lernten, wie schnell ein angreifendes Krokodil sein konnte. Aus dem Himmel fielen gleichzeitig dutzendweise Seeadler und versuchten die Männer mit Krallen und Schnäbeln zu blenden.
Wenn den Reptilien oder Vögeln der Angriff gelang, lag meist ein Spanier mit zermalmtem Bein oder blutigem Gesicht am Boden und wurde schnell das Opfer von anderen Tieren. Die Spanier lernten auch, dass die gepanzerten Echsen sehr hartnäckig an ihrem Leben hingen und nicht so einfach zu töten waren. Dafür mussten die Reptilien bitteres Lehrgeld hinsichtlich der scharfen Waffen zahlen.
Nur Halbwüchsige tauchten zwischen den Hütten auf und verschossen Pfeile mit Steinspitzen oder schleuderten Steine. Diese Waffen konnten den besser gepanzerten Söldnern kaum etwas anhaben. Zwar gab es verletzte Arme und Beine, aber die Männer kämpften weiter.
Schnell brannten auch schon die ersten Hütten. Damit wollte man weitere Hinterhalte verhindern und die Indios aus den Verstecken treiben.
Reihenweise fielen Menschen und Tiere den wütenden Angriffen beider Seiten zum Opfer. Für die Spanier zeichnete sich plötzlich ab, dass die Verteidiger eine Hütte besonders beschützten. Sofort stand für die Angreifer fest, dass dort ein kostbarer Schatz war. Noch wilder stießen sie vor, bis sie mit gierigen Blicken in die Hütte traten.
Sie brüllten vor Wut, als sie nur einen hölzernen Sockel mit einem kopfgroßen Stein darauf fanden. Nur ein schmutziggrauer Stein? Dafür hatten sie die vielen Freunde verloren? Gab es etwa keinen Schatz? Gab es keine eingefasste Quelle?
Ab jetzt war es ein Gemetzel, mit dem die Spanier ihre rasende Wut und Enttäuschung über die fehlende Beute an Tieren und Indianern ausließen. Sie nahmen keine Rücksicht auf Alte, Frauen, Kinder oder Säuglinge. Und Tiere und Indianer kämpften mit verzweifeltem Mut.
Nur weil Leon de le Moreno am Ende einschritt, gab es noch zwei junge Mädchen, die von den Dorfbewohnern am Leben blieben. Die etwa 16jährigen Mädchen waren bei Angriffen nur niedergeschlagen worden und wurden jetzt streng gefesselt und bewacht.
Allerdings waren von den Spaniern neben Don Leon auch nur noch neun Söldner und sieben Matrosen mit leichteren Wunden auf den Beinen. Ein halbes Dutzend anderer war schwer verletzt mit zerbissenen Beinen oder geblendet. Die meisten Angreifer aber waren tot.
Mit 90 Mann war er aufgebrochen und nun standen ihm nur noch 16 einsatzfähige Männer zur Verfügung. Für Don Leon war es ein furchtbarer Blutzoll, den er für die Einnahme des Dorfes hatte entrichten müssen. Seine schlagkräftige Truppe mit Feuerwaffen, Stahl und Rüstungen war beinahe von Tieren und primitiven Wilden mit Steinwaffen komplett vernichtet worden. Das Dorf selber war fast vollkommen niedergebrannt.
Don Leon ließ den Stein, den die Indios so verteidigt hatten, ins Sonnenlicht bringen. Ein Raunen ging durch die Überlebenden. In der Hütte hatte der Stein nur grau gewirkt. Jetzt im Sonnenlicht schillerte er in allen Regenbogenfarben. Vielleicht war er doch etwas wert? Vielleicht war es ein neuer Edelstein?
Er wurde in einen Sack gepackt und nach einer unruhigen Nacht, in der man wegen der Angst vor Indianerangriffen kaum geschlafen hatte, brach man am nächsten Morgen zum eiligen Rückmarsch auf. Die Beute und die beiden Gefangenen wurden mitgenommen. Die Gefangenen wollte Leon zu Hause genauer befragen, was es mit dem Stein auf sich hatte. Hier fehlte ihm die Zeit.
Deswegen ließ er die schwerer Verletzten auch einfach zurück. Wer nicht einigermaßen gehen und mithalten konnte, blieb zurück. Wegen wenigen wollte der Don nicht den mehr als mageren Erfolg riskieren. Zum zusätzlichen Tragen aller Verwundeten fehlten ihm Männer.
In gewisser Weise waren auch die Indianer hochmütig gewesen. Sie pflegten ihre Abgeschiedenheit. Viele Jahre und Kämpfe hatten ihnen nie einen wirklichen Gegner gezeigt. So hatten sie erst nach den ersten Minuten des Angriffs durch die Spanier einen jungen Burschen als Läufer zum nächsten Dorf um Unterstützung geschickt.
Als die Indios dann Stunden nach dem Abmarsch der Spanier in dem zerstörten Dorf auftauchten, töteten sie zuerst in rasender Wut angesichts der völligen Vernichtung des Dorfes und dessen Bewohner die verwundet zurückgebliebenen Invasoren. Doch die einbrechende Nacht zwang sie, die Verfolgung erst am nächsten Tag aufzunehmen. So bekamen die Spanier einen Tag Vorsprung.
Überraschenderweise gab es für die Spanier auf dem Rückweg kaum noch Angriffe durch Tiere. Doch es war eine Flucht, auch wenn Don Leon es als notwendigen zügigen Rückzug bezeichnete. Es schien, als ob die Natur den schnellen Rückzug der Spanier unterstützte. Für die beiden jungen indianischen Frauen allerdings war es ein Vorteil, denn niemand hatte seit ihrer Gefangennahme Zeit, sich an ihnen zu vergehen, wie es sonst meist mit gefangenen Frauen passierte.
Am Strand schifften sich alle sofort in die Boote ein und fuhren zur wartenden Karavelle. Nicht notwendige Dinge blieben einfach am Strand liegen. Die Beiboote kamen wieder an Deck und wurden dort vertäut. Der Stein wurde in Don Leons Kabine verschlossen. Die beiden Indianermädchen sperrte man in dem Käfig im Laderaum ein, der eigentlich für die Sicherung des erwarteten Schatzes an Bord war. Dann zogen die Spanier die Segel auf und Kurs nach Kuba wurde gesetzt.
Der junge Matrose, der die jungen Indianerinnen auf dem Marsch bewacht hatte, sah auch hier nach ihnen. Heimlich brachte er ihnen Wasser und Brot, obwohl Don Leon die Versorgung untersagt hatte. Der Matrose half ihnen, sich die kleineren Verletzungen zu versorgen. Die Indios waren einerseits dankbar, aber auch misstrauisch. Doch der Matrose machte ruhig weiter und schenkte ihnen ein aufmunterndes Lächeln. Er ahnte zwar, was die beiden am Ziel erwarten würde, aber die Reise dahin sollte nicht schon mit Torturen beginnen. Er selber hasste die Folter, weil sein Vater als verurteilter Dieb auf dem Rad gestorben war.
In der Nacht änderte sich alles. Die ISABELLA geriet in die Ausläufer eines Hurrikans. Zu spät erkannte man den wachsenden Wind als Sturm. Zu spät reffte man die Segel. Zu schnell steigerte sich der Wind zu Orkanböen, zu schnell wurden normale Wellen zu haushohen Brechern. Zu spät verschalkte man alle Luken und die Grätings. Zu viele Matrosen waren bei dem Vorstoß in das unbekannte Land gefallen und sie fehlten nun bei der Bedienung des Schiffes.
Als die ersten wilden Sturmböen die Männer beim Segelreffen erwischten, verschwanden gleich drei Matrosen in der nun tosenden See, vom Sturmwind einfach aus den Rahen gepflückt oder von den Brechern ins Meer gespült. Keine zwanzig Minuten später brach der Hauptmast unter dem Winddruck der nicht gerefften Segel. An den anderen Rahen hingen die Segel nun in Fetzen. Behindert durch den halb im Wasser liegenden Mast drehte die Karavelle quer zum Wind und nahm die Wellen von der Seite.
Immer schwerer neigte sich der Rumpf im Wind. Welle auf Welle brachen seitlich über das Schiff herein. Wasser drang durch die Stückpforten und sammelte sich im Rumpf. Die Beiboote wurden durch die Brecher aus den Verzurrungen gerissen und verschwanden über Bord. Immer schwerfälliger reagierte das Schiff auf das Ruder.
Verzweifelt versuchten die Männer, das Schiff zu retten. Die meisten ahnten das kommende Verderben und kämpften um das nackte Überleben. Wenn sie den gebrochenen Mast loswurden und wenn die Pumpen es schafften und wenn ….
Nur ein junger Matrose schlich hinunter in den Rumpf. Schnell hatte er dort eine Eisenstange gefunden, mit der er das Schloss am Käfig aufhebelte. Er wollte nicht, dass die jungen Frauen gar keine Chance hatten und beim Untergang im Käfig gefangen ertrinken mussten. Sie sollten die gleiche Chance haben, wie jeder Mann an Bord. Fast freudig und unbemerkt kletterten die beiden Mädchen mit dem jungen Matrosen durch eine Stückpforte ins Meer.
Als der Morgen trübe dämmerte, war der Sturm weitergezogen. Nur einige Holztrümmer schwammen noch im Wasser. Die ISABELLA zählte aber jetzt zu den vermissten Schiffen der spanischen Flotte. Man nahm an, dass sie auf ihrer Reise gesunken war. Es blieb eines der damals typischen Schicksale.
Katastrophen
Eine Villa in Miami Beach:
„Boss, es gibt möglicherweise ein Problem.“
„Und welches?“
Rodrigo Meduci wandte seinen Blick nicht von der Schönheit mit dem Teint von heller Milchschokolade, die sich vor ihm auf der Liege räkelte. Die Frau kam aus New Orleans und war eine Kreolin. Irgendwo in ihrem Stammbaum tauchte eine afrikanische Herkunft auf, wahrscheinlich durch die Sklaverei in den damaligen Südstaaten importiert. Sie war sehr jung, gerade Anfang 20, gertenschlank, hatte hüftlange wellige schwarze Haare und endlos lange Beine. Unterstrichen wurde deren Länge noch von den hochhackigen Sandaletten, von denen sie sich selbst auf der Liege nicht trennte. Die schmalen goldfarbenen Schnüre der Schuhe betonten noch die in leuchtendem Rot lackierten Zehennägel. Auch das Bikinihöschen war aus goldfarbenem Stoff und so winzig, dass fast nichts verdeckt wurde. Ebenso bedeckte auch das Oberteil gerade die Brustwarzenhöfe. Der Rest war dünne Schnur. Obwohl die Frau schon große Brüste gehabt hatte, waren diese nochmals durch Implantate bis an die Grenzen gedehnt. Auch jetzt im Liegen wölbten sich die prallen Halbkugeln entgegen der Schwerkraft. Wenn sie den Weg entlangstöckelte, schwangen nur anmutig die Hüften, aber oben herum dagegen wippte kaum etwas.
Ihr Vorname, Pearl, passte zu ihr. Auch Rodrigo sah sie als eine wertvolle Perle in seiner Sammlung.
Sie war jung und hoffte darauf, dass Rodrigo ihr zu einer Karriere verhalf. Vielleicht als Model, denn sie war ausnehmend schön anzusehen. Dafür jedenfalls tat sie alles. Auch, wenn sie dafür das Betthäschen eines übergewichtigen älteren Mannes war. Er war ihr Sugar Daddy. Und er war großzügig, wie sie schon gelernt hatte. Der Goldschmuck an ihren Handgelenken und dem Hals bezeugte das. Dafür nahm sie den 54jährigen mit seinen 40 Kilo Übergewicht in Kauf. Immerhin hatte er ein scharf gezeichnetes Gesicht mit südamerikanischen Wurzeln und immer noch schwarzen kurzen Haaren. Und er stand seinen Mann, wie sie täglich erleben durfte.
„Äh, Boss, ich würde es gern unter vier Augen besprechen.“
Jetzt hatte Manolo die Aufmerksamkeit seines Bosses. Der hatte verstanden, dass es um Geschäft ging, um Geschäfte, die nicht für die Ohren der Frau bestimmt waren. Er wusste auch, dass Manolo ihn nicht wegen Nichts stören würde.
„Pearl, ab ins Schlafzimmer“, befahl er der Frau barsch.
Die Frau räkelte sich weiter und reagierte kaum.
Dafür reagierte Rodrigo. Mit einer Handbewegung drehte er das halbvolle Glas in seiner linken Hand. Der kalte Drink ergoss sich mit den Eiswürfeln über die Frau. Mit einem spitzen Schrei richtete sie sich auf.
„Spinnst du …?“
Weiter kam sie mit dem Schrei nicht, denn er schlug mit dem Handrücken der Rechten zu. Seine ansatzlose Rückhand riss ihren Kopf herum und ließ sie verstummen. Entsetzt sah sie ihn an.
„Wenn ich dir sage, du gehst, dann gehst du. Sofort und ohne Widerworte. Entweder gehst du jetzt sofort in das Schlafzimmer und wartest dort, oder du verlässt das Haus für immer. Wenn ich dich im Schlafzimmer finde, dann strengst du dich besser an, um mich zu besänftigen. Comprende?“
Mit den scharfen Worten deutete er mit dem Daumen hinter sich auf das Haus. Ohne ein weiteres Wort huschte die junge Frau mit feuchten Augen an ihm vorbei. Sie hatte gerade auf die schmerzhafte Weise angefangen zu lernen, dass ihr Sugar Daddy auch andere Seiten hatte.
Als sie im Haus verschwunden war, nickte Rodrigo noch einem breitschultrigen Mann mit schwarzen Stoppelhaaren zu, dem im Schatten eines Baumes stand und alles beobachtet hatte. Hank war Anführer seiner Leibwächter und er hatte gerade den Auftrag bekommen, Pearl zu überwachen. Zumindest ging das Schlafzimmer zur anderen Seite. Wehe, wenn sie das Gespräch mitbekam. Immerhin war Manolo sein oberster Buchhalter und in mancher Hinsicht sein Stellvertreter. Er wachte über alle Geschäfte. Besonders über die, die der Staat nicht mitbekommen durfte.
„Also, Manolo?“
„Ich habe gerade einen Roman gelesen …“
„Einen Roman? Deswegen störst du?“ unterbrach Rodrigo unwirsch.
„Sorry, Boss, aber die Autorin Nia Raver beschreibt unseren Zulieferungsweg hier in Florida und die Beschreibungen sind derart exakt, die muss Informationen haben.“
„Erkläre“, zog Rodrigo die Brauen zusammen.
„Sie beschreibt den Transportweg mit der Cessna und dass das Flugzeug über Kuba in den Tiefflug geht und so in Richtung Keys unterwegs ist. Sie sagt, dass jemand in der Luftüberwachung geschmiert ist, um das Tiefergehen nicht zu melden. Sie schreibt, dass die Ladung über dem Meer abgeworfen wird und Fischer die Lieferung an Land bringen. Da steht, wie die Ware in der Fischfabrik weiterverarbeitet und anschließend im Bauch von tiefgekühlten Fischen verschickt wird. Sie beschreibt, dass der Drogenboss im Roman das Geld von den Kaimaninseln aus transferiert und in Miami Beach wohnt. Die Namen stimmen natürlich nicht, aber wenn ich allein die verwendeten Orte nehme, dann sind nur wenige Kilometer Unterschied.
In Summe weiß sie sehr viel und beschreib fast exakt unsere Abläufe. Wenn das ein Bulle liest und auf dumme Ideen kommt, dann ….“
Manolo ließ den Rest offen, aber Rodrigo hatte ihn schon verstanden. Tatsächlich stimmte alles fast exakt überein. Das kleine Flugzeug, der Mann in Luftüberwachung in Key West, die Fischverarbeitung, die LKWs, sogar dass er in Miami Beach lebte. Er dachte nach. Das Buch war im Handel. Das konnte er so nicht mehr bremsen. Also musste er seine Route ändern. Doch woher hatte die Frau diese Informationen?
„Du hast Recht. Wenn es wirklich so nahe an der Realität ist, ist es gefährlich. Finde heraus, wer hinter der Autorin steckt, Manolo. Dann überprüfe ihre Verbindungen und Kontakte. Wenn einer davon aus unserer Organisation stammt, mach ihn kalt. Wenn du nichts herausfindest, dann stopf das Leck auf der anderen Seite.“
„Ja, Boss.“
Mit einem Kopfnicken bestätigte Manolo und eilte fort. Er würde sich um alles kümmern.
Für einige Minuten blickte Rodrigo noch vor sich auf den Boden. Es war nicht gut, wenn er laufend seine Routen ändern musste. Das verschreckte Kunden und Lieferanten. Für sein Geschäft brauchte es Stabilität. Nur dann würde er sein Geschäft ausweiten können.
Mit einem leisen Fluch wandte er sich ab und ging auch ins Haus. Er war wütend. Aber er wusste, wie er seine Wut loswerden konnte. Vor allem, weil dabei noch jemand lernen würde. Oh ja, Pearl würde lernen. Besonders Gehorsam. Sie hatte einen herrlichen Körper. Mehr brauchte sie nicht in der Zukunft, die er für sie sah. Auch dafür musste sie lernen, sofort und ohne Zögern alle, wirklich alle Wünsche zu erfüllen, die jemand an ein willenloses Spielzeug richtete. Rodrigo entschied, dass die Abrichtung heute beginnen würde, egal, ob sie gehen wollte oder im Schlafzimmer wartete. Sie wusste sowieso schon zu viel. Schon das Wissen um seine Mitarbeiter war zu viel Wissen. Die Entscheidung trieb ein böses Lächeln in sein Gesicht. Auch das Abrichten macht Spaß. Der Verkauf der trainierten Stute bringt Geld. Den geschenkten Schmuck bekam einfach die Nächste. Und willige Weiber gab es genug. Eigentlich machte er mit null Investition viel Gewinn und dass mit viel Freude.
--- xxx ---
Eine Buchmesse in Philadelphia:
Xenia Carver war auf Wunsch ihres Verlages hier. Autogrammstunden, kleine Lesungen, Gesicht zeigen, mit Leserinnen reden. Einfach Public Relation betreiben. Werbung für das neue Buch. Die Buchmesse, die das ganze Wochenende für das Publikum geöffnet war, war voll mit Besuchern. Das Interesse am Lesen war ungebrochen.
Am Rande tauschte sich Xenia mit anderen Autoren aus. Die 25jährige schrieb nun schon seit fünf Jahren unter dem Pseudonym Nia Raver. Sie hatte Glück gehabt und einen Verlag gefunden, der sie gefördert hatte. Ihre Krimiserie kam gut an. Der Held, ein Privatdetektiv namens Pitt Logan, fand viel Anklang. Die Geschichten waren alle gut recherchiert. Es gab amüsante Episoden und auch genügend falsche Fährten, um die Leser mitfiebern zu lassen. Am meisten begeisterte der Held, der natürlich auch immer bildschöne Frauen traf, sich aber dann zielsicher die richtigen Fettnäpfchen aussuchte, um anfangende Frauenbeziehungen enden zu lassen. Er durfte ein oder mehrere tolle Nächte erleben und machte dann ungewollt den Fehler, der ihm die Ohrfeige und ein heftiges Türknallen einbrachte. Bei Beziehungen war er der ‚Ritter von der traurigen Gestalt‘. Es war die Geschichte im Hintergrund der Serie. Wann traf er die Richtige und wie gewann er sie? Es machte den Charakter damit für die Leser so einfach zum Akzeptieren. Pitt war nicht der Supermann, sondern ein Mensch wie jeder andere. Nicht supergut, superschlau und superschnell, sondern mit Fehlern und Schwächen behaftet. Jeder konnte in den Spiegel sehen und denken, dass Pitt Logan gar nicht so anders war als man selber.
Erfahrungen, Vorgehensweise, neue Ideen waren für alle ein Thema, die selber schrieben. Natürlich las man selber auch und konnte hier mit den jeweiligen Autoren und Autorinnen Dank und auch Kritik austauschen. Oft waren es Kleinigkeiten, die aber bei Lesern viel ausmachen konnten.
Mit ihren schulterlangen braunen Haaren und den ebenfalls braunen Augen hielt sich Xenia zwar für akzeptabel, aber nicht für schön. Meist trug sie praktische Kleidung ohne viel Aufwand. Nur für die Messe hatte sie sich in einen hellbraunen Hosenanzug gekleidet, der ihre schlanke Figur betonen.
Von der Messe versprach sie sich Tipps, denn sie wollte ihren Helden weiterentwickeln. Reine Krimis und Thriller gab es haufenweise. Sie hatte sich überlegt, vielleicht etwas anderes mit einzubauen. Sie dachte an Fantasy, Ausflüge in die Magie, Beschaffung von Artefakten und ähnlichem. Ein anderer Gedanke war, dass sie ihm einen Helfer zur Seite stellen wollte. Vielleicht einen ehemaligen Soldaten für mehr Action oder jemanden, der vielleicht etwas mehr Prickeln in die Story bringen würde. Da oft Frauen eine Nebenrolle spielten, konnte Erotik etwas mehr betont werden. Noch hatte sich Xenia nicht festgelegt. Da suchte sie die Erfahrungen anderer.
Heute, der Sonntag, war der letzte Tag. Ihre offiziellen Termine hatte sie gestern bereits gehabt, so dass sie sich heute ihren eigenen Interessen widmen konnte.
Die Messe hatte erst vor kurzem für den heutigen Tag geöffnet. Nach hielt sich der Andrang in Grenzen. Momentan hatte sich Xenia mit der Autorin Lona Sky in eine stille Ecke zurückgezogen. Lona Skys Romane beinhalteten oft Fantasy-Charaktere und spielten immer in einer SM-Welt. Mal waren es Menschen, die Elfenmädchen fingen, mal andersherum Dämonen, die sich hilflose Menschenfrauen holten. Typisch war bei ihren Romanen, dass die Opfer, immer die weiblichen Charaktere, von den männlichen Fängern mit Peitsche und Fesseln gequält wurden. Da wurde Sadomasochismus betrieben. Zwar blieb alles unblutig, aber die Frauen wurden automatisch immer die Sklavinnen für die Männer. Und sie fühlten sich natürlich zufrieden in dieser Rolle. Immer wieder gab es sehr deutlich beschriebene Szenen, fast schon pornografisch detaillierte Darstellungen. Aber die Versklavung wandelte sich regelmäßig in Liebe und so kam immer ein Happy End zwischen den Protagonisten heraus, wobei die Frau darum bettelte, Sklavin bleiben zu dürfen.
Xenia hatte eine Reihe von Lona Skys Büchern gelesen. Allerdings hatte sie oft die Logik in den Geschichten vermisst. Plötzlich tauchte etwas auf oder man wusste neue Erkenntnisse, ohne dass der Leser mitbekam, wie sie zustande kamen. Manchmal änderten sich Dinge ab, damit sie passend zur gerade verlaufenden Szene waren. Es hatte Xenia gewundert, dass sie scheinbar die einzige war, die derartige Kritik fand. Aber vielleicht war sie als Autorin auch kritischer und hinterfragte mehr. Deswegen hatte sie die Chance genutzt, als sie die Autorin alleine in der Ecke hatte sitzen sehen.
„Sag Eilene zu mir“, hatte die Frau gebeten und sich mit ihrem bürgerlichen Namen vorgestellt.
Die kleine, etwas kräftiger gebaute Frau war Mitte 40 und hatte jahrelange Erfahrung als Autorin zu verzeichnen. Sie erklärte Xenia ihre Sichtweise und verblüffte sie mit jedem Satz.
„Mach dir doch keine großen Gedanken. Die Leser interessiert Logik nicht. Die wollen nur saftige Szenen und eine einigermaßen verständliche Gesamtstory“, sagte Eilene.
„Wie kann die Story gut sein, wenn sie unlogisch ist?“ wollte Xenia wissen.
„Ist doch einfach. Logik verkompliziert alles. Dann musst du auf Details achten. Ein Leser will Action, keine Details. Der will höchstens eine detaillierte Beschreibung der Nippel, aber nicht, wie und ob du jeden Knopf an der Bluse öffnest. Wenn man ihr die Bluse aufreißt, dann gibt es keine Probleme mit Knöpfen oder Nähten. Die Bluse hat zu reißen und Knöpfe werden fliegen. Das erwartet der Leser. Wenn er selber es zu Hause nicht fertigbringt, bestärkte es doch nur die Kraft des Protagonisten. Den Leser interessiert nicht, wie der Held die Frau überzeugt, mit ihm in die Kiste zu klettern. Er will sie darin schwach und unterwürfig erleben. Also fordert es der Held und die Frau stimmt sofort zu, egal ob es realistisch wäre oder nicht. Die Frau hat spätestens zwei Seiten nach dem Kennenlernen das Schmachten und Sabbern anzufangen. Rettungsloses Verlieben eben.
Dem Leser ist es egal, ob du in Situationen den Helden aus dem Off herzauberst. Logik ist absolute Nebensache. Hauptsache, er ist im richtigen Moment zur Stelle. Und wenn die Heldin in Schwierigkeiten geraten soll, dann sorge dafür. Du als Autorin bist Gott für die Charaktere. Du brauchst ein Problem? Zack – du schaffst es. Ein Leser denkt nicht nach, ob es überhaupt möglich ist oder so passieren kann. Action ist angesagt.
Eine beschissene Ausgangslage, die Heldin in verzweifelten Nöten und der strahlende Held tritt auf. Die erste Rettung und schon etwas Spannung. Dann kommen die üblichen Missverständnisse und das obligatorische sich zieren, damit die Leser mitfiebern. Eine saftige Szene, dass man auf weitere hofft. Als nächstes eine noch größere Gefahr und am Ende siegt der Held erneut. Und wenn der Böse bereits besiegt ist, macht nichts. Du zauberst einfach eine neue, noch größere Gefahr herbei. Und wenn sie 20 Mann in ihrer winzigen Küche bedrohen. Und – zack – ist der Held eben für alle unerkannt hinter dem Vorhang verborgen gewesen. Natürlich das Finale nicht vergessen und sie sinkt an seine Brust. Fertig.“
„Das ist alles?“
„Gut ist auch, wenn die Heldin schwach oder naiv ist. Dann wirkt der Held umso besser. Natürlich ist der Held in allem der Beste. Ob beim Kampf oder im Bett. Niemand denkt darüber nach, ob der Typ es verdient, sie zu bekommen. Das ‚Verdienen‘ ist unwichtig. Der männliche Leser will sich mit dem starken Helden identifizieren. Er bekommt die Beute, die Frau. Und die hat zu seinen Füßen zu sitzen, zu ihm aufzusehen und ihn anzuschmachten. Eine Leserin will sich schwach fühlen und vom starken Helden gerettet und zünftig geliebt werden. Dann rollt die Leserin mit den Augen und würde gern an Stelle der Heldin sein. Das nennt man Schmachtfaktor, verstehst du?“
„Hm, aber eine starke Heldin will doch auch jede Frau sein.“
„Blödsinn. Ich schreibe Liebesromane, kein Heldenepos. Starke Frau ist Dummheit. Dann erwartet der männliche Leser laufend ein Hinterfragen der Handlungen des Helden oder er fühlt sich untergebuttert, wenn die Heldin das Problem selber löst. Daraus resultiert die Vorstellung, am Ende dominiert auch die Frau in der Beziehung. Welchem Mann gefällt das schon? Und schon fehlt dir die Hälfte der Leserschaft. Held und Heldin auf gleicher Ebene? Schwachsinn! Dann könnte sich die Heldin gleich selber retten oder gar den Helden retten? Wer will denn so einen Humbug lesen?
Nein, nein, nein. Eine schwache naive Heldin und der starke überragende Held sind das alleinige Erfolgsrezept. Je naiver sie ist, desto mehr schmachtet sie den Helden, ihren Retter, an.“
Eilene überlegte. Dann zuckte sie mit den Schultern.
„Eine frühere Autorenkollegin, die wie ich auch über SM schreibt, hat mir damals ihren Trick verraten. Seither trage ich bei öffentlichen Terminen immer ein Sklavenhalsband. Mein Mann macht gerne mit, wenn ich mich bei Interviews als seine Sklavin bezeichne. Und meine SM-Geschichten haben sich seither viel besser verkauft, weil jeder glaubt, dass ich wirklich eine Sklavin bin.“
„Heißt das, Sie haben keine Erfahrung mit dem Thema?“
„Bin ich meschugge? Soll ich mich prügeln lassen? Wozu? Es gibt so viele Bilder von Szenen im Netz. Beschreibe sie, schmücke sie aus, lass es saftig sein und die Leser lieben es. Mach ein paar Andeutungen und die Leser glauben es. So einfach ist das.“
„Aber das ist doch eine Lüge.“
„Quatsch, Schäfchen. Lüge ist ein hässliches Wort. Das nennt sich Marketing. Für mich hatte es auch den Vorteil, dass ich mich nicht mehr oft mit Lesern treffen muss. Mein ‚Herr‘ ist dagegen. Ob es stimmt, will doch keiner wirklich wissen.“
Wenig später saß Xenia mit zwei anderen Autoren zusammen. Hier diskutierten sie ausgiebig, wie intensiv Recherche betrieben werden musste. Reichte es, wenn man einen bekannten Namen bei historischen Romanen nannte oder musste man auch Handlung und das Jahr exakt in Einklang bringen? Hatte sich die historische Persönlichkeit in der Zeit dort aufgehalten oder reichte es, die Persönlichkeit einfach dorthin zu versetzen? Wie sah es mit Mode und Gegenständen aus, die für diese Zeit genannt wurden? Wenn bei moderner Hightech Gerätebezeichnungen genannt wurden, mussten diese existieren oder durften sie erfunden sein, wenn es in der aktuellen Zeit spielen sollte.
Es gab eine Vielzahl von Argumenten, die für Genauigkeit sprachen, genauso wie es als weniger notwendig erachtet wurde, wenn es keine direkte Einwirkung auf die Handlung nahm.
Zumindest konnte sie in den Gesprächen herausfinden, dass viele auf Präzision setzten, besonders wenn es um Krimis und ähnliche Thriller ging. Da wurde recherchiert, da musste alles passen. Und es gab andere Themen, da konnte man der Phantasie freien Lauf lassen. Fantasyromane oder Science-Fiction gehörten dazu.
Trotzdem machte es sie nachdenklich, dass es auch Themen gab, bei denen so getan wurde, als ob man Ahnung hatte und doch war alles nur eine Marketingmaßnahme. Man dichtete sich als Autor ein Wissen an, dass nicht vorhanden war.
Xenia setzte sich bereits nach dem Mittagessen in ihren Wagen und fuhr nach Hause. Die Abschlussfeier besuchte sie nicht mehr. Dafür hatte sie einiges mitbekommen, über dass sie bei der Heimfahrt nachdachte.
Zum einen ging es um die Aussage, dass man die allgemein bekannten Fakten exakt berücksichtigen und nicht verbiegen durfte. Oder … es musste im Vorwort angeführt werden, dass man zugunsten der Geschichte Veränderungen durchgeführt hatte. Da konnte sie sich der Einstellung vieler Autorenkollegen nur anschließen.
Das andere hatte sie mehr erschüttert. Gab es wirklich Autoren, die kaum Ahnung von dem hatten, über das sie schrieben? Und gab es die Autoren, die sich als etwas ausgaben, was sie gar nicht waren? War da so viel Marketing dahinter, nur um die Verkaufszahlen anzukurbeln?
Für Xenia war es die Frage, wie sie selber sich verhalten sollte. Die Frage hatte sie sich aber am schnellsten beantwortet. Ehrlichkeit war eine Tugend und sie würde sie verwenden. Die Konsequenz daraus war allerdings, dass sie sich dann mit den Themen detaillierter auseinandersetzen musste, die sie einbauen wollte.
Naja, sie musste nicht zaubern lernen, wenn sie magisches einbauen wollte. Aber sie musste dem Komplex nachgehen. Weiße Magie, schwarze Magie, was gab es an Abgrenzungen und Regeln für die Anwender? Konnte man mischen? Welche Wesen durften damit mitspielen? Sollte man Geschichten mit alten Mythen kombinieren? Ihr Held agierte hier in den Staaten. Ihn mal eben nach Deutschland auswandern zu lassen, war nicht glaubhaft. Ein Abenteuer vielleicht, aber da musste sie an das Problem Sprache denken und wie sie das einbauen konnte. Natürlich konnte man die Großmutter einführen, die deutsch mit dem Enkel gesprochen hatte. Was aber gab es an Mythen hier in den Staaten? Hatten die Indianer dazu etwas zu bieten. Sie wollte ja nicht eine Neufassung vom ‚Friedhof der Kuscheltiere‘ schreiben.
Xenia schmunzelte. Da steckte schon einmal Recherche dahinter. Vielleicht gab es … doch, da war …, gab es nicht indianische Märchen oder Sagen von Menschen, die sich in Tiere verwandeln konnten? Irgendetwas ist da in meiner Erinnerung. Es wäre vielleicht ein Aspekt, wenn so ein Gestaltwandler der Helfer meines Helden Pitt Logan wird. Er kann sich in einen Adler verwandeln und aus der Luft beobachten und ausspionieren. Oder er wird zum Bären mit großen Kräften. Sie grinste.
Ja, in so etwas steckte Potential. Und schon nahm in Gedanken ein neuer Charakter seine Züge an. Ein Indianer, hochgewachsen, asketisches Aussehen, stoische Miene, vielleicht trockenen Humor, …. In ihrem Kopf entstand mehr und mehr das Bild der Person. Dann zuckten erste Gedanken über das Wie durch ihren Kopf. Der Sohn eines Medizinmannes mit altem Wissen? Sollte man Grenzen setzten, wie nur einmal wandeln alle 24 Stunden? Oder doch besser ein Amulett? Oder sogar mehrere, um sich in verschiedene Tiere wandeln zu können?
Mit den Gedankenspielen verschwand der Frust über andere Autoren langsam. Sie würde ihren Weg gehen, was die Ehrlichkeit anging. Und so ein Gestaltwandler …? Xenia freundete sich immer mehr mit so einer Idee an. Es bot eine Vielzahl von Möglichkeiten.
--- xxx ---
Portsmouth, Virginia, USA:
Luke Baker war ein typischer Befehlsempfänger. Man sagte ihm, was er zu tun hatte und er machte es. Für ihn musste nur das Geld stimmen.
Er war kein gutaussehender Mann. Mit nur 1,64 Körpergröße war er klein. Dazu kam eine hagere Gestalt und Füße mit Schuhgröße 48. Das Gesicht war mit dicken Akne-Pickeln übersät. Auch wenn er erst Anfang 30 war, hatte man den Eindruck, dass er 20 Jahre älter sein musste. Möglich, dass auch der dünne Haarkranz und die schlampige Kleidung dabei eine Rolle spielten.
Als Intelligenz verteilt wurde, hatte er sich umgedreht und weitergeschlafen. Beim zweiten Aufruf war er zu faul gewesen, seine Hand zu heben. Deswegen hatte er nur mitbekommen, was übrigblieb. Komischerweise schien er häufig Glück zu haben, wenn er in Schwierigkeiten kam. Und die zog er oft an wie ein Magnet.
Seine Karriere war eine Reihe von Misserfolgen. Zuerst hatte er sich als Kurier angeboten. Er scheiterte bereits am ersten Tag, weil er einen Polizisten nach dem Weg fragte. Auf dessen Frage, was Luke in dem verrufenen Viertel wollte, hatte er das Päckchen mit dem weißen Pulver gezeigt und gesagt, dass er es dort abliefern sollte. Sein Glück war, dass es die erste Tour war und man ihn erst mit Milchpulver auf die Probe gestellt hatte.
Später hatte er es einmal mit Bankraub versucht. Mit einer echt wirkenden Spielzeugpistole und einer stark in die Stirn gezogenen Pudelmütze hatte er den Schalterraum gestürmt. Als er beim Kassierer war und gerade die Waffe hob, wurde er von hinten von einer 80jährigen mit Rollator wegen ‚Vordrängeln‘ angeblafft und nach hinten geschickt. Eingeschüchtert hatte er sich hinter der Dame eingereiht. Ältere Frauen verdienten Respekt. Bevor die Oma ihre Diskussion mit dem Schalterbeamten beendet hatte, war die Polizei gekommen, alarmiert mit dem Betätigen des Alarmknopfes durch den Kassierer. Sein Glück war die Spielzeugpistole und dass er gar nicht dazu gekommen war, eine Forderung auszusprechen. Der Richter erkannte Lukes geistige Fähigkeiten sehr schnell und ließ den Prozess in einer Verwarnung enden.
Heute schlug er sich als Helfer durch oder erledigte präzise erklärte Aufgaben. Dann sah er nicht links und rechts, sondern folgte nur den Anweisungen. Und da er meistens ein Glückskind war, schaffte er die Aufträge. Auch wenn es andere wunderte, so bekam er doch den nächsten Auftrag.
Dieses Mal klang es einfach. Jemand wollte, dass er einen Kellerraum präparierte. Natürlich sollte er kein Feuer legen oder sonst etwas Dramatisches. Das würde der Versicherung auffallen, wie der Auftraggeber gesagt. Es sollte einen kleinen Knall geben und ein Licht. Das würde Schreck genug sein, hieß es. Luke glaubte es, denn die 500 Dollar konnte er immer gebrauchen. Und Luke bekam genaue Anweisungen, einen Termin und auch die notwendigen Werkzeuge.
Damit begann auch das Ende seiner langen Glückssträhne. Fortuna war müde geworden. Luke Baker war ein Fulltime-Job für sie gewesen.
Den abgesprochenen Termin verschlief Luke ganz einfach. Der Samstag war für ihn sehr gut verlaufen und er hatte beim Pferderennen gewonnen. Das hatte er abends ausgiebig gefeiert, anstatt seinen Job zu erfüllen. Es belastete ihn nur nicht, denn die Bewohnerin würde sowieso das ganze Wochenende abwesend sein und erst montags zurückkehren, wie ihm der Auftraggeber versichert hatte.
Kaum waren am Sonntagabend die meisten Lichter in der Häuserzeile erloschen, war Luke aus seinem alten Lieferwagen ausgestiegen. Mit der kleinen Sporttasche in der Hand eilte er zur Haustür. Das Schloss stellte ihn vor keine großen Herausforderungen und kaum eine Minute später schloss er die Tür von innen.
Mit der Taschenlampe leuchtete er kurz durch die Zimmer. Vielleicht gab es ja noch etwas Wertvolles, dass er beim Weggehen noch mitnehmen konnte. Doch zuerst kam seine Aufgabe. Die Pflicht ging vor. Den Abgang in den Keller hatte er schnell gefunden.
Hier schaltete er das Licht ein, nachdem er die Tür angelehnt hatte. Sein Auftraggeber hatte ihm gesagt, er solle zuerst die Lampe an der Decke manipulieren. Die Versicherung würde es dann als technischen Defekt einstufen und zahlen, hatte der Auftraggeber ihm erklärt. Für Luke mit seinem scharfen Verstand war damit ein Versicherungsbetrug geplant.
Also entfernte Luke das Gehäuse und löste einen Draht. Prompt erlosch die Beleuchtung. Im Schein der Taschenlampe bog er den ziemlich starren Draht so zurecht, dass gerade eben Kontakt bestand. Die Lampe ging zwar an, flackerte ab. Luke freute sich, weil jetzt manchmal kleine Funken zwischen Draht und Klemme sichtbar wurden. Genau das hatte man von ihm gefordert. Innerlich klopfte sich Luke auf die Schulter. Er war eben Profi.
Dann betätigte er den Schalter und löschte das Licht. Den nächsten Schritt musste er unbedingt im Schein der Taschenlampe ausführen, hatte man ihm aufgetragen. Neben etlichen kompliziert aussehenden Geräten in dem Raum gab es noch zwei Rohrleitungen, die in den Raum führten. Um die eine, die bei der Heizung endete, brauchte er sich nicht kümmern. Das war die Wasserleitung.
Die andere war die Entscheidende. Sie hatte an der Wand einen Sperrhahn, der auf geschlossen stand und mit Draht und einer Plombe in der Position gesichert war. Das kurze anschließende Rohrstück trug zusätzlich eine versiegelte Verschlusskappe. Mit einer Rohrzange löste er diese Kappe und legte sie auf den Boden. Um den Draht kümmerte er sich mit einem Seitenschneider. Die Stücke ließ er achtlos auf den Boden fallen. Dann konnte er den Hahn drehen und gleich darauf war ein leises, aber kräftiges Zischen zu hören.
Nun hatte er Zeit. Er musste nur noch seine Werkzeuge zusammenpacken und konnte verschwinden. Doch er nahm sich die Zeit, diese merkwürdigen Geräte, die ihn so gar nicht an eine Heizung erinnerten, im Licht der Taschenlampe zu betrachten. Aha, Solartechnik, fand er heraus. Respekt, da muss jemand Geld haben. Kein Wunder, dass man die Investition durch einen kleinen Versicherungsbetrug ausgleichen will. Luke versuchte, die Funktionsweise zu erkennen. Immerhin konnte ihm so etwas in Zukunft erneut über den Weg laufen.
Einige Minuten später musste er husten. Er fühlte sich leicht schwindelig. Aber er schob es auf die Nachwirkungen der Getränke gestern.
Xenia lehnte ihren Kopf müde an die Nackenlehne im Wagen, als sie nach stundenlanger Fahrt vor ihrem Haus anhielt und den Motor ausschaltete. Vielleicht hätte sie doch erst, wie geplant, am kommenden Morgen fahren sollen. Nun war es kurz vor Mitternacht.
Während sie mit einer Hand ihren Nacken massierte, kletterte sie aus dem Wagen. Ein Druck auf die Fernbedienung und das leise Klicken zeigte ihr, dass der Wagen verschlossen war. Mit der Handtasche in der Hand ging sie zur Haustür und schloss auf.
Sie sparte sich den Lichtschalter. Hinter sich schob sie die Tür ins Schloss. Den Weg ins Bett fand sie im Dunkeln. Nebenbei legte sie die Handtasche noch auf die Kommode und ging weiter.
Fast wäre sie gegen die Tür zum Keller geprallt. Die stand halb offen. Mit einer Handbewegung schlug die Tür zu. Xenia ging weiter in Richtung Schlafzimmer. Dort angekommen streifte sie zuerst die flachen Schuhe ab und spielte für einen Moment mit den Zehen. Dann zog sie die Jacke aus und legte sie über die Lehne eines Stuhls.
Sie war schon beim dritten Knopf an ihrer Bluse angekommen, als sie ins Stocken kam und stöhnte. Sie brauchte doch noch ihren Koffer. Das waren Zahnbürste und Waschzeug drinnen. Tief atmete sie durch und wandte sich um. Noch einmal schlüpfte sie in ihre Schuhe. Müde ging sie erneut durch die Wohnung, nahm die Schlüssel, öffnete die Haustür und ging weiter zum Wagen.
Mit einem Klick schloss sie den kleinen Kofferraum auf und holte ihren Trolley heraus. Sie stellte ihn neben sich und verschloss den Wagen erneut.
Als sich die Haustür öffnen, erstarrte Luke für eine Sekunde. Dann aber schaltete er sofort die Taschenlampe aus. Mit einer schnellen Bewegung stellte er sich hinter eines der Geräte. Nur für den Fall, dass jemand nachsah, warum die Tür offen gestanden hatte. Dabei stieß er sich mit dem Handgelenk an einer Kante. Im Schmerz öffnete sich seine Hand und die Taschenlampe fiel zu Boden. Es war nicht laut, denn sie hatte gummierte Ränder. Luke konnte hören, wie sie ein Stück zur Seite rollte, aber seine Aufmerksamkeit war nach oben gerichtet.
Er hörte, wie die Kellertür ins Schloss fiel. Beinahe atmete er erleichtert aus. Niemand hatte ihn entdeckt. Er wartete ab, ob etwas passierte. Dabei schätzte er völlig richtig ein, dass der Bewohner nur früher als geplant gekommen war und wohl nun ins Bett gehen würde.
Doch nun erstaunte es ihn, dass er noch einmal die Haustür hörte, wie sie geöffnet wurde. Kam noch jemand? Oder ging der Bewohner nur nochmals hinaus, um etwas zu holen? Luke konnte es nicht entscheiden. Und er fühlte sich schlechter. Sein Schwindelgefühl nahm zu. Waren es wirklich nur die Drinks? Oder stellte sich gerade eine Klaustrophobie bei ihm heraus? Oder war es nur das Entdeckungspotential im Moment.
Müde schüttelte er den Kopf. Aber nur einmal, denn ihm wurde wieder schwummrig und eine leichte Übelkeit ergriff ihn. Es wurde Zeit, dass er seine Sachen einsammelte und hier verschwand, bevor noch etwas schief ging. Trotz dem Schwindelgefühl ging er in die Hocke und tastete nach der Taschenlampe. Nur konnte er sie nicht ertasten.
Unterdrückt fluchte er und hustete erneut. Warum nur kam ihm die Luft so stickig vor? Doch dann hatte er eine Idee. Die Kellertür war doch zu. Niemand würde sehen, wenn er hier Licht machte.
Vorsichtig tastete er sich vorwärts bis an die Wand. Dort richtete er sich stöhnend auf. Warum nur fühle ich mich so schlapp? Das ist mir noch nie passiert. Aber er kämpfte weiter. Ganz grob vermutete er, wo er war und schob sich an der Wand entlang. Seine Hand wischte umher, um den Lichtschalter zu finden.
Dann stieß er dagegen. Zufrieden grinsend betätigte er ihn. Überdeutlich hörte er das Knistern an der Lampenfassung. Der einen Sekundenbruchteil spätere Lichtblitz blendete ihn vollkommen. Was …? schaffte er noch in Gedanken, dann flog er auch schon durch den Raum. Der Aufprall und die auf das Licht folgende Feuerwalze schaltete alle seine Gedanken aus. Für immer.
Es war der Moment, bei dem Xenia einen ersten Schritt wieder in Richtung Haus machen wollte. Wie in Zeitlupe sah auch sie das plötzliche Licht in allen Fenstern ihres Hauses. So hell hatte sie es noch nie gesehen. Dann schienen sich die Wände zu wölben. Wie unbeteiligt stand sie noch einen Moment da und sah zu, die sich das Dach auflöste und die Schindeln in den Himmel rasten. Die Holzwände des Hauses brachen auseinander und wirbelten als Splitter durch die Luft. Sogar die Vorderseite kam auf sie zu.
Doch gleichzeitig erfasste sie die Druckwelle und schleuderte sie nach hinten auf die Straße. Hart schlug sie auf dem Rücken auf. Völlig benommen und wie unbeteiligt sah sie, wie ein Teil der Fassade die Stelle unter sich begrub, an der sie eben noch gestanden hatte. Damit wurde auch ihr Wagen von Trümmern bedeckt.
Als in der Ferne schon die ersten Sirenen ertönten, lag sie noch immer ohne Bewegung auf der Straße. Fassungslos starrte sie ihr Haus an, beziehungsweise das, was davon noch übrig war. Rudimentäre Wände markierten das Äußere, meistens stand höchstes noch etwas bis zum Fensterrahmen. Alles darüber fehlte einfach oder kam langsam als Fetzen von oben herab. Die schwereren Teile, wie Holz und Schindeln, war schon längst wieder unten und hatte sich zum Teil in der Nachbarschaft verteilt. Was jetzt noch kam, schien Papier, Stoff und ähnliches zu sein.
Langsam kamen auch Nachbarn auf die Straße. Verletzt war niemand, aber sie betrachteten genauso fassungslos die Schäden an den eigenen Häusern, wie auch das Trümmerfeld auf Xenias Grundstück. Abgesehen von den näherkommenden Sirenen herrschte betroffenes Schweigen. Mit den Trümmern bei Xenias Haus war allen die Ursache verständlich, auch wenn das Wieso noch unklar war.
Kurz hintereinander trafen Polizei, Feuerwehr und ein Krankenwagen ein. Alle blickten erst einmal sekundenlang auf den Ort der Katastrophe. Dann wurden sie aktiv. Die Polizei sperrte Straße und Umgebung ab. Ebenso begannen die Befragungen der Nachbarn. Später würden noch Techniker kommen. Für sie ging es um die Ursache und einen möglichen Verursacher.
Die Feuerwehr löschte die noch bestehenden kleineren Brände und blockierte die Gaszufuhr an anderer Stelle. Damit waren zwar auch andere Haushalte ohne Gasversorgung, aber ohne die Maßnahme konnte man bei Xenia die Leitung nicht mehr abdichten. Der tiefergelegene, nun oben offene Kellerraum wurde mit Luft gespült, um die restlichen giftigen und entzündlichen Gase zu beseitigen. Später mussten ja Spezialisten hinunter wegen der Untersuchung. Sie waren auch diejenigen, die unter den Trümmern die Leiche im Keller fanden.
Damit änderte sich auch die Arbeit und Aufgabe der Polizei. Nun wurden weitere Spezialisten herbeigerufen.
Inzwischen hatte sich die Sanitäter um Xenia gekümmert. Andere Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Xenia hatte fast ebenso viel Glück, denn man konnte keine Brüche oder schlimmere Verletzungen an ihr feststellen. Da gab es nur etliche Schürfwunden und Prellungen durch den Aufprall auf der Straße.
„Sie müssen mehr als einen Schutzengel gehabt haben“, hatte der Sanitäter gemurmelt, während er sie versorgte.
Natürlich wurde auch sie befragt, was denn passiert wäre. Und sie konnte in keiner Weise behilflich sein. Schließlich war sie gerade erst nach Hause gekommen. Auch zur Leiche konnte sie keine Hinweise geben, denn sie lebte allein. Es gab keine Mitbewohner.
Nur in einem Punkt konnte sie helfen. Als eine Gasexplosion als Möglichkeit angedeutet wurde, verwies sie darauf, dass sie keine Gastherme hatte und ihr früherer Gasanschluss durch die Stadt stillgelegt worden sei. Die Aussagen führten zu weiteren Untersuchungen.
Erst in den frühen Morgenstunden ließ man sie gehen. Fast hilflos hatte sie dagestanden. Ihr Haus war weg und der Zugang zu den Resten gesperrt. Eigentlich hatte sie nichts mehr außer den Kleidern am Leib … und zumindest den Trolley, der auch auf die Straße geschleudert worden war. Nur die fast unbeschädigte Handtasche hatte ihr die Polizei aus den Trümmern besorgt.
Endlich hatte sie sich aufraffen können und checkte in einem nahen Hotel ein. Schließlich hatte die Polizei weitere Fragen und sie selber musste für die Versicherungen auch alles in die Wege leiten.
Am nächsten Tag hatten die Zeitungen schon ihre Schlagzeilen. Reporter, die es mitbekommen hatten, waren zum Explosionsort gekommen. Sie hatten versucht, auf das abgesperrte Gelände zu kommen, waren aber von der Polizei gehindert worden. Da Xenia von der Polizei in Beschlag genommen war, hatten auch die Anwohner keine Ahnung, wo die Eigentümerin des Hauses war. Es war eben die typische Vorortsiedlung mit ziemlich gleichen Häusern und Vorgärten. Jeder kannte jeden und niemand interessierte sich für den anderen, außer wenn dessen Hund im eigenen Garten einen Haufen hinterließ.
Als dann die verdeckte Blechwanne mit der Leiche weggebracht wurde, war vielen Neugierigen klar, was passiert war. Und die Reporter griffen es auf.
‚Am Sonntag gegen Mitternacht wurde die Vorstadt von Portsmouth durch eine Explosion erschüttert. Ein Wohnhaus wurde durch eine Gasexplosion völlig zerstört. Die Feuerwehr fand eine Leiche im Keller des Gebäudes, vermutlich die Eigentümerin. Umliegende Gebäude wurden beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von …‘
So stand es am nächsten Tag zu lesen. Exakt festgelegt hatte sich niemand, aber es war schließlich alles eindeutig. Und mit dem obligatorischen Hinweis auf noch andauernde polizeiliche Untersuchungen und noch keine offiziellen Statements sicherte sich die Presse weiter ab. Doch für die Leser war es eindeutig.
Auch Xenia las es. Sie kommentierte es nicht, sondern war nach kurzem Nachdenken zufrieden. So konnte sie von hier weggehen, ohne dass es auffiel.
Es dauerte noch eine weitere Woche, bis sie den Ort verließ. Das Ziel stand fest. Nur wenige Gegenstände hatte sie aus ihrem Wagen und dem Haus bergen können. Die Gegenstände kamen in eine angemietete Garage als Stellplatz. Glücklicherweise hatte sie dafür gesorgt gehabt, dass alle wichtigen Unterlagen, wie Versicherungen und die Besitzurkunde des Hauses, im Bankschließfach gewesen waren.
Wie es nun mit dem Haus weiterging, musste noch entschieden werden. Vorher durfte sie nichts verändern. Doch sie hatte sich zumindest hinsichtlich Kleidung einiges besorgt. Das Geld auf der Bank stellte sie vorerst nicht vor Probleme. Bis sie wieder ein wirkliches Zuhause hatte, würden aber noch viele Wochen vergehen.
Am besten hatte der Ersatz für das zerstörte Auto geklappt. Die Versicherung hatte mit dem Polizeibericht den Schaden als Totalschaden eingestuft und ihr den Restwert überwiesen. Damit hatte sie sich wieder den gleichen Wagen besorgt. Es stellte somit keine große Veränderung für sie dar.
Natürlich hatte sie auch mit ihren Eltern telefoniert. Die sollten es nicht aus den Nachrichten hören. Das Gespräch hatte erwartungsgemäß zuerst ein großes Jammern bei ihrer Mutter hervorgerufen. Als sie sich etwas beruhigt hatte, war das Telefonat endgültig aus dem Ruder gelaufen.
„Komm zu uns, Xenia. Vater und ich haben Platz. Du kannst dein altes Zimmer benutzen“, bot ihre Mutter an, „und dein Vater würde sich freuen, wenn du ihm im Laden hilfst. Weißt du, du kannst auch den Garten betreuen.“
Xenia schüttelte den Kopf. Nichts gegen ihre Eltern, aber sie war 25. Da brauchte sie niemanden, der ihr stündlich Empfehlungen und Anweisungen gab, was sie machen sollte. Und laufende Ratschläge, wer als guter Ehemann in Frage käme und welche Ausbildung sie doch besser noch machen sollte, konnte sie auch nicht ertragen. Autorin, auch wenn es sich inzwischen für sie sogar auszahlte, war kein annehmbarer Beruf für ihre Eltern.
„Tut mir leid, Ma. Aber ich habe ein anderes Unterkommen.“
„Und wo? Bei einer Freundin?“ fragte ihre Mutter leicht pikiert, weil ihre gerade entwickelten Pläne wieder platzten.
„Nein. Ich habe beschlossen, Opa Sam‘s Haus zu nutzen.“
„Opa Sam? Stimmt, er hat dir ja seine Insel vererbt. Na, dann hoffe ich für dich, dass die Hütte noch nicht zusammengefallen ist. Dann kannst du ja vielleicht bei seinen Öko-Freaks unterkommen.“
Die Anteilnahme in der Stimme ihrer Mutter hatte merklich nachgelassen.
„Was meinst du damit? Als ich das letzte Mal da war, war es ein schönes Haus gewesen, dass Opa Sam mit seiner Frau Evelyn bewohnt hatte.“
„Seiner zweiten Frau. Seit damals war nicht mehr mit ihm zu reden. Er hat seine Firma wegen ihr verkauft, anstatt sie deinem Vater zu übereignen, und war nur noch mit diesen Umweltschützern unterwegs. Und dein Besuch ist sicher auch schon sieben oder acht Jahre her, denn danach ist diese Frau ja einfach verschwunden und hat ihn sitzengelassen.“
„Es ist egal, Mutter. Ich gehe jedenfalls auf die Insel. Da habe ich meine Ruhe, auch zum Schreiben.“
--- xxx ---
Eine Villa in Miami Beach:
Rodrigo Meduci betrachtete die nackte kaffeebraunen Schönheit vor sich auf den Knien.
Für Pearl war das Leben anders geworden. Als Rodrigo damals ins Schlafzimmer gekommen war, hatte sie sich sehr um ihn bemüht, um ihn wieder freundlich zu stimmen. Sie hatte ihn auf jede erdenkliche Art verwöhnt. Dass er ihr am Ende eine dicke lederne Manschette um ihren rechten Knöchel gelegt und mit einem Schloss für sie unlösbar verschlossen hatte, hatte sie nur erstaunt. Immerhin war die Manschette innen gepolstert. Sie hatte noch gekichert, als er ihr vorgeschlagen hatte, ein Spiel zu machen, damit sie eine Überraschung erleben durfte und hatte sich willig die Augen verbinden lassen. Ebenso willig hatte sie sich von ihm durch das Haus führen lassen. Sie hatte gedacht, er wolle sie verwirren, weil es Treppen hoch und wieder hinunter ging. Da hielt sie es noch für ein Spiel.
Das Lachen war ihr vergangen, als erneut ein Schloss klickte und er ihr die Augenbinde abnahm. Langsam war Entsetzen in ihre Augen getreten.
„Überraschung“, hatte er hämisch gerufen und ihr die Zeit gegeben, erste Erkenntnisse zu sammeln.
Der Raum hatte keine Fenster. So grob verputzt schien es ein Kellerraum zu sein. Die einzige Tür war aus dickem Holz und mit Metallbändern verstärkte. Es gab sogar ein kleines, von außen verschließbarem Fenster darin. Der Raum war hoch und von der Decke hingen an etlichen Stellen Ketten herab. Eine stabile Kette war jetzt auch an ihrer Fußmanschette, doch sie war nicht lang genug, damit sie die Tür oder die hintere Raumhälfte erreichen konnte. Was sie dort sah, erinnerte sie an eine Folterkammer. Neben ihr lag eine Matratze und eine Decke auf dem Boden. Und sie konnte eine Duschecke erreichen. Zumindest vermutete sie das, denn dort hing ein Schlauch und es gab ein faustgroßes Loch im Boden als Abfluss. Wahrscheinlich diente es zu mehr, denn eine Toilette sah Pearl nicht. Fassungslos blickte sie Rodrigo an.
„Du bist schön und es wird Zeit, dass ich daraus Kapital schlage. Ab jetzt weht ein anderer Wind. Ab jetzt gehorchst du. Schon der Ansatz eines Wunsches lässt dich springen. Egal, was von dir gewünscht wird. Und wenn ich ‚egal‘ sage, dann meine ich es absolut wörtlich. Ab jetzt hast du keinen Willen mehr. Die Frau gibt es nicht mehr, nur noch das Spielzeug mit Namen Pearl. Nett, lieb und begierig, Wünsche zu erfüllen.“
Langsam wich sie vor ihm zurück. Der Schock hielt sie gefangen, während er fortfuhr.
„Jeder, der den Raum betritt, darf dich ficken. Egal wie und egal wo bei deinem Körper. Er gehört dir nicht mehr. Und du wirst machen, was man von dir will. Zögerst du oder bietest du schlechte Leistung, dann wirst du den hinteren Teil des Raumes kennenlernen. Jeder darf dort mit dir machen, was er will. Bist du gut und willig, gibt es Nahrung. Nur am Leben wirst du bleiben, denn dein Körper ist nun eine Ware. Du entscheidest allein über das Wie dein Leben aussieht.“
Damit hatte er den Raum verlassen und die Tür von außen verriegelt. Die Lampe unter der Decke brannte Tag und Nacht.
Eine Woche später war sie zerbrochen. Eine Woche voll Schmerzen hatten ihr gezeigt, was er meinte. Sie hatte erfahren müssen, wie grausam Menschen gequält werden konnten, ohne dass man bleibende Spuren sah. Seitdem war sie absolut folgsam. Dafür war sie trainiert worden in Dingen, von denen sie früher nicht einmal geahnt hatte, dass man es machen konnte.
Rodrigo war wieder einmal selber gekommen. Er hatte vor ihr auf den Boden gespuckt und mit den Fingern gedeutet. Sofort hatte sie es aufgeleckt und sich wieder hingekniet, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Ängstlich blickte sie zu ihm hoch. Auch schweigen hatte sie gelernt. Sprechen durfte sie nur, wenn sie gefragt wurde. Sie hatte es schmerzhaft, aber schnell begriffen.
„Ich habe einen Käufer für dich gefunden“, erklärte Rodrigo grinsend, während er es sich von ihr mit dem Mund besorgen ließ.
„Noch sechs Wochen, dann wirst du ihm geliefert. Er möchte noch, dass du auf seine Lieblingswünsche trainiert wirst. Und wehe, wenn er Reklamationen hat.“
Damit ließ er sie wieder allein. Später würde man mit dem Spezialtraining beginnen. Und sie würde ihre Haare verlieren. Alle, bis auf die Wimpern. Der Käufer mochte keine Haare.
Oben im Büro wurde er von Manolo, seinem Buchhalter, erwartet. Nachdem das Tagesgeschäft besprochen war, schob Manolo noch eine ausgedruckte Pressemitteilung über den Tisch.
Zuerst blickte Rodrigo verständnislos zu seinem Mitarbeiter hoch, denn die Kopfzeile mit ‚Portsmouth, Virginia‘ sagte ihm nicht. Dort hatte er keine Geschäftsbeziehungen. Doch Manolo erklärte noch nichts und nickte zum Blatt hin. Rodrigo hob es an und las.
‚Am Sonntag gegen Mitternacht wurde die Vorstadt von Portsmouth durch eine Explosion erschüttert. Ein Wohnhaus wurde durch eine Gasexplosion völlig zerstört. Die Feuerwehr fand eine Leiche im Keller des Gebäudes, vermutlich die Eigentümerin. Umliegende Gebäude wurden beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von …‘
Rodrigo hob erneut den Kopf.
„Und was soll ich damit?“
„Das Gebäude gehörte einer gewissen Xenia Carver. Sie ist von Beruf Autorin. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich von ihrem letzten Buch erzählt habe.“
Kurz musste Rodrigo überlegen, aber dann fiel es ihm wieder ein.
„Verbindungen zu uns?“ fragte er knapp.
„Tut mir leid. Da hat sich nichts gefunden. Entweder hatte die Frau eine rege Phantasie und fand die Parallele nur zufällig oder es wurde etwas nicht gefunden. Auf jeden Fall wird kein weiteres Buch zu erwarten sein.“
Rodrigo nickte zufrieden.
„Gut gemacht.“