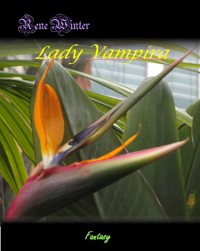2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Marcus Septimus ist ein Söldner. Zusammen mit 4 Gefährten übernimmt er Aufträge. Im Jahr 58 n.Chr. befielt Imperator Nero den Angriff auf das Königreich Armenia, dessen Herrscher durch einen Umsturz mit einem Verwandten des Partherkönigs ersetzt wurde. Damit fällt Armenia als römischer Bündnispartner weg und wird zu einer Bedrohung. Der römische Feldherr Corbulo setzt Marcus und seine Männer als Späher und Saboteure ein. Um den armenischen König zur Schlacht zu zwingen, befielt Corbulo, 3 armenische Befestigungen mit allen Bewohnern niederzumachen. In Volandum, einer der 3 Befestigungen, wird Marcus eingesetzt. Doch Massaker liegen ihm nicht. Er erwirkt von Corbulo eine Gnade und darf 10 Armenierinnen als Sklavinnen aus der Stadt führen. Mit den 10 Frauen machen sich die 5 Männer anschließend auf zu einer langen Reise bis zur Provinz Germania Superior, wo Marcus Eltern ein Landgut haben. Die Reise birgt Gefahren und auch am Ziel erfahren sie Schrecken. Und die Sklavinnen lernen auf der Reise mehr über sich und auch ihre Begleiter. Denn die Männer und Frauen bilden eine Gemeinschaft, die weniger Herr und Sklavin, sondern ein Miteinander zum Überleben braucht. Vertrauen und Verantwortung, Pflichte und Rechte gehören dazu. Doch läuft einiges anders, als alle erwartet haben. Auch wenn immer wieder ein Scheitern droht, so ist es immer der Mut und die Entschlossenheit aller, die sie weiterbringt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Römische Sklavin
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Ich erzähle eine Geschichte, keinen Tatsachenbericht.
Wegen der expliziten Beschreibungen ist sie für Leser (m/w/d) ab 18 Jahren geeignet.
Alle hier vorkommenden Personen sind erwachsen und frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt.
Auch wenn es BDSM zu der Zeit nicht gab, so habe ich die eine oder andere Beschreibung an die Regeln des heutigen BDSM angelehnt: Gegenseitiges Einverständnis, bewusste Akzeptanz und vor allem Sicherheit sollten allen vor Augen stehen, falls man solche Beschreibungen als Anregung empfindet.
Es würde mich freuen, wenn diese Geschichte gefällt.
Für Kritik, Lob oder Verbesserungsvorschläge wäre ich dankbar.
Inhaltsverzeichnis
Historisches Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Der Auftrag
Volandum
Reisebeginn
Der Weg
Überfall
Rast
Ziel
Erbe
Suche
Bekenntnisse
Erkenntnisse
Begegnungen
Epilog
Anhang
Der Auftrag
Alea iacta est
(lat.: Der Würfel ist geworfen)
Ausspruch Caesars beim Überschreiten des Rubicon gemäß Sueton
Rom, Winter 54 n.Chr.
„Was hast du auf dem Herzen, Sempronius?“
Der gerade 17jährige rotblonde schlanke Mann hinter dem wuchtigen Tisch mit den aufwendigen Intarsien aus Elfenbein und Gold blickte mit zusammengezogenen Brauen auf den kahlköpfigen älteren Mann, der neben dem Tisch von einem Fuß auf den anderen trat. Sempronius sollte der letzte Bittsteller an diesem Tag sein. Immerhin stand heute noch eine Feier für den jungen Mann an.
„Herr, es sollte etwas geschehen.“
Mit den Worten entrollte der Berater eine Karte auf dem Tisch vor Kaiser Nero. Sie zeigte den Osten des Imperium Romanum, genauer die Provinzen, die an das Partherreich angrenzten. Pontus, Capadocia, Cilicia, Syria, Judäa waren römische Provinzen. Angrenzend nach Osten lag Armenia, Mesopomatia und dahinter vor allem Parthia.
„Ja, und?“
Nero wusste noch nicht, auf was sein Berater hinauswollte. Dass es in den entfernten Provinzen immer wieder Ärger gab, war nichts Neues. Das brachte das Riesenreich, dessen Herrscher er seit zwei Monaten war, mit sich.
„Herr, schon euer Vater Claudius, mögen ihm die Götter gewogen sein, hatte vor seinem Tod Pläne hinsichtlich Armenia überdacht. Leider hat ihn seine Krankheit gehindert.“
Elegant umschiffte der Ältere die Klippe, Neros Adoptivvater zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Er vermied besonders jeden schwächsten Hinweis auf eine Ermordung des Kaisers. Gerüchte über eine Pilzvergiftung kursierten in den Gassen. Nicht wenige, die diese Gerüchte förderten oder nur darüber redeten, erlagen selber plötzlichen Unfällen oder begingen Selbstmord. Auch Neros Augenbrauen entspannten sich wieder.
„Und was hat sich verändert?“
„Nun, wie Ihr wisst, hat der parthische Großkönig Vologaeses den uns wohlgesonnenen König Mithridates in Armenia abgesetzt und seinen eigenen Bruder Tiridates auf den Thron gehoben. Spione haben berichtet, dass Vologaeses angefangen hat, auch Mesopotamia auf seine Seite zu ziehen.“
Die Hand des Beraters deutete auf die entsprechende Kartenstelle.
„Wenn man sich nun vorstellt, dass Armenia mit parthischer Unterstützung Capadocia bedroht und gleichzeitig Mesopotamia mit gleicher Hilfe versucht, Syria zu annektieren, dann wäre das ein Keil bis ans Mare Mediterraneum und würde den Landweg nach Judäa und vor allem Egyptus unterbrechen.“
Der Berater schwieg und ließ seine Worte wirken. Nero beugte sich vor und studierte die Karte. Er erkannte die Bedrohung, die der Berater in den Raum stellte. Wenn dem parthischen Großkönig dieser Coup gelänge, wäre es ein breiter Keil, der vom Pontus Euxinus bis zum Mare Mediterraneum reichte und erst, vorerst, auf halber Strecke nach Egyptus endete. Es wäre schon fast der umgekehrte Siegeszug des großen Alexanders. Die Gebiete zurückzuholen, wären mehr als aufwendig. Viel Zeit, viel Gold und viele Legionen.
Nero wusste, dass die Parther stark waren. Nicht umsonst herrschte schon lange einen schweigenden Krieg an den Grenzen. Es gab immer wieder kleine Geplänkel und Scharmützel. Überfälle auf kleine ungeschützte Dörfer. Nach Crassus und Markus Antonius in den letzten hundert Jahren hatte es keine großen Feldzüge gegeben. Aber Crassus und Markus Antonius standen besonders für Niederlagen gegen diesen Feind. Empfindliche Niederlagen für Rom. Damit waren die Parther gefährliche Feinde. Natürlich würde jeder Sieg über die Parther einen Triumpf bedeuten. Der Senat und das Volk würden den Triumphator tagelang bejubeln, weil sein Sieg die empfindlichen Niederlagen auslöschte. Doch gefährlich bedeutete auch, dass es eine weitere, noch bitterere Niederlage geben konnte. Vielleicht nicht in der Zahl der Getöteten, aber ein Volk, dass die Römer zum dritten Mal besiegte, würde den Römern den Nimbus von Stärke und Unbesiegbarkeit nehmen. Dann konnten sich Provinzen erheben und einen Flächenbrand auslösen.
„Was haben wir dort?“
„Vier Legionen, schlecht ausgebildet und mit verminderter Stärke, Herr.“
„Welche?“
„Die Dritte Gallica, die Vierte Scythica und die Sechste Ferrata in Cappadocia. Dazu die Zehnte Fretensis in Syria, Herr.“
Der Berater hatte sich vorbereitet. Die Bedrohung wuchs. Thracia war noch nicht lange her, dass Claudius es annektiert hatte und damit die Meerenge des Bosporus sicherte. Noricum als weiteres Bollwerk gegen die Germanenstämme war genommen und auch Britannia verzeichnete Eroberungen. Insgesamt viele Bereiche, die noch Truppen banden. Zu viele, fand Nero.
Nur abziehen und sich dort schwächen … oder neue Legionen aufstellen, konnte er ohne Grund auch nicht. Da spielte der Senat nicht mit. Auch Nero festigte noch seine Position und stellte sich momentan mit den Senatoren auf guten Fuß. Noch musste auch Nero dem Senat den Eindruck bieten, schwach und führbar zu sein. Noch hatte Nero nicht alle Positionen unter seiner Kontrolle, die er für die uneingeschränkte Macht brauchte.
Wenn die Parther sich allerdings erst einmal mit Macht festgesetzt hatten, würde es lange Kriege und viele Truppen kosten, verlorene Provinzen zurückzugewinnen. Überhaupt: Rom eroberte und wuchs. Aber es schrumpfte nicht. Das war nicht erlaubt. Und ihm würde man das Debakel anlasten. Es sei denn …?
„Haben wir dort einen Feldherrn?“
„Gnaeus Domitius Corbulo ist ein bewährter Mann und verfügbar.“
Nero dachte einige Minuten nach. Von dem Mann hatte er schon gehört. Ein kluger Stratege. Dann nickte er.
„Gut. Corbulo wird der neue Statthalter von Cappadocia und Gallatia. Er erhält damit den Befehl über die dortigen drei Legionen. Corbulos Aufgabe sei, die Legionen zu stärken und vorzubereiten. Auch auf die syrischen Truppen darf er zugreifen. Es muss ein Erfolg werden. Wir werden zuschlagen, wenn das parthische Gesindel es nicht erwartet. Solange muss die Grenze gehalten werden. Nicht mehr.“
„So sei es, Herr. Der Befehl wird Euch zum Siegeln vorgelegt.“
Schnell zog der Ratgeber die Karte vom Tisch und rollte sie beim Hinausgehen wieder zusammen. Corbulo würde ihm zu Dank verpflichtet sein. Und Sempronius hatte schon Vorstellungen, wie der Dank aussehen konnte.
Bereits am folgenden Tag verließen mehrere Kuriere mit Abschriften den Palast, um Corbulo seine neue Aufgabe anzuweisen. In den folgenden Monaten erhielt der Kaiser nur günstige Statusberichte.
Vier Jahre später, 58 n.Chr.
Gnaeus Domitius Corbulo hatte seine Aufgabe gut vorbereitet. Seit Jahren trainierte er nun die vier Grenzlegionen. Alte Legionäre hatte er entlassen und junge Soldaten eingezogen. Die volle Stärke war erreicht und der Krankenstand niedrig. Um die Truppen abzuhärten, verbrachten die Legionäre meistens ihre Zeit in Zelten. Eine Reihe von Kastellen hatte der Feldherr entlang der gesamten Grenze erweitert, ausgebaut und mit Truppen belegt. Er selber verbrachte seine meisten Zeit bei der Truppe. Er schlief wie sie, er aß das Gleiche wie sie, er marschierte mit ihnen, er saß auch am Lagerfeuer mit ihnen, … er war einer von ihnen. Und er sorgte für sie. Es gab Ärzte, gut ausgebildete Ärzte. Es gab frische Vorräte. Brot ohne viele Maden, frisches Fleisch, Gemüse und Wein. Deswegen folgten sie ihm willig. Auch, weil sie wussten, dass er gegen Deserteure hart vorging. Disziplin wurde hoch eingestuft bei der Truppe. Und Corbulo zeigte den Soldaten, was er unter Disziplin verstand und dass er sich derselben auch als Feldherr unterwarf.
Auch die Hilfstruppen, die Auxilliartruppen, waren vorbereitet und standen in ihren Stellungen. Damit standen mehr als 20.000 Mann bereit für den Angriff. Zusätzlich zu den drei Legionen an der Grenze stand die vierte Legion aus Syria, die Zehnte Fretensis im Hinterland als Reserve.
Jetzt, im Frühjahr 58, nickte Nero in Rom. Die Zeichen standen günstig. Auch die Auguren hatten Günstiges gesehen. Durch Unruhen und Aufstände im eigenen Reich musste Vologaeses eigene parthische Truppen aus Armenia abziehen. Er konnte seinen Bruder nicht mehr unterstützen.
Kaum trafen die Berichte der Spione ein, gab Nero seinen Befehl. Armenia gehörte wieder unter römische Kontrolle.
Kaum erhielt Gnaeus Domitius Corbulo den Befehl, versetzte er alle seine Frontlegionen in Alarmbereitschaft. Verdeckte Späher schwärmten tiefer ins Feindesland und erkundeten günstige Ziele und Truppenansammlungen der Armenier.
Dabei ergab sich ein erster Zwischenfall, beinahe ein Desaster und damit böses Vorzeichen für die Truppe. Paccius Orfitus, ein ehemaliger Primus Pilus, ein Führer der ersten Kohorte der ersten Zenturie einer Legion, ein hochangesehener Posten, unternahm mit einer kleineren Truppe einen Raubzug. ‚Abducet praedam, qui occurit prior (deutsch: Die Beute nimmt, wer früher kommt)‘, galt als Wort bei den Legionären. Und Orfitus war gierig. Sein schlampiges Vorgehen beim Plündern eines Dorfes brachte ihm zwar Beute, rief aber auch ein nahes und überlegenes Truppenkontingent des Feindes auf den Plan. Er hatte dessen Lager schlicht übersehen beim Erkunden. Orfitus‘ eiliger Rückzug glich einer Flucht. Er verlor dabei einen Teil seiner Männer, bevor er die rettenden Stellungen erreichte.
Dort hatte Corbulo zu tun, um die restlichen Truppen an einer Panik zu hindern. Die verzweifelte Flucht mit weggeworfenen Waffen, panischen Schreien und geschlagenen Wunden ließen die Reihen an der Grenze wanken. Einige Soldaten dort machten schon den Schritt nach hinten, um sich anzuschließen. Vorgesetzte hieben mit Stöcken auf sie ein und brachten sie zum Stehen. Der Krieg hatte noch nicht richtig angefangen und schon eine fast vernichtende Niederlage? Das schlug schwer auf die Kampfmoral. Corbulo musste hart durchgreifen.
Ein Teil der Kommandeure unter Orfitus und der selber wurden vor der Truppe hingerichtet. Die restlichen wurden degradiert. Und die überlebenden Soldaten aus Orfitus‘ Truppe wurden dezimiert. Auch wenn es nicht wirklich viele waren, das Aussprechen der Decimatio, der Dezimierung, war eine seltene und sehr harte Strafe bei den römischen Truppen. Per Los wurde einer von zehn Legionären gewählt und von den eigenen Kameraden, von den neun ‚Glücklichen‘ getötet.
Die Strafe sprach sich in Windeseile in den Kastellen herum. Es motivierte die Truppen, die folgenden Gegenangriffe blutig zurückzuschlagen. Das waren die Erfolge, die Corbulo für die Moral der Truppe brauchte. Jeder neue Sieg beflügelte und stärkte die Männer.
Er wartete noch eine Woche, bevor er seine Befehle gab. Dann wusste er, wo sich der Feind zentrierte und er konnte zuschlagen. Ein toter Krieger kann nicht verteidigen und auf der Flucht zerstreute Feinde brauchten Zeit zum Sammeln. Und die würde er ihnen nicht lassen. Den Feind unter Druck setzen und halten, war sein Plan. Wer Zeit bekam, konnte planen. Wer diese nicht hatte, lief weiter in der Hoffnung, sie irgendwann zu bekommen.
Einer der vielen Späher war Marcus Septimus. Er war ein Söldner und hatte sich mit seinen Gefährten den Römern verdingt. Seinen Auftrag hatte er direkt von Corbulo bekommen. Der Römer mochte den Söldner. Er hatte seinen Werdegang verfolgt und die Zuverlässigkeit erprobt. Für den Feldherrn war er einer seiner Besten.
Eine Zeitlang hatte er in Ägypten und Nubien gedient. ‚Öffner der Wege‘ hatte man ihn dort genannt, weil er Räuberbanden fand und vernichtete. Er hatte die Karawanenwege gesäubert.
Auch hier war er mit seiner kleinen Gruppe unterwegs. Vier Männer folgten ihm. Marcus bezahlte sie. Er vertraute ihnen. Vier Männer, die sich seit Jahren kannten, die Schweiß, Blut, Hunger und Siege geteilt hatten. Vier Männer, die wie einer denken und handeln konnten. Jeder von ihnen war ein hervorragender Kämpfer, perfekt ausgebildet an Speer, Bogen, Dolch und Schwert. Jeder von ihnen beherrschte den lautlosen Kampf.
Und sie sprachen die Landessprache. Marcus hatte einen Lehrer in den letzten beiden Jahren angeheuert und seine kleine Truppe hatte lernen müssen, wenn sie nicht unterwegs waren.
Momentan waren es keine tiefen Vorstöße. Es ging um die feindlichen Grenztruppen und -befestigungen. Sie waren der erste Schritt. Dann kam das Hinterland. Es waren kleine Gefechte und Stiche. Corbulo erhoffte sich, dass er Tiridates zur Feldschlacht zwingen konnte. In drei Säulen rückte er vor. Er hoffte, dass der armenische König versuchen würde, die kleinen römischen Truppenteile anzugreifen. Männer wie Marcus sollten das Hinterland beobachten. Dann wäre Tiridates der böse Überraschte, wenn er es mit drei Legionen statt wenigen Männern zu tun bekam. Corbulo verfügte über mehr als 15000 Soldaten plus einigen tausend Mann als Hilfstruppen, Reiterei, Belagerungswaffen und mehr.
Doch Tiridates stellte sich nicht zum Kampf. Also entschied Corbulo, den Kampf zu Tiridates zu tragen. Ruhig und in breiter Formation marschierten die drei Legionen auf Atraxarta, der Hauptstadt Nordarmeniens zu. Seine Erkunder sorgten für gute Wege, Versorgungspunkte, die geplündert werden konnten und den eigenen Nachschub wenig notwendig gestalteten. ‚Ernähre dich aus dem Land, solange es geht‘ war eine bekannte Soldatenweisheit. ‚Nimm es, bevor es ein anderer macht‘ galt genauso. So mehrte sich auch so manches persönliche Gepäck der Soldaten. Darüber sah Corbulo hinweg. Im Gegenteil hielten solche ‚Gewinne‘ die Moral der Truppe trotz eintöniger Kost und kalten Nächten hoch.
Jeden Tag wechselten berittene Boten zwischen den Truppenteilen. Beim Feldherrn liefen die Fäden zusammen. Er koordinierte die kleinen Überfälle auf umliegende Orte und Höfe. Eine breite Schneise der Verwüstung kennzeichnete seine Route. Und er wartete auf seinen Gegner. Doch der kam nicht.
Armenia, halbe Strecke bis zur nördlichen Hauptstadt Artaxata
Es war eine mondlose Nacht. Nur Sternlicht vom wolkenlosen Himmel erhellten schwach den Boden. Das Land war hügelig und nur von Steppengras bedeckt. Einige kleine Baumgruppen mit niedrigen Bäumen unterbrachen die Eintönigkeit. Und da war die eine Stelle, wo der Boden einen ganz schwachen rötlichen Schimmer hatte.
Der Reiter zügelte sein Pferd und hob die rechte Hand für einen Moment. Hinter ihm verstummten die Huftritte seiner vier Gefährten. Die erhobene Hand sank tiefer und deutete auf den schwachen Lichtschein. Ohne einen weiteren Befehl stiegen die fünf Reiter ab. Auf einen Wink des Anführers übergab einer seine Zügel dem Nachbarn und lief im Dauerlauf in die Richtung. Die anderen führten ihre Tiere zu einer nahen Buschgruppe. Dort befestigten sie die Zügel an einige Ästen. Alle prüften den Sitz ihrer Waffen. Kein Wort fiel. Doch sie verteilten sich und beobachteten das gesamte Umland. Eine Überraschung konnten sie nicht gebrauchen. Dann warteten sie.
Nach einer ganzen Weile sahen sie den losgeschickten Mann zurückkommen. Ohne das beobachten einzustellen, versammelten sie sich bei dem Rückkehrer.
„Was hast du gesehen, Mirkan?“ fragte der Anführer.
Er war schlank und hochgewachsen. Wie alle anderen auch trug er grobe wollene Kleidung in Erdfarben, überwiegend braun. Das Ganze bestand aus Hose und einer Art Hemd, über die noch eine Jacke gezogen war. Abgerundet wurde es durch eine Wollkappe und knöchelhohe Lederschuhe, die mit Riemen an den Füßen befestigt waren. Alles wirkte ungepflegt und schmutzig. Und alle Männer waren Ende 20 vom Alter her. Abgesehen von den struppigen Pferden wirkten sie wie Bauern oder Hirten. Niemand sah ihnen an, dass sie unter der groben Wolle noch lederne Bekleidung trugen, die an einigen Stellen mit Metallstreifen als Schutz verstärkt waren. Auch unter den Wollkappen war eine weitere aus dickem wattiertem Leder verborgen.
Der Angesprochene war von etwas dunklerer Hautfarbe und kurze schwarze Haare hingen unter seiner Kappe hervor. Trotz seines Dauerlaufes wirkte er nicht erschöpft.
„Reiter, die lagern. Leichte Berittene, Bogenschützen und Lanzen. Ich schätze so um die 200 Mann nach der Anzahl an Zelten und Pferden. Sie haben Zelte aufgebaut. Allzu viele saßen nicht mehr an den Feuern.
Das Ganze ist eine Senke mit einem Wasserloch, einem kleinen Teich. Wird einige Tage reichen. Linker Hand sind es etwa 50 Zelte, eines etwas größer mit einer Standarte davor. Wahrscheinlich der Befehlshaber. Dann brennen ein halbes Dutzend Lagerfeuer. Und rechts, etwas abseits ist eine Pferdekoppel aus Seilen mit den ganzen Tieren. Dort stehen auch fünf Wagen für Lasten, wahrscheinlich Nahrung und die Zelte. Aber dort stehen auch 20 Streitwagen.
Um das Lager läuft ein Doppelposten und bei den Pferden habe ich drei Mann gesehen, Marcus.“
„Gute Arbeit, Mirkan. Du bist der Beste.“
„Danke.“
Während Marcus in brütendes Schweigen versank, holte sich Mirkan seine Feldflasche und trank einige Schlucke.
„Streitwagen, he? Das scheint eine nette Truppe zu sein“, murmelte ein Dritter. Auffallend waren seine blauen Augen, trotz der Dunkelheit.
„Du hast Recht, Brutus. 200 berittene Bogenschützen und 20 Streitwagen können Legionären zu Fuß den Tag versauen. Dauernde Pfeilsalven fordern Verluste. Vielleicht nicht viel bei jedem Angriff und auch nicht immer Tote. Aber wie stark ist die Truppe an dem Abend noch. Nimm nur einen Verletzten pro Angriff. Dann sind das … 20, 30 oder mehr Männer, die nicht mehr kämpfen können. Dazu die geringere Marschleistung, weil sie dauernd einen Schildwall bilden müssen. Und Tiridates lehnt sich entspannt zurück und sammelt seine Truppen.“
„Willst du Verstärkung anfordern, Marcus? Zusätzliche Reiterei zum Schutz der Kohorten?“
Die Frage kam von einem Mann mit breiten Schultern. Auffallend bei ihm waren die blonden Haarspitzen unter seiner Wollmütze neben den blauen Augen. Der Mann stammt nicht aus dieser Gegend, sondern weit aus dem Nordwesten des Imperium Romanum.
„Warum, Tormus? Es sind doch nur 200 Feinde.“
Leises Lachen antwortete auf diese lässige Feststellung. Auch Marcus grinste. Es war keine wilde Übertreibung bei fünf gegen 200. Jeder von ihnen hätte einen ähnlichen Satz bringen können. Sie alle hatte wegen ihrem langjährigen Zusammensein auch schon eine Ahnung, warum Marcus diese Aussage traf. Ein offener Kampf war natürlich illusorisch. Aber … ihre Gegner waren Reiter. Und was war ein Reiter wert, wenn er kein Pferd hat? Was nutzen Streitwagen ohne Zugtiere? Und wie sollen diese Truppen die Römer behindern, wenn sie erst ihre Tiere einfangen müssen? Wie also konnten fünf Männer 200 Feinde zumindest behindern?
„Ich denke, heute ist eine gute Nacht für Pferdediebe.“
Wieder kam ein leises Kichern als Antwort auf Marcus‘ Entscheidung. Alle blickten kurz zu Mirkan, der breit grinsend seine Schultern zuckte. Seine frühere Profession war allen bekannt. Sekunden später prüfte jeder bereits, ob er hatte, was er wahrscheinlich benötigte, und ob Utensilien am Körper klappern konnten. Und dann waren sie unterwegs. 50 Schritt vor ihnen lief Mirkan. Er kannte das Ziel und er kannte, zumindest grob, den Weg der Wächter. Hinter ihm liefen die anderen, alle in einer Reihe. So würden sie nur eine schmale Spur im Gras hinterlassen, eine, die eher übersehen werden konnte.
Eine Weile später blickten fünf Augenpaare in das Lager hinunter. Die Männer lagen oben auf der Hügelkuppe und hatten sich auf dem Bauch vorgeschoben. Was sie sahen, passte ihnen gut in ihren Plan. Die Feuer waren bereits heruntergebrannt. Alle Armenier schienen zu schlafen, einige an den Feuern, die meisten in den Zelten. Bewegung kam nur von den zwei Männern, die auf halber Hanghöhe patrouillierten. Zwei weitere Männer waren im Sternenlicht hinter der Pferdekoppel zu sehen. Einzeln gingen sie am Seil entlang, begegneten sich, drehten sich und marschierten zurück. Und auch bei den Wagen blitzte immer wieder ein Helm auf.
Die fünf Beobachter tauschten Blicke. Sie dachten wieder alle dasselbe. Idioten. Zwei Mann oben auf der Kuppe sehen viel weiter. Liegen sie, werden sie nicht gesehen.
Mit wenigen Gesten gab Marcus seine Befehle. Er teilte ein, wer wen übernehmen sollte. An die Doppelpatrouille kamen sie schlecht heran. Da war zu viel freies Gelände. Also kümmerten sie sich nur um die Pferde. Tormus folgte Marcus, als sie fast ganz am Boden um die Patrouille herumkrochen. Ihr Ziel waren die Wagen. Die anderen drei würden sich um die Pferdewächter kümmern.
Auf halber Strecke pressten sich alle bewegungslos auf den Boden. Der Soldat bei den Wagen löste sich aus seinem Schatten und ging zu den nur noch schwach brennenden Feuern. Dort stieß er einige Männer an. Murrend erhoben sich diese. Wachwechsel. Die Aufgeweckten sammelten ihre Ausrüstung ein und lösten dann die Männer am Hang und bei den Pferden ab. Keiner kam den bewegungslos Liegenden zu nahe.
Die blieben weiter nur liegen, bis sie vermuten konnten, dass die abgelösten Soldaten in ihren Zelten wohl auch schliefen. Erst dann krochen sie wie Schatten weiter. Eine Zeit später lagen Marcus und Tormus bei den Wagen. Zwischen den Rädern hindurch sahen sie die Beine des Postens, der wohl die beiden anderen Wächter bei den Pferden beobachtete.
Dann zirpte eine Grille zweimal hintereinander. Aus einer anderen Richtung echote eine zweite Grille. Marcus sah Tormus an. Beide nickten kurz. Ihre Freunde waren in Position. Beide Männer erhoben sich und schlichen um beide Seiten des Wagens. Während Tormus lautlos handelte, machte Marcus Geräusche. Er wollte gehört werden.
Als er um den Wagen kam, hatte sich, wie erwartet, der Wächter ihm zugewandt und seine Lanze halb gesenkt.
„Wer bist du?“ stieß er hervor.
Der Soldat wurde nicht laut. Er wollte niemanden wecken, denn immerhin kam der Unbekannte ja vom Lager. Aber er hatte hier nichts zu suchen.
„Ich bin Mirko, der Wagenknecht“, erwiderte Marcus auf Armenisch.
Dafür hatten sie die Sprache gelernt.
„Bitte entschuldigt, Herr“, gab sich Marcus unterwürfig, „ich habe meinen Wasserschlauch im Wagen vergessen.“
„Wasser gibt es im Lager. Scher dich fort.“
„Ja, Herr. Aber … ich würde gern meinen Schlauch … Ich mag das Wasser dort … es schmeckt besser.“
Der Soldat braucht nicht lange, um zu verstehen, was der Knecht meinte. Das war ein … spezielles Wasser. Garantiert würde es von innen heraus wärmen.
„So, besser soll es schmecken. Gut, hole ihn. Aber nur, wenn ich einen Schluck probieren kann.“
„Aber, Herr?“
Mit jedem Satz war Marcus nähergekommen. Auch Tormus hatte sich um den Wagen geschoben. Als sich der Wachposten entspannte und sich schon die Lippen erwartungsvoll leckte, packten sie zu. Marcus umklammerte die Handgelenke des Wächters, während Tormus seine großen Hände um den Hals des Mannes legte und zudrückte. Die Augen des Mannes waren weit aufgerissen, aber nicht ein Laut kam aus seinem Mund. Er riss verzweifelt an Marcus Griff, aber der ließ nicht los. Und Sekunden später erstarben die Bewegungen. Doch beide gingen auf Sicherheit und hielten ihn weiter, bevor sie den Toten sanft auf den Boden legten.
Dieses Mal war es Marcus, der dreimal wie eine Grille zirpte. Erfreut hörten beide Männer zwei andere Grillen ebenso oft zirpen. Alles war bisher gutgegangen. Die Wächter waren erledigt.
Während sie auf die Kameraden warteten, schauten sie über die Wagenränder. Das Sternenlicht war hell genug, um ihnen bestimmte Beutel zu zeigen. Sie enthielten Naphta, wie schon die Perser diese schwarze Flüssigkeit nannten, die an einigen Stellen aus der Erde trat. Die Römer kannten es als Steinöl. Es wurde für Lampen genutzt. Auch hier fanden sie etliche Ziegenbeutel mit der stinkenden Flüssigkeit.
Schnell huschten die Männer zu den Streitwagen und schütteten die Flüssigkeit darüber. Den letzten Beutel leerten sie wie eine Spur zurück zu den Transportwagen.
Kaum waren sie fertig, kamen die drei fehlenden Kameraden. Nur trug der eine noch eine andere Person über die Schulter.
„Was soll das, Brutus?“ zischte Marcus und deutete auf die Person.
Es war eine Frau und sie war gefesselt und geknebelt. Anscheinend war sie bewusstlos.
„Tut mir leid, Marcus,“ gab der Angesprochene leise zurück.
„Unterwegs sind wir über ein Liebespaar gestolpert. Ein Soldat vergnügte sich wohl mit der Lagerhure. Fast hätte er uns gesehen. Nun ist er tot. Die Frau musste ich niederschlagen. Übrigens, die Seile auf der anderen Seite sind kaputt.“
„Oh, verdammt. Konnte es denn nicht glatt gehen? Nun gut. Lege sie dort drüben ab, damit sie nicht in die Flammen gerät. Tormus, ich brauche fünf Stangen oder Speere. Wickele Tücher um die Spitzen und bringe sie her. Ihr anderen holt fünf Pferde hierher. Nur Zaumzeug. Los.“
Einige Minuten später waren alle wieder zusammen. Die Stäbe mit den Tüchern tauchten sie in die Ölpfütze. Marcus kniete nieder. Mit Feuerstein und seinen Dolch schlug er Funken. Und gleich darauf brannte die Pfütze. Das Feuer sprang über auf die Tücher. Hoch schlugen die ersten Flammen. Und das Feuer folgte schnell der Spur vergossenen Öls, bis es die Streitwagen erreichte. Kurz zögerten die Flammen, aber dann nahmen sie das ölgetränkte Holz an und mit lauter werdenden Geräuschen loderten die Flammen auf, fraßen sich durch das Holz und sprangen über zum benachbarten Wagen. Funken stieben in die Höhe.
Sofort mit den ersten Flämmchen sprang Marcus auf und schwang sich auf das bereitgehaltene Pferd. Die Tiere wurde nervös, als sie das Feuer sahen und Rauch rochen. Schnell zogen die fünf Männer ihre Tiere herum und verteilten sich entlang der Koppel. Mit den Stangen und den daran hängenden brennenden Tüchern, zusammen mit schrillen Schreien trieben sie die Pferdeherde vor sich her in die Nacht. Im Galopp versuchten die Pferde der Bedrohung durch das Feuer zu entkommen. Doch die brennenden Tücher direkt hinter ihnen schürten die Panik. 800 Hufe donnerten über die Steppe und brachten den Boden zum Erzittern. Und die Männer trieben sie weiter. Unterwegs holten sie noch ihre eigenen Pferde.
Einen Tag später trieben sie immer noch einiges über hundert Pferde in das römische Lager. Etliche Tiere waren seitlich weggelaufen, aber sie waren zu wenige gewesen, um die Herde zusammenzuhalten. Doch sie konnten zufrieden etwa 140 Tiere übergeben, wie eine Zählung ergab.
„Wo hast du denn die Pferde her?“ lachte ein Tribun, der Marcus kannte.
Grinsend zuckte der die Schultern.
„Da draußen sind jetzt 200 Reiter ohne Pferde. Oder die 20 Streitwagen werden nun von ehemaligen Reitern gezogen. Oder sie sind Asche. Was ist dir lieber?“
Der Tribun stieß einen Pfiff aus. 200 Reiter. 20 Streitwagen. Er war beeindruckt, was Marcus wieder getan hatte. Kein Wunder, dass der Feldherr ihn als seinen besten Mann bezeichnet.
Während Marcus und seine Freunde sich einen Ruhetag gönnten, ging ein Bericht an den Feldherrn Corbulo. Truppenart und -stärke, ebenso wie der Ort waren für ihn wichtig. Denn er wartete auf seinen Gegenspieler. Wer die besten Informationen hatte, würde wahrscheinlich siegen, wenn es zum Kampf kam.
Etwa zur gleichen Zeit verließ ein anderer Bote das ehemalige Lager der Armenier in die entgegengesetzte Richtung. Der Befehlshaber gab einen schonungslosen Bericht. 15 Streitwagen waren zerstört. Drei Transportwagen waren auch verbrannt. Dazu der halbe Proviant. Fast alle Pferde waren weggetrieben worden. Man brachte nur noch ein Dutzend Reiter zusammen. Da fielen die vier toten Soldaten nicht ins Gewicht. Als einzige Entschuldigung stützte sich der Befehlshaber auf die Aussage einer Lagerhure, die gefesselt aufgefunden wurde. Sie war nicht lange genug bewusstlos gewesen, sondern habe sich nur so gestellt. Deswegen konnte sie einige Informationen liefern. Demnach wären es nur fünf Männer gewesen, die wie Schatten kamen und kämpften. Der Anführer solle Marcus heißen. Der Befehlshaber ergänzte, dass es eher fünfzig Männern gewesen seien. Als sie das Lager angriffen, konnten sie zurückgeschlagen werden und flohen mit den Pferden. So umschrieb er, dass durch das Feuer alle erwachten und wild durcheinanderliefen. Und so versuchte er, seinen Kopf zu retten. Vergeblich.
Tirdates schickte Kopien an alle seine noch nicht vereinten Truppen und auch an die Befestigungen auf dem Weg der Römer. Dort war nur von Kriegern, die wie Schatten kämpften die Rede. Der armenische König, der Bruder des parthischen Herrschers, hatte schon verstanden, was ihm gemeldet worden war. Der Befehlshaber erhielt seine Strafe für die Lügen und seine Unfähigkeit. Ein Nachfolger ersetzte den Toten.
Und eine dieser Kopien erreicht die Befestigung Volandum, das letzte größere Bollwerk vor der Hauptstadt Artaxata.
Römisches Feldlager, wenige Tagesmärsche vor der armenischen Befestigung Volandum
Nach den ersten Wochen des Vormarsches erweiterte Corbulo seinen Befehl. Ab jetzt herrschte ‚Verbrannte Erde‘. Dörfer und Gehöfte bekamen das Angebot, die Waffen abzugeben und sich zu ergeben. Wenn sie das befolgten, durften die Bewohner mit dem, was sie tragen konnten, abziehen. Vieh, Nahrung und Brauchbares wurde der Truppe zugeführt. Alles andere wurde verbrannt. Kein Haus, keine Nahrung sollte dem Feind bleiben. Felder wurden verwüstet, nicht brauchbares Vieh getötet. Die Bevölkerung und deren Anführer sollten lernen, was es hieß, sich gegen Rom zu wenden. Gab es allerdings Widerstand, dann lautete der Befehl auf ‚keine Überlebenden‘ als Strafmaßnahme. Und ‚keine‘ meinte Cordulo absolut wörtlich, als er es seinen Truppenkommandeuren und auch den Spähern erklärte.
Es war ein Befehl, der Marcus Septimus böse aufstieß. Er führte Krieg. Männer waren Gegner. Wer sich wehrte, konnte sterben. Konnte. Der Bessere, Glücklichere überlebte. Das war der Lauf der Welt. Aber Frauen, Kinder und Alte? Dass Frauen und Kinder in die Sklaverei geführt wurden, war auch normal in seiner Welt. Aber wenn ein Idiot zum Messer griff, sollten deswegen alle umgebracht werden? Alle? Ausnahmslos? Dieser Befehl bedeutete Massaker. Das war ohne Ehre.
Seine Männer dachten ähnlich. Zwar war ihre Aufgabe das Spähen, aber sie waren oft die Ersten bei Gehöften. Dörfer umgingen sie und meldeten das Gesehene der nachfolgenden Truppe. Einzelne Bauernhöfe nahmen sie selber ein. Sie entwaffneten die Bewohner und schickten sie fort. Dann brannten die Häuser.
Corbulo runzelte die Stirn, wenn er die Berichte von Marcus las. Meist waren die Bewohner mit ihrem Vieh verschwunden. Aber er sagte nichts. Denn er konnte Marcus‘ Begründung, er könne nicht warten, bis jemand kam und das Vieh übernahm, verstehen. Und er verstand Marcus besser, als der vermutete. Manchmal musste ein Feldherr grausam sein, um zu siegen.
Langsam näherte sich die römische Truppe der Hauptstadt Artaxarta. Es trafen auch Meldungen ein, dass Tiridates ein Heer zusammenzog, um die Hauptstadt zu schützen. Doch die Meldungen besagten, dass er langsam marschierte und weitere Truppen erwartete.
Der römische Feldherr sah es mit Sorge. Zwar hatte er während der Ausbildung seiner Truppen immer wieder ein Verhalten auf das sogenannte ‚Parthische Manöver‘ geübt, aber er war sich nicht sicher, ob sich die Kommandeure daran halten würden.
Das Parthische Manöver bestand aus dem Angriff leichter Reiterei, bewaffnet mit Bögen. Sie schossen Pfeilhagel ab, gingen aber nicht in den Nahkampf, sondern drehten vorher ab. Die Gegenseite wertete es als Sieg und Flucht und ging zur Verfolgung über. Das zersplitterte die Truppe und die nun kleineren Verbände wurden einzeln aufgerieben. Crassus hatte die Erfahrung gemacht und auch Markus Antonius hatte es missachtet. Die Folge waren vernichtende Niederlagen gewesen. Vernichtend für Rom. Corbulo wollte siegen.
Also musste er Tiridates provozieren. Es gab einige stärker befestigte Stützpunkte zwischen ihm und der Hauptstadt. Befestigungsmauern und Kasernen waren Hindernisse, die seinen Vormarsch bremsen und ihm Verluste zufügen konnten. Er konnte sie auch nicht umgehen, denn dann war der Feind in seinem Rücken und unterband den Nachschub oder schuf eine zweite Front. Corbulo nahm die drei Befestigungsanlagen ins Visier, die auf seinem Weg lagen. Der Auftrag erging an seine Späher, diese Befestigungen auszukundschaften.
Marcus Septimus, seinem besten Mann, wurde Volandum, der größten der drei Befestigungen, zugeteilt. Allerdings ging ein heftiger Streit zwischen den beiden Männern einher. Sie kannten sich lange und respektierten sich. So wie Marcus im Feldherrn den überlegenen Strategen sah, so wusste der im Gegenzug die Qualitäten des anderen bei Spionage und Kampf zu würdigen.
Marcus hatte mitbekommen, wie die erste Befestigung genommen, verbrannt und geschleift worden war. Und er hatte gesehen, wie man alle Einwohner getötet hatte. Es gab nicht einen Überlebenden. Es war eine grausame Arbeit gewesen. Selbst die Legionäre waren schweigend mit der gemachten Beute abgezogen.
„Das könnt ihr nicht machen“, sagte Marcus mit fassungsloser Miene.
Der Feldherr hatte ihm seine Aufgabe genannt. Er hatte drei Tage Zeit, Volandum auszuspähen. Wenn möglich, sollte er die Tore öffnen oder Sabotage betreiben.
„Doch“, erwiderte der Feldherr, „Tiridates muss zum Angriff gezwungen werden. Das ist Punkt eins. Item secundum: wenn du dich einmal mit Crassus beschäftigt hättest, dann wirst du lernen, dass er den Fehler beging und in jeder genommenen Stadt eine Besatzung zurückließ. Zwar grundsätzlich nicht verkehrt, aber sein Gegner nahm diese Städte wieder und vernichtete die kleineren Besatzungen nacheinander ohne große eigene Verluste. Fazit: weniger Truppen bei Crassus.
Tertius: ich kann mir diesen Fehler nicht erlauben. Dafür habe ich zu wenig Truppen. Es ist zu viel Feindesland um mich herum. Wenn wir abgeschnitten werden, sind wir verloren. Verstehst du? Ich darf nicht warten, bis Tiridates zu stark geworden ist oder Verstärkungen bekommen hat. Es gibt Gerüchte, dass er in einigen Wochen weitere parthische Verbände bekommt. Mögen es Gerüchte bleiben, aber es muss jetzt sein. Ich kann auch nicht erlauben, dass in meinem Rücken Befestigungen sind, die der Feind wieder besetzen kann. Also werden die Städte dem Erdboden gleichgemacht.“
Marcus brütete über den Befehl. Verweigern konnte er ihn nicht, denn er war angeworben worden. Und aus strategischer Sicht hatte der Feldherr nicht unrecht.
„Gut, ich stehe in meinem Wort.“
Der Feldherr atmete aus. Seinen besten Mann wegen Fahnenflucht oder Feigheit hinzurichten, hätte ihn geschmerzt und die Moral der Truppe gefährdet.
„Aber …“, fuhr Marcus mit harter Stimme fort, „aber nach Volandum werde ich mit meinen Männern gehen. Dies ist unser letzter Auftrag.“
„Gut“, nickte der Feldherr.
„Und wir werden Beute anstatt unserem Sold in Volandum nehmen.“
„Gut“, sagte der Feldherr ein zweites Mal.
„Niemand wird uns wegen der Beute behelligen.“
„Gut“, kam ein drittes Mal die Zustimmung.
„Diese Beute kann auch Sklaven beinhalten.“
Damit ging Marcus gegen die Anweisung von Corbulo an … keine Überlebenden. Diesmal schwieg der Feldherr. Beide Männer wechselten harte Blicke. Ansichten und Wünsche kämpften in den Blicken miteinander. Dann zog sich der Feldherr ein Papier heran und schrieb einige Worte. Das Dokument schob er Marcus hin, nachdem er es gesiegelt hatte. Als der danach griff, legte Corbulo seine Hand darauf.
„Es ist die Genehmigung. Ich gewähre es dir in Anerkennung deiner bisherigen Dienste.
Aber … du hast deine Forderungen genannt … nur höre meine. Ihr werdet Armenia verlassen. Und ihr werdet Cappadocia verlassen. Dein Aufenthalt ist nicht länger erwünscht, weil du mitten im Feldzug gehst. Denn du kannst der Beweis für meine Schwäche sein. Du wirst mir schwören, dass du deine lebende Beute nie verkaufst. Mein Befehl lautet keine Überlebende. Ich kann den Befehl beugen. Du wirst nur Sklavinnen nehmen, keine männlichen Sklaven. Egal welchen Alters. Eine Sklavin ist eine Sache. Aber ich will keine Überlebenden in der Gegend haben. Vor allem nicht hinterher.“
Dieses Mal dachte Marcus länger nach. Dann leistete er seinen Schwur.
Volandum, befestigte Stadt, Lager und Fürstenwohnsitz,
etwa zur selben Zeit:
„Was hast du dir dabei gedacht?“ schrie Tirza.
Tirza war die 18jährige Tochter des Stadtfürsten Meandoras von Volandum. Ihre offenen hüftlangen schwarzen Haare wehten, während sie durch den Raum stapfte und wild mit den Armen ruderte. Ihr schlanker Körper war mit einer ledernen Weste über dem Leinenkleid bedeckt. Alles war in den Farben Rot und Blau gehalten und reich verziert und mit Goldfäden durchwirkt. An ihren breiten geflochtenen Ledergürtel hing ein kurzer, relativ schlichter Dolch in einer Lederscheide. Man sah der jungen Frau ihren Reichtum und die Stellung an Ihre Haare wurden zusätzlich noch mit einem schmalen silbernen Reif, besetzt mit einigen Edelsteinen, gehalten. Auch die Lederstiefel, die ihr bis zu den Unterschenkeln reichten, war fein gearbeitet und verziert. Ihre grauen Augen blitzten.
Ihr gegenüber saß ihr Vater hinter seinem Arbeitstisch. Ausgebreitete Karten und Berichte zeugten von seiner Arbeit. Die schwarzen Haare zeigten keine grauen Spitzen, auch wenn die Furchen in seinem Gesicht vom Alter des Mannes sprachen. Seine Kleidung war eine Mischung aus Tunika, Wollhose und knöchelbedeckenden Schuhen. An seinem breiten Ledergürtel, mit Metallmedaillons verziert, hing ein kunstvoller Dolch in einer goldenen Scheide, geschmückt mit einigen kleinen Edelsteinen.
Draußen auf dem Gang neben der Tür standen zwei Krieger, bewaffnet mit Speer und Schwert, gerüstet mit einem Schuppenpanzer als Schutz von Brust und Hüfte. Ein unmerkliches Zucken der Mundwinkel durchbrach die stoische Ruhe der Gestalten.
Man kannte die Tochter des Stadtfürsten. Man wusste, dass er nachsichtig mit ihr war. Sehr nachsichtig. Zu nachsichtig, wie einige fanden. Die Krieger allerdings wussten, dass die Tochter sich selber hart trainierte und die Waffen beherrschte wie manch älterer Kämpfer. Lange hatte es so ausgesehen, als ob der Fürst keinen Sohn bekommen würde. Als er kam, verlor der Fürst bei der Geburt seine Frau. Das war jetzt zehn Jahre her. Seitdem hatte der Fürst nicht mehr geheiratet, aber er nahm sich einige Sklavinnen. Doch seine Tochter zähmte er nicht.
„Was willst du, Tirza? Es ist der Befehl des Königs.“
„Ich weiß. Aber die Römer kommen. Wir brauchen unsere Männer hier.“
„Du verstehst es nicht Tirza. Der König sammelt die Truppen. Die Römer sind weit weg von ihrem Land. Sie verlieren laufend Männer. Noch bevor sie die Hauptstadt erreichen, werden sie vernichtend geschlagen. Und auf der Flucht werden weitere sterben. Dafür sorgen unsere Reiter und die Gepanzerten. Kein Römer wird zurückkehren.“
„Aber sie werden Volandum zerstören.“
„Nein, meine Tochter. Noch habe ich hundert Soldaten. Es gibt Männer, die ich zu den Waffen verpflichte. Die Mauern sind drei Mannslängen hoch und fest. Wir haben genügend Pfeile und Waffen. Die Lager sind voll. Sollen sie kommen. Wir werden sie zurückschlagen. Belagern können sie uns nicht. Und der König kommt bald zu unserer Unterstützung. Die Römer, die hier gegen uns siegen wollen, können nicht gleichzeitig gegen den König kämpfen. Allein deswegen habe ich dem König auf seinen Befehl hin unsere 200 leichten Reiter, die hundert Gepanzerten und 300 Fußkämpfer geschickt. Der König wird vernichtend über die anmaßenden Römer kommen.“
„Aber …“
„Schluss“, nahm die Stimme des Stadtfürsten an Kraft zu und er schlug die flache Hand auf den Tisch.
„Ahhhh.“
Die junge Frau schrie die Wand an, während sie hilflos die Arme hochwarf. Dann rannte sie aus dem Raum.
Beinahe rannte sie einen weiteren Soldaten um, der gerade den Raum betreten wollte und gerade noch auswich. Kopfschüttelnd sah der etwas ältere Mann der jungen Frau nach. Dann betrat er das Arbeitszimmer. Respektvoll verneigte er sich.
„Was bringst du für Nachrichten, Sigonides?“
Der Stadtfürst lehnte sich zurück und betrachtete wohlwollend den älteren Soldaten. Eine Handbewegung wies auf einen Scherenstuhl und einen noch leeren Pokal neben einem Weinkrug. Der Brustpanzer des Neuankömmlings wies eine Reihe goldener Schuppen auf und kennzeichnete ihn als Kommandeur. Sigonides war der Oberbefehlshaber der Soldaten in dieser Befestigung.
„Schlechte Neuigkeiten, Herr. Unsere Späher haben gemeldet, dass Kagavan und Dzarehavan zerstört wurden. Nur noch wir stehen zwischen dem Feind und Artaxarta. Eine ganze Legion rückt auf uns vor. In drei Tagen, spätestens, sind sie hier.“
Mehr musste der Mann nicht sagen. Beide wussten, dass mehr als 5000 Römer nicht von 100 Kriegern aufgehalten werden konnten. Selbst wenn etliche Zivilisten halfen.
„Was noch?“ fragte Meandoras leise.
Er hatte dem Gegenüber angesehen, dass da noch etwas war. Und es schien schlimm zu sein, denn sonst hätte er es schon gesagt.
„Die Späher sagen außerdem, die verdammten Römer haben in beiden Befestigungen niemanden am Leben gelassen. Weder Mann noch Frau, weder Säugling noch Greis. Nicht einmal Sklaven.“
Erschüttert schloss der Stadtfürst die Augen. Was vor kurzem noch als Drohung geklungen hatte, wurde nun Tatsache. Lange dachte er nach. Weglaufen konnte er nicht. Er musste den Vormarsch der Römer verzögern. Auch, wenn es sein Leben kostete. Aber konnte er die Zivilisten der Vernichtung ausliefern? Sollte er seine Familie, seinen Sohn und die Tochter, wegschicken?
„Höre, Sigonides, meinen Befehl.
Nimm zehn Krieger, belade Wagen mit Nahrung. Nimm die Schwachen, Kinder, Alten und Frauen. Führe sie nach Artaxarta in Sicherheit. Bewaffne alle Bürger und auch die Sklaven. Wer mit uns kämpft, wird nach der Vernichtung der Römer freigelassen.“
Der Soldat nickte und wollte bereits aufstehen, als ihn eine Handbewegung des Fürsten stoppte.
„Aber aus diesem Haus wird niemand gehen. Es soll niemand sagen, ich habe an mich zuerst gedacht.“
Er wusste, dass er damit alle Bewohner seines Hauses zum Tode verurteilte. Er wusste aber auch, wie Tiridates, der König, mit denen verfuhr, die sein Missfallen erregt hatten. Gerade jetzt war jede Form von möglicher Feigheit großes Missfallen.
„Ich gehorche, Herr.“
Damit erhob sich der Soldat und ging hinaus. Auch ihn drückte die Frage, welche Krieger er retten sollte durch den Auftrag.
Marcus Septimus, später Nachmittag:
Mit seinem struppigen braunen Pferd ritt Marcus in das versteckte Lager seiner Truppe. Bis auf den Wächter oben am Hang saßen alle um das kleine rauchlose Feuer. Ihr Lager hatten sie in einer Senke aufgeschlagen. Ein paar Bäume spendeten Schatten und eine bessere Pfütze bot den Pferden Trinkwasser an.
Erwartungsvoll blickten alle ihren Anführer an, während der von seinem Pferd abstieg. Immer noch schweigend band er sein Tier an die lange Leine und setzte sich zu den anderen. Unaufgefordert wurde ihm der Schlauch mit dem verdünnten Wein hingestreckt. Langsam nahm er einen tiefen Zug und spülte den Staub aus seiner Kehle. Dann nahm er einen zweiten Zug. Sein Blick glitt über seine Männer. Wie vor jedem Auftrag stellte er sich die Frage, wen er am Ende noch bei sich haben würde. Wer würde seine Reise in den Orcus angetreten haben?
Da war Tormus. Ein Germane. Blond mit blauen Augen. Hochgewachsen mit dicken Muskeln an Oberarmen und Beinen. Und ein geübter Kämpfer mit zwei Kurzschwertern. Kein Wunder als ehemaliger Gladiatorensklave. Marcus hatte ihn der Arena abgekauft und freigelassen.
Dann Brutus. Natürlich nicht verwandt mit Caesars Mörder, aber dafür häufiges Ziel von Spott. Kein Wunder bei den blauen Augen und den schwarzen Haaren. Immer glattrasiert, ein fast jugendliches Aussehen, beinahe eitel. Aber schnell wie eine Viper mit dem Dolch. Und genauso tödlich.
Mirkan. Hager, braune Haut, schwarze Augen und Haare. Der Syrer beherrschte seinen kurzen Bogen. Sein Schuss hatte noch jeden Vogel vom Himmel geholt, wenn er in Reichweite kam.
Der letzte war Crissos. Er war der schweigsamste der Gruppe. Kaum einmal verzog er seine Miene bei Späßen. Der drahtige kleinere Mann mit dem unscheinbaren Äußeren, den langweiligen braunen Haaren und Augen, war auch ein hervorragender Bogenschütze. Er stammte ursprünglich aus Brundisium in Süditalien und war nach Athena umgesiedelt. Momentan hatte er den Wächterposten oben am Hang inne. Er beobachtete das Umland auf Bewegungen.
Seine Männer stammten aus allen Teilen des Imperium Romanum. Alle hatten eine wilde Vergangenheit hinter sich. Brutus war kriminell gewesen. Ein Bandenmitglied, damals in Aquilea. Er hatte ihn überfallen wollen und war sein Freund geworden. Crissos hatte er in Athena aufgegabelt. Er hätte eine ‚Luftveränderung‘ gebraucht, wie er sagte. Tormus hatte er in Antiochia aus der Arena geholt und Mirkan hatte von ihnen in Egyptus gehört. Jetzt waren sie eine Gruppe. Jeder stand für jeden. Sie hatte viel erlebt und waren verschworen. Und das Marcus der Anführer war, hatten alle akzeptiert. Niemand machte ihm die Position streitig. Auch, weil er zwar der Anführer war, im Einsatz aber nicht besser als die anderen. Im Gegenteil ließ er auch den Besseren der Gruppe den Vorrang, wenn es sinnvoll war. Auch deswegen neidete ihm niemand den Posten, als Bindeglied zu dem römischen Feldherrn zu fungieren. Das Wort und das Langschwert waren seine Waffen.
„Volandum ist unsere nächste Aufgabe.“
Marcus‘ kurze Bemerkung ließ alle nicken. Die größere Befestigung war ihnen allen geläufig. Die Details würden sie noch erfahren. Was sie schweigen ließ, war aber der harte bittere Gesichtsausdruck ihres Anführers.
„Es ist unser letzter Auftrag in diesem Feldzug.“
Das hob eine Reihe von Augenbrauen. Immerhin war das tatsächliche Ende noch lange nicht abzusehen. Warum diese Entscheidung?
„Wenn ihr euch mehr erhofft habt, bitte. Ich entlasse euch nach Volandum aus meinen Diensten.
Aber ich habe genug. Ausspionieren ist richtig. Den Truppen die Tore öffnen, ist eine Herausforderung. Aber alle Bewohner zu massakrieren, ist eine Schande. Und das ist der Befehl. Keine Überlebenden, egal wer, egal wie alt. Wenn wir fertig sind, gibt es Volandum nicht mehr und auch niemanden, der dort gewohnt hat.“
Die Männer dachten schweigend über das Gesagte nach. Auch sie hatten plötzlich einen schalen Geschmack im Mund. Gekämpft und getötet hatten sie alle. Offen und aus dem Hinterhalt. Fair und unfair. Sie hatten gekämpft, um zu überleben. Mit allen Mitteln. Immer war ein ‚er oder ich‘ dahintergestanden. Doch es waren Bewaffnete gewesen, immer mit der Chance zu gewinnen. Aber so hatten sie sich ihre Ehre bewahrt.
Und sie verstanden, dass diese jetzt in Gefahr war. Sie wären nicht die Eroberer, sondern die Schlächter von Volandum. Das wäre eine Tat, der sie sich nie rühmen konnten. Es würde ihr Ansehen als gute Kämpfer beschmutzen. Stolze Krieger … stolz auf Können und Überleben … ja, das waren sie. Schlächter von Kindern und Greisen … das lehnten sie ab. Und genau das war nun ihr Auftrag? Auch sie wussten, dass es keine Alternative gab.
„Was noch? Ich gehe nicht davon aus, dass du geschwiegen hast“, fragte Brutus.
Er war am längsten mit Marcus zusammen. Und er ahnte, dass der noch etwas in der Hand hatte.
„Du hast Recht. Ich habe mit dem Feldherrn geredet. Er hat mir seine Gründe genannt. Ja, sie sind nicht aus Grausamkeit entstanden. Nein, jedenfalls nicht aus reiner Grausamkeit und Lust am Töten. Er will den Armenier zum Angriff provozieren, bevor der zu stark wird.“
Dazu konnten wieder alle ein leichtes Nicken produzieren. Die Strategie dahinter verstanden sie. Das Gemetzel stieß trotzdem wie Galle auf.
„Corbulo entlässt uns. Nachdem Volandum aufgehört hat zu existieren. Ich habe mit ihm gesprochen, meine Gründe genannt und einen Handel mit ihm getroffen. Wir dürfen Beute nehmen. Wir dürfen als einzige Ausnahme weibliche Sklaven nehmen. Zehn Sklavinnen sind mir genehmigt.“
Marcus stieß ein bitteres Lachen aus.
„Genehmigt“, spuckte er nochmals aus.
„Es wird also zehn Frauen geben, die überleben“, sinnierte Brutus leise.
Provokativ hob er beide Hände mit gespreizten Fingern und sah in die Runde.
„Zwei Handvoll. Von wievielen? Von hunderten? Vielleicht tausend Bewohner?“
Er wurde bitter und spuckte zur Seite aus.
„Zehn sind mehr als keiner“, äußerte Crissos leise.
Der Mann aus dem Süden Italias war bekannt für seine nüchterne Art. Wo immer er einen noch so winzigen Vorteil sah, nutzte er ihn.
„Du hast Recht, Crissos. Zehn sind mehr als niemand. Aber es bedeutet auch, dass wir die Götter sein dürfen und für zehn Frauen über Leben und Tod entscheiden. Du kennst die Arena, Tormus. Stellt euch folgendes vor: alle Frauen der Befestigung knien im Sand und der Henker steht hinter ihnen. Bei welcher macht ihr den Daumen hoch oder runter? Welche ist würdig weiterzuleben und welche nicht?“
Marcus ließ den Satz offen. Jeder verstand sein Bild. Zehn Leben klang viel. Natürlich. Aber sie mussten mit dem Bild im Herzen leben, dass sie eine Frau auswählten und viele, viele andere dafür dem Henker überließen. Keiner mochte das Bild. Es machte sie zu einer besonderen Art von Henkern.
Sie wussten auch, wenn Marcus nicht zugestimmt hätte, wären sie jetzt auf dem Weg zur eigenen Hinrichtung wegen Befehlsverweigerung. Das Bild gefiel noch weniger.
„Noch eines“, sagte Marcus.
„Wir haben drei Tage. Dann steht die Legion von den Toren.“
„Wie ist dein Plan?“ fragte Mirkan.
„Morgen früh ziehen wir näher ran. Dann sickern wir nach und nach als Flüchtlinge hinein. Immer einzeln. Versucht mit einer Gruppe anderer Flüchtlinge aufzutreten. Sagt, ihr hattet Höfe, weitab. Tormus färbt die Haare. Wo sind Depots? Wasser? Waffen? Wo können wir Feuer legen? Ihr kennt die Aufgaben. Wir treffen uns jede Nacht um Mitternacht am Marktplatz. Zwei offene Handflächen, wenn alles in Ordnung ist. Ansonsten erkundet jeder für sich.“
Alle nickten schweigend. Die Aufgabe war riesig. Die Last war erdrückend. Weitere Pläne konnten sie erst vor Ort machen. Jeder wusste, was er zu tun hatte und worauf es ankam.
Volandum
Vae victis
(lat.: Wehe den Besiegten)
Geht zurück auf einen Bericht des römischen Dichter Livius über den Keltenkönig Brennus, der Anfang des 4. Jahrhundert v.Chr. Rom plünderte.
Das Einsickern in die Befestigungsanlage gelang ohne große Schwierigkeiten. Viele kamen und viele gingen. Die meisten waren auf der Flucht. Entweder suchten sie hier Schutz oder sie flüchteten weiter, weil die Römer näherkamen.
So konnten Marcus und seine Gefährten selbst die eigenen struppigen Pferde in zwei verschiedenen Herbergen unterstellen. Dann schwärmten sie durch die Anlage. Sie war großzügig geplant. Besonders die jetzt fast leeren Kasernen und dazugehörige Stallungen nahmen viel Platz ein. Hinzu kamen drei große Kornspeicher und zwei Schuppen. Hier wurden normalerweise Vorräte gelagert. Die Spione merkten bald, dass nicht mehr allzu viel hier war.
Sie erfuhren, dass in den letzten Tagen zwei größere Transporte in die Hauptstadt geschickt worden waren. Und sie hörten, dass fast die ganzen Truppen zu einem Treffpunkt nahe der Hauptstadt geschickt worden waren. Nur noch knapp hundert erfahrene Krieger, Fußkämpfer, waren hier und besetzten die Mauern und die beiden Tore. Allerdings bekamen sie auch mit, wie einfache Bürger mit dem Bogen oder dem Speer ausgebildet wurden. Sogar Sklaven hatten Waffen bekommen. Mit den ganzen Bewohnern, den Händlern und mehr, kamen wieder einige zusammen. Es würde die Römer nicht hindern, die Befestigung zu nehmen … dafür wären es zu wenige und die meisten unerfahren … aber es konnte höhere Verluste bedeuten.