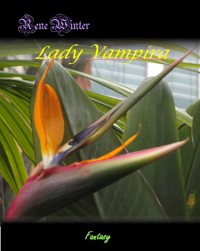2,99 €
Mehr erfahren.
Ben Howard ist Witwer. Trotzdem bleibt der Wunsch nach einem Erben bestehen. Heiraten oder sich verlieben will er aber nicht.
Monica Moraine hat Beziehungsängste. Durch ein traumatisches Erlebnis hat sie Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Deswegen lässt sie keine tiefere Beziehung zu.
Monicas Großvater Henry hat finanzielle Probleme. Sein Neffe Cedric hat einen Schuldschein, den er im ungünstigsten Moment präsentiert. Henry braucht eine halbe Million, um den Schuldschein zu begleichen. Aber die Banken geben ihm keinen Kredit mehr, weil er bereits über dem Limit ist.
Ben Howard sucht per Annonce für ein Jahr ein Frau, die ihm ein Kind schenken soll. Sein Kind. Monica will ihrem Großvater gegen Cedric helfen und bewirbt sich. Sie fordert aber die halbe Millionen und bietet dafür 3 Jahre. All inklusive – keine Einschränkungen.
Ben akzeptiert sie als seine Sklavin. Er fordert sie immer wieder aufs Neue und sie lernt vieles über sich kennen.
Cedric bekommt mit, dass Henry wegen ihrer Hilfe das Testament geändert hat und nun Monica zur Alleinerbin gemacht hat. Also muss er sie loswerden und entführt sie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sklaven-Deal
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenIntro
Ich erzähle eine Geschichte, keinen Tatsachenbericht.
Wegen der expliziten Beschreibungen ist sie für Leser (m/w/d) ab 18 Jahren geeignet.
Alle hier vorkommenden Personen sind erwachsen und frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt.
Es werden auch Aktionen aus dem Bereich BDSM beschrieben.
Bitte denken Sie dabei immer an die Grundsätze bei BDSM:
Gegenseitiges Einverständnis, bewusste Akzeptanz und vor allem Sicherheit.
Auch, wenn Bens Halbinsel und auch Coconut Island und Frontier Island erfunden sind, die Küsten von Oregon und Kalifornien bieten spektakuläre Ansichten und sind an manchen Stellen ähnlich wie in der Geschichte.
Es würde mich freuen, wenn diese Geschichte gefällt.
Zum Buch:
Ben Howard ist Witwer. Trotzdem bleibt der Wunsch nach einem Erben bestehen. Heiraten oder sich verlieben will er aber nicht.
Monica Moraine hat Beziehungsängste. Durch ein traumatisches Erlebnis hat sie Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Deswegen lässt sie keine tiefere Beziehung zu.
Monicas Großvater Henry hat finanzielle Probleme. Sein Neffe Cedric hat einen Schuldschein, den er im ungünstigsten Moment präsentiert. Henry braucht eine halbe Million, um den Schuldschein zu begleichen. Aber die Banken geben ihm keinen Kredit mehr, weil er bereits über dem Limit ist.
Ben Howard sucht per Annonce für ein Jahr ein Frau, die ihm ein Kind schenken soll. Sein Kind. Monica will ihrem Großvater gegen Cedric helfen und bewirbt sich. Sie fordert aber die halbe Millionen und bietet dafür 3 Jahre als seine Sklavin. All inklusive – keine Einschränkungen.
Ben akzeptiert sie als seine Sklavin. Er fordert sie immer wieder aufs Neue und sie lernt vieles über sich kennen.
Cedric bekommt mit, dass Henry wegen ihrer Hilfe das Testament geändert hat und nun Monica zur Alleinerbin gemacht hat. Also muss er sie loswerden und entführt sie.
Akzeptiert Ben diese Veränderung und lässt Cedric gewinnen?
Inhalt
Intro
Zum Buch
Inhalt
Wunschgedanke
Schatzfund
Distanz
Dolchstoß
Forderung
Siegel
Touché
Einzug
Erfahrungen
Wendungen
Herausforderungen
Strafen
Titanenkämpfe
Verschwunden
S.A.R.
Entscheidungen
Verträge
Epilog
Nachdenklichkeit als Nachwort
Wunschgedanke
Howard Manor, nördliche Küste, Bundesstaat Oregon, USA, im März
Mit einem leisen Knarren öffnete sich die schwere Eingangstür aus Eiche. Fast eine Handbreit dick war der Türflügel und mit breiten Eisenbändern verstärkt. Durch die salzige Luft an der Küste hatten sich in den Jahren an einigen Stellen weiße Krusten gebildet. Niemand hatte sie entfernt. Auch er nicht. Er kümmerte sich nur um die gläserne Front, die zum Meer hin zeigte. Ansonsten gab es keine Fenster.
Allein diese breite Glasfront zog er regelmäßig ab. Auch das machte allein er selber. Dafür kam keine Reinigungsfirma.
Genaugenommen kam außer ihm niemand zu diesem Haus. Es war ein flaches Gebäude mit fast quadratischem Grundriss. Nur ein flaches Spitzdach ließ Regen und Spritzwasser bei Sturm außen abperlen.
Ursprünglich waren die Wände außen mit Klinker verkleidet worden und das Dach bestand aus Kupferplatten. Aber zehn Jahre hatten das Dach stumpf gemacht und an den Unebenheiten der Klinker gab es die Salzablagerungen.
Außer ihm ging niemand zu dem Gebäude. Nicht, weil es rund hundert Meter vom Hauptgebäude entfernt fast direkt an der Steilküste lag, sondern weil er es ganz einfach verboten hatte. Besonders durfte niemand außer ihm das Gebäude betreten. Man konnte es nicht abschließen, aber jeder hier hielt sich an sein Gesetz.
Schweigend betrat Ben Howard den einzigen Raum des Hauses. Hinter sich schloss er die Tür. Sofort herrschte wieder Stille im Raum. Kein Windgeräusch drang von außen herein. Selber das Prasseln bei Regen wurde durch die dicke Panzerglasscheibe, die die gesamte Front zum Meer hin umfasste, zur Bedeutungslosigkeit reduziert.
Neben dieser Glasfront gab es keine anderen Fenster. Nichts erhellte den Raum außer dem Licht, dass durch die Scheibe fiel. Es war ein schweigender, düster wirkender Raum. Und es gab keine Einrichtung, nur Leere. Und doch war der Raum für ihn fast zu voll.
Knapp 15 Meter maß der Raum in jede Richtung und war etwa drei Meter hoch. Eine Balkendecke schloss nach oben ab und die Wände waren von dunklem Eichenholz bedeckt. Nur der Fußboden bestand aus grauen glattgeschliffenen Granitplatten.
Ben blieb einen Moment an der Tür stehen. Er war 1,90 groß, schlank und hatte immer noch schwarze Haare. Auffällig war nur eine sehr helle, beinahe weiße, dicke Strähne nahe dem Scheitel, die nach rechts gekämmt war. Sein Gesicht, das scharf geschnitten war und einen eher harten Gesichtsausdruck hatte, war glatt rasiert. Es wirkte nicht wie bei jemandem, der gerne lacht, eher im Gegenteil. Ben war 43 Jahre alt. Die Zeit hatte Spuren in seinem Gesicht hinterlassen. Trotzdem hatte er eine durchtrainierte Gestalt, um die ihn mancher 30jährige beneiden würde. Seine braunen Augen blickten scharf und wirkten doch traurig. Langsam ließ er seinen Blick durch den Raum gleiten.
Auf der rechten Wandseite hingen dicht nebeneinander ein dutzend lebensgroße Bilder eines älteren Ehepaares. Es zeigte sie beim Spazierengehen oder auf der Couch sitzend. Da waren Bilder von Veranstaltungen, bei denen sie im Vordergrund standen und andere, die eine beschauliche Stimmung wiederspiegelten.
Auf der linken Seite des Raumes war eine gleiche Anzahl von ebenso großen Bildern einer bezaubernd schönen jungen Frau von Mitte oder Ende 20. Ihr Lachen und ihre Freude sprangen dem Betrachter förmlich aus den Bildern entgegen. Auch sie war in den unterschiedlichsten Situationen abgebildet. Aber alle zeigten ihre übersprühende Lebensfreude.
Bens Miene wurde ganz weich, als er die Bilder langsam betrachtete. Jedes einzelne Bild betrachtete er intensiv. Er schien fast mit den abgebildeten Personen zu kommunizieren.
Ruhig und mit Pausen ging er nach vorne zum Fenster. Davor stand ein breiter Clubsessel, der den Blick nach draußen bot. Neben dem Sessel stand eine lebensgroße Statue aus weißem Alabaster, die eine Hand scheinbar auf die Rückenlehne des Sessels gelegt hatte. Es waren die einzigen Gegenstände in dem Raum.
Leicht glitten Bens Fingerspitzen über den Arm der Statue, als er um sie herum zum Sessel ging und sich setzte. Die Statue war ein Abbild der jungen Frau auf den Bildern. Als Statue war sie in einem langen fließenden Kleid dargestellt. Während die eine Hand sich auf der Lehne des Sessels befand, war die andere angewinkelt vor dem flachen Bauch. Ein kleiner Bilderrahmen mit einem leicht verblassten Schwarzweißbild stand auf der nach oben offen gehaltenen Hand.
Totenstille herrschte im Raum, als Ben bewegungslos aus dem Fenster blickte. Er konnte draußen das Meer sehen und den grauen Himmel mit den Wolken, die der Wind vor sich hertrieb. Da die Front nahe der Kante der Steilküste gebaut war, wirkte es fast so, als ob man wie der Kapitän eines Schiffes aus der Kommandobrücke blickte.
Ganz leicht spürte er das Zittern, wenn die Brandung etwa 30 Meter unter ihm gegen die Steilwand donnerte.
Er genoss den Anblick der Naturkräfte. Gleichzeitig schickte ihn der Anblick langsam zurück in die Vergangenheit. Auch das Zittern im Untergrund erinnerte ihn.
Ben suchte manchmal diese Stille. Dann war er auch mal für Stunden von der Welt verschwunden. Hier würde ihn niemand stören. Hier gab es weder elektrisches Licht noch ein Telefon. Nur die Temperatur war gleichmäßig geregelt, egal, ob es Winter oder Sommer war. Und jeder seiner Angestellten wusste, dass er hier nicht gestört werden durfte.
Hier war er bei seinen Eltern, seiner Frau und ….
Heute war es auf den Tag zehn Jahre her, als es passierte. Er erinnerte sich an jede einzelne Minute von damals. Jedes Wort von damals hatte er noch im Kopf. Er konnte genau sagen, wie Sylvias Haar damals frisiert gewesen war und welchen Nagellack sie sich aufgetragen hatte. Er roch immer noch ihr Parfüm von damals. Er sah, wie sie lächelnd eine Strähne wegpustete, die sich vor ihre Augen geschoben hatte. Er konnte sich an jede Falte im Gesicht seiner Eltern erinnern.
Damals.
Vor genau zehn Jahren.
Sie hatten einen Ausflug gemacht. Sylvia hatte sie eingeladen. Es war damals von einer Überraschung die Rede gewesen, die sie zeigen wollte.
Alle waren der Einladung gefolgt. Warum auch nicht? Es war schließlich der zehnte Hochzeitstag von Ben und Sylvia. Die beiden führten eine glückliche Ehe. Vieles hatte sie zusammen unternommen. Nur ein Schatten lag über der Ehe. Beide hatte sich ein Kind gewünscht. Sie hatte keine Kinder bekommen können. Dabei hatten sie in den letzten Jahren bereits einiges versucht.
Jetzt, am Hochzeitstag, hatte Sylvia die Familie eingeladen. Auch in den Jahren davor hatte an dem Tag eine Art Familienfest stattgefunden. Entweder hatte er oder Sylvia eingeladen und sie hatten den Tag immer mit seinen Eltern begangen. Insofern war es nichts Besonderes gewesen. Sylvia selber hatte keine Eltern mehr. Sie war schon als Waise groß geworden.
Sie hatten damals den Wagen auf dem Parkplatz des Lokals geparkt und waren zuerst eine Runde in der Umgebung spazieren gegangen. Dann hatten sie im Lokal in einer Nische Platz genommen und sich Kuchen und Kaffee bestellt.
Während sie darauf warteten, war Ben aufgestanden und hatte die Toilette aufgesucht. ‚Beeil dich‘ hatte Sylvia ihm lachend hinterhergerufen. ‚Wenn du wiederkommst, bekommst du dein Geschenk‘.
Die Toiletten waren im Keller untergebracht.
Natürlich hatte er nach der Ankündigung darüber nachgedacht, was es dieses Jahr sein würde. Sein Geschenk für sie wartete zu Hause. Das würde sie nach der Heimkehr bekommen. Er hoffte, dass der Welpe sie glücklich machte.
Hinterher hatte er sich dort am Waschbecken die Hände gewaschen, als ihn eine Art tiefes Röhren aufhorchen ließ. Es klang beinahe wie ein lauter Motor. Ein großer Motor. Zuerst hatte er an einen Jet im Tiefflug gedacht, aber dazu schwoll das Dröhnen zu langsam an. Irgendwie klang dieser Motor überdreht.
Komisch, hatte er gedacht, wieso ist der Straßenlärm so laut. Das ist doch ein Ausflugslokal und liegt nicht direkt an der Straße.
Seine Hände hielten noch das Handtuch, als das ganze Gebäude erzitterte und ein lautes Krachen zu hören war. Ein tiefes Bersten und Prasseln hing in der Luft. Mehrere schwere Schläge ließen die Decke beben.
Nur Sekunden später eilte er die Kellertreppe nach oben. Staub lag schwer in der Luft und raubte die Sicht. Er musste husten, als der Staub in seine Lungen drang. Ein hohes Jaulen, wie von durchdrehenden Reifen, quälte seine Ohren.
Fassungslos blieb er in der Tür zum Lokal stehen. Staub wirbelte umher. Eine Wandseite des Lokals fehlte genau wie ein Teil der Decke zum Obergeschoß. Trümmer und Steine lagen überall. Ein Sattelschlepper mit einem Container auf dem Aufleger stand dort, wo ihr Tisch gewesen war. Er versuchte durch die nächste Wand zu kommen, weil seine Reifen immer noch durchdrehten und dieses Jaulen verursachten. Nur der Schwung war aufgebraucht und er kam nicht weiter.
Ben stand in einer Glocke des Schweigens. Nur dieses Jaulen der Reifen hörte er. Er nahm nicht die Schreie aus Panik und Schmerz der anderen Menschen um ihn wahr. Für ihn waren die Flüchtenden nicht existent. Er sah nur, dass dort, wo seine Eltern und seine Frau gesessen hatten, jetzt eine schwere Zugmaschine stand.
Nur ein ‚Wieso‘ hämmerte in seinem Kopf, während er den Sattelschlepper anstarrte. Bewegen konnte er sich nicht.
Er nahm nicht wahr, wie draußen Sirenen aufheulten. Er bemerkte nicht die blauen und roten flackernden Lichter vor dem Haus. Er hörte nicht die geschrienen Kommandos, mit denen Polizei, Feuerwehr und Sanitäter sich koordinierten. Er sah den Feuerwehrmann in das Fahrerhaus der Zugmaschine klettern und er hörte, wie der Motor mit einem Blubbern erstarb. Das Jaulen der Reifen verstummte. Trotzdem änderte sich für ihn nur, dass die Glocke, in der er immer noch stand, nun zu einer schweigenden geworden war.
Er sah und hörte und nahm doch nichts wahr. Nur sein Blick war voll Unglauben und Unverständnis auf den Platz ihres Tisches gerichtet.
Selbst, als sich jemand vor ihm aufbaute und ihm die Sicht versperrte, reagierte er nicht. Unterbewusst sah er die Mundbewegungen des anderen, aber er hörte nichts.
Es brauchte noch einen zweiten Helfer, damit sie ihn wegführen konnten. Vor dem Gebäude wurde er auf eine Bank gedrückt und ein Sanitäter kümmerte sich um ihn. Ben verstand nicht, was der Mann wollte. Er starrte nur geradeaus. Dass der Helfer ihm etwas spritzte zur Beruhigung, interessierte ihn nicht.
Die Helfer hatten verstanden, dass er unter Schock stand. Er hatte wohl in dem Lokal jemand verloren, der ihm nahestand. Sie hatten ihn herausgeholt, weil ein Teil des Gebäudes einsturzgefährdet war und er ihnen im Weg stand.
Er konnte nichts sagen, wie viel Zeit vergangen war, aber irgendwann wandelte sich seine Starre. Langsam hatte sein Kopf verstanden, dass sein Frau und seine Eltern tot waren. Sie waren wohl in ihrer Nische von dem herandonnernden LKW getötet worden.
Wut schwoll in ihm an. Die Wut auf den Fahrer wurde zu einem rasenden Zorn.
Hart packte er einen vorbeieilenden Polizisten an der Schulter.
„Ich will, dass der Bastard, der den Truck gefahren hat, auf dem Stuhl brät“, knurrte er voll bösem Hass.
Im ersten Moment hatte sich der Polizist gegen den Griff wehren wollen, hatte aber dann erkannt, dass er es hier mit einem Opfer zu tun hatte.
„Ihr Wunsch kommt zu spät, Sir“, antwortete er stattdessen mitleidig.
„Nach dem, was wir bisher wissen, hatte der Fahrer einen Herzinfarkt und hat dabei mit dem Fuß das Gaspedal durchgetreten. Sein Körper hat das Lenkrad blockiert. Er war bereits tot, als er in das Gebäude gefahren ist.“
Bens Hand löste sich von der Schulter des Beamten und fiel herunter. Ein Toter hatte seine Frau und Eltern ermordet. Nicht einmal die Strafe konnte Ben ihm diktieren. Er sank zurück auf den Sitz. Seine Wut war bei den erklärenden Worten förmlich verpufft.
Wieder starrte er nur teilnahmslos vor sich hin.
Stunden später wurde der Truck aus dem Lokal gezogen. Jetzt konnten die Helfer sich um die Toten und Verletzten unter den Trümmern kümmern. Allerdings hielt man ihn zurück. Man ließ ihn nicht dorthin. Er beobachte nur, wie ein Beamter einige schwarze Säcke dorthin brachte. Gleich darauf wurde ihm die Sicht durch eine schnell aufgestellte Wand versperrt.
Ben saß weiterhin nur apathisch auf seinem Sitz. Sein Denken war wie eingefroren. Sie sind nicht mehr. Keine Eltern und keine Sylvia würden mehr um ihn sein. Seine Zukunft war ein schwarzes Loch.
Langsam kam ein Beamter auf ihn zu. Er hielt ihre Handtasche in der Hand. Sylvias Handtasche. Er hatte sie erst vor knapp zwei Monaten mit ihr zusammen ausgesucht.
Als der Mann vor ihm stand, öffnete der Beamte den Mund und schien etwas sagen zu wollen. Aber er schluckte nur und schloss den Mund wieder. Ben starrt die Tasche an und eine Träne löste sich aus seinem Augenwinkel.
Erneut räusperte sich der Polizist.
„Sie sahen friedlich aus. Nur so überrascht. Es muss ganz schnell gegangen sein“, krächzte der Mann leise. Er fühlte sich so hilflos gegenüber dem Mann, der vor ihm saß. Er wollte ihm mit seinem Worten ein bisschen Trost spenden, auch, wenn es wahrscheinlich nichts nutzte.
Dann reichte ihm der Beamte ihre Handtasche. Fast unbeschädigt sah sie aus. Nur die dünnen roten Spritzer auf dem hellen Leder störten. Abwesend öffnete er die Tasche. Warum, hätte er nicht sagen können. Vielleicht nur, um irgendetwas zu machen.
Ein kleines Foto fiel heraus. Eigentlich kein Foto, sondern eher ein ausgedrucktes Bild. Verständnislos sah er das Bild an. Es wirkte unscharf und wie verrauscht. Alles in Schwarzweiß. Irgendetwas Kleines war dargestellt. Wie zusammengerollt sah es aus.
Scheinbar brauchte es Stunden, bis er begriff, was er in der Hand hielt. Ein Ultraschallbild. Ein Bild, das normalerweise eine Frauenärztin erstellte, wenn sie eine junge Frau untersuchte. Ein Bild, das normalerweise zu großer Freude Anlass gab.
Für ihn war es ein Bild, das ihn in tiefste Bewusstlosigkeit schickte.
Es dauerte fast drei Wochen, bis er nach dem Nervenfieber aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Seit damals hatte er kaum noch gelacht und er hatte eine helle Strähne in seinem sonst schwarzen Haar.
Wieder zuckten seine Wangenmuskeln, als er daran dachte. Aber ohne Tränen starrte er mit versteinerter Miene aus dem Fenster.
Und doch fühlte er sich ihnen hier nahe. Irgendwie waren sie hier neben ihm und blickten mit ihm hinaus. Auf der einen Seite standen seine Eltern und auf der anderen Seite stand Sylvia mit ihrem ungeborenen Kind im Arm.
Stundenlang saß er bewegungslos in dem Sessel und starrte nach draußen. Er sah die Wolken ziehen und das Rot des Sonnenuntergangs. Im Raum wurde es dunkler. Nur das Licht von außen erhellte ihn schwach.
Langsam formte sich ein Gedanke in seinem Kopf. In den Stunden des Starrens wurde die Idee immer deutlicher und nahm Gestalt an.
Fast war es eine Frage und Bitte, als er sich in seinen Gedanken an Sylvia wandte und ihre Meinung wissen wollte. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass sie ihm lächelnd zunickte und seinen Plan guthieß. Er glaubte auch, einen zustimmenden Impuls aus Richtung seiner Eltern zu verspüren. Auch ihnen schien seine Idee zu gefallen.
Erst jetzt erlaubte er sich ein paar Tränen.
Langsam erhob er sich. Sein Rücken straffte sich, als er langsam zur Tür schritt. Dort drehte er sich noch einmal um und sein Blick wanderte erneut durch den Raum.
„Danke“, flüsterte er.
Dann zog er die Tür auf und verließ das Gebäude.
Nun hatte er einen Plan. Den musste er noch etwas genauer ausarbeiten und die Bedingungen formulieren. Da warteten auch noch einige Gespräche auf ihn. Aber jetzt hatte er ein Ziel.
Weit ging er nicht. Nur wenige Schritte neben dem Haus, dass er gerade verlassen hatte, war noch ein Gebäude. Kein richtiges Gebäude, eher der gemauerte Eingang zu einer Treppe, die in die Tiefe des Felsens führte. Er verschwand darin.
Erst eine Stunde später kam er wieder heraus. Jacke und Hemd trug er in der Hand. Sein Körper war nass und an Brust, Armen und Stirn waren einige blutige Kratzer.
Jetzt ging er ruhig weiter. Jetzt hatte er einen stolzen Zug um seine Mundwinkel. Jetzt konnte er sich an die Umsetzung seines Plans machen.
Schon am nächsten Tag saß er mit seinen Anwälten zusammen. Sein Auftrag war einfach. Sie sollten ein Dokument entwerfen, das vor Gericht Bestand hatte, wenn beide Parteien unterschrieben hatten. Es sollte eindeutig die Rechte und Pflichten der Beteiligten festhalten. Und es sollte so verständlich sein, damit niemand sagen konnte, er habe es falsch verstanden.
Vier Wochen später begann seine Suche. Er hatte seine Anfrage in den einschlägigen Foren geschaltet. Dann begann das Sichten der Bewerbungen. Das war allerdings allein seine Aufgabe als einer der Beteiligten.
Schatzfund
Moraine Transports, Portland, Bundesstaat Oregon, USA, im Januar
„Bist du noch nicht unterwegs?“
Mit den Worten schrie Richard Moraine seinen Sohn Cedric an, der im Büro noch Unterlagen zusammensuchte. Der 36jährige blickte seinen Vater gelassen an.
„Es ist noch Zeit. Um 18 Uhr muss ich da sein. Das schaffe ich locker.“
„Wenn du gefahren wärst, als ich es dir gesagt habe, hättest du schon wieder hier sein können. Ich habe bereits den nächsten Auftrag an der Hand. Das muss ich jetzt wegen dir selber machen“, keifte der Alte.
Richard Moraine war 58, dürr und mit einer Habichtsnase ausgestattet. Dass er hochgewaschen war und kaum noch Haare auf dem Kopf hatte, hatte ihm auch schon den Vergleich mit einem Geier eingebracht. Natürlich nur hinter seinem Rücken.
Dass ihn aber jeder andere der zehn Mitarbeiter in der Spedition, die er in Portland betrieb, einen Sklaventreiber nannte, wusste er wohl. Er war sogar stolz auf den Titel. Für ihn zeigte es doch damit, dass er sich für seine Firma den Arsch aufriss. Ein 12-Stunden-Tag war für ihn normal.
Nachdem ihn vor vielen Jahren seine Frau verlassen hatte, war zumindest sein einziger Sohn Cedric bei ihm geblieben und arbeitete für ihn. Allerdings könnte der deutlich mehr Einsatz zeigen, wie Richard fand.
„Im Keller habe ich noch 20 Kartons stehen, die müssen auch noch zum Schredder. Das sind alles alte Unterlagen. Die müssen weg. Das steht auch für morgen auf deinem Programm, Cedric.“
Der stöhnte nur leise. Was Arbeit anging, war der Alte mehr als erfinderisch. Und wenn er seinen Sohn damit ärgern konnte, sogar noch mehr.
Eigentlich gab es nur einen Grund, der Cedric hier hielt. Er hoffte täglich auf den Herzinfarkt bei seinem Vater, um zu erben. Würde er anderswo anfangen zu arbeiten, würde er enterbt werden. Die Zusage hatte ihm sein Vater schon vor Jahren gegeben.
„Ja, ich kümmere mich darum“, sagte Cedric halblaut.
Sein Vater nickte und knallte die Bürotür wieder zu, als er wegging.
Nur wenig später hörte Cedric das Pfeifen durchdrehender Reifen. Kurz verzogen sich seine Mundwinkel. Sein Vater kannte nur Bleifuß oder Vollbremsung. Und er war jetzt wieder mit seinem Kleintransporter unterwegs. Er hatte schon mehr Tickets wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen gesammelt, als die gesamt restliche Belegschaft zusammen. Aber es war ihm egal. Er kannte den Polizeichef sehr gut. Insofern blieb es immer bei den Verwarnungen.
Cedric lehnte sich für einen Moment zurück und dachte über seine Arbeit nach. Als er vor 18 Jahren hier angefangen hatte, hatte die Firma 20 Fahrer, 8 Lagerarbeiter und noch ein paar Leute in der Buchhaltung beschäftigt. Heute waren es neben seinem Vater noch insgesamt 14 Beschäftigte, inklusive ihm selber. Von den früheren drei Lagerhallen waren in den letzten Jahren zwei verkauft worden. Sein Vater schob alles auf die schlechte Wirtschaftslage. Er selber dachte eher an schlechtes Management und Fehlinvestitionen.
Wenn er sich die Entwicklung ansah, gab er der Firma noch schätzungsweise weitere zehn Jahre. Dann war Konkurs angesagt.
Er selber war dann Mitte 40. Was hatte er vorzuweisen? Er kannte sich in Logistik aus, er konnte Trucks fahren. Selbst Buchhaltung schaffte er. Ob er da allerdings mit gelernten Profis mithalten konnte, wagte er zu bezweifeln. Insofern schätzte er seine Berufsaussichten für die Zeit nach einem solchen Konkurs als mehr als schlecht ein. Zu alt und nur gelernte Kraft.
Natürlich lag es an seinem Vater. Der hatte ihn am Studium gehindert und in der Firma eingespannt. Es war immer das gleiche Argument. Bleib bei mir oder ich enterbe dich.
Offiziell hatte er also ziemlich schlechte Karten für seine Zukunft.
Er grinste. Gut, dass er bereits vor ein einigen Jahren angefangen hatte, finanziell vorzubeugen. Bei einem Bier hatte er mit ein paar alten Kumpels vom Militär, die ähnlich frustriert waren, eine neue Firma gegründet. Allerdings war die nicht im Handelsregister eingetragen.
Cedric war der Boss. Er hatte drei Trucks von seinem Vater als schrottreif eingestuft und offiziell dem Schrotthändler verkauft. Tatsächlich standen sie in einer anderen Lagerhalle, die sein Freund Sam Mitchel gemietet hatte. Sam war einer der Ex-Soldaten und er war sein Stellvertreter in dieser ‚Firma‘.
Durch seine beruflichen Kontakte fand Cedric lukrative Ladungen, die von anderen transportiert wurden. Irgendwo auf einsamen Rastplätzen wurden die Trucks überfallen und die Güter umgeladen. Fast militärisch exakt schlugen sie jedes Mal zu. Es gab keine Verletzten oder gar Toten. Nur die Ladung verschwand spurlos. Ein klassischer Versicherungsfall für die Transportfirma und ein ungeklärter Fall für die Polizei.
Er selber konnte gefälschte Transportscheine ausstellen und die Ladungen auf eigene Rechnung an den Mann bringen. Mit einer oder auch einmal zwei solcher Aktionen im Monat war es nicht ausreichend, um eine Sonderkommission bei der Polizei zu gründen. Für die Mitarbeiter stellte es auch keinen Stress dar. Selbst eine Pause brachte niemanden in Probleme. Mit dem Stichwort ‚kleine Erbschaft‘ hatte jeder seiner Mitarbeiter eine passende Ausrede, warum er oft zu Hause war.
Am nächsten Nachmittag ging Cedric in den Keller, um die Kartons auf einen Wagen zu laden. Die Hälfte hatte er bereits verladen, als ein Karton unten aufplatzte und der Inhalt sich auf dem Boden verteilte. Er fluchte. Jetzt kam das Einsammeln noch hinzu.
Zuerst besorgte er sich Klebeband und verschloss den offenen Boden des Kartons. Nochmals würde nichts herausfallen. Dann stellte er den Karton offen hin. Mit den Händen ergriff er die Blätter, die vor ihm lagen und schob sie zusammen. Handvoll für Handvoll packte er sie wieder in den Karton. Rechnungen, Geschäftsbriefe, Rechnungen, Lieferscheine, Briefe, Schuldschein, Rechnungen, Briefe …
Abrupt hielt er inne. Dann holte er die Blätter wieder heraus. Seite für Seite überflog er jedes einzelne Blatt. Nur unbewusst hatte er die Überschriften gelesen. Nur einen flüchtigen Blick hatte er dabei auf das gworfen, was er gerade in den Händen gehabt hatte.
Schuldschein! Erst später war ihm die Bedeutung des Wortes in der monotonen Arbeit aufgegangen. Jetzt suchte er die Unterlage. Vielleicht war das etwas, mit dem man noch Geld machen konnte.
Dann hielt er das Dokument in der Hand. Schnell überflog er die Angaben. Und er las es erneut langsamer und ganz langsam noch ein drittes Mal. Seine Hand fing an zu zittern, als ihm der Text bewusst wurde.
Vor fast 20 Jahren hatte sein Vater Richard seinem Bruder Henry 400.000 Dollar geliehen. William, der Vater der Brüder, war bereits verstorben und Henry hatte die Firma geerbt. Für irgendeine Investition hatte er Geld benötigt und Richard hatte es ihm als eine Art Kapitalanlage geliehen.
Natürlich hatte er es nicht umsonst getan. Cedric grinste, er kannte seinen gierigen Vater. Der Schuldschein konnte frühestens nach fünf Jahren präsentiert werden und er hätte dann eine glatte halbe Millionen ausgezahlt bekommen. 20 Prozent Gewinn bei fünf Jahren Laufzeit. Das klang nach seinem Vater.
Und er hatte noch eines draufgesetzt. Sollte Henry nicht innerhalb von einem Monat zahlen, würden alle Anteile von Henry auf Richard übertragen. Netterweise hatte es auch gleich ein Anwalt so formuliert, dass bei Richard oder Henry auch noch die Erben als Rechtsnachfolger eingetragen waren.
Cedric musste sich erst einmal auf einen anderen Karton setzen. Seine Gedanken wirbelten. Was da stand, war fast schon ein Blanko-Scheck. Eine halbe Millionen!
Langsam kam das klare Denken wieder zum Zuge. Sein Vater musste alle Unterlagen systematisch eingepackt haben. Wahrscheinlich war das Dokument in einem Ordner gewesen und sein Vater hatte den als alt angesehen. Und schon wanderten alle Inhalte in einen Karton. Ordnung war wichtig für Richard. Wenn der Schuldschein schon zurückgezahlt worden war, dann musste die Quittung an dem Schuldschein gehangen haben. Also musste die Quittung, wenn sie existierte, in dem gleichen Karton gewesen sein.
Hektisch schob er die restlichen Blätter wieder in den Karton zurück. Ganz oben legte er den Schuldschein darauf. Und er brachte diesen Karton direkt nach oben und deponierte ihn im Kofferraum seines eigenen Wagens. Damit würde er sich zu Hause auseinandersetzen.
Wenn es keine Quittung gab, hatte sein Vater auch kein Recht mehr auf den Schuldschein. Er hatte ihn sogar vernichten wollen. Wahrscheinlich hatte er daran nie mehr gedacht.
Eine halbe Millionen. Die Sonne schien gleich heller für Cedric. Damit ließ sich etwas anfangen. Jetzt brauchte er nur noch etwas Glück und es gab keine Quittung. Und sein Vater würde dann nichts davon abbekommen.
In Gedanken plante er schon den nächsten, damit notwendigen Schritt.
So intensiv er auch an den nächsten Tagen suchte, eine Quittung, dass der Schuldschein beglichen worden war, fand er nicht. Natürlich bestand damit weiterhin die Möglichkeit, dass Henry noch eine Quittung hatte. Allerdings glaubte er das nicht. Dazu war sein Vater zu pedantisch, was die Ablage anging.
Die folgenden Tage beschäftigte er sich mit Moraine Inc. und was es Wissenswertes über die Firma gab. In zwei Monaten war wieder eine von diesen langweiligen Familientreffen. Vorstandssitzung nannte das Onkel Henry immer hochtrabend, weil ja jeder noch Anteile hatte. Entscheidungen fielen aber keine, außer, dass er mitteilte, was er vorhatte.
Eins muss man dem alten Knacker lassen, dachte Cedric. Im Gegensatz zu meinem Vater brachte Henry seine Firma immer weiter. Wie viele Millionen die jetzt wohl wert war?
Cedric hatte ein paar Artikel gelesen, die dazu führten, dass sein Herz noch höher schlug. Anscheinend stand ein Riesendeal vor dem Abschluss. Wenn man der Presse traute, würde auch ein Riesengewinn für Henry herausspringen. Aber er musste dafür investieren und vorstrecken.
Vielleicht sollte ich einmal mit einem Bekannten reden. Der ist Banker und könnte vielleicht etwas über die Kreditwürdigkeit von Henry herausfinden. Immerhin brauchte er eine halbe Millionen für den Schuldschein.
Die Auskunft seines Bekannten ließ Cedric noch stärker zittern. Aber er ließ noch weitere drei Wochen verstreichen. Dann nahm er eine Woche Urlaub und flog an die Ostküste. Seinem Kumpel Sam Mitchel hatte er die Firmenschlüssel und einen klaren Auftrag gegeben. Und er hatte ihm eine Belohnung von 200.000 Dollar versprochen für die Erledigung und das Schweigen.
Mitten in seinem wohlverdienten Urlaub erreicht Cedric die Mitteilung, dass sein Vater tödlich mit seinem Kleintransporter verunglückt war. Nach polizeilichen Ermittlungen war er mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve getragen worden und in eine Hauswand gerast. Die Bremsen hatten versagt. So, wie es aussah, war es wohl ein Marderbiss gewesen, der die Bremsleitung zerstört hatte.
Natürlich brach er seinen Urlaub sofort ab und kehrte zurück. Dann kümmerte er sich um die Beisetzung. Auch Onkel Henry und dessen Enkelin Monica waren da.
Wieder schoss es Cedric in die Lenden, als er Monica sah. Kühl und schweigend nahm sie an der Beisetzung teil. Kühl und schweigsam verhielt sie sich ihm gegenüber. Kühl und ruhig verschwand sie bald danach wieder zusammen mit ihrem Großvater.
Kalte Frauen sind wie ein Vulkan, dachte Cedric grimmig. Man muss sie nur richtig wecken.
Phase eins war beendet. Demnächst kam Phase zwei. Und jetzt dachte er noch über eine Phase drei und vier nach. Es war eine spontane Idee, aber warum sollte es nicht nochmals funktionieren? Man müsste es noch genauer durchdenken. Zumindest würde er daran denken, wenn Phase zwei nicht wie gewünscht funktionierte.
Distanz
60th Café, Portland, Bundesstaat Oregon, USA, im April
„Tut mir leid, aber ich habe heute Abend schon etwas vor“, sagte Monica Moraine mit einem schiefen Lächeln zu ihrer Geschäftspartnerin und Freundin Lucy Barns.
Mit der gleichalten Lucy war die 26jährige Monica seit dem College befreundet. Mit ihren schulterlange blonden Haare, den blaue Augen und einem Schmollmund bot Monica ein sehr sinnliches Bild. Dass sie auch schlank war und einen mittelgroßen festen Busen vorweisen konnte, ließ die Blicke noch länger auf ihr verweilen.
Allerdings war sie nicht das ‚blonde Dummchen‘, wie viele vermuteten, sondern sie hatte Wirtschaft studiert und mit Summa cum Laude abgeschlossen. Sie hatte einen scharfen Verstand und, wie ihre wenigen Freunde bestätigten, auch eine scharfe Zunge, wenn es darauf ankam. Nicht, dass sie andere gezielt verletzte, aber Ironie und Sarkasmus konnte sie einsetzen.
Jetzt war sie mit ihrer Freundin dabei, erfolgreich zu werden. Man hatte sich zwar nach der Schule eine Zeitlang aus den Augen verloren, aber fleißig miteinander gechattet. Und vor drei Jahren hatten sie sich wieder getroffen. Sie hatten über ihr Leben philosophiert und sich ihre Träume erzählt. Portland war eine große Stadt und beide hatten an verschiedenen Enden der Stadt gewohnt. Heute wohnten sie näher zusammen.
Dann aber hatte sie sich zusammengetan und ihren Traum wahrgemacht. Sie hatten ein Café eröffnet. ‚60th-Café‘ hatten sie es genannt. Genau genaugenommen war es eine Tanzbar. Den vorderen Teil hatten sie im Stil der 60er Jahre eingerichtet. Tische, Stühle und Wandschmuck gaben Zeugnis dieser Ära von Rock n’ Roll und beginnender Discozeit. Sogar eine alte Wurlitzer Zodiac 3500 von 1971 und eine Wurlitzer 1015 von 1946 hatten sie dort stehen und diese mit den damaligen Hits bestückt. Beide Geräte waren restauriert und jeweils eine war für eine Woche im Einsatz.
Größen wie unter anderem Chuck Berry, Ray Charles, Buddy Holly, Little Richard, Bill Haley und natürlich Elvis Presley waren vertreten. Aber auch Gruppen wie die Beatles, The Drifters und The Supremes konnte gehört werden.
Lucy und Monica waren immer wieder fasziniert, dass die Geräte fast permanent im Einsatz waren, selbst wenn man einen Dime (10 Cent-Münze) pro Song einwerfen musste. Es freute sie, dass ihr Café sowohl bei Älteren als auch bei der Jugend so beliebt war. Oft saßen auch altersmäßig gemischte Gruppen zusammen und diskutierten bei Kaffee, Milchshake oder Cola die aktuellen Probleme in der Welt oder der Stadt.
Der hintere Teil war eine große Halle mit einem kleinen Podium. Dort wurden Tanzkurse angeboten, aber auch Schulbands oder kleine Gruppen konnten hier ihre Auftritte buchen. Hier traf klassischer Walzer auf House, genauso wie Disco-Beat auf Techno.
Seit drei Jahren betrieben sie nun dieses Lokal und sie hatten inzwischen vier Vollzeitangestellte, sowie etliche Schüler oder Studenten, die sich stundenweise gerne etwas verdienten. Und sie schrieben schwarze Zahlen, was die Umsätze anging.
Kurz nach der Eröffnung hatte Lucy hier ihren Ehemann kennengelernt. Er war Ingenieur und hatte ein Faible für diese Ära. So war er das erste Mal gekommen und hatte Lucy kennengelernt. Ein halbes Jahr später hatten die beiden hier im Lokal geheiratet. Lucy war glücklich. Allerdings wollte sie, dass ihr Umfeld ebenso glücklich wurde.
Regelmäßig veranstaltete sie Partys in ihrem Zuhause und auch Monica war gerne dort. Bis sie feststellte, dass Lucy sie unbedingt verkuppeln wollte. Jedes Mal wurde ihr ein anderer toller Begleiter zugeschoben. Monica musste zugeben, dass die Auswahl wirklich nicht schlecht war. Es hatte sich manche kürzere Affäre daraus ergeben, die meistens Monica wieder beendet hatte.
Aber seitdem sie das gezielte Bestreben von Lucy dahinter erkannte, ging sie zu den Partys auf Distanz. Es änderte zwar grundsätzlich nichts an dem Verhältnis der beiden Frauen, aber es enttäuschte Lucy, dass sie bei Monica nicht so zum Zug kam, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Monica gab offen zu, dass es an ihr lag. Sobald sie merkte, dass in einer Beziehung Gefühle auftauchten, brach sie ab. Sie konnte nicht anders. Sie hatte vor Jahren etliche Sitzungen bei einer Psychologin deswegen gehabt. Das Problem war geblieben, trotz der Empfehlungen, die sie bekommen hatte.
Vor sieben Jahren waren ihre Eltern und ihre beiden Geschwister vor den Augen der damals 19jährigen von einem Irren erschossen worden. Der war mitten in eine Veranstaltung geplatzt und hatte gleich wild um sich geschossen. 12 Tote gab es damals. Auch der Amokschütze starb. Monica hatte nur überlebt, weil sie ihr Vater noch im Sterben mit seinem Körper gedeckt hatte.
Wie ein Abschiedsbrief dokumentierte, hatte der Täter mit dieser Aktion gegen Tierversuche protestieren wollen.
Seitdem schaffte sie es nicht mehr, eine Beziehung einzugehen. Jedes Mal kam die Angst in ihr hoch, dass sie dann wieder einen geliebten Menschen verlieren würde. Sie wusste, dass es irrational war, aber sie konnte nichts dagegen machen. Sie wusste auch, dass sich diese Ängste eigentlich hochschaukelten, dass sie heute fast Panik bekam, wenn sie merkte, dass Liebe möglicherweise aufkeimte.
Allein der Gedanke, dass dann vielleicht sogar Kinder kämen, ließ sie flüchten. Das Szenario, Mann oder Kind so zu verlieren, wie sie es damals erlebt hatte, hatte jedes Mal Schweißausbrüche zur Folge.
Liebe, Ehe und Kinder wurden ihr drei Panikworte. Alle, was in diese Richtungen ging oder sich dahin entwickelte, war absolutes Tabu für sie. Wenn ein Partner eines der drei Worte in Zusammenhang mit ihrer Beziehung erwähnte, wies sie ihm die Tür. Für immer. Sie wusste, dass es völlig unsinnig war, aber ihr Kopf akzeptierte nichts anderes.
Als sie die ersten Beziehungen deswegen abbrach und es dem Partner zu erklären versuchte, hatten die weniger Verständnis aufgebracht. ‚Wir schaffen das‘, ‚Ich beschütze dich‘ oder ‚Uns passiert das nicht‘ waren häufige Argumente gewesen. Monica hatten sie nicht jedoch überzeugt.
Im Gegenteil. Ihre weiterhin bestehenden Ängste und damit Ablehnung einer Bindung hatten zu lautstarken Streits und wüsten Beschimpfungen geführt.
Seitdem brach sie Beziehungen ab, sobald sie erste Emotionen für den Partner fühlte. Dass sie deswegen von den ehemaligen Liebhabern oft als frigide bezeichnet wurde, war ihr egal. Eigentlich war es ihr fast sogar recht, wenn es sich so herumsprach. Ein One-Night-Stand oder eine kurze Affäre passten dann zu ihr und die Männer hatten keine größeren Erwartungen.
Andererseits hatte es zur Folge, dass sie sich manchmal regelrecht verfolgt fühlte. Mit blond, blauäugig, einem schönen Körper und Single war sie ein permanentes Ziel für Eroberungsversuche. Durch den Ruf der Kälte wurde sie als Frau sogar zum doppelten Ziel. Welcher Mann wollte sich schon gern nachsagen lassen, dass er aufgab, bevor er es nicht versucht hatte.
Immerhin winkte doch für ihn das Ziel, ihre frigide Einstellung zu knacken. Monica hatte es schon mitbekommen, dass Wetten darüber liefen, wer die ‚Eisfestung‘ als erstes erobern würde.
Sie lächelte, wenn sie an dieses Bild dachte. Eingetreten waren schon einige in die Festung, aber noch niemand hatte seine Fahne auf ihren Zinnen errichten können.
Ein Kind von Traurigkeit war sie aber nicht geworden. Sie genoss das Werben, sie gönnte sich die Männer im Bett und ihre Erfahrung, aber sie bestimmte, wann sich die Türen hinter den Männern wieder schlossen.
Nur ihren Großvater liebte sie. Henry Moraine war ihr Ratgeber und ihre Familie. Komischerweise hatte sie bei ihm diese Verlustängste nicht. Möglicherweise lag es daran, dass er mit seinen 64 Jahren ein Alter hatte, bei dem man die Beziehung zwar hatte, aber trotzdem eine gewisse Distanz einnahm.
Vielleicht lag es auch daran, dass ihr Großvater seit rund 15 Jahren Witwer war und er nie eine neue Beziehung angefangen hatte. Er war damit in einer ähnlichen Position wie sie selber, fand sie.
Monica musste immer lächeln, wenn sie darüber nachdachte. Sie schob es am Ende auf den Unterschied von zwei Generationen, der diese nahe und doch ferne Beziehung beschrieb.
Gut, es hatte bis vor kurzem noch Großonkel Richard und seinen Sohn Cedric gegeben. Auch das war Familie. Mehr gab es nicht mehr. Und die beiden hatte sie, Gott sei Dank, nur zweimal im Jahr zur Aufsichtsratssitzung gesehen. Vor wenigen Wochen war Richard bei einem Verkehrsunfall gestorben.
William Moraine war Anfang des 20. Jahrhunderts der Gründer der Firma gewesen. Mit Elektrik hatte es angefangen und war heute bei Elektronik gelandet. Durch einige Patente hatte man eine sichere Plattform für die weitere Entwicklung geschaffen.
William hatte drei Söhne gehabt. Henry war der älteste. Dann kam Arthur. Allerdings hatte der sich weniger für die Firma, sondern nur für das Geld, das sie ihm brachte, interessiert. Mit Mitte dreißig war er bei einer Fuchsjagd vom Pferd gestürzt und hatte sich das Genick gebrochen. Ohne Familie endete sein Zweig damit.
Da Richard als der dritte, jüngste Sohn sich auch weniger für die Firma interessierte, sondern etwas Eigenes aufbauen wollte, hatte er sich von William auszahlen lassen. Nur fünf Prozent Anteil hatte er behalten. Jetzt war auch er gestorben.
Damit blieb nur noch Cedric als Verwandtschaft übrig. Das Schlimmste war, dass der ihr ablehnendes Verhalten einfach ignorierte. Wenn sie zusammen waren, tat er immer so, als ob sie beste Freunde, ja sogar ein Liebespaar wären. Als Cousins konnten sie das zwar sein, aber Monica würde eher lesbisch, wenn Cedric der letzte Mann auf Erden wäre.
Ihr graute schon vor der nächsten Aufsichtsratssitzung. Da musste sie wieder hin. Immerhin gehörte ihr durch das Erbe ein Viertel von Moraine Inc. Natürlich war es eher nur theoretisch, weil der Großvater in der Praxis alles kontrollierte. Durch das Erbe war ihr der Anteil ihres Vaters zugefallen. Sie konnte den Anteil nur an einen anderen Anteilseigner verkaufen, also nur innerhalb der Familie, aber wenn es um Entscheidungen ging, hatte sie ein entsprechendes Mitspracherecht.
Anteilsmäßig würde Cedric mit den nur fünf Prozent seines Vaters nicht viel machen können, aber das konnte sich irgendwann ändern. Henry besaß die restlichen 70 Prozent der Firma. Damit konnte er faktisch allein bestimmen. Die fehlenden Prozente bildeten nur die mögliche Sperrminorität, wenn sich Monica und Cedric einig waren.
Aber genauso natürlich stimmte sie immer Großvater Henry zu. Was wusste sie denn schon über diese Geschäfte?
Wieder musste sie schmunzeln. Cedric würde wieder wilde Vorschläge machen, für die sich niemand interessierte. Eigentlich war es nur Zeitverschwendung.
Aber sie kam auch ins Grübeln, wenn sie daran dachte, wie es wäre, wenn Henry irgendwann starb. Nach dem aktuellen Testament würden Cedric und sie jeweils die Hälfte erben. Damit hätte sie 60 und Cedric 40 Prozent. Es würde bedeuten, dass sie sich gegenseitig blockieren konnten. Selbst für den Verkauf der Firma mussten sie sich einig sein.
Dolchstoß
Moraine Inc. Tower, Portland, Bundesstaat Oregon, USA, Ende April
Henry Moraine erhob sich aus seinem Ledersessel am Kopfende des großen gläsernen Tisches.
Normalerweise hatte man von 27sten Stock des Moraine-Gebäudes einen wundervollen Panoramablick auf die Stadt und die nahe Parkanlage. Nur interessierte sich heute niemand der Anwesenden dafür.
In dem großen Besprechungsraum, der für etwa 20 Personen eingerichtet war, befanden sich nur vier Menschen. Henry Moraine als Vorsitzender der Firma, sein Neffe Cedric und seine Enkelin Monica. Der Grund war die halbjährliche Vorstandssitzung. Nur die Anwesenden hatten Anteile an der Firma.
Einzig der unabhängige Protokollführer war nur beruflich anwesend. Seine Aufgabe war das Protokoll als Unparteiischer und wegen der Vorstandssitzung notwendig.
Alle trugen schwarz oder waren zumindest dunkel gekleidet. Das lag daran, dass erst vor wenigen Wochen Henrys Bruder Richard beerdigt worden war.
„Monica, Cedric“, begrüßte Henry die anderen nochmals offiziell.
„Ich bitte euch, euch zu erheben für eine Gedenkminute an Richard. Er ist erst vor kurzem von uns gegangen und wir wollen sein Andenken ehren. Er war einer der Familie.“
Während sich Monica sofort erhob und die Hände vor dem Körper faltete, stand Cedric deutlich langsamer auf. Fast provokativ verschränkte er seine Hände auf dem Rücken. Stirnrunzeln ließ Henry seinen Blick ein paar Sekunden auf Cedric ruhen, dann senkte auch er seinen Blick.