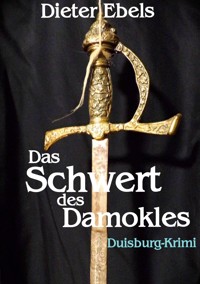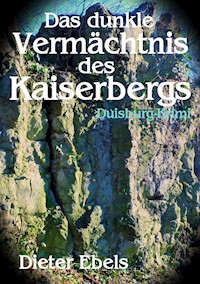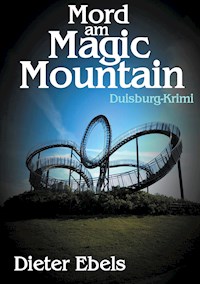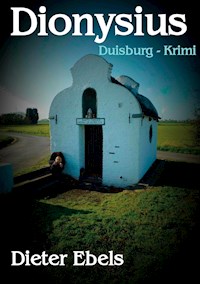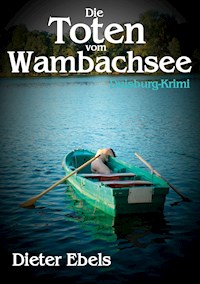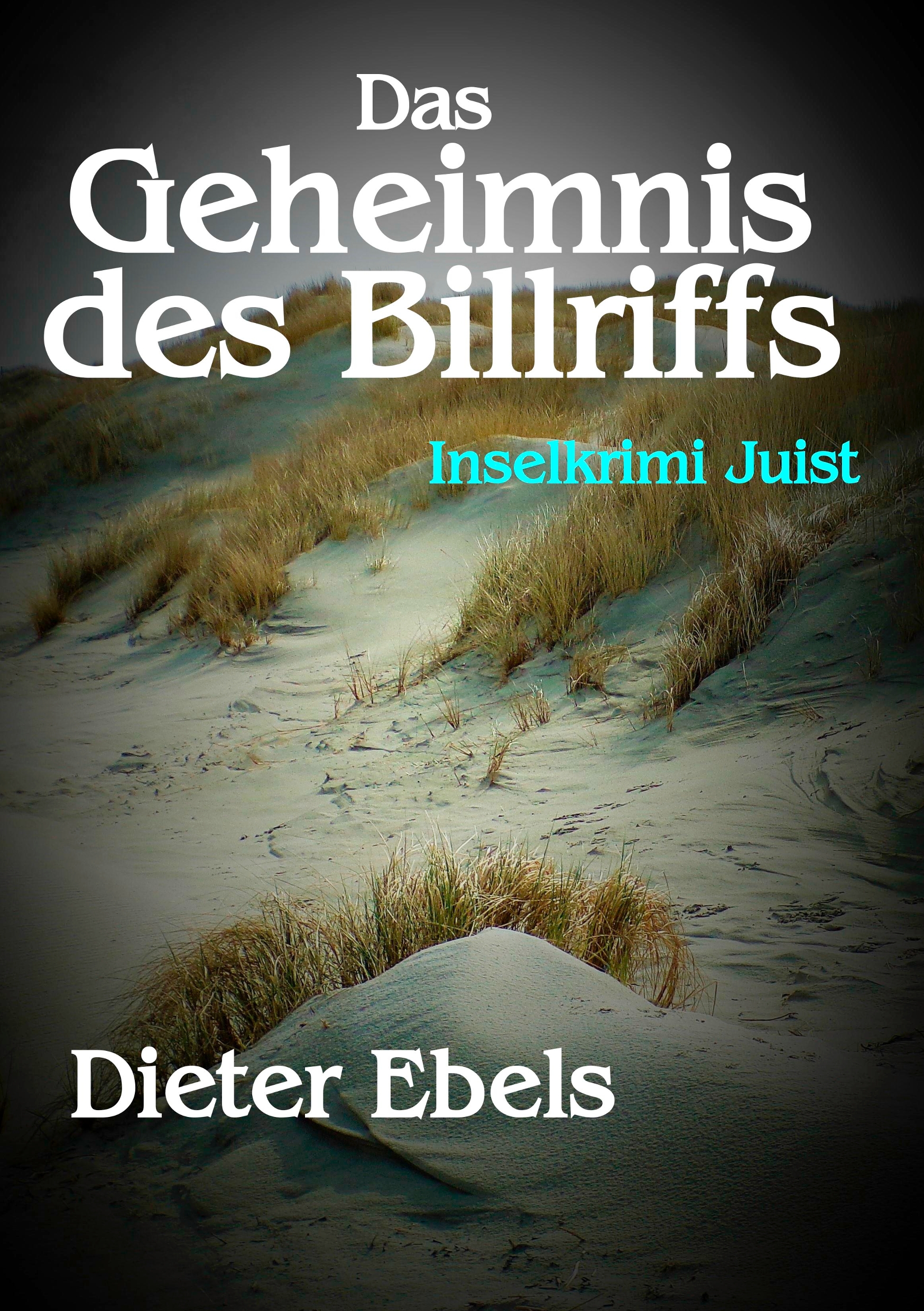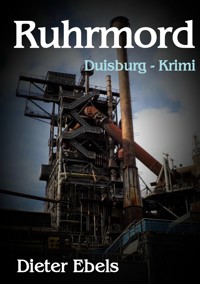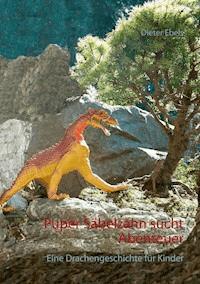Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Deutschland in den Jahren des Zweiten Weltkrieges. Besonders in den großen Industriestädten zermürben ständige Bombenangriffe die Bevölkerung. Not und Elend sind allgegenwärtig. Diese authentische Geschichte schildert die Kriegsjahre aus der Sicht des Mädchens Helene. Während Helenes Vater als Soldat im Krieg ist, erlebt sie zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern all die Grausamkeiten des Krieges. Als sie durch die Kinderlandverschickung nach Bayern kommt, kann sie die Kriegswirren für einige Zeit verdrängen, doch kaum kehrt sie nach Hause zurück, überschatten tragische Ereignisse ihr Leben. Eine erschütternde Geschichte, die tief unter die Haut geht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 742
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bereits kurz nach der Vorstellung auf der Frankfurter Buchmesse 2007 begeisterte diese authentische Geschichte die Leser. Der Klett-Verlag übernahm zu Lehrzwecken einen Teil des Originaltextes und veröffentlichte ihn in einem Geschichtsschulbuch für das 9. Schuljahr.
Neu überarbeitete Ausgabe
2018
Inhaltsverzeichnis
Helene - eine Kriegskindheit
Der erste Schultag
Der Jahreswechsel
Die Schicksalszeit
Die Kinderlandverschickung
Der Schicksalsschlag
Besuch aus der Heide
Familienurlaub
Frohe Weihnachten
1944 - Ein Schicksalsjahr
Helene - eine Kriegskindheit
Da saß sie nun vor mir, die alte Dame, die mir schon viele Geschichten aus ihrer Kindheit erzählt hat. Die Zeit, die sie als junges Mädchen erlebt hatte, brachte alles andere, als eine schöne Kinderzeit hervor. Gewiss, es gab auch einige recht lustige Anekdoten, doch das meiste von dem, was sie berichtete, war sehr erschütternd. Ich fragte mich, wie es die Frau nach einer solch schicksalsreichen Kinderzeit noch schaffte, dieses stete, liebenswürdige Lächeln in ihrem Gesicht zu behalten. Nur manchmal, wenn sie von den unsäglichen Grausamkeiten des Krieges erzählte, dann wurden ihre Augen feucht, dann lief auch ab und zu die eine oder andere Träne ihre Wangen hinab.
Ich hatte die Dame gefragt, ob ich ihre Geschichte aufschreiben durfte. Für einen Moment war das liebenswürdige Lächeln aus ihrem faltigen Gesicht verschwunden. Ihre Antwort war ein, eher zögerliches: „Ja“. Forschend blickte sie mich mit ihren glasigen Augen an.
„Warum wollen Sie meine Geschichte aufschreiben?“, fragte sie.
Ich sagte ihr, dass auch andere Menschen, besonders jüngere, erfahren sollten, wie grausam so ein Krieg ist und was die Leute damals alles durchmachen mussten. Die alte Dame nickte.
„Ja“, sagt sie noch einmal. „Ich werde Ihnen all meine Erinnerungen an die schrecklichen Tage des Krieges erzählen.“
Ihr Blick ging für einen Moment nach unten.
„Sie müssen mir aber eines versprechen“, meinte sie schließlich und schaute mich wieder an. „Wenn ich Ihnen meine Kindheit schildere, dann werde ich kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich werde auch von den Dingen berichten, über die man eigentlich niemals redet. Es gibt Einiges, das ich seit damals in mir trage und worüber ich noch mit keinem Menschen gesprochen habe, es sind Dinge, die mir wirklich sehr peinlich waren und immer noch peinlich sind. Damals bin ich sogar von einem Erwachsenen sexuell missbraucht worden, ohne dass es mir bewusst war. Ich möchte deshalb nicht, dass jemand meinen Namen erfährt. Auch die Namen der anderen Leute, von denen ich erzählen werde, dürfen Sie nicht nennen. Versprechen Sie mir das?“
Ich gab der Dame das Versprechen und sagte ihr, dass ich beim Niederschreiben der Geschichte, die Namen durch andere ersetzen würde. Ihren Vornamen allerdings, Helene, den sollte ich ruhig aufschreiben.
Der Blick der alten Dame ließ Nachdenklichkeit erkennen. Ihre grauen Haare wirkten, als sei sie gerade erst beim Frisör gewesen. Diese ordentliche Frisur war mir schon bei vorherigen Treffen mit ihr aufgefallen, genau wie ihre elegante Kleidung. Sie achtete ganz offensichtlich auch noch im Alter auf ein sehr gepflegtes Äußeres. Dennoch, da ich ihr wahres Alter kannte, wusste ich, dass sie gut zehn Jahre älter wirkte, als andere, gleichaltrige Frauen. Das war wohl der Tribut eines schicksalhaften Lebens.
„Also, junger Mann“, sagte sie, „was wollen Sie hören? Womit soll ich anfangen?“
„Wie weit können Sie denn noch zurück denken? Woran können Sie sich denn noch erinnern?“
Sie überlegte kurz. Dann sagte sie:
„Ich weiß noch, wie ich eingeschult wurde.“
„Gut“, meinte ich zu ihr und nahm meinen Block und meinen Stift zur Hand. „Dann erzählen Sie mal.“
Ich ahnte noch nicht, dass mir die Geschichte, die ich nun zu hören bekam, dermaßen unter die Haut gehen sollte, dass sie mir sogar die eine oder andere eine Gänsehaut bescheren würde.
Hier ist sie nun, die Geschichte einer alten Dame, deren Kindheit eigentlich nichts anderes war, als eine große Tragödie, die Geschichte von Helene:
Der erste Schultag
Ich höre noch genau, wie die Lehrerin meinen Namen aufrief:
„Helene Steinert.“
Ich stand auf und sagte laut:
„Hier!“
Während die Lehrerin, die hinter dem Pult saß, meine Anwesenheit notierte, setzte ich mich wieder hin. Es war mein erster Schultag. Vor mir, auf dem Tisch, lag meine neue Schiefertafel. Ich war stolz auf diese Schiefertafel, die ich von meinem Onkel Otto zur Einschulung bekommen hatte. Daneben hatte ich fein säuberlich meinen Griffel und den kleinen Schwamm gelegt. Der Schwamm war allerdings genauso wenig neu, wie mein Schulranzen. Diese Sachen gehörten vorher meinem ältesten Bruder Franz. Er hatte zum Geburtstag einen neuen Ranzen bekommen. Franz brauchte auch keine Schiefertafel mehr, denn er durfte in der Schule schon mit Tinte auf Papier schreiben.
Es war der Sommer des Jahres 1942. Ich war sieben Jahre alt. Eigentlich sollte ich schon im vorigen Jahr eingeschult werden, doch da ich lange Zeit schwer krank war, wurde die Einschulung um ein Jahr verschoben. Das Mädchen, welches neben mir auf der Schulbank saß, hatte nur eine gebrauchte Schiefertafel, deren eine Ecke schon etwas abgeschlagen war. Auch ihr Griffel war bereits auf die Hälfte herunter gespitzt worden. Ihre Kleidung wirkte ebenfalls sehr abgetragen. Das Gleiche galt auch für die meisten anderen Mädchen in der Klasse.
Es war Krieg und vielen Leuten ging es sehr schlecht. Wir wohnten im Duisburger Stadtteil Hamborn. Man sagte, uns Leuten aus der Großstadt gehe es besonders schlecht. Aber den Bauern, die auf dem Lande um die Stadt herum lebten, denen sollte es so richtig gut gehen. Nicht nur, weil diese von den Bombenangriffen, die in der letzten Zeit immer öfter die Städter zermürbten, verschont blieben, sondern weil sie sich selber versorgen konnten. Wie gesagt, an neue Kleidung war oft nicht zu denken. Da war es auch ganz normal, dass man die Kleidungsstücke seiner älteren Geschwister auftrug. Kein Mensch achtete darauf, dass der Rock verschlissen war oder dass auf den durchgescheuerten Ärmeln der Bluse, große Flicken, oft aus einem anderen Stoff, prangten. Auch ich hatte eine ältere Schwester. Sie hieß Ilse und war neun Jahre alt, zwei Jahre älter, als ich. Im Prinzip ging es mir so, wie allen anderen, die ältere Geschwister hatten. Auch ich musste die getragenen Sachen von Ilse, soweit sie noch nicht ganz verschlissen waren, auftragen. Aber heute, am Tage meiner Einschulung, da durfte ich mein neues Kleid anziehen. Auf dieses Kleid war ich besonders stolz, noch mehr als auf meine neue Schiefertafel. Meine Mutter hatte mir das Kleid selbst genäht. Mein Vater, der momentan als Soldat im Krieg war, arbeitete normalerweise im Wasserwerk und hatte dort einen wichtigen Posten. Er bekam guten Lohn und darum konnte meine Mutter immer etwas Geld weglegen. So konnte sie auch den Stoff für mein neues Kleid bezahlen. Ich durfte mit ihr in das Kaufhaus am Hamborner Altmarkt gehen und mir den Stoff für das Kleid selbst aussuchen. Als ich diesen Stoff im Kaufhaus liegen sah, weiß mit roten Streublümchen, da wusste ich sofort, dass daraus mein Kleid werden sollte.
Heute Morgen, als meine Mutter mich für den ersten Schultag herausputze, wollte ich gar nicht mehr vom Spiegel weggehen. Wie gut mir doch mein neues Kleid stand. Ich glaubte, das hübscheste Mädchen von allen zu sein. Das Mädchen, welches ich vor mir im Spiegel sah, war wie aus dem Bilderbuch. Es war mit einem weißen Kleid mit roten Blümchen bekleidet und trug schneeweiße Söckchen. Das Einzige, was dieses Bild etwas trübte, waren die schwarzen Lackschuhe, die doch schon arg zerkratzt wirkten. Obwohl sie mit Schuhwichse gewienert worden waren, konnte man ihnen die Jahre ansehen, in denen sie bereits von meiner Schwester Ilse getragen wurden. Wie immer, hatte Mutter meine langen, blonden Haare zu zwei ordentlichen Zöpfen geflochten.
Wenn ich mich so in meiner Klasse umsah, so musste ich feststellen, dass alle Mädchen heute Zöpfe trugen. Bei denen, die nicht ganz so lange Haare hatten, waren die Zöpfe dem entsprechend kurz.
Innerlich war ich aufgeregt, denn schließlich war der erste Schultag etwas ganz Besonderes. Mein Blick ging durch das Klassenzimmer. Vorne, hinter dem Pult der Lehrerin, war die große Tafel an der Wand. Die vier großen Fenster auf der linken Seite ließen den Raum sehr hell erscheinen. Alle Wände des Klassenzimmers wirkten etwas vergilbt. An der, den Fenstern gegenüber liegende Wand hing ein einziges Bild, ein Bild von Adolf Hitler, unserem Führer. Über der Tür musste bis vor kurzem ein Kreuz gehangen haben. Deutlich hob sich die weiße Form des Kreuzes von dem vergilbten Untergrund ab. Ich weiß nicht, woran es lag, aber der Raum strahlte irgendwie Kälte aus und erweckte Unbehagen in mir.
Nachdem die Lehrerin alle Schülerinnen der Klasse aufgerufen hatte, erklärte sie uns die Schulregeln. Dann durften die Mädchen, die es schon konnten, ihren Namen auf die Schiefertafel schreiben. Stolz schrieb ich in großen Buchstaben Helene auf meine Tafel. Es gab aber auch Mädchen, die das noch nicht konnten. Dafür waren andere in der Lage, sogar ihren Vor- und Nachnamen zu schreiben. Dann sagte die Lehrerin, dass sie in ihrer Klasse ganz besonders auf Zucht und Ordnung achte. Ein gutes deutsches Mädchen hat auch ein gutes Benehmen. So sollten wir immer gerade und aufrecht sitzen. Die Hände gehörten auf den Tisch und der Blick müsse stets nach vorne gerichtet sein. Wer etwas sagen wollte, der musste sich melden und nur wenn die Lehrerin es erlaubte, durfte geredet werden. Ansonsten war Stillschweigen und Aufpassen angesagt. Wenn unsere Lehrerin morgens in die Klasse kam, dann hatten wir aufzustehen und laut zu grüßen. Überhaupt, jedes Mal, wenn ein Erwachsener das Klassenzimmer betrat, mussten wir uns sofort von den Plätzen erheben.
Dann gab es für uns eine Überraschung. Die Lehrerin schickte ein Mädchen zum Schulhausmeister, um ihm zu sagen, dass er die Überraschung aus dem kühlen Keller holen soll. Erwartungsvoll saßen wir da. Dann ging die Tür auf und der Hausmeister kam mit einer Kiste, gefüllt mit vollen Milchflaschen herein. Frische Milch, die habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Jedes Mädchen bekam eine Flasche. Ich weiß heute noch, wie lecker mir diese Milch geschmeckt hat. Sie war so richtig kühl und erfrischend. Fast ohne die Flasche abzusetzen, trank ich die Milch aus. Es war einfach ein Genuss. Den anderen Mädchen ging es offenbar genauso, wie mir. Auch sie tranken gierig ihre Flaschen leer.
An den Namen meiner ersten Lehrerin kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Nur eines, das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte großen Respekt vor ihr und auch ein wenig Angst.
Als ich an diesem Tag die Schule verließ, erwartete meine Mutter mich bereits auf dem Schulhof.
Mutti hatte blonde, recht kurz geschnittene Haare, die immer etwas wellig waren. Das kam von den Lockenwicklern, die sie sich immer vor dem Zubettgehen in die Haare drehte. Sie trug ihr graues Alltagskleid. Ich fand, dass ich eine sehr hübsche Mutter hatte. Manche der Mütter, die ihre Kinder abholten, hatten nur Kittel an.
Freudig lief ich auf Mutti zu. Ich war froh, dass sie mich liebevoll in den Arm nahm, denn das, was ich am ersten Schultag gelernt hatte, bestand nur aus strengen Regeln und hatte mich doch etwas verunsichert. Einige Mädchen wurden von beiden Elternteilen von der Schule abgeholt, viele aber auch nur von der Mutter, weil der Vater entweder arbeiten war oder, wie mein Vater, als Soldat für das Vaterland gegen den Feind kämpfte. Meine Mutter merkte wohl, dass ich verunsichert war. Sie streichelte mir über den Kopf, zog mich an sich heran und drückte mich. Allerdings drückte sie mit Vorsicht. Sie war schwanger und um die Weihnachtszeit herum sollte das Kind geboren werden. Natürlich hatte sie mir erzählt, dass sie für Weihnachten den Klapperstorch bestellt hatte, damit ich noch ein Geschwisterchen bekomme. Mein großer Bruder Franz aber hatte mir ein großes Geheimnis anvertraut. Er sagte, dass es den Klapperstorch überhaupt nicht gibt und dass die Kinder aus dem Bauch der Mutter kommen. Natürlich habe ich das dem Franz geglaubt, denn ich hatte zu keinem so viel Vertrauen, wie zu ihm. Deshalb wusste ich auch, warum Mutter mich nicht so feste drückte. Das könnte dem kleinen Kind im Bauch ja weh tun.
Den Weg nach Hause genoss ich. Ich hatte das Gefühl, als waren alle Blicke nur auf mich und auf mein wunderschönes Kleid gerichtet. Vielleicht hatte ich es mir aber auch nur eingebildet. Schließlich bogen wir in unsere Straße ein. Die Straße verlief schnurgerade und wurde auf beiden Seiten von großen Mehrfamilienhäusern gesäumt. Hier standen nur Häuser mit mindestens drei Stockwerken. Stolz, wie ein Pfau, schritt ich neben meiner Mutter her.
Als wir zu Hause ankamen, da stand Frau Neubart vor der Haustür. Sie war unsere Nachbarin und wohnte in der vierten Etage, direkt über uns.
Als sie uns sah, meinte sie zu meiner Mutter:
„Frau Steinert, was haben Sie denn da für ein hübsches Mädchen mitgebracht? Ach, das ist ja die kleine Helene. Mit diesem schicken Kleid hätte ich sie ja fast nicht wieder erkannt.“
„So ein hübsches Mädchen habe ich ja noch nie gesehen“, kam eine Stimme von oben.
Es war die Oma Lohmann, die wie immer aus dem Fenster schaute. Eigentlich war diese Nachbarin noch gar nicht so alt, aber weil sie so ein faltiges Gesicht hatte, nannten alle Kinder sie Oma Lohmann. Diese Frau hatte nichts anderes zu tun, als den lieben langen Tag am Fenster zu sitzen. Dabei hatte sie stets ihre Katze auf dem Arm. Es war ein wirklich schönes Tier, weiß mit schwarzen und braunen Flecken.
„Du bist ja eine richtige Dame“, sagte sie zu mir.
Diese Worte erfüllten mich mit Stolz und ich stieg freudig die Treppen hinauf. Normalerweise hatte ich in unserem Treppenhaus immer so ein bedrückendes Gefühl. Das Treppenhaus war mir schon immer etwas unheimlich gewesen. Es hatte nur auf jeder halben Etage ein winzig kleines Fenster und es wurde niemals so richtig hell darin. Ja, es war bedrückend duster. Heute aber war mir das egal. Als wir oben in unserer Wohnung ankamen, da hätte ich mein weißes Kleid mit den roten Blümchen am liebsten nicht mehr ausgezogen. Doch leider wies Mutter mich an, das Kleid wieder in den Schrank zu hängen. Zum Essen sollte ich mir etwas anderes anziehen, weil das neue Kleid zu schade war. So ging ich in das Elternschlafzimmer, zog das Kleid aus und hängte es in den großen Kleiderschrank. Dann begab ich mich ins Kinderzimmer und zog mich um. Das Zimmer war sehr klein. Es hatte gerade Platz für den Schrank und für das Bett, in dem meine Schwester Ilse und ich schliefen. Das Zimmer meiner drei Brüder war etwas größer. Die drei hatten ein normales Bett und ein Etagenbett. Jeder hatte einen Schlafplatz für sich ganz alleine. Ich dagegen musste mit Ilse zusammen in einem Bett schlafen.
Bald saß die Familie in der Küche zu Tisch. Der Stuhl vor Kopf blieb leer, denn dort saß immer mein Vater. Jetzt, wo er weg war, wagte keiner es, sich auf diesen Stuhl zu setzen. Als ich den leeren Stuhl sah, musste ich an Papa denken. Wie gerne hätte ich ihn heute zu Hause gehabt. Wie mochte es ihn im fernen Frankreich wohl ergehen?
Auf der einen Seite des langen Tisches saß meine Mutter, daneben ich und neben mir die Ilse. Uns gegenüber saßen meine drei Brüder, Franz, Heinz und Hänschen. Franz war der älteste von ihnen. Er war zwölf. Seinen Vornamen hatte er von meinem Vater, der ebenfalls Franz hieß. Ich hatte zwar alle meine Geschwister lieb, aber irgendwie war Franz mein Lieblingsbruder. Neben ihm saß der zehnjährige Heinz und neben diesem saß Hänschen. Hänschen war der jüngste in der Familie. Er war erst vier.
Meine Schwester Ilse sah immer sehr lustig aus. Ihr Gesicht war von Sommersprossen übersät. Ilse hatte, genau wie ich, Zöpfe. Ihre waren aber viel länger als meine. Manchmal band sie jeden ihrer Zöpfe zu einer großen Schlaufe zusammen. Meine Mutter sagte dann immer, dass sie jetzt Affenschaukeln hat.
Meine Brüder waren alle drei blond und alle hatten den gleichen Haarschnitt, selbst das kleine Hänschen. Ihre Haare waren sehr kurz geschnitten und jeder von ihnen trug auf der linken Kopfseite einen kerzengeraden Scheitel. Der Frisör kostete uns zu viel, deshalb schnitt unsere Tante Heti ihnen immer die Haare.
Heute gab es Kartoffelsuppe. Der Reihe nach reichten wir Mutter die Teller an. Mit einer Schöpfkelle, von der die meiste Emaile schon abgesprungen war, löffelte sie das Essen aus einer großen Suppenschüssel auf die Teller. Als jeder von uns seinen gefüllten Teller vor sich stehen hatte, falteten alle die Hände. Mein ältester Bruder Franz sprach das Tischgebet.
„Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen.“
„Amen“, wiederholten alle.
Erst dann nahmen wir die Löffel auf, um zu essen.
Die Küche war der größte Raum unserer Vierzimmerwohnung. Sie bot ausreichend Platz für so eine große Familie wie wir. Genau in der Mitte war der Tisch. An der einen Wand stand ein großer Küchenschrank, der oben sogar eine Glasvitrine hatte. Dieser Schrank war schneeweiß. Neben dem Schrank befand sich noch ein kleines Tischchen mit einem Stuhl davor. Da hat mein Vater immer gesessen und Geld gezählt. Vater musste zwischendurch auch mal Außendienst machen und bei den Leuten das Wassergeld abkassieren. Auf dem kleinen Tisch hat er dann immer ganz viele Geldhäufchen gemacht. Auf der einen Tischseite stapelte er die Pfennigstücke und die Zweipfennigstücke. In der Mitte die Fünfpfennigstücke und die Groschen. Auf der anderen Seite war das Silbergeld. Oft schimpfte Vater auch darüber, dass einige Leute nicht pünktlich das Wassergeld bezahlten. Dann musste er ein zweites Mal zu ihnen. Wie gerne hätte ich meinen Vater jetzt schimpfen gehört, doch leider war er nicht da. Auf der anderen Seite der Küche war der Spülstein. Daneben war ebenfalls ein kleiner Tisch. Ganz in der Ecke stand der Ofen. Das Feuer in ihm brannte gerade nieder. Mutter entfachte es im Sommer nur mittags zum Essenkochen. Unsere Wohnung war für die damaligen Verhältnisse schon recht komfortabel, denn wir hatten einen zweiten Ofen im Wohnzimmer. Auf der anderen Flurseite unseres Hauses gab es nur Dreizimmerwohnungen. Diese hatten nur einen Ofenrohranschluss.
Nach dem Essen mussten meine Schwester Ilse und ich noch beim Abwasch helfen. Mutter spülte das Geschirr und wir trockneten es ab. Die drei Jungens waren nach draußen gegangen um zu bolzen. Eigentlich wäre ich nach dem Abwasch auch gerne raus gegangen, um zu spielen, aber Onkel Otto und Tante Heti wollten noch vorbeikommen und mir zum ersten Schultag gratulieren. Ich war aber nicht böse darüber, dass ich nicht nach draußen konnte, denn zur Feier des Tages durfte ich wieder mein neues Kleid anziehen.
Als die zwei endlich kamen, konnte ich das Kleid wieder stolz präsentieren und wie erwartet, erntete ich viel Lob darüber. Besonders Tante Heti sprach viel über das schöne Kleidchen. Sie war selbst immer so schick angezogen. Heti war eine sehr schöne Frau und meine Mutter sagte immer, dass sich alle Männer nach ihr umdrehen. Meine Mutter sah eigentlich immer gleich aus, Tante Heti aber hatte andauernd andere Frisuren. Auch ich fand sie sehr hübsch. Heti war Krankenschwester von Beruf. Sie arbeitete im Sankt Johannes Hospital. Das war ein riesig großes Krankenhaus bei uns in Hamborn. Ich mochte Tante Heti sehr gut leiden. Onkel Otto dagegen sah immer gleich aus. Er trug immer eine Uniform mit glänzenden Knöpfen und einer dicken Koppel am Gürtel. Onkel Otto war bei der SA. Jedes Mal, wenn er bei uns war, erzählte er, wie viel gute Dinge unser Führer doch für Deutschland tut. Er sagte, dass wir alle dem Führer dankbar sein müssten, weil noch nie jemand mehr für kinderreiche Familien getan hat.
Das Gleiche hatte mein Vater auch immer gesagt. Ich war allerdings damals anderer Meinung, denn weil mein Vater für den Führer im Krieg war, fehlte er der Familie. Ich vermisste meinen Vater sehr und ich wusste auch, dass meine Mutter abends im Bett oft heimlich weinte, weil Papa ihr fehlte. Doch ich hätte es niemals gewagt, meine Meinung laut auszusprechen. Onkel Otto war der Bruder meines Vaters. Heti und Otto hatten keine eigenen Kinder.
Zur Feier des Tages hatte mir Onkel Otto eine Tüte Bonbons mitgebracht. Er sagte, die Bonbons seien für die Einschulung und dafür, dass ich so ein gutes deutsches Mädchen sei.
Wie auch immer, natürlich habe ich mir sofort ein Bonbon in den Mund gesteckt. Eigentlich wollte ich meinen Geschwistern ein paar der Bonbons aufheben, doch diese waren so lecker, dass ich die ganze Tüte auf naschte.
Nach einiger Zeit aber hatte ich keine Lust mehr, mit den Erwachsenen im Wohnzimmer zu sitzen. Deshalb ging ich in das Schlafzimmer meiner Eltern. Dort war der große Spiegel an der Wand, vor dem ich schon heute Morgen so lange gestanden hatte. Nun stand ich wieder davor, um mich in meinem hübschen Kleid zu bewundern. Ich drehte mich nach allen Seiten und ich fand mich einfach todschick.
Während ich mich so spiegelte, merkte ich, wie es mit einem Mal in meinem Bauch zu brummeln anfing. Hatte ich vielleicht die Bonbons zu schnell herunter geschlungen? Oder lag es an der kalten Flasche Milch, die ich in der Schule so gierig geleert hatte? Zuerst machte ich mir keine großen Gedanken darüber und der Anblick des hübschen Mädchens dort im Spiegel ließ das Brummeln auch schnell vergessen. Doch plötzlich bekam ich ein fürchterliches Magendrücken. Es bollerte und blubberte in meinem Bauch. Mir wurde klar, dass ich jetzt doch besser zur Toilette gehen sollte.
Also verließ ich die Wohnung und ging in das Treppenhaus. Die Toilette lag eine habe Etage tiefer. Sie wurde von beiden Familien genutzt, die auf unserer Etage wohnten. Schnell war ich die Stufen hinab gestiegen und griff eilig die Klinke der Toilettentür. Doch die Tür war abgeschlossen.
„Besetzt.“, hörte ich eine weibliche Stimme sagen.
Es war die Stimme von Frau Masitz, unserer Nachbarin. Mein Magendrücken wurde immer stärker. Ohne zu zögern rannte ich die zwei Treppen hinunter, die zur nächsten Toilette führten. Doch es war, als hätte sich, was die Toiletten betraf, alles gegen mich verschworen. Auch dieses Klo war besetzt. Sicher, unten im Haus war noch eine weitere Toilette, doch diese konnte man schon seit Tagen nicht mehr benutzen, weil das Klo verstopft war und es niemanden gab, der die Sache in Ordnung brachte. Den Gestank daraus konnte man mittlerweile sogar durch die geschlossene Tür wahrnehmen. So verharrte ich abwartend vor der Toilettentür. Mittlerweile krümmte ich mich vor lauter Magendrücken und hüpfte unruhig von einem Bein auf das andere.
Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte:
„Entschuldigung, dauert es noch lange? Ich muss ganz nötig.“
Da hörte ich die Stimme des dicken Nachbarn aus dem ersten Stock. Er sagte durch die verschlossene Klotür, dass ich mich noch solange gedulden müsse, bis er seine Zeitung ausgelesen hat.
Das hatte mir noch gefehlt. Ich beschloss, wieder nach oben zur anderen Toilette zu gehen, um Frau Masitz zu fragen, ob sie sich bitte beeilen könnte. Doch nachdem ich die erste Treppe hinter mich gebracht hatte, geschah es. Ich konnte das, was da in mir so brodelte, nicht mehr halten. Begleitet von einem ekelig klingenden Blubbern, ging alles in die Hose und es stank fürchterlich. Wie versteinert stand ich da und wagte es nicht, mich zu bewegen. Wenn jetzt jemand kommt und mich so sieht, gar nicht auszudenken. Ich war verzweifelt. Dann aber ging ich vorsichtig Stufe für Stufe empor.
Wie sollte ich es Mutter sagen? Und dann war da ja auch noch Onkel Otto und Tante Heti. Was für eine Blamage.
Ich schlich mich leise in die Wohnung und ging direkt in mein Kinderzimmer. Von dem Gestank, der mich umgab, konnte einem übel werden.
Oh mein Gott, wie war mir das peinlich.
Doch es wurde noch schlimmer, denn als ich an mir herab blickte, da sah ich, dass es mir bereits an den Beinen herab lief. Oh mein Gott! Das Allerschlimmste war aber, dass auch mein neues Kleid versaut war, mein schönes weißes Kleid mit den roten Blümchen. Schließlich faste ich mir ein Herz und rief verhalten:
„Mutti?“
„Ja“, kam Mutters Stimme aus dem Wohnzimmer.
„Mutti, kannst du bitte einmal kommen?“
Als meine Mutter kam und sah, was geschehen war, erschrak sie. Sofort erzählte ich ihr von den besetzten Toiletten und dass ich einfach nicht mehr einhalten konnte. Meine Mutter ging ins Wohnzimmer und erzählte Onkel Otto und Tante Heti von meinem Missgeschick.
„Jetzt wissen es alle“, dachte ich laut. „Was für eine Blamage.“ Ich fragte mich, was die beiden jetzt wohl von mir dachten. Bestimmt würden sie es in der ganzen Verwandtschaft herum erzählen. Ich war blamiert.
Ich hörte, wie mein Onkel und meine Tante sich bei meiner Mutter verabschiedeten. Noch bevor die zwei aus der Tür waren, rief Onkel Otto:
„Das kommt davon, wenn man so gierig eine ganze Tüte Bonbons in sich hineinschlingt. Ein gutes deutsches Mädchen muss sich mäßigen können. Du musst eben noch viel lernen.“
Dann aber sagte Tante Heti laut:
„Du brauchst dich dafür nicht zu schämen, Helene. So etwas ist mir auch schon mal passiert.“
Das, was sie sagte, konnte ich irgendwie nicht glauben. Eine so schicke und schöne Frau, wie Tante Heti, macht sich doch nicht in die Hose. Nein, das glaubte ich ihr nicht. Wahrscheinlich wollte sie mich nur trösten.
Als ich später in der Zinkwanne saß, die Mutter extra aus dem Keller holen musste, versprach sie mir, niemanden etwas davon zu erzählen, nicht einmal meinen Geschwistern. Mutti hatte weder mit mir geschimpft, noch war sie mir böse. Ja, meine Mutter war eben der allerliebste Mensch, den man sich vorstellen konnte. Ich wusste, was für eine schwere Zeit sie durchmachte, so ganz alleine mit fünf Kindern. Sie ließ sich uns Kindern gegenüber auch nichts davon anmerken, wie sehr sie darunter litt, dass Papa nicht da war. Ja, Mutti war wirklich der allerbeste Mensch, den es auf der ganzen Welt gab.
Abends, als sie noch einmal an mein Bett kam, um mir einen Gutenachtkuss zu geben, da habe ich meine Arme um ihren Hals geschlungen und ihr gesagt, wie lieb ich sie habe. Sie schaute mich an und lächelte dabei, wie wohl nur eine liebende Mutter lächeln kann. Dann sagte sie leise:
„Ich hab dich auch lieb.“
Sie deckte mich liebevoll zu und gab mir noch einen Kuss auf meine Stirn. Da sah ich, wie Mutti versuchte, Tränen in ihren Augen vor mir zu verbergen.
Es dauerte noch sehr lange, bis ich an diesem Abend endlich eingeschlafen war.
Den Tag meiner Einschulung werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Der Jahreswechsel
Es war Anfang Dezember. Die Vorweihnachtszeit war sehr trostlos. Ich wusste, dass es die ersten Weihnachten ohne meinen Vater sein würden. Der Gedanke daran machte mich sehr traurig. Meinen Geschwistern, allen voran Heinz, ging es genauso. Als ich mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte, sagte sie mir, dass Vater am Heiligen Abend ganz fest an uns denken würde und wenn wir dann auch an ihn denken, dann wäre es fast so, als sei er da. Sie sagte mir auch, dass ich mittlerweile, ich war im August acht Jahre alt geworden, ja ein großes Mädchen sei und Vater recht traurig wäre, wenn wir Weihnachten nicht glücklich sind. Es war das erste Mal, dass die tröstenden Worte meiner Mutter bei mir ihre Wirkung verfehlten. Ohne Vater konnte es einfach kein glückliches Weihnachten geben.
In dieser Zeit saß ich oft auf meinem Bett und hielt die Postkarte in der Hand, die mir Vater zu meinem achten Geburtstag geschickt hatte, eine Postkarte aus dem fernen Frankreich. Obwohl diese Karte erst mit einer Woche Verspätung angekommen ist, war sie für mich das allerschönste Geburtstagsgeschenk. Vorne auf der Karte war das Bild vom Eiffelturm. Den sah ich mir immer wieder an. Ich wusste, wie riesig groß dieser Turm war, konnte es mir aber dennoch nicht vorstellen. Wenn man oben auf unserem Dachboden ist und aus dem kleinen Fenster schaut, dann konnte man den Gasometer von Bruckhausen sehen. Ich habe schon einmal direkt vor dem Gasometer gestanden. Er ist das größte Gebäude, was ich jemals gesehen habe, höher noch, als ein Kirchturm. Von meinem Vater wusste ich, dass es der größte Gasometer von ganz Deutschland war. Onkel Otto hat mir gesagt, dass der Eiffelturm in Paris fast viermal so hoch ist. Doch das konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
Ich war stolz auf diese Postkarte, genau so stolz, wie ich auf alles war, was mit meinem Vater zu tun hatte. Papa hat als Soldat sogar einen Orden bekommen, weil er zehn Kameraden vor dem Feind gerettet hatte. Dafür verlieh man ihm das Eiserne Kreuz, einen Orden, um den ihn alle beneideten. Das sagte wenigstens Onkel Otto, denn er war stolz auf seinen Bruder.
Wenn ich die Postkarte umdrehte, dann sah ich das, was mein Vater geschrieben hatte. Obwohl ich in der Schule immer eifrig lernte, konnte ich die Schrift meines Vaters nicht lesen. Sie war irgendwie zu schnörkelig. Natürlich wusste ich ganz genau, was dort geschrieben stand. Schließlich hatte Mutti es mir oft genug vorlesen müssen. Dort stand:
Mein liebes Helenchen, ich wünsche dir zu deinem Geburtstag alles Gute. Mir geht es sehr gut. Ich freue mich schon darauf, wenn ich endlich wieder bei euch sein kann. Dein Papa.
Darunter stand noch:
Ich habe euch alle sehr lieb.
„Ich habe dich auch lieb, Papa“, sagte ich leise.
Dann legte ich die Postkarte wieder unter mein Kopfkissen. Jeden Abend, wenn meine Mutter mich ins Bett gebracht hatte, holte ich die Karte noch einmal hervor und strich mit meinem Finger darüber.
„Gute Nacht, Papa“, flüsterte ich dann leise und schob die Postkarte wieder unter mein Kissen.
Meine Mutter versuchte in dieser Zeit, ihren Schwangerschaftsbauch so gut wie es eben ging zu verbergen. Sie trug nur sehr weite Kleider, das heißt, eigentlich trug sie immer nur ein und dasselbe Kleid. Jedes Mal, wenn sie merkte, dass eines von uns Kindern auf ihren dicken Bauch blickte, drehte sie sich von uns weg. Oft sagte sie auch, dass sie sehr durstig war und deshalb so viel Wasser trank, dass der Bauch anschwoll. Doch nur mein jüngster Bruder Hänschen nahm ihr diese Geschichte ab. Mutter erzählte auch immer, dass es ja nicht mehr lange dauern würde, bis das der Klapperstorch kommt und das bestellte Geschwisterchen bringt. Ich habe meinen Bruder Franz gefragt, warum keiner wissen durfte, dass unser Geschwisterchen in Muttis Bauch war. Doch Franz wusste es auch nicht.
Mein Bruder Franz hatte von Mutti Stubenarrest bekommen, weil er im letzten Monat wieder einen seiner bösen Streiche gespielt hat. Franz war überall berühmt und berüchtigt für seine Streiche. Doch seit Vater im Krieg war, hatte er sich noch gesteigert. Meine Mutter hatte es nicht leicht mit ihm. Nun hatte Franz einen ganzen Monat lang Stubenarrest bekommen und musste dazu noch den Kohledienst übernehmen. Das heißt, er musste, immer wenn es nötig war, in den Keller gehen und einen Eimer Kohle hinauf holen. Vorher hat es meistens meine Mutter ganz alleine gemacht. Manchmal, wenn er gerade zu Besuch war, ist aber auch Onkel Otto in den Keller gegangen. Nun musste Franz ganz alleine die Kohle holen und er durfte noch zusätzlich die Asche hinaus in die Tonne bringen. Das war er aber selber schuld.
Als letzen Monat der Kohlenhändler mit seinem Pferdewagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gestanden hat, da hatte Franz wieder eine seiner gemeinen Ideen. Wir saßen, zusammen mit einigen Kindern aus der Nachbarschaft, auf der Treppe unserer Haustür. Von dort aus sahen wir zu, wie der Kohlenhändler im gegenüberliegenden Haus verschwand. Nach einer Weile kam er wieder heraus, schob einen Keil unter die Tür, damit sie nicht zufiel und ging zu seinem Wagen. Der Kohlenhändler, den wir Kinder immer nur den „schwarzen Mann“ nannten, war wirklich so schwarz, wie Ruß. Ich kannte keinen anderen Menschen, der ein so schwarzes Gesicht und so schwarze Hände hatte. Sein Wagen war genau so schwarz und selbst die beiden Pferde, die den schweren Wagen immer zogen, sahen schmutzig aus. Der Mann schob einen großen Sack Kohle zum Ende der Landefläche. Dann stellte er sich darunter und zog sich den schweren Sack auf die Schulter, über die er vorher ein Leder gelegt hatte. Schließlich verschwand er mit dem Sack auf dem Rücken in der Haustür. Es dauerte sehr lange, bis er wieder heraus kam. Dann nahm er den nächsten Kohlensack und trug ihn wieder ins Haus.
Kaum war der Mann verschwunden, da sprang Franz auf und rannte zum Kohlenwagen. Mit einem Sprung war er auf dem Kutschbock und löste die Bremse. Dann kam er wieder herunter, fasste die Pferde am Zaumzeug und zupfte auffordernd daran, bis sich die beiden Tiere in Bewegung setzten. Er zog das Gespann auf unsere Straßenseite hinüber und führte es durch die große Toreinfahrt auf unseren Hinterhof.
Ich werde nie vergessen, was ich für eine Angst hatte. Wenn der schwarze Mann jetzt kommen würde, dann gäbe es für Franz bestimmt eine riesige Tracht Prügel. Vielleicht würde der schwarze Mann, der ja unheimlich stark war, meinen Bruder sogar totschlagen.
Franz aber führte das Gespann in aller Seelenruhe hinter einen der Schuppen. Was er dann tat, war noch gemeiner. Er knotete die langen Mähnen der beiden Pferde einfach miteinander eng und fest zusammen, so eng, dass die Tiere sich fast mit den Köpfen berührten.
Wir alle, das heißt, meine Geschwister Heinz, Ilse, Franz und ich, begleitet von drei Nachbarskindern, rannten in den Hausflur bis in die zweite Etage. Dort blickten wir abwartend aus dem Fenster zur Straße hinaus. Was würde der schwarze Mann machen, wenn er sah, dass sein Kohlenwagen verschwunden war? Wir alle hatten Angst. Nur Franz, der schien sich überhaupt nicht zu fürchten.
Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Kohlenhändler endlich heraus kam. Wie angewurzelt, blieb er stehen. Er schaute nach rechts und schaute nach links. Dann konnte man selbst durch dem Dreck auf seinem Gesicht sehen, wie er dunkelrot anlief.
„Welches Schwein war das?!“, hallte seine Stimme laut durch unsere Straße. „Welches Schwein war das?“
Der Mann rannte bis zur nächsten Straßenecke und blickte sich dort um.
Dann kam er wieder zurück gerannt.
Wir alle beobachteten ihn und hatten dabei riesige Angst, davor, dass er uns entdecken könnte. Nur mein Bruder Franz schlug sich vor Lachen auf die Knie.
Jetzt sahen wir, wie der schwarze Mann in die andere Richtung lief. Wir verloren ihn aus den Augen. Nach einer ganzen Weile kam er wieder zurück und ging in das Haus, in das er die Kohlen getragen hatte, um nach kurzer Zeit zusammen mit einer Frau wieder heraus zu kommen. Er gestikulierte wild mit den Händen.
Da wir hören wollten, was er zu der Frau sagte, öffneten wir das Flurfenster. Genau in dem Moment, wo wir das Fenster aufmachten, fiel der Blick des schwarzen Mannes genau auf uns. Ich war wie erstarrt und mir lief eine Gänsehaut über den Rücken. Der Kohlenhändler schaute aber sofort wieder weg.
Noch einmal gingen seine Augen suchend in beide Richtungen. Dann setzte er sich auf den Bordstein und schlug seine schmutzigen Hände vors schwarze Gesicht. Wir hörten seine verzweifelte und schluchzende Stimme bis zu uns hinauf:
„Sie haben mir alles gestohlen, meine Pferde, meinen Wagen, was soll ich jetzt tun? Nun hab ich nichts mehr.“
In diesem Moment tat er mir leid. Der Mann dort auf dem Bordstein war nicht mehr der starke schwarze Mann, vor dem wir immer etwas Angst hatten. Er wirkte jetzt, wie ein armer Bettler.
Ich wandte mich an meinen Bruder:
„Du bist ja so gemein, Franz. Warum hast du das getan?“
Aber Franz lachte nur.
Mein Blick ging wieder hinunter zu dem Mann, der da wie ein Häufchen Elend auf dem Bordstein saß. Er hielt immer noch das Gesicht in seinen Händen verborgen. Dabei schüttelte er leicht seinen Kopf. Ich empfand wirklich tiefstes Mitleid mit ihm.
Dann schaute ich wieder zu meinem Bruder, der immer noch gehässig lachte.
„Bitte, Franz“, sagte ich. „Bring ihm seinen Wagen wieder.“
„Damit er mich totschlägt?“, fuhr Franz mich an. „Bring du ihm doch den Wagen.“
Ich liebte meine Geschwister und ganz besonders Franz. Er war mein Lieblingsbruder. Doch in diesem Moment hasste ich ihn. Er konnte ja so gemein sein.
Dann sahen wir, wie aus der Haustür gegenüber ein älterer Mann kam. Er ging zu dem Kohlenhändler. Deutlich hörten wir seine Worte:
„Ihr Kohlenwagen ist drüben auf dem Hof. Die Kinder haben ihn durch die Einfahrt gezogen. Ich habe alles aus meinem Fenster heraus beobachtet.“
Dann zeigte der Mann auf das Flurfenster, aus dem wir schauten.
„Die da oben“, sagte er. „Die waren es gewesen.“
Blitzschnell zogen wir unsere Köpfe zurück. Dann rannten wir vor lauter Angst hinauf auf den Dachboden. In der äußersten Ecke des Bodens versteckten wir uns hinter einem alten Schrank.
„Wenn er uns erwischt“, meinte mein Bruder Heinz, der sogar in die Schranktür gekrochen war, „dann wird er uns mit seinen schwarzen Händen bestimmt erwürgen.“
Als ich das hörte, fing ich an, zu heulen. Es war Franz, der mich in den Arm nahm und versuchte, mich wieder zu beruhigen.
Ilse schimpfe mit mir:
„Wenn der schwarze Mann dein Heulen hört, dann findet er uns sofort.“
Alle verhielten sich ganz still. Wir warteten auf das, was bald passieren würde.
Nach einer sehr langen Wartezeit, die uns wie eine Ewigkeit erschien, vernahmen wir Schritte im Treppenhaus. Dann klopfte jemand an eine Wohnungstür. Jetzt vernahmen wir eine laut schimpfende Männerstimme.
Es war der schwarze Mann. Nun hörte ich auch die Stimme des Mannes, der uns an den Kohlenhändler verraten hatte und dann vernahm ich die Stimme meiner Mutter. Das Geschrei im Treppenhaus schien überhaupt nicht mehr aufzuhören.
„Diesem Kerl von drüben“, sagte Franz leise, „der uns verraten hat, dem werden wir zur Strafe ein Fenster einschlagen.“
„Er hat uns nicht verraten“, flüsterte einer der Nachbarsjungen. „Er hat dich verraten, Franz. Wir haben ja überhaupt nichts getan.“
Wir alle wussten, dass er recht hatte. Franz ganz alleine hatte uns diese Suppe eingebrockt. Er sollte sie auch alleine auslöffeln.
Obwohl sich alle, außer Franz, ihrer Unschuld bewusst waren, blieben wir ängstlich in unserem Versteck. Auch als die Männer laut polternd das Treppenhaus wieder verlassen hatten, trauten wir uns noch nicht hinaus.
Ich glaube es waren einige Stunden, die wir dort saßen.
Dann kam jemand die Treppe hoch und betrat den Dachboden. An den Schritten erkannten wir, dass da jemand zielsicher auf unser Versteck zuhielt. Wir duckten uns ängstlich zusammen. Wer konnte wissen, dass wir hier waren? Eigentlich kannten nur wir Kinder dieses Versteck.
Es war meine Mutter, die da mit einem Mal vor uns stand. Sie hatte ihre Hände in die Hüften gestützt und schaute sehr böse drein. Ihr wütender Blick ging an uns allen vorbei und traf nur Franz.
Jetzt erfuhren wir, dass der Kohlenhändler die Knoten aus den Pferdemähnen nicht mehr heraus bekommen hatte. Er musste einen Teil der langen Mähnen mit der Schere abschneiden. Als Entschädigung hatte er von meiner Mutter fünf Mark verlangt und als der Nachbar von Gegenüber ihr bestätigte, dass unser Franz der Übeltäter war, da hat sie dem Kohlenhändler die fünf Mark auch gegeben. Fünf Mark, das war eine Menge Geld für uns.
Ja, mit meinem Bruder Franz, da hatte Mutti wirklich ein schweres Los gezogen.
Am Abend hatte ich gehört, wie meine Mutter sich mit Frau Neubart, unserer Nachbarin von oben, im Treppenhaus unterhalten hat. Mutti klagte über das Leid, welches sie durch das Benehmen von meinem ältesten Bruder ertragen musste.
Nun hat Franz den ganzen Dezember lang Stubenarrest.
Die Dezembertage zogen so unendlich langsam dahin, wie noch nie.
Einen Sonntag werde ich niemals vergessen. Es war der zweite Advent.
Wir saßen abends mit der ganzen Familie in der Küche. Tante Heti war auch da. Auf dem Tisch brannte eine Kerze und alle sangen Weihnachtslieder. Es war einer der wenigen Momente, in denen man all den Kummer vergaß. Mutti und Tante Heti saßen mir direkt gegenüber. Die Beiden konnten sehr gut singen. Ihre Stimmen klangen einfach wunderschön und wenn sie manche Lieder auch noch zweistimmig sangen, dann bekam man eine Gänsehaut.
An diesem Abend gab es für uns noch eine große Überraschung. Tante Heti stellte ihre Tasche auf den Tisch und griff hinein. Sie zauberte drei Äpfel daraus empor, drei wunderschöne, rote Äpfel. Dann nahm sie ein Messer aus der Schublade des Küchentischs und zerteilte jeden Apfel in
zwei Hälften. Mit den Worten: „Guten Appetit Kinder“, legte sie vor jedem eine Apfelhälfte auf den Tisch. Die andere Hälfte meines Apfels aß meine Mutter, die mir direkt gegenüber saß. Den leckeren Geschmack dieser Äpfel habe ich bis heute nicht vergessen. Es war lange her, dass ich einen Apfel gegessen hatte. Nach dem großen Apfelessen wurden wieder Weihnachtslieder gesungen. Tante Heti stimmte „Oh du fröhliche“ an. Danach wurde zum Abschluss des Abends noch das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen. Das war ein sehr feierlicher Moment. Wir alle standen auf, gaben uns die Hände und sangen. Ich blickte dabei auf den hellen Schein der Kerze. Bisher hatte sie unruhig hin und her geflackert.
Jetzt aber, wo wir „Stille Nacht“ sangen, brannte auch die Kerze ganz ruhig. Die Flamme schien sich kaum zu bewegen. Es war, als ob selbst die Kerze vor Ehrfurcht ergriffen war. Mir lief ein wohliger Schauer über den Rücken.
Dann aber geschah etwas ganz Schreckliches. Während wir die letzte Strophe sangen, brach Mutti plötzlich zusammen. Sie fiel einfach auf den Boden und blieb liegen.
„Mutti!“, hörte ich mich laut schreien.
Eilig lief ich um den Tisch herum. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals vorher im Leben eine solche Angst gehabt zu haben. Als ich bei Mutti war, standen meine Geschwister schon bei ihr. Hänschen weinte laut und rief immer:
„Mutti! Mutti!“
Hilfe suchend ging mein Blick zu Franz. Er war der große Bruder, er würde alles wieder gut machen. Doch das, was ich in seinen Augen sah, war nur Entsetzen und Hilflosigkeit.
Ich schaute wieder zu Boden, sah aber nur die Beine meiner Mutter.
Tante Heti, Heinz und Ilse versperrten mir die Sicht. Erst als Tante Heti meine Geschwister zur Seite schob, konnte ich Muttis Gesicht sehen. Ihre Augen waren geschlossen. Sie lag ganz regungslos da.
Ich sah, wie Tante Heti Muttis Puls fühlte. In diesem Moment war es ganz still. Keiner sagte etwas. Nur das leise Schluchzen von Hänschen war zu hören. Wenn jetzt noch jemand helfen konnte, dann war es Heti. Sie war schließlich Krankenschwester. Immer noch hielt sie Muttis Handgelenk fest.
„Ist sie tot?“
Es war Franz, der das fragte.
Ich hörte mich laut schlucken. Mir wurde schlecht. Wie konnte Franz so etwas fragen?
Tante Heti legte Muttis Arm vorsichtig auf den Boden.
„Sie ist nicht tot“, sagte sie.
Bei diesen Worten fielen mir tausend Steine vom Herzen. Dennoch war die Angst um meine Mutter noch nicht verschwunden.
„Helene“, sagte Heti zu mir. „Geh und hole mir ein Kissen.“
Dann wandte Tante Heti sich an Franz.
„Los Franz, laufe zum Doktor. Klopf solange an seine Tür, bis er aufmacht. Sage ihm, dass deine hochschwangere Mutter zusammen gebrochen ist. Er soll so schnell kommen, wie er nur kann. Los, beeil dich.“
Als ich mit dem Kissen in die Küche kam, hörte ich noch, wie Franz mit polternden Schritten die Treppen hinunter rannte. Auch Heinz hatte die Wohnung verlassen. Heti hatte ihn nach oben zu Frau Neubart, die über uns wohnte, geschickt.
Wir legten das Kissen unter Muttis Kopf. Sie hatte sich immer noch nicht bewegt.
Mittlerweile weinten alle, außer Tante Heti. Es war fürchterlich. Ach, wäre Papa doch nur hier. Der wusste immer, was zu tun war. Außerdem würde Mutti niemals umfallen, wenn Papa hier wäre. Daran glaubte ich ganz fest. Aber Papa war nicht da. Ich blickte meine weinenden Geschwister an und fühlte mich verloren. Dass ich selber bitterlich weinte, das war mir gar nicht bewusst.
Als Heinz mit Frau Neubart kam, fragte diese ganz aufgeregt, was passiert sei. Tante Heti sagte, dass Franz bereits den Arzt holt.
Gemeinsam trugen die zwei Frauen meine Mutter ins Schlafzimmer und legte sie vorsichtig auf das Bett.
Wir Kinder blieben in der Küche sitzen.
Vor uns, auf dem Tisch, brannte noch die Kerze. Ich konnte das alles nicht begreifen. Der Abend war doch so schön gewesen. Wir hatten extra Weihnachtslieder für das Christkind gesungen. Warum tat der liebe Gott uns dann so etwas an?
Ich blickte zu Ilse, zu Heinz und zum kleinen Hänschen.
Was passiert, wenn sie doch stirbt? Dann hätten wir keine Mutti mehr und wären ganz alleine. Bei diesem Gedanken begann ich fürchterlich zu weinen, so laut, dass Frau Neubart aus dem Schlafzimmer kam, um mich zu trösten. Ein Weinkrampf nach dem anderen schüttelte mich durch. So sehr sich Frau Neubart auch um mich bemühte, sie konnte mich nicht beruhigen.
Als ich dann schließlich nur noch vor mich hin schluchzte, hörte ich, wie Heinz sagte:
„Wann kommt denn endlich der Doktor?“
Natürlich wussten wir alle, wie weit der Doktor von uns weg wohnte.
Selbst wenn Franz schnell gerannt war, dann würde er doch noch eine gute viertel Stunde brauchen, um den Arzt zu erreichen.
Frau Neubart strich mir immer noch mit der Hand tröstend über mein Haar. Ich mochte sie sehr gut leiden. Es war die beste Nachbarin, die wir hatten. Sie war immer da, wenn man jemanden brauchte. Alle aus unserem Haus mochten sie. Frau Neubart hat es nicht immer leicht gehabt hat. Seit einem Jahr war sie Witwe. Herr Neubart hatte im Rathaus bei der Meldebehörde gearbeitet. Er war dort sogar der Abteilungsleiter gewesen. Dann hatte man ihn in seinem Kantor tot aufgefunden, Herzschlag. Tagelang hatten wir das laute Weinen von Frau Neubart gehört. Es drang von oben durch die Decke. Jetzt aber war sie wohl darüber weg. Wenigstens ließ sie sich nichts mehr anmerken.
Nach einer schier endlos erscheinenden Zeit hörten wir den Motor eines Automobils. Endlich war der Doktor da.
Nachdem er Mutti untersucht hatte, sprach er lange mit Tante Heti. Wir saßen noch immer, zusammen mit Frau Neubart, in der Küche, voller Hoffnung, dass der Doktor gleich mit einer positiven Nachricht aus dem Schlafzimmer kommen würde.
Nun hörten wir Hetis Stimme.
„Frau Neubart“, sagte sie. „Würden Sie bitte einmal ins Schlafzimmer kommen?“
Wortlos stand die Angesprochene auf und verließ die Küche.
Meine Angst um Mutti wurde nun noch größer. Warum hatten sie Frau Neubart gerufen? Steht es etwa schlimm um Mutti?
Da saßen wir nun rund um den Küchentisch und warteten. Als ich in die Gesichter meiner Geschwister sah, wusste ich, dass sie alle die gleiche Angst durchlebten. Ich blickte in tränengefüllte Augen. Das kleine Hänschen saß auf Ilses Schoß und schluchzte. Heinz blickte mir kurz in die Augen und legte dann den Kopf seitlich auf seine auf dem Tisch verschränkten Arme.
Franz, der neben mir saß, schaute unentwegt zu der Tür, durch die Frau Neubart gerade verschwunden war. Ich sah, wie eine Träne über seine Wange hinab kullerte. Verunsichert nahm ich seine Hand und hielt sie fest. Meinen Kopf legte ich Hilfe suchend an seine Schulter.
„Ich habe solche Angst, Franz“, sagte ich. „Meinst du, dass es schlimm um Mutti steht?“
„Du brauchst keine Angst zu haben“, versuchte er mich zu trösten. „Es wird alles wieder gut, ganz bestimmt.“
Mir war durchaus bewusst, dass mein Bruder ebenfalls Angst hatte und überhaupt nicht wusste, wie es um Mutti stand. Dennoch beruhigten seine Worte mich etwas. In diesem Moment war ich so froh, dass er da war und dass ich meinen Kopf an seine Schulter lehnen konnte.
Es war für uns alle eine schlimme Situation. Niemand dachte jetzt mehr an die Gemeinheit, die Franz dem Kohlenhändler zugefügt hatte und niemand dachte mehr daran, wie schön und besinnlich das Weihnachtsliedersingen vorhin gewesen war. Auch wenn ich den leckeren Apfelgeschmack immer noch im Mund hatte, im Moment war alles vergessen.
Als Frau Neubart und Tante Heti wieder in die Küche kamen, blickten wir die beiden erwartungsvoll an.
„Hört zu, Kinder“, begann Tante Heti. „Eurer Mutter geht es gut. Sie ist wieder aufgewacht.“
Hätte man in diesem Moment die Steine purzeln hören, die uns allen von den Herzen fielen, dann wäre das Gepolter groß gewesen. Mutti war wieder wach!
„Der Doktor sagt aber“, sprach Heti weiter, „dass sie sehr viel Ruhe braucht. Deshalb wird er sie gleich mit seinem Automobil ins Krankenhaus bringen.“
„Dann sind wir ja ganz alleine“, empörte sich das kleine Hänschen.
„Nein, Kinder, ihr seid nicht alleine. Frau Neubart wird bei euch bleiben.
Sie hat sich dazu bereit erklärt, solange für euch zu sorgen, bis eure Mutter wieder nach Hause kommt. Onkel Otto und ich werden auch oft vorbeikommen, um nach euch zu sehen.“
„Ich will nicht, dass Mutti ins Krankenhaus kommt!“, rief Hänschen.
Er begann wieder, zu weinen. Ilse, auf deren Schoß er saß, versuchte vergeblich, ihn zu beruhigen. Wie sollte man auch einem Vierjährigen beibringen, dass seine Mutter von zu Hause weg soll?
Nun kam der Doktor in die Küche. Dr. Phillip war für einen Mann recht klein geraten. Er war auch ziemlich schmächtig. Dennoch hatten alle Leute großen Respekt vor ihm. Das lag einzig und alleine daran, dass er ein Arzt mit Leib und Seele war. Der gute Mann kannte keinen Feierabend. Er war eigentlich immer im Dienst. Außerhalb seiner Sprechstundenzeit machte er grundsätzlich Hausbesuche bei seinen Patienten und das auch am Wochenende. Wenn man ihn brauchte, dann war er da, und wenn es mitten in der Nacht war. Tante Heti wusste ein Lied davon zu erzählen, wie andere Ärzte sind. Einmal, als es Onkel Otto sehr schlecht ergangen war und er tagelang mit ganz hohem Fieber zu Bett lag, da war unser Dr. Philip selbst schwer krank. Er lang zu dieser Zeit sogar im Krankenhaus. Natürlich wurde er von einem anderen Arzt vertreten, doch als Heti diesen nachts holen wollte, weil das Fieber von ihrem Mann die 41 Gradgrenze überschritten hatte, machte dieser Doktor nicht die Tür auf. Tante Heti hatte durch das Fenster gesehen, dass er zu Hause war und kräftig gegen seine Tür geklopft. Als er dann schließ-lich doch öffnete, sagte er zu meiner Tante, dass er jetzt keinen Dienst hat und sie Onkel Otto mit einer Droschke zum Krankenhaus fahren sollte.
Unser Doktor Phillip würde so etwas niemals machen. Das wussten alle und deshalb war er auch so ein beliebter Mensch.
Dr. Phillip stellte sich vor uns und blickt mit müden Augen in die Runde.
„Also, Kinder“, sagte er. „Eure Mutter muss für ein paar Tage ins Krankenhaus. Mit etwas Glück habt ihr sie aber schnell wieder. Das Wichtigste, was eure Mutter jetzt braucht, das ist Ruhe, sehr viel Ruhe. Wenn ich euch so betrachte, dann weiß ich mit Sicherheit, dass sie zu Hause bei euch keine Ruhe hat. Wisst ihr, Kinder, ich kann mich noch daran erinnern, als meine eigenen Kinder so alt waren, wie ihr es jetzt seid. Da hatte meine Frau auch niemals Ruhe, egal, wie lieb die Kinder waren.“
Er wandte sich an Frau Neubart.
„Ich denke, dass Sie die Kinder für ein paar Tage gut versorgen können, Frau Neubart. Es ist ja nicht für all zu lange.“
Frau Neubart lächelte und meinte:
„Wissen Sie, Herr Doktor, und wenn es Wochen wären, für Frau Steinert würde ich alles tun. Außerdem glaube ich, dass die Kinder besonders lieb sind, wenn ihre Mutti nicht da ist.“
Sie blickte uns an.
„Das stimmt doch, Kinder, oder?“
Franz war der einzige, der antwortete.
„Ja, Frau Neubart, das stimmt. Und ich verspreche Ihnen, dass ich in der ganzen Zeit nicht einen einzigen Streich spielen werde.“
Der Arzt nickte zufrieden und packte sein Stethoskop, welches er gerade noch um den Hals getragen hatte, in seine schwarze Tasche.
„Na dann, Kinder“, sagte er, „geht euch von eurer Mutter verabschieden, aber einer nach dem anderen. Und vergesst nicht, leise zu sein. Eure Mutter ist zwar wieder bei Bewusstsein, aber sie ist noch sehr schwach.
Zeigt ihr, dass ihre Kinder schon groß sind und sie sich keine Sorgen machen braucht.“
Dann kam der Abschied von Mutti.
Ilse ging als erstes ins Schlafzimmer. Sie durfte zusammen mit Hänschen hinein gehen. Als sie nach einigen Minuten wieder heraus kamen, weinte Hänschen wieder. Der Kleine tat mir ja so leid. Er konnte nicht verstehen, warum Mutti weg musste.
Dann schickte der Arzt mich zu Mutti. Vorsichtig und leise betrat ich das Elternschlafzimmer. Da lag Mutti auf dem Bett. Ihr Gesicht wirkte sehr blass. Als sie mich sah, da lächelte sie. Es war ein sehr gequältes Lächeln, aber sie lächelte.
„Komm her, mein Schatz“, sagte sie mit müder Stimme. „Setzt dich zu mir.“
Ich setzte mich auf die Bettkante.
Mutti nahm meine Hand und blickte mir verschlafen in die Augen.
„Du brauchst dir keine Sorgen um mich zu machen“, meinte sie. „Der Doktor hat gesagt, dass es nichts Schlimmes ist. Ich brauche nur ein paar Tage Ruhe und dann komme ich wieder ganz schnell zu euch nach Hause.“
Sie hob ihre Hand und streichelte mir über die Wange.
„Du musst mir etwas versprechen“, sprach sie weiter. „Wenn ich weg bin, dann seid bitte lieb und achtet gegenseitig auf euch. Hört auf das, was euch Frau Neubart sagt.“
„Ja, Mutti, das werden wir ganz bestimmt tun.“
„Und wenn ich wieder komme, dann feiern wir ein schönes Weihnachtsfest.“
„Ja, Mutti, das wird bestimmst sehr schön.“
Mutti lächelte mich wieder liebevoll an.
„Komm, Helene, gib mir noch einen Kuss und dann sollen die Großen zu mir kommen“
Mit „die Großen“ meinte sie meine beiden älteren Brüder. Sie nannte sie immer so.
Ich beugte mich vor und gab ihr einen Kuss.
„Tschüss, Mutti.“
„Tschüss, Helene. Ich bin schon bald wieder da, du wirst sehen.“
Das Gefühl, welches ich hatte, als ich das Schlafzimmer verließ, kann ich nicht beschreiben. Ich hatte Magenschmerzen, mir war schlecht und total schwindelig.
Als sich auch meine großen Brüder von Mutti verabschiedet hatten, brachten Dr. Phillip und Tante Heti meine Mutter hinunter zum Automobil des Doktors. Wir alle standen noch so lange oben am Küchenfenster, bis wir das Auto nicht mehr sahen.
Danach saßen alle wieder in der Küche.
Mir war immer noch schlecht und bald merkte ich, dass ich mich übergeben musste. Schnell verließ ich die Wohnung und rannte die Treppe hinunter zur Toilette. Ich erreichte sie im allerletzten Moment.
Als ich wieder nach oben in die Wohnung ging, führte mich mein Weg zuerst ins Schlafzimmer, weil ich von dort Geräusche gehört hatte. Es war Tante Heti, die gerade dabei war, das Bett von Mutti abzuziehen. Das, was ich dann sah, versetzte mir den nächsten Schock. Genau in der Mitte auf Muttis Bettlaken, war ein riesengroßer, roter Fleck. Ich erkannte sofort, dass es Blut war.
Meine Tante schaute mich an und hatte sofort meinen entsetzten Gesichtsausdruck gesehen.
„Was hast du, Helene?“
Sie bemerkte, dass meine Augen auf den Blutfleck gerichtet waren.
„Ach“, sagte sie, „du guckst wegen diesem Fleck so komisch. Da ist dem Doktor vorhin aus Versehen eine Flasche mit Jod umgekippt. Jetzt ist das ganze Bett versaut.“
Für einen kurzen Moment glaubte ich ihr. Dann aber dachte ich daran, dass Mutti ja genau dort gelegen hatte, wo jetzt dieser Fleck war. Wenn also der Doktor eine Flasche Jod umgeschüttet hätte, dann wäre es über meine Mutter gelaufen und nicht auf das Bett unter ihr. Nun wusste ich, dass Tante Heti gelogen hatte. Ich sollte nicht erfahren, dass es Blut war.
Wortlos verließ ich den Raum und ging wieder in die Küche zu den anderen. Mir war schon wieder schlecht.
Ich glaube, es war einer der längsten Abende in meinem Leben. Es wollte und wollte nicht später werden. Und auch, als ich dann ins Bett ging, da wollte die Zeit nicht vergehen. Ich dachte nur an Mutti. Wie würde es ihr im Krankenhaus jetzt wohl gehen? In meinen Gedanken sah ich wieder diesen riesigen Blutfleck, der mitten auf Muttis Bettlaken war. Unwillkürlich faltete ich meine Hände und begann zu beten:
„Lieber Gott, mach dass meine Mutti schnell wieder gesund wird. Bitte, bitte, lieber Gott, mache sie wieder gesund.“
Ich lag ganz alleine im Bett. Meine Schwester Ilse war noch in der Küche bei meinen Brüdern.
Das Beten hatte mich für einen Moment abgelenkt, doch dann sah ich immer wieder den Blutfleck vor mir. Ich kann nicht mehr sagen, wie viele Stunden ich noch wach gelegen hatte, aber irgendwann bin ich schließlich doch eingeschlafen. Ich habe nicht mehr gemerkt, als Ilse zu mir ins Bett gekrochen ist.
Als ich morgens wach wurde, da war es schon hell. Meine ersten Gedanken waren wieder bei meiner Mutter.
Neben mir lag die Ilse. Sie schlief noch tief und fest.
Dann aber erschrak ich. Es war schon hell! Ich hatte verschlafen.
Eigentlich müsste ich doch schon in der Schule sein. Ich sprang auf und lief mit nackten Füßen in die Küche. Dort saßen Heinz und Franz am Tisch.
„Ich habe verschlafen“, sagte ich zu ihnen. „Jetzt wird die Lehrerin schimpfen.“
Franz blickte mich an und meinte:
„Deine Lehrerin wird nicht schimpfen. Ich war heute Morgen schon in der Schule. Frau Neubart hat mich mit einem Zettel dorthin geschickt, den der Doktor geschrieben hat. Wir brauchen zwei Tage nicht in die Schule gehen, weil Mutti im Krankenhaus ist.“
„Wo ist Hänschen und wo ist Frau Neubart?“, fragte ich.
„Hänschen schläft noch und Frau Neubart ist unten in der Waschküche.“
Ich setzte mich zu meinen Brüdern. Der Tisch war schon gedeckt. Dort standen fünf Teller und auf jedem Teller lag eine Scheibe Brot.
Meine beiden großen Brüder waren schon dabei, sich die Brote zu schmieren. Auch ich nahm meine Scheibe Brot und griff nach dem großen Glas mit Rübenkraut, welches mitten auf dem Küchentisch stand.
Eigentlich aß ich gerne eine Schnitte mit Rübenkraut, aber heute Morgen wollte es einfach nicht schmecken.
Dann hörte ich, wie die Wohnungstür aufging. Frau Neubart kam herein.
Sie hatte einen grauen Kittel an. Um ihre Haare hatte sie sich ein buntgeblümtes Tuch gewickelt.
„Gut, dass du schon wach bist, Helene“, sagte sie. „Du kannst mir gleich nach dem Frühstück beim Waschen helfen. Ich habe das Feuer im Kessel schon angemacht, damit wir mit der Kochwäsche früh fertig sind.“
Eigentlich hatte ich ja überhaupt keine Lust, beim Waschen zu helfen.
Aber ich habe Mutti ja gestern versprochen lieb zu sein und auf Frau Neubart zu hören.
„Weißt du“, fragte Frau Neubart, „wo deine Mutter das Waschmittel stehen hat?“
„Es steht in der Kammer.“
Sie holte das Waschmittel und verließ wieder die Wohnung.
Ich aß noch zu Ende. Dann wusch ich mich und zog mich an. Schließlich ging ich hinunter in die Waschküche zu Frau Neubart.
Als ich die Waschküchentür aufmachte, kam mir eine dichte Dampfwolke entgegen. In der Waschküche konnte man im wahrsten Sinne des Wortes seine Hand nicht mehr vor den Augen sehen.
„Helene? Bist du das?“, hörte ich die Stimme von Frau Neubart durch die Nebelwolke.
„Ja.“
„Ich habe den ersten Schwung Wäsche schon in das Spülbecken gelegt.
Du kannst sie ja schon einmal durchspülen.“
Zielsicher ging ich durch die dichten Rauchschwaden zu den beiden großen, viereckigen Spülbecken hinüber. Ich hatte meiner Mutter schon oft dabei geholfen, die Wäsche auszuspülen. Es war eine ganz schön anstrengende Arbeit, aber als Mädchen musste man das ja lernen.
Außerdem hatte ich meiner Mutter immer gerne geholfen.
So rührte ich mit einem großen Holzstab im Spülbecken herum.
Schließlich zog ich die einzelnen Wäschestücke heraus, um sie in das andere Spülbecken zu legen. Dort gab es dann die zweite Spülung.
Frau Neubart hatte heute Morgen wohl schon eine Menge Wäsche gewaschen, denn sie stand vor dem großen Wäschewringer und drehte an der Kurbel. Auch ich hatte schon ein paar Mal ausprobiert, die Kurbel der Wringmaschine zu drehen, aber das war mir zu schwer. Selbst meine ältere Schwester Ilse schaffte es kaum, die Kurbel zu drehen. Um zu wringen, musste man viel Kraft haben.
Bald hatten sich die dichten Schwaden aus weißem Dampf wieder gelegt.
Es wurde später Vormittag, bis wir mit dem Waschen fertig waren.
Mittlerweile war auch Ilse zu uns gekommen. Sie musste mithelfen, die schweren Wäschekörbe ganz nach oben auf den Dachboden zu tragen.
Dort wurde die Wäsche dann zum Trocknen auf die langen Leinen gehängt.
Als wir wieder hinunter in die Wohnung gingen, kam uns meine Tante Heti entgegen.
„Ich komme gerade aus dem Krankenhaus“, sagte sie. „Ich werde euch drinnen erzählen, was mir eurer Mutter ist.“
Erst als wir alle, auch Frau Neubart, am Tisch saßen und Tante Heti erwartungsvoll ansahen, sagte sie:
„Also Kinder, ich habe eine gute Nachricht für euch. Eurer Mutter geht es schon wieder viel besser und morgen gehen wir alle ins Krankenhaus, um sie zu besuchen.“
Ein Jubeln ging durch die Küche. Was war das für eine tolle Nachricht!
Etwas Schöneres hätte meine Tante nicht sagen können.
„Ich habe sehr lange mit dem Stationsarzt geredet“, sprach Tante Heti