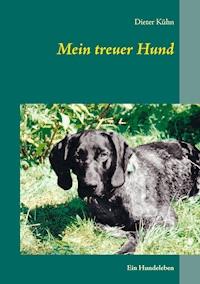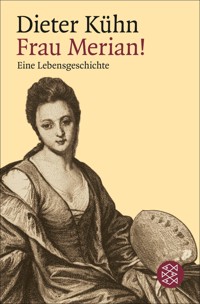9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stark erweiterte und völlig überarbeitete Neuausgabe des Mittelalter-Klassikers Dieter Kühns berühmtes Buch über Oswald von Wolkenstein, den Tiroler Ritter und Abenteurer, Handels- und Weltreisenden, den Dichter, Komponisten und Sänger ist durch wissenschaftliche Forschung abgesichert und zugleich voll sprühender Phantasie. Oswald von Wolkenstein (1377–1445), der neben Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide als bedeutendster deutscher Dichter des Mittelalters gilt, war zugleich rauer Geselle und virtuoser Künstler. Kühns mitreißende Darstellung der spätmittelalterlichen Welt und seine Übertragungen der Wolkenstein-Lieder in unser heutiges Deutsch, die »einem rote Ohren machen« (Adolf Muschg), sind ein einzigartiges Lesevergnügen, belehrend und unterhaltend, Abenteuer- und Kulturgeschichte. In den drei Jahrzehnten seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Mittelalter-Klassikers sind allerdings wichtige Dokumente zu Oswalds Leben entdeckt worden, ist die Entschlüsselung der Liedtexte fortgeschritten, sind umfassende Untersuchungen zu jener Ära der Frührenaissance erschienen. So hat sich Dieter Kühn zu dieser erheblich erweiterten Neufassung des Buchs entschlossen – das bisherige Bildnis des Wolkensteiners musste übermalt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1019
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Dieter Kühn
Ich Wolkenstein
Die Biographie
Über dieses Buch
Stark erweiterte und völlig überarbeitete Neuausgabe des Mittelalter-Klassikers
Dieter Kühns berühmtes Buch über Oswald von Wolkenstein, den Tiroler Ritter und Abenteurer, Handels- und Weltreisenden, den Dichter, Komponisten und Sänger ist durch wissenschaftliche Forschung abgesichert und zugleich voll sprühender Phantasie. Oswald von Wolkenstein (1377–1445), der neben Wolfram von Eschenbach und Walther von der Vogelweide als bedeutendster deutscher Dichter des Mittelalters gilt, war zugleich rauer Geselle und virtuoser Künstler. Kühns mitreißende Darstellung der spätmittelalterlichen Welt und seine Übertragungen der Wolkenstein-Lieder in unser heutiges Deutsch, die »einem rote Ohren machen« (Adolf Muschg), sind ein einzigartiges Lesevergnügen, belehrend und unterhaltend, Abenteuer- und Kulturgeschichte.
In den drei Jahrzehnten seit Erscheinen der ersten Auflage dieses Mittelalter-Klassikers sind allerdings wichtige Dokumente zu Oswalds Leben entdeckt worden, ist die Entschlüsselung der Liedtexte fortgeschritten, sind umfassende Untersuchungen zu jener Ära der Frührenaissance erschienen. So hat sich Dieter Kühn zu dieser erheblich erweiterten Neufassung des Buchs entschlossen – das bisherige Bildnis des Wolkensteiners musste übermalt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg/Anna-Lena Witte
Coverabbildung: Oswald von Wolkenstein. Darstellung in der Innsbrucker Liederhandschrift B. 1432
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-10-401821-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Von Köln nach Wolkenstein – [...]
Ich stelle den Wagen [...]
Die Südtiroler Sage von [...]
Der Wolkensteiner nennt in [...]
In einer der Länder- [...]
Im Sommer 1399 erkrankte [...]
Rückkehr nach Tirol. An [...]
Am 22. April 1407 war [...]
Oswald demonstrierte selbstbewusst, standesbewusst [...]
Dass Oswald mit Lust [...]
Der Wolkensteiner als Dichter, [...]
Zu dieser Zeit war [...]
Nach bald einem Jahrhundert [...]
Schon mehrere Abschnitte über [...]
Hauenstein – unter den Burgen, [...]
Themenwechsel! Stichwort Körperlichkeit! Und [...]
Im November 1419 ist [...]
Und wieder einmal ritt [...]
Hauenstein, so zeigt sich [...]
Es folgen dramatische Vorgänge: [...]
Oswald trat, nach Ausfertigung [...]
Wahrscheinlich 1424 oder bereits [...]
Am 27. November 1426 hatte [...]
Schon recht bald nach [...]
Oswald war im Oktober [...]
Als würde für den [...]
Der sehr kalte Winter [...]
Im Sommer oder Frühherbst [...]
Sigmund hatte nach der [...]
Zu berichten ist von [...]
Anhang
Berichte und Exkurse
Bibliographie
I. Primärliteratur
II. Sekundärliteratur
Bildnachweise
Bildteil
Oswald von Wolkenstein mit [...]
Der Wolkensteiner, hochdekoriert: Brustbild [...]
Oswalds Kopf in neuer, [...]
Die Burgruine Wolkenstein und [...]
Die Trostburg; im Vordergrund [...]
Burg Hauenstein, ohne Santnerspitze [...]
Oswald auf dem Marmor-Gedenkstein [...]
Oswald von Wolkenstein neben [...]
Porträt König Sigmunds, möglicherweise [...]
Herzog Friedrich IV. von [...]
Die Stadt Konstanz, auf [...]
Umschlagzeichnung des Urbars, das [...]
Die Belehnung des Pfalzgrafen [...]
Bildausschnitt: Reiter des Gefolges, [...]
Oswald, links, mit anderen [...]
Oswald mit halbiertem Fisch, [...]
Von Köln nach Wolkenstein – längst schon liegt die Reiseroute fest: von Köln nach München, von München nach Herrsching, von dort über Partenkirchen, Innsbruck ins Grödnertal, Val Gardena; am Ende dieses Tals der Ort Wolkenstein, italienisch Selva, und hier die Burgruine Wolkenstein – die Urburg der Wolkensteiner. Einen ersten Eindruck vermittelte mir eine alte Fotografie: Eine senkrechte, mehrere hundert Meter hohe Felswand, und am oberen Ende einer Schräge von Steingeröll, in eine Einwölbung hineingebaut: die kleine Burg. Als ich das Foto zum ersten Mal sah: Assoziationen an eine Pueblofestung.
Von Köln nach Wolkenstein: Flugsteigkopf B, Ausgang 4. Ich lehne mich an eine Leichtmetallbarriere vor der Glasfront, schaue auf das Heck des City-Jet, den Servicewagen, die Männer in Overalls. LH 622 nach München, abgekürzt MUC. Das grüne Lichtsignal über dem Ausgang des Warteraums noch nicht eingeschaltet, die Bordkarte in der Lederjacke. Ich fliege zu einer Lesung nach München, und weil ich dort etwa drei Viertel der Strecke Köln–Wolkenstein hinter mir habe, will ich per Auto weiterfahren nach Südtirol, Norditalien: in Oswalds Region. Im Bewusstsein längst schon das neue Buchprojekt, es fordert mehr und mehr Raum: eine Biographie über Oswald von Wolkenstein. Da ist es selbstverständlich, dass ich mir die Orte, die Burgen anschaue, die in seinem Leben wichtig waren: Burg Wolkenstein, Burg Hauenstein, Burg Schöneck, Burg Neuhaus, die Trostburg und Greifenstein. Weiter gäbe es noch die Burg Forst bei Meran, Vellenberg bei Innsbruck, aber in diesen Burgen ist Oswald nicht freiwillig gewesen, dorthin hatte man ihn überführt.
Zwei grüne Lichtpunkte, wechselweise an- und abgeschaltet; zweiter Aufruf, second calling. Durch den Teleskopgang zum Flugzeug; ein Fensterplatz. Die Betonplatten wasserstumpf, grellhell, gleich wieder stumpf – rasch und tief ziehende Wolkenballen. Böen drücken das kurze Gras flach neben der Piste. Die Beschleunigung, das Abheben, spürbare Einwirkung der Böen, schon sind die ersten Kilometer der Strecke Köln–Wolkenstein hinter mir. Unter mir: Grün wassersatt, Straßen und Dächer nassdunkel. Schon Wolkenbänke, die wir durchfliegen, Turbulenzen. Das Durchstoßen der Wolkenschicht, rasches Auflichten des diffusen Grau, letzte Wolkenschleier, Wolkenfetzen; Quellweiß. Einige Wolkenlöcher: jeweils ein Ausschnitt Feldmuster, Straßenlinien, Siedlungsformen; bald schon bleibt die Wolkendecke geschlossen.
Ich lese von einem alten Gasthaus, und stolz erkläre der Wirt den Gästen, aus einer Dachrinne laufe das Regenwasser ab zur Sill, damit letztlich ins Schwarze Meer, auf der anderen Seite in den Eisack, damit zum Mittelmeer. Ich lese von einem Brauch: War der Bauer gestorben, durchschritt der Hauptknecht alle Räume des Bauernhauses, sagte: Der Bauer ist tot, sagte auch in den Ställen: Der Bauer ist tot, sagte an den Bienenstöcken: Der Bauer ist tot. Und ich lese von Kornfeldern, die so steil sind, dass im Frühjahr die vom Schmelzwasser abgeschwemmte Erde in Körben wieder hinaufgetragen werden muss. Lese Wörter wie: Schnalser Nudeln und Innicher Sterz, wie: Sauerkraut-Türteln und Topfennocken. Und Beinschinken wurden eingelegt in eine Beize von Trester mit Salz, Pfeffer, Salpeter, Lorbeerblättern, Knoblauch, Wacholderbeeren; danach wurde der Schinken wochenlang geräuchert.
Ich lege die Zeitschrift weg, schaue hinaus: eingeebnetes Quellweiß, auf der Tragfläche ein gleißender Lichtreflex. Von Düren über Köln nach Wolkenstein ist auch Oswald gereist, auf dem Rückweg seiner Reise von Wolkenstein über Köln nach Aachen; er wird als Reiter für eine Strecke jeweils mehrere Wochen gebraucht haben; für mich ist es nur ein Tag – Zugfahrt, Flug, Autofahrt zusammengerechnet. Ich versuche mir vorzustellen, was es damals hieß, bis nach Litauen, auf die Krim, ins Heilige Land zu reisen, nach England, Schottland, Irland, nach Italien, Frankreich, Spanien, Nordafrika. So hat er einen weiten Kreis gezogen um eine Region, die sich mit wenigen Namen markieren lässt: Kastelruth, Seis, Ratzes. Und dort ein Punkt, der für Oswald zentral war: die Burg Hauenstein. Er hatte diese Burg besetzt, als sie ihm nur zu einem Drittel gehörte, danach jahrelanger Streit mit dem Besitzer, Oswald wurde schließlich gekidnappt, eingesperrt, gefoltert, aber seinen Anspruch auf die Burg gab er nicht auf. Ihre topographische Umgebung hat er in verschiedenen Liedtexten benannt: die Zuordnung dieser Namen auf einer Karte genügt mir freilich nicht, ich möchte wissen, wie lange man von der Burg bis nach Ratzes geht und ob man von Hauenstein aus Kastelruth sehen kann, das Oswald in Liedtexten genannt hat, und wie weit es ist hinauf zur Seiser Alm, auf der seine Rinder weideten.
Eine Durchsage: Wir überfliegen Frankfurt. Voraussichtlich der Publikationsort des Buchs. Das Erscheinungsjahr ist im Bewusstsein fixiert: 1977, da ließe sich Oswalds 600. Geburtstag feiern. Sechshundert Jahre – die Zahl kann eigentlich nur entmutigen, zugleich ist sie eine Herausforderung: Möglichst viele Informationen sammeln, sie zusammensetzen zu einem biographischen Bericht, zugleich zu einem Bild, wenigstens zu einer Skizze seiner Zeit. Dazu würde ich mich kaum aufraffen, wäre mir Oswald nicht seit längerem nah, beinah gegenwärtig in einigen seiner Liedtexte, vor allem im Hauenstein-Lied: Nach vielen Reisen sitzt er fest in Ratzes am Schlern, auf seinem »Kofel«, von dichtem Wald umschlossen, und er sieht nur hohe Berge, tiefe Täler, sieht Felsbrocken, Gesträuch, Baumstubben, Schneestangen, wörtlich: Schneestangen, und statt des gewohnten Umgangs mit Personen von Rang und Adel: Kälber, Geißen, Böcke, Rinder und »knospot leut«, also grobe, plumpe Leute, und die beschreibt Oswald als schwarz, hässlich, als verrußt oder verrotzt, je nach Lesart, und die eigenen Kinder fallen ihm in der Enge auf die Nerven, er wird aggressiv, und Eselschreien, Pfauenkreischen, ein tosender Wildbach – vor fünfzehn Jahren etwa hatte ich diesen Liedtext zum ersten Mal gelesen: einer der Anstöße, mich genauer mit Oswald zu beschäftigen, und nun, September 75, ist es so weit; das Bewusstsein fixiert auf diesen Mann, eine erste Mappe ist mit Manuskriptblättern gefüllt.
Auslösend auch das Porträtgemälde, das ich in kleiner Reproduktion seit langem schon kenne: Der massige Schädel, die gedrungene Nase, das rechte Auge geschlossen, die Narbe auf der Unterlippe, die pelzverbrämte Kappe, das prunkvolle Gewand mit Orden auf diagonalem Brustband – müsste man über jemand, den man so genau vor sich sieht, nicht Zutreffendes sagen und schreiben können, wenn man nur genügend Informationen sammelt? Dazu, als weitere Schreibmotivation: Beschäftigung mit einem Mann, der verschiedene, zuweilen gegensätzliche Möglichkeiten verwirklicht hat, in seinem Leben, in seinen Arbeiten. Und zugleich wieder: Bewusstsein der Distanz, die sich kaum überspringen lässt. Und wiederum: Herausforderung durch das Andersartige, das Fremde.
Die Reise nach Wolkenstein wird die Distanz zu Oswald von Wolkenstein kaum verkürzen. Zu sehen, was Oswald gesehen hat, als Kind, als Erwachsener: Landschaften, die ihn jahrelang umgaben und die mich für einige Tage umgeben werden – kann ich dort Rückschlüsse ziehen? Was hat er von diesen Landschaften gesehen? Wie weit war sein Sehen vorgeprägt von Wahrnehmungsweisen seiner Zeit? Beispielsweise Abgeschiedenheit, die uns heute aufatmen lässt in einer Welt, die enger und enger wird – hat ein Oswald sie gesucht, war sie ihm gleichgültig, hat er sie gemieden? Ich mache mir deutlich: ich reise nicht nach Südtirol, Norditalien, um aus Sichtbarem Rückschlüsse zu ziehen, ich will mir nur mal seine Umgebung anschauen.
Das Hinabschrägen zur Wolkenschicht, bald wischt es hellgrau am Fenster vorbei: Wolkenkuppen; die Lichtmulden schrumpfen. Diffuses Grau, Licht absorbierend. Das Flugzeug gerüttelt; ein paar Dutzend Köpfe an den Rücklehnen hin und her pendelnd. Druck in den Ohren, schlucken. Auf einem Baggersee Wellen, sogar Schaumkronen. Einzeln stehende Bäume von Böen gezaust; ausgleichende Klappenbewegungen an der Tragfläche. Ins Weidegrün werden Windmuster gepresst. Erste Leitlichter. Grasfläche, gesehen durch mein Fenster, durch das gegenüberliegende Fenster, durch mein Fenster. Hartes Aufsetzen. Ausrollen. Losschnallen.
Durch den langen Korridor gehend, auf die Rolltreppe zu, vorbei an Plakaten, die für bayerische Fremdenverkehrsorte werben, wünsche ich mir, die Plakatflächen wären mit Reproduktionen von Oswalds Porträtgemälde bedeckt, im Vierfarbendruck: Der massige, runde Schädel, das geschlossene rechte Auge, die kurze, gedrungene Nase, das Doppelkinn und wieder: Der massige, runde Schädel, das geschlossene rechte Auge, die kurze, gedrungene Nase, das Doppelkinn und wieder …
Am frühen Nachmittag ein Gespräch im Bayerischen Rundfunk. Zwischendurch frage ich mich, ob ich zur Musikabteilung gehen soll, ich kenne einen der Redakteure, wenn auch nur flüchtig: anfragen, ob man für das nächste oder übernächste Jahr an einer Sendung über Oswald von Wolkenstein interessiert wäre, mit ausgewählten Liedbeispielen – einige seiner Lieder mittlerweile als Ohrwürmer: »Wach auff mein hort … Es fügt sich do ich was von zehen jaren alt …« Auch seine Musik als Auslöser der Biographie.
Kein Besuch in der Musikredaktion. Die Lesung. Bier, Doppelkorn. Mit der S-Bahn nach Herrsching. Am Wochenende arbeite ich weiter an der Übertragung eines Liedtextes.
Und dann, am Montagmorgen, der Aufbruch. Der Tag wie mit mächtigem Gongschlag eröffnet: WOLKENSTEIN! Aus dem Fenster blickend, weil das Wetter nun Reisewetter ist, registriere ich: föhnblauer Himmel, intensives Licht.
Die Tasche in den Wagen gelegt, die Autokarte. Die Route liegt fest: Weilheim, Partenkirchen, Mittenwald, Zirler Berg, Innsbruck, Brenner, Brixen, Abfahrt Grödnertal, Val Gardena. Wie auf Werbeprospekten von Fremdenverkehrsorten ist der Ortsname WOLKENSTEIN dick gedruckter Mittelpunkt in einem Netz von Linien, die heranführen von Zürich, Brüssel, Amsterdam, von Hamburg, Berlin, Wien, von Triest, Florenz, Genua: WOLKENSTEIN, SELVA.
Kreisstadt Weilheim. Gebirgskulisse, davor Dörfer, Wiesen, Fichten, Birken. Das Hinweisschild Mittenwald. Ortsumgehung Mittenwald, die Häuser rechts in einer Senke; links, wenn ich hochschaue, das Karwendelgebirge: Konturen wie frisch herausgebrochen. Grenzübergang. Zirler Berg, schon geht es nach Innsbruck – Straßenbauten für die Olympischen Winterspiele 76. Hier in Innsbruck ist Oswald mehrfach gewesen. Und außerhalb, oberhalb der Stadt, war er eingesperrt, in Vellenberg bei Axams; das muss irgendwo zur Rechten am Hang liegen, aber ich mache keinen Abstecher, im Bewusstsein wird der Ortsname WOLKENSTEIN immer größer.
Innsbruck rasch umfahren. Innsbruck ausschnittweise im Rückspiegel; wenn ich mich umschaue, sehe ich die Bergkulisse nordwärts, im linken Seitenfenster kurz die Sprungschanze Bergisel, wie der Pfeiler einer riesigen Autobahnbrücke, die einmal über Innsbruck hinweggeführt werden soll. Nach der Bergisel-Brücke der Bergisel-Tunnel, die Sonnenburgbrücke, die Europabrücke, die Hauptmautstelle Schönberg; ich zahle, erhalte einen Prospekt über die Brenner-Autobahn: Die wichtigste europäische Nord-Süd-Verbindung, offen auch bei extremen Witterungsbedingungen; vierzig Notrufsäulen; elektronische Glatteiswarnung; Kommandozentrale; TV-Kameras; von Psychologen bestimmte Farbabstufungen an den Leitplanken sollen das Unterbewusstsein der Fahrer so beeinflussen, dass sie die Geschwindigkeit verringern – wirkt sich bei mir nicht aus, ich will nach WOLKENSTEIN! Luft wummert durch das halb geöffnete Seitenfenster, staut sich im Gehäuse: es ist sommerlich warm, ich fahre ohne Schuhe, in Jeans und Hemd. Föhngereinigtes Blau. Bergzüge, Bergmassive rechts, Bergzüge, Bergmassive links. Die Gschleiers-Brücken, die Mützener-Brücken, die Gschnitztal-Brücke, die Autobahn fast völlig leer, kein winkender »Wachlsepp« macht mich ungeduldig, knallrot, mit einem Wimpel Vorsicht fordernd. Schon die Felperbrücke. Bergmassive, Burgen – Sichtmarkierungen auf dem Weg nach Wolkenstein! Abfahrt Nößlach, Gries, Obernberg, bald schon der LKW-Stauraum, Geldwechsel, der Obernberger Talübergang und Ausfahrt Brennersee, Brenner-Ort, der Brennerpass. Engführung: die Autobahntrasse nah an der Straße, in deren Verlauf Oswald geritten sein dürfte: »Von Wolkenstein brach ich nach Köln auf, gut gelaunt.« Südwärts bleiben Autobahntrasse, Eisenbahntrasse und Fluss nah beisammen, Verkehrsadern, gebündelt: pro Jahr überqueren rund 8 Millionen Reisende den Brenner – mein geringer Beitrag zur Statistik. Von Köln nach Wolkenstein reise ich, gutgelaunt.
Wieder zahlreiche Brücken, die Namen in den beiden Landessprachen der »Autonomen Provinz Bozen«: Jetzt kann es wirklich nicht mehr lange dauern, bis ich abbiege ins Grödnertal, Val Gardena. Schon ist Brixen, Bressanone, angezeigt. Dieses Brixen, dessen Domtürme auftauchen im Flirrlicht, ist für mich jetzt nur der Name des Orts, in dem die Gedenktafel steht aus dem Jahre 1408: Oswald lebensgroß als Rittersmann, mit Schwert und Fähnchen, mit Harnisch und Kampfrock, mit gepanzerten Schuhen auf den Wappen der Familien Wolkenstein und Villanders; sein rechtes Auge geschlossen, sein stattlicher Kinnbart kunstvoll geflochten, Löckchen auf dem Haupt; in seiner Linken ein Helm, Pfauenfederschmuck. Fotografien dieser Tafel habe ich mir genau angeschaut, neue Informationen wird mir die Marmortafel nicht bringen – dennoch, im Bewusstsein dehnt sie sich aus, überdeckt fast das Stadtbild: auf dieser Tafel hat Oswald sich selbst gesehen. Als er sie herstellen ließ, war er etwa dreißig Jahre alt, hatte noch knapp vier Jahrzehnte zu leben.
Nicht einmal wegen dieses Halbreliefs schwenke ich ab, ich werde es mir später anschauen, jetzt erst Wolkenstein, WOLKENSTEIN. Brixen im Seitenfenster, Brixen im Rückspiegel. Der Druck des Gedenksteins lässt nach, sein Volumen verringert sich, denn schon ist Klausen angezeigt und Waidbruck, damit wächst ein anderer Name im Bewusstsein, TROSTBURG; zugleich das Bild, das ich mir nach Fotos von dieser Burg gemacht habe.
Die Autobahnausfahrt, eine Brücke über den Eisack: Umleitung. Aber sie hat einen Vorteil: auf der anderen Seite des Tals sehe ich hoch am Hang eine Burg, erkenne sie sofort – die Trostburg! Ich halte, schaue hinauf: eine Schlossburg mit zahlreichen Fensterläden, rot und weiß gestrichen, der Turm mit Dachhaube. Ein mächtiger Akzent gesetzt in diese Landschaft: WIR VON WOLKENSTEIN! Das Besichtigen dieses Gebäudes verschiebe ich: erst Wolkenstein, Selva. Zurück über den Eisack, auf schmaler Brücke, über die Eisenbahntrasse, über den PLATZ OSWALD VON WOLKENSTEIN. Hier bin ich richtig, hier werden Plätze und Straßen nach Oswald benannt!
Ich fahre unter der Autobahn durch. Das Grödnertal: Felsen, nass von Sickerwasser; die Straße in Windungen am Wildbach entlang.
Bald weitet sich das Tal, St. Ulrich, Ortisei, St. Christina, S. Cristina, und nun ist es angezeigt: Wolkenstein, Selva. Ungeduld, obwohl es bloß noch ein paar Kilometer sind. Das Ortsschild WOLKENSTEIN, SELVA, blau und weiß. Mit diesem Schild rückt der Satz, der mich begleitet, in die Vergangenheitsform: Von Köln nach Wolkenstein reiste ich gutgelaunt. Während ich in den Ort hineinfahre, Staunen: ein Hochplateau, ringsum Berge. Vor mir, in Fahrtrichtung quergestellt, ein riesiges Bergmassiv.
Ein geschlossenes, vergammelt aussehendes Hotel, vor dem ich den Wagen abstelle. Aussteigend sehe ich den Namen ALBERGO OSVALDO. Na bitte. Wieder ein Rundblick: Hangflächen, Bergwände, Felsmassive – ja, das ist ein Herkunftsort!
Im Ort selbst, durch den ich gehe, um mir eine Regionalkarte zu kaufen, weist nichts auf Vergangenheit hin: eine Ansammlung von Hotels, weitere Hotels werden hinzugebaut; Wolkenstein, so habe ich gelesen, wurde in den sechziger Jahren zu einem der »Zentren der Winterurlaubsindustrie«. Hinweisschilder für Pensionen, Hotels, Wanderwege und Seilbahnen; Andenkenläden, Boutiquen. Kurz vor der Mittagspause kann ich noch eine Karte kaufen: Das quergestellte Massiv am Talende ist die Große Sella-Gruppe, höchste Spitze 3151 Meter; südwärts führt am Fuß des Massivs die Straße zum Sellajoch, nordwärts zum Grödner Joch; südlich vom Dorf der Langkofel, 3181 Meter. Das Dorf selbst in einer Höhe von etwa 1500 Metern. Eine Burg Wolkenstein ist nicht eingezeichnet.
Aber ganz in der Nähe der Albergo Osvaldo ein Wegweiser: Schloss Wolkenstein. Ich fahre vorbei an einem Feuerwehrhaus, auf dem riesig der Familienname-Ortsname steht: Oswald als gefeiertes Vorbild der Feuerwehr von Wolkenstein? Oswald gehörte zu denen, die eher Feuer legten als Feuer löschten: seine ruppigen, oft harten Methoden, beispielsweise im Kampf um die Burg Hauenstein – in einem der Bücher, die ich über ihn gelesen habe, wird er als abenteuerliche Verbrechernatur bezeichnet. Aufgepasst also: sich nicht bestechen lassen durch die Naturtheaterszene einiger seiner Auftritte!
Auf schmaler Straße fahrend, warte ich darauf, dass ein Bergmassiv an die Straße heranrückt; aber das Tal bleibt sanft, grün, weitgeschwungen. Ich frage. Ja, das Schloss sei ganz in der Nähe, in der Senke, man könne es nach wenigen hundert Metern schon sehen, von oben. In einer Wiesenmulde? Es ist die Fischburg, die, wie ich später lese, ein Nachkomme von Oswalds Bruder Michael gebaut hat, Engelhard Dietrich von Wolkenstein. Diese Burg schaue ich mir gar nicht erst an, ich frage nach der Burgruine Wolkenstein, und die liegt ganz woanders, drüben im Langental.
Ein weites Tal, abgeschlossen und eingefasst von bewaldeten Bergrücken, dahinter Karstschrägen, darüber Felsmassive. Ein Weg mit vielen Windungen; Felsbrocken, Fichtengruppen. In der Talsohle, rechts unten, ein breiter Weg, ein Sportplatz, eine Kaserne, die Auslauffläche einer Abfahrtsstrecke, leere Gehäuse der Zeitanzeiger. Wenn ich mich umdrehe, sehe ich den Ort und jenseits des Orts, südlich, über dem ersten, noch bewaldeten Bergzug das kahle Felsmassiv des Langkofel, des Sassolungo, und links davon das Sella-Massiv, wiederum links davon die Berge auf der anderen Seite des Tals: immer deutlicher die zeitweilige Umgebung Oswalds!
Endlich sehe ich die Burgruine, nach erneuter Wegkrümmung, und bleibe stehen: senkrecht die Stevia-Wand, und dort, wo die Geröllschräge, auf der ich stehe, an das Massiv stößt, das Gemäuer der Wolkensteinburg. Enttäuschend klein! Ob sehr viel Mauerwerk abgebrochen, ins Tal gerutscht ist?
Im Zickzack hinauf, nur die Andeutung eines Pfads. Eine Mauer mit Türbogen und Schießscharten in »Schlüssellochform«, also für Feuerwaffen: etwa fünfzehntes Jahrhundert, wie ich später lese. Zwischen Vormauer und Burgmauer der kleine Zwinger. Die Kulisse der turmartigen Burg; Fensteröffnungen zeigen vier Stockwerke an. Ich steige auf einen Felsblock, der sicherlich schon außerhalb der Fundamente lag, schaue hoch: Die Burg ist unter einen Felsüberhang gebaut, Fels zugleich als Dach. Die Türöffnung und die beiden größeren, schräg übereinanderliegenden Fenster der Frontmauer zeigen die Stärke des Mauerwerks an: etwa ein Meter. Seitenbänke aus Stein in diesen Fensternischen, größere Flächen Verputz: aus Oswalds Zeit?
Der Grundriss muss dreieckig gewesen sein: die Mauer südwärts steht noch; die zweite Mauer fehlt; der Fels als dritte Wand. Wahrhaftig ein Felsnest, wenigstens fünfzig Meter über der Talsohle – ich denke wieder an Pueblo-Indianer, an Verteidigungsbauten von Höhlenbewohnern.
Höhlenähnlich müssen die Räume der Burg gewesen sein; bei diesem sehr kleinen Grundriss waren es vier Räume übereinander: nach oben kam man wohl nur auf Leitern, für eine Treppe war da kein Platz. Hatte man die Felswand verputzt? Spuren von Bearbeitung sind nicht zu sehen, nichts glattgehauen, abgeschliffen – wurden Felle oder Teppiche vor diese im Sommer kühle, im Winter kalte Felswand gehängt?
Die »Fenstersitze«: in diesen Nischen saß man wohl meist. Schaute man hinaus, ›genoss den Ausblick‹? Das wäre höchstens im Sommer möglich gewesen, im Winter wurden Fensteröffnungen zugemacht, durch geöltes Pergament in Holzrahmen, durch Bretter. Die Wolkensteiner als Höhlenbewohner, zumindest in dieser Burg: An der Felswand wohl Kondenswasser, von unten Küchendüfte und die Leitern rauf und runter: Kinder, Verwandte, Besucher – es muss ein ziemliches Gedrängel gewesen sein! Nichts also von der Ruhe, die mich jetzt umgibt: hier wird Oswald kaum an Liedern gearbeitet haben, der sonst so robuste Mann war sehr geräuschempfindlich – zumindest in Selbstdarstellungen.
Wiederholt schaue ich, von ›innen‹ her, an der Wand hoch: Risse im Mauerwerk – irgendwann mal könnte sich auch diese Südwand vom Fels lösen, könnte die Karstschräge hinabrutschen. So mache ich mehr Fotos als geplant, Detailaufnahmen: etwa, wie oben das Mauerwerk anschließt an den überkragenden Fels. Dort, im obersten Raum, musste man sich wohl bücken, um ans Fenster zu kommen.
Ich fotografiere die Mauer vom Zwinger aus, der überdacht war, wie Balkenlöcher anzeigen: gewiss war hier der Stall für Pferde und Maultiere, dazu der übliche Hühnerstall, Taubenschlag. Ich fotografiere von außen die Vormauer, obwohl sie nach Oswalds Zeit gebaut wurde. Geh durch beide Maueröffnungen zurück in den vormaligen Innenraum der Burg, fotografiere von hier aus die Umgebung: pompöse Bergregion, Panorama von 180 Grad.
Spektakuläres Ambiente! Wahrhaft einmalige Lage! Für die Verfilmung einer Raubritterstory sicherlich geeignet. Sonst sind Burgen in Hanglage gebaut, oder, noch besser, auf einem hochragenden Felsmassiv, einem steilen Felssporn, hier aber kauert sich die Burg gleichsam hinein in die Einhöhlung der Steilwand. Aufsehen erregend, aber nicht ansehnlich. Schon gar nicht als namengebender Stammsitz eines frisch ausgeschlagenen Familienzweiges, der sich erst noch etablieren, sich profilieren will. Diese Schlichtburg war wohl am ehesten geeignet als Quartier bei einer längeren Jagdpartie, als Fluchtburg bei einer innerfamiliären Auseinandersetzung der härteren Art, als Sitz eines Verwalters, eines Burghüters. Hingegen als Stammsitz einer Adelsfamilie: kaum repräsentativ genug.
Aber die Umgebung …! Wie zur Betonung des Außerordentlichen wächst hinter der Sella-Gruppe eine Gewitterwand auf, graublau; das Bergmassiv ist noch beleuchtet von der inzwischen recht tief stehenden Sonne: rotgrau die Bergwände, Karstschrägen. Wolken aufziehend auch am Langkofel, der Gipfel des Bergklotzes zeitweise verhüllt, die Wolken dann wieder als riesige Schleppe. Das Sella-Massiv über dem schwarzgrünen Fichtensockel stumpfgrau; die Gewitterfront quecksilberhell durchädert, fernes Grummeln. Und wieder, wie mit Scheinwerfern, die partielle Ausleuchtung des Felsmassivs, ein sattes Rot.
Ein Vorfahre der Mutter Oswalds, Randolt von Villanders, kaufte 1293 von den Gebrüdern Maulrapp Burg und Gericht Wolkenstein samt landwirtschaftlichen Liegenschaften. Und der Burgherr begann Anwohner zu überfallen, zu berauben.
Wohl im Jahre 1318 wurde ein Protokoll über seine Vergehen aufgenommen. Ich lese im vierten Band des Tiroler Burgenbuchs, dass er eigenmächtig Wald- und Weiderechte einschränkte, Gemeindegrund für neue Höfe rodete, lese von Beraubung, Misshandlung, Einkerkerung von Untertanen, von Überfällen auf Frauen und Mädchen.
Von der Burg aus hatte der eigenmächtige Grundherr sicherlich auch Kaufleute ausgeraubt. Denn sie lag am alten Hangweg (»Heiden-Weg«) zwischen zwei Pässen (Grödner Joch und Sellajoch) und dem Eisacktal; dieser Weg hatte in einer Schlinge (um dem feuchten oder sumpfigen Talgrund auszuweichen) bis in die Öffnung des Langentals geführt, und das hieß: er verlief unterhalb der Burg Wolkenstein. Kaufleute kamen mit ihren Waren auf den Saumtieren also fast bis ›vor die Tür‹.
Oswalds Großvater Konrad wurde 1319, nach dem Tod des räuberischen Vaters, vom Landesfürsten mit Burg und Gericht Wolkenstein belehnt. Doch erst für das Jahr 1370 lässt sich der Familienname »von Wolkenstein« zum ersten Mal urkundlich nachweisen.
Konrad wandelte den Zinnenschnitt im Wappen der Familie Maulrapp in das diagonale Wolkenband um. Allerdings, der Name Wolkenstein hat ursprünglich nichts mit Wolken zu tun; mit »Walchenstein« wurde die Gebirgsregion der Welschen bezeichnet – romanische Flüchtlingsgruppen, die sich im Langental angesiedelt hatten. Erst später die volksetymologische Umdeutung.
Oswalds Vater, Friedrich, hielt sich an den Familiennamen Wolkenstein, siegelte aber noch mit dem Wappen der Familie Villanders: Tiroler Landadel aus der Umgebung des Dorfes Villanders am Osthang des Ritten.
Vater Friedrich hatte zwar einen potentiell klangvollen Namen, kam so rasch aber nicht zu Rang und Ehren und schon gar nicht zu hinreichendem Besitz: ein paar Bauernhöfe gehörten zur Burg, doch die vertraglich vereinbarten Lieferungen und Zahlungen der Pächter dürften gering gewesen sein. Friedrich verwaltete gegen Salär die eine oder andere Burg, die von den Herrschaften zeitweilig nicht genutzt wurde; in solch einer Position wurde man als »Hauptmann« bezeichnet.
Erst die Heirat konnte den jungen Familienzweig aufwerten: Friedrich heiratete Katharina von Villanders. Sie dürfte eine Morgengabe eingebracht haben, die Gründung und Unterhalt der rasch wachsenden Familie ermöglichte, wenn auch in weiterhin bescheidenem Rahmen. Bruderlos hatte sie zwar Anspruch auf ein ansehnliches Erbe, doch ihr Vater wurde sehr alt. Erst 1382, wohl in Vorahnung seines Todes, setzte er sein Testament auf. »Ich, Ekhard von Villanders, genannt von Trostburg, (…) vermache meinen befestigten Wohnsitz Trostburg mit Vogtleuten und Liegenschaften und der gesamten Habe meiner lieben Tochter Katharina, Gattin des Friedrich von Wolkenstein, sowie deren Kindern.«
Willkommener Zuwachs! Nun konnte man dem Felsennest den Rücken kehren, offizieller Familiensitz wurde die (damals noch recht bescheidene) Trostburg, mit weitem Blick hinab ins Eisacktal, hinüber zu den Hängen des Ritten, einem Vorgebirgsmassiv.
Vier Jahre später – Vater Ekhard war gestorben, das Testament vollstreckt – wurde eine Urkunde ausgestellt: »Wir, Leopold, von Gottes Gnaden Herzog zu Österreich, zu Steier, zu Kärnten und zu Krain, Graf von Tirol, erklären und bekunden öffentlich mit diesem Dokument: Nachdem Ekhard von Villanders, genannt: von Trostburg, verstorben war, erbaten von Uns die Erbin Katharina, seine Tochter, und unser getreuer Friedrich von Wolkenstein, ihr Ehegatte, dass Wir ihnen alle Güter übertragen und verleihen, die Unsere Lehen sind.« Es folgte eine Auflistung von zehn landwirtschaftlichen Gütern und etwa dreißig Höfen. Deren Pächter, Erbpächter waren künftig zu Lieferungen von Naturalien, teilweise auch zu Zahlungen verpflichtet.
Die »Grundherrschaft« von Friedrich und Katharina: Lehnsgut und Gericht Wolkenstein, die Trostburg, Bauernhöfe und Ländereien, die zur Burg Hauenstein bei Seis gehörten, die Pfandherrschaft Kastelruth, Liegenschaften in den Pfarreien Rodeneck und Villanders – Gebiete zwischen Eisack und Dolomiten.
Sieben Kinder aus dieser Ehe, vier Töchter, drei Söhne. Die Namen der Töchter, in alphabetischer Reihenfolge: Anna, Barbara, Martha, Ursula. Der erstgeborene Sohn hieß Michael, es folgte Oswald, sodann Leonhard.
Keine präzisen Angaben, mit denen sich Oswalds Biographie eröffnen ließe; weder ist sein Geburtsjahr dokumentiert noch sein Geburtsort. Vorsichtige Autoren geben an, Oswald sei zwischen 1376 und 1378 geboren – am wahrscheinlichsten ist das Jahr 1377.
Und wo wurde er geboren? Bleibt man beim Geburtsjahr 1377, so dürfte das auf Burg Schöneck geschehen sein. Sie war im Besitz der Grafen von Görz, die sie aber kaum oder gar nicht nutzten. So setzten sie »Pfleger« ein. Zu jener Zeit siegelte Friedrich von Wolkenstein als »Hauptmann von Schöneck«. Das bedeutete: Oswalds Vater war Verwalter der Liegenschaften, war Obmann des Gerichtsbezirks.
Wolkenstein und Schöneck: deutlicher könnten die Unterschiede kaum sein! Die Burg Schöneck ist an einem Wiesenhang gebaut, auf kleiner Felskuppe, die von Büschen, von Bäumen fast völlig verdeckt wird; sanft geschwungene Höhenzüge ringsum. In das Pustertal blickend, ostwärts, sehe ich, was sich seit Oswalds Kindheit kaum verändert hat: ein paar Häuser in der Senke, Bauernhöfe, eine Mühle, von der zumindest der Name geblieben ist, und: Fichtenhänge, Fichtenhänge, weit geschwungen.
Was Natur ist – musste das Oswald als Kind in Schöneck nicht auf entschieden andere Weise erlebt haben als in Wolkenstein? Alles sanft hier, bewachsen, keine Felswand im Rücken, keine Felsmassive im Halbkreis des Blickfelds. Wie Oswalds emotionale Beziehungen zu diesen so unterschiedlichen Wohnsitzen, Umgebungen waren, ich weiß es nicht. Gefiel ihm das Felsennest Wolkenstein, oder war (auch) ihm jene Umgebung zu karg, zu schroff und er zog (bereits als Kind beeinflusst von Vorlieben seiner Zeit) mildere Regionen vor wie hier in Schöneck?
Ich würde die Burgruine gern näher beschauen. Doch der Besitzer hat ein offenbar ausgeprägtes Eigentumsbewusstsein: Lattenzaun, Stacheldraht, am Tor die Anschrift: Cani cattivi, böse Hunde. Die höre ich im Gemäuer röhren. Ich klingle nicht, sage nicht ins Sprechgerät, ich interessierte mich seit längerem für Oswald von Wolkenstein, würde gern mal die Burganlage besichtigen, ich lasse mich abschrecken. (Später, als der Besitzer dies in einem Zeitungsvorabdruck liest, lädt er mich zu einem Tiroler Weißen ein und zur Besichtigung.) Einen Viertelkreis gehe ich um den Besitz herum, bis zur kleinen Waldschlucht mit Bach, hinter der Burg. Der Turm ist restauriert, ein Dach aufgesetzt, darunter Schlagläden, rot und weiß gestrichen, alle geschlossen.
Und Hauenstein? Die Burg, deren Name mit dem Namen des Dichters und Komponisten Oswald von Wolkenstein scheinbar unauflöslich verbunden ist: noch ohne biographische Bedeutung zu jener Zeit? Damals wurde eine Konstellation geschaffen, die Oswald vor immer neue Probleme stellen wird, in der er wiederum andere vor immer neue Probleme stellen wird.
Die Familie Hauenstein hatte diese kleine Burg besessen – nicht, wie sonst üblich, auf einem Hügel, einem Felssporn dominierend, sondern in Hanglage, im Wald, am Fuße eines Bergmassivs. Die Hauensteiner gerieten in Zahlungsschwierigkeiten, mussten einen Teil ihres Besitzes verkaufen, und das hieß: einen Anteil an Burg und zugehörigen Liegenschaften. Ein Drittel des Besitzes, der Grundherrschaft wurde von Friedrich dem Wolkensteiner übernommen, zwei Drittel verblieben bei Anna Hauenstein, verheiratet mit Martin Jäger, einem Bürger, mit dem Oswald später erhebliche Schwierigkeiten kriegen wird, nachdem er dem Ehepaar erhebliche Schwierigkeiten bereitet hat. Kind Oswald hatte also wohl Zutritt zur Burg Hauenstein, dort gelebt hat er damals aber nicht, auch nicht zeitweilig.
Oswald als Kind auf Schöneck, auf Wolkenstein, auf der Trostburg: Felsen, Burgtürme, Kellerverliese; Wälder, Bäche, Wiesen – verbanden sich damit Kindheitserinnerungen? Kein Bericht darüber, kein Hinweis darauf – nur eine Lücke in der Überlieferung?
In einem französischen Lied des 14. Jahrhunderts werden die Lebensalter mit Jahreszeiten, mit Monaten verglichen; dabei werden die ersten sechs Jahre gleichgesetzt mit dem Januar. In einem französischen Lied des 13. Jahrhunderts heißt es denn, ein sechsjähriges Kind könne kaum etwas wert sein, doch solle man es gut versorgen, gut ernähren; wer keinen guten Anfang habe, werde auch kein gutes Ende finden.
Philippe Ariès zitiert in seiner Geschichte der Kindheit diese Liedtexte, zeigt vor allem an Gemälden des Mittelalters, wie man damals Kinder sah: als kleine Erwachsene – gleiche Physiognomie, gleiche Kleidung, nur Größenunterschiede. Ariès zieht den Schluss, dass man das Spezifische der Kindheit noch nicht realisierte; was nicht im Bewusstsein war, konnte auch nicht auf Bildern erscheinen. Kindheit war wie nicht vorhanden: Januar, der musste nur überstanden werden. Diese Neutralität wird motiviert durch die sehr hohe Kindersterblichkeit: man wusste, dass höchstens die Hälfte der Kinder durchkam. Das war so im Hohen Mittelalter, war immer noch so in Oswalds Zeit, blieb so bis ins siebzehnte, ja achtzehnte Jahrhundert. Montaigne: »Sie sterben mir alle als Säuglinge weg.« Starke emotionale Bindung an das neugeborene Kind konnte man sich kaum leisten: zu schwer wäre mit jedem Todesfall die Belastung geworden. Ein Kleinkind war wie ein Probestück einer Serie, war noch halb anonym, konnte jederzeit wieder verschwinden.
Erst ab sieben Jahren etwa begann man zu zählen und wurde auch gleich zu den Erwachsenen gezählt. Ein zehnjähriger Junge, zum Beispiel, war kein Kind mehr, sondern ein kleiner Erwachsener mit heller Stimme, und der musste beim Bauern auf dem Feld und im Stall arbeiten, beim Handwerker in der Werkstatt, und als Sohn eines Adligen erlernte er möglichst rasch das Kriegshandwerk.
Die ersten zehn Lebensjahre: ein kurzes Kapitel in Oswalds Biographie!
Es ließe sich erweitern durch Informationen über eine durchschnittliche Kindheit im Mittelalter, etwa wie folgt: Kinder und Erwachsene trugen meist ein langes, hemdartiges Gewand, dicker oder dünner je nach Jahreszeit; man hängte Kindern vielfach ein Amulett um, wegen der hohen Sterblichkeit; es gab auch in Burgen keine räumliche Trennung zwischen Kindern und Erwachsenen (›Kinderzimmer‹); kleine Kinder hatten zwar ihre eigenen Spiele, Reifentreiben und Kreiselschlagen, Ballspiel und Fangspiel, Reigen und Plumpsack, aber Kinderspiele wurden recht bald identisch mit Erwachsenen-Spielen, die allerdings, nach unserer Vorstellung, vielfach recht kindhaft, ja kindisch waren. Beliebt war im 14. Jahrhundert unter Erwachsenen und Kindern vor allem das Froschspiel: Der ›Frosch‹ saß auf dem Boden, die andren jagten um ihn herum, der ›Frosch‹ musste hüpfend versuchen, einen Mitspieler zu fangen. Ebenfalls beliebt bei Erwachsenen wie bei Kindern: Schneeballschlachten, Versteckspiele.
Das Einzige, was über Oswalds Kindheit berichtet wird: Bei einem Fastnachtstreiben auf der Trostburg sei ihm durch einen Pfeil oder Bolzen versehentlich das rechte Auge ausgeschossen worden. Keine dokumentierte Nachricht – also ein Familienhistörchen? Ich werde später darauf eingehen.
Ich stelle den Wagen ab auf der PIAZZA OSWALD VON WOLKENSTEIN, gehe den Schlossweg hinauf zur Trostburg. Reste einer Pflasterung, in mehreren Steinplatten sehe ich Radrinnen.
Steile Wiesenschräge, Obstbäume, einige Bauernhäuser; Wald oberhalb der Burg: mehrere Stockwerke hoch das Wohngebäude mit weiß und rot gestrichenen Schlagläden.
Die Trostburg ist nach Oswalds Zeit erheblich verändert worden, vor allem durch Engelhard Dietrich von Wolkenstein, zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Lange Zeit, etwa ab 1500, war die Burg kaum noch bewohnt, war zeitweilig Waffendepot, doch der Nachkomme, wohl auch beeindruckt von der weithin beherrschenden Hanglage des befestigten Wohnbaus, leitete überfällige Reparatur- und Bauarbeiten ein.
Den Wohnturm, der auf dem vorgeschobenen Felskopf stand, baute er um in einen Bergfried. Schießscharten für Geschütze. Oberhalb der Burganlage ein kleiner Turm, ich sehe ihn zwischen Bäumen: Der »Römerturm«, zur Sicherung eines Felshügels, der die Burg überragt – von dort aus hätten Belagerer die Anlage leicht beschießen können. Freiherr Engelhard baute zudem einen Wehrgürtel mit drei Türmen und äußerem Turmzwinger, Kanonenscharten in den Türmen, Sturmpfähle an den Mauern.
Die Burg, die Oswald mehrfach besucht hat, sie wurde also weitgehend umgestaltet. Dennoch, ich steige hinauf, Äpfel essend, die ich von Ästen reiße: Diese Burg war wichtig in der Familiengeschichte der Wolkensteiner, schon Vater Friedrich hatte sie besessen, und Michael, als Ältester, hatte sie übernommen.
Der Pflasterweg führt zu einer Türöffnung. Auf einem Pfad gehe ich um das Schlossgebäude herum; links die Wehrmauer. Ein Weinfass, aufgestellt, ein Schlauch hängt hinein, Wasser läuft über den Rand. Eine Frau klammert Wäschestücke an die Leine, beachtet mich nicht, geht in den Bau, durch eine offen stehende, schwarz gestrichene Eisentür. Hühner, kein Hund. Ich gehe weiter, oberhalb des Schlossgebäudes, innerhalb des Wehrmauerrings: ein Wiesenpfad. Von den Fenstern des Wohntrakts wird man weiten Blick haben ins Eisacktal, vor allem südwärts, Richtung Bozen. Offenbar sind Besichtigungen der Burg nicht vorgesehen.
Ich gehe zu einem Turm, im Süden – es führt ein asphaltierter Weg hinauf. Einen Burgweg muss es hier schon zu Oswalds Zeit gegeben haben, denn im Turm hinter dem Michelstor sehe ich in halber Höhe den Rest einer Steinplatte: die stilisierten Wolkensäcke des Familienwappens, ein »chel von wolkenstain« – also dürfte Oswalds älterer Bruder den Turm erbaut haben, und sein Nachkomme Engelhard Dietrich hat diese Steinplatte nicht herausreißen oder mit Verputz überdecken lassen. So etwas wie eine Sichtverbindung zum Vorfahren, zum Stammvater des Trostburger Zweigs der Familie.
Um mehr zu sehen von alter Bausubstanz, müsste ich in den inneren Burgbereich kommen. Die einzige Öffnung zwischen Umfassungsmauer und Schlossgebäude ist die schwarz gestrichene Eisentür, die halb offen steht. Ein Gewölbedurchgang. Rechts einige Stufen hinab, eine Tür, auch sie steht halb offen; in einem ziemlich dunklen Raum sitzen zwei ältere Frauen, ein Mann, schweigend löffeln sie Suppe. Ich grüße, sie grüßen nicht zurück, hocken am Tisch, Wachstuch, sie löffeln. Ich sehe vor mir, was ich in manchen Filmsequenzen gesehen, wovon ich auch gelesen habe: verschlossene Landleute. Mich wundert also nicht, dass eine der Frauen auf meine Frage, ob ich mich hier ein wenig umschauen kann, nur mit einem Wort antwortet: Nein. Ein klares, ruhiges, entschiedenes Nein. Ich frage nicht weiter, sie sagen nichts weiter, stumm wird die Suppe gelöffelt. Ich steige zum Gewölbegang hoch, gehe ein paar Schritte burgeinwärts: ein schmaler Gang zwischen Mauern; Sensen an Holzstangen, Pferdehalfter. Hühner laufen herum. Ich nehme an, einer der stummen Suppenlöffler behält mich im Blick; ich gehe zurück zur Eisentür.
Vier Jahre später: der Bau erschließt sich mir vom windfauchenden Turmraum bis zu den stockfinsteren Verliesen. Ein Fernsehinterview, Thema Oswald, die Trostburg als Kulisse. Dann folge ich dem Team in die Burg; einige Innenaufnahmen, wohl für Zwischenschnitte.
Dominierend: der Renaissancesaal mit lebensgroßen stuckierten Statuen zur Familiengeschichte. Stammvater Randolt von Villanders. Michael von Wolkenstein, der zeitweilige Burgherr, mit einer Kreuzfahne. Und, wie zu erhoffen, doch anders als erwartet: Oswald, zweiäugig, als beinah ätherischer Jüngling, dekoriert mit zwei Orden. (Von Hans-Dieter Mück erfahre ich später, dass bei Rückzugsgefechten der Wehrmacht 1943 auch die Trostburg unter Beschuss geriet und dabei wurde, ausgerechnet, Oswalds Kopf getroffen und zerstört. Den hat man später rekonstruiert: nun leicht herabgesenkt zu einer Lyra in der Linken des Dichters und Musikers.) Weitere Sockel im Saal, freigehalten für Figuren künftiger Burgherren der Familie, aber die haben die Angebote nicht mehr wahrgenommen.
Helle Räume mit Blick westwärts und südwärts in das Eisacktal … Räume mit dunkelbrauner Holztäfelung, mit Fenstersitzen in den etwa zwei Meter starken Mauern … Ein Raum wie das Innere eines Blockhauses: Bohlen an den Wänden, Balken an der Decke – während einer Pestepidemie war das Holz gekalkt worden, zur Desinfektion, nun wurden von Restauratoren letzte Kalkreste entfernt, zuletzt aus Holzritzen, Wurmlöchern. Und genealogische Wappen wurden sichtbar … Ein kleines Nebenzimmer, von dem aus der bucklige Kachelofen beheizt, in dem vielleicht auch etwas aufgewärmt, rasch zubereitet wurde, eine gotische ›Teeküche‹ …
Die Kapelle, die Engelhard Dietrich anno 1604 ausgestalten und ausmalen ließ: rustikale Renaissance. Ein Nebenraum, leer: hier hatte Engelhard seine Reliquiensammlung aufbewahrt. In einem weiteren Zimmer, wohl der früheren Sakristei, ein bäuerlich bemalter Schrank, wandbreit und deckenhoch. Öffnet man die rechte Tür, löst man eine Arretierung, zieht man einige der Bodenbretter nach vorn, so zeigt sich ein Ausschlupf: ein gelenkiger Flüchtling konnte von hier aus durch einen Hohlraum zwischen dem Kapellenboden und der Decke des tieferen Stockwerks in den Speicher kriechen, konnte auf einer Seitentreppe, Nebenstiege nach unten, nach draußen entkommen.
Gespräch mit einem der Studenten, die noch Renovierungsarbeiten durchführen, er zeigt mir Räume und Bereiche, in die Besucher sonst nicht geführt werden. Wir steigen eine Wendeltreppe hoch zum Turmraum, einer der Fensterläden wird nach innen geöffnet, wir blicken ostwärts auf ein Wiesenplateau mit Grasrampen – der frühere Lustgarten. Diesem Wiesenplateau die Rücken zuwendend, sehen wir ein Fresko, arg verwittert: eine kahlköpfige Lady sitzt am Fenster, durch das wir hinausgeschaut haben, schaut auf den Lustgarten, dessen Grundfläche wir eben gesehen haben, jetzt wieder sehen, vergleichend hin- und herschauend zwischen dem gemalten und dem realen Fenster, zwischen dem bunt gemalten Lustgarten und der grasgrünen Lustgartenfläche.
Der Fensterladen wieder geschlossen, es geht die Wendeltreppe hinunter auf den Hof, der eng und feucht ist. Ein Fresko-Stammbaum auf einer der Galeriebrüstungen. Die Schlossküche, und hier sehen wir nun, was zu Oswalds Zeit kaum anders ausgesehen hat: ein Gewölberaum mit völlig schwarzer Decke – Ruß, der sich im Lauf von Jahrhunderten angesetzt und zu Kohlenstoff verwandelt hat, steinhart, lackglänzend.
Drei Plattformen: für das Braten in Pfannen, für das Kochen in Kesseln, für das Grillen am Spieß. Ein Ofen für die Brotfladen, die zweimal im Jahr gebacken wurden. Stapel von Brennholz, denn hier wird noch immer geräuchert – ein Metzger aus Waidbruck.
Die Nebenräume: helle Höhlen, in denen Nahrungsmittel gelagert wurden, vormals abgeliefert von Bauern der Umgebung. Hinter der Küche eine Treppe, die unter einer Decke endet; eine Öffnung in einem hohlen Tragpfeiler; Gewölbebogen; eine geheimnisvolle Inschrift auf einem Balkenstück.
Und weiter: ein Raum für die Burgwache. Eine Säule in der Mitte, an ihr Holzrahmen mit Zapfen, an denen wohl Helme, Rüstungsstücke, Waffen hingen; ein schmaler Fenstersitz. Jenseits eines kleinen Gangs der Gefängnisraum. Auch hier: nur ein Lichtschlitz. Eine Bodenklappe, eine Bodenöffnung – die beiden Verliese. Mit einer Taschenlampe hineinleuchten. Ins erste Verlies führen einige Stufen hinunter; der Grundriss so knapp, dass sich hier auch kleinwüchsige Gefangene nicht ausstrecken konnten, sie mussten kauern, auf dem Boden oder auf der ersten Stufe. Im zweiten Verlies konnten auch kleine Gefangene nicht stehen, hier konnte man nur liegen – vergrößerter Sarg, im Fels. Und früher noch dies: faulendes Stroh, Urin, Scheiße; völlige Finsternis unter der Bodenklappe des allenfalls dämmrigen Raums.
Mit dieser Besichtigung, aufrecht und gebückt, gehend und tappend, wird der Burgbau präsent: die hellen Wohnräume oben, die schwarze Räucherhöhle unten, die stockfinsteren Verliese, und all diese Gegensätze eingefasst von massigen, vielfach feuchten Mauern.
Marx Sittich von Wolkenstein beschreibt, Ende des 16. Jahrhunderts, das Land Tirol. Vieles von dem, was er registriert, dürfte auch für Oswalds Tirol charakteristisch gewesen sein.
So gebe es viele Bären im Lande Tirol, auch Wölfe – in besonders kalten Wintern kämen Bären und Wölfe von den Bergen herab in die Niederungen zu den menschlichen Siedlungen. Auch sei der Luchs nicht selten im Land, der Biber und der Dachs, der Otter und der Fuchs. Steinmarder seien zahlreich und Murmeltiere: »ein kurz wolliges Tierle«. Ausreichend Gämsen und Steinböcke. Und Schneehühner, Rebhühner, Haselhühner. Und Spielhennen und Schneegänse und Reiher und Enten und Gänse und drei Arten von Wildtauben. Und Finken, Amseln, Drosseln, Hirngrillen, Nachtigallen, Brandvögel, Zaunschlüpfer, Rohrdommeln, Sperlinge und so weiter. Es gebe auch zahlreiche giftige Tiere, vor allem Spinnen und Skorpione. Und Schlangen: die Blindschleichen, zu Unrecht als blind bezeichnet. Die Hauptfarben: schwarz, lederfarben, blau. Auch schneeweiße Schlangen. Und Vipern mit breiten Köpfen, schmalen Hälsen, aschfarben, mit schwarzen, viereckigen Flecken auf dem Rücken. Auch kleine Wasserschlangen.
Und weiter: Es gebe es in diesem Land genug Fleisch – Ochsen, Kühe, Geißen, Lämmer, Böcke. Auch ausreichend Schmalz, Butter, Milch. Öl werde aus Italien eingeführt; Versuche mit Ölbäumen seien in Tirol nicht erfolgreich gewesen, zu frühe Kälteeinbrüche.
In der »von Gott mild gesegneten und löblichen Grafschaft Tirol« gebe es Wein in »Güte und Menge«; der Weinanbau beginne südlich von Brixen. Besonders gute Rebsorten werden aufgezählt. Und in Bozen werde Branntwein hergestellt, reichlich und von guter Qualität. Mit Getreide könne sich das Land knapp selbst versorgen – in einer Region wächst der beste Roggen, in einer anderen die beste Gerste, und im Pustertal gibt es reichlich Bohnen, Erbsen, Linsen. Viel Obstanbau: Erdbeeren, Äpfel, Kirschen, Pflaumen, Granatäpfel. Verschiedene Pfirsichsorten: bei einigen löst sich das Fleisch gut vom Kern, bei anderen nicht.
»Gott der Erschaffer« hat Tirol auch reichlich ausgestattet mit Wäldern und Wiesen. Verschiedentlich erreicht das Gebirge eine Höhe von »drei Meilen Wegs«; dort oben wächst freilich nichts mehr. Regnet es im Tal, so schneit es im Felsbereich. Doch wie zum Ausgleich: die »allergrößten« Tannen, Fichten und Lärchen an den Berghängen – vor allem Lärchen würden auf der Etsch bis ans Meer gebracht, zum Schiffsbau. Für die Landesbewohner freilich bleibe genügend Bauholz und Brennholz; »ganz zu schweigen von dem Holz, das in den höchsten Wäldern umgeworfen wird und dort liegend ohne Nutzen verfaulen muss. Ein ganzes Land hätte daran eine lange Weile genug zu brennen.« Aber es gibt ja auch noch Eichen-, Buchen-, Eschen-, Erlen-, Föhren- und Birkenwälder. Auch wilde Kirsch-, Apfel- und Birnbäume. Viele Esskastanien: »Die armen Leute nähren sich damit, machen Mehl und Brot daraus.«
Und der Chronist berichtet von »Bergwerken, Erzgruben, von Salz, Alaun, Vitriol und Steinen«. Im Salzbergwerk bei Hall arbeiten 5000 bis 6000 Menschen, das Feuer unter den Siedepfannen geht nur aus zu Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Weiter die »herrlichen Bergwerke«, in denen Gold, Silber, Kupfer, Blei, Eisen gefördert werden. Die Schmelzhütten gehören teils den Landesfürsten, teils den Fuggern. Die »stattlichen Bergwerke in Taufers und Ahrn« gehören den Herren Wolkenstein-Rodenegg. Reichlich Kupfer, Schwefel, Vitriol. Jene Herren von Wolkenstein besitzen auch noch ein Bergwerk zu Kältenbach: eine Silbergrube mit etwa 100 Knappen.
An Gestein werde gefunden und abgebaut: Marmor, Alabaster, Porphyr, weißer Sandstein. Und man finde den grünen Jaspis und den roten Blutstein, zum Teil mit grünen Äderchen.
Die »von Gott edelbegabte Grafschaft Tirol« sei weiterhin ausgezeichnet durch reiches Wachstum von Heilkräutern: der weiße Nießwurz, dessen Saft unter anderem gegen Läuse schützt. Und der Meisterwurz, der Hl. Geistwurz, hilfreich gegen allerlei Gift und Pestilenz, gegen Gedächtnisschwäche und Steinbildung. Und der Rosenwurz oder Frauenwurz sei folgendermaßen anzuwenden bei Unfruchtbarkeit: in Milch aufkochen, trinken, den ehelichen Geschlechtsverkehr ausüben – da empfängt die Frau noch zur selbigen Stunde.
Weiter zählt er an Kräutern auf: Schlangenmord, auch Schmalwurz genannt, hilfreich bei Schwindelanfällen und Fallsucht; wenn man es kaut, »vertreibt es alle Melancholien«. Und der Enzian »ist gut für Gift, Bruch, Husten«, auch bei schwachem oder krankem Magen. Der Gäms- oder Schwindelwurz wird vielfach von Gämsjägern gekaut, so wird ihnen beim Klettern nicht schwindlig. Und: Engelfuß und Hammerwurz und Kreuzwurz und Hirschwurz und Haarstrang und Wintergrün und Weinraute und Wermut und Stabwurz und so weiter.
Im zwölften Kapitel äußert sich der Wolkensteiner über die Fruchtbarkeit der ›Weiber‹: nachdem er so viel über die Fruchtbarkeit der Grafschaft geschrieben hat, will er auch diesen Punkt nicht auslassen. Der Freiherr ist mit der Fruchtbarkeit der Frauen zufrieden; sie könnte allerdings noch höher sein, würden die Frauen nur mal auf Schleckwerk und übermäßigen Weinkonsum verzichten – dadurch werde die Leibesfrucht zumindest geschwächt. Es wird berichtet von Zwillingen, Drillingen, Vierlingen. Missgeburten gebe es »in dieser Grafschaft leider zu viel«, und zwar beim hohen wie beim niedrigen Stand, doch der Chronist meint, es gehöre sich nicht, auf diesen Punkt näher einzugehen.
Folgen Ausführungen über die Gesundheit Tirols, die gute Luft; es gibt zwar Gicht und Podagra, aber es ist offenbar nichts Außergewöhnliches, wenn jemand hundert Jahre alt wird; eine Frau, die gesund gelebt habe, nur von Kraut, Rüben, Nudeln, sie sei 104 geworden; das mache der Verzicht auf »delikate und schleckhafte Speisen«. Und Peter von Gerauch hat das 112. Jahr erreicht, geht noch immer seiner Wege und Stege, handelt und wandelt, kauft und verkauft, »ist bei guter Vernunft«, hat ein gutes Gedächtnis, kann viele alte Geschichten erzählen, kein Wunder.
Insgesamt aber: es wird nach dem Geschmack des Chronisten zu viel gefressen in Tirol. Beispielsweise bei Hochzeiten; früher sei man noch mit drei bis vier Gängen zufrieden gewesen, »heute« hingegen müsse alles fürstlich zugehn, auch bei ärmeren Leuten müssten es vierzig bis fünfzig Gänge sein, meint er. Ach, und all das Geschleck aus dem Welschland …
Weil schon mehrfach auf soziale Schichten hingewiesen wurde, will Marx Sittich nun auch die vier Landstände der Grafschaft beschreiben. Er benennt und beschreibt erstens den geistlichen Stand, zweitens den löblichen Ritterstand, aber danach bricht entweder die Aufzeichnung ab, oder ausgerechnet an dieser Stelle ist ein Stück des Manuskripts verloren gegangen: kein Wort über den Bürgerstand und den Bauernstand …
Im zweiten Hauptteil geht der Chronist regionsweise vor, beschreibt die einzelnen Fürstentümer und Hochstifte, beginnt bei Trient. Interessant ist für uns aber nur, was er über das Gericht Kastelruth, das Gericht Wolkenstein schreibt.
Das Kastelruther Gebiet bezeichnet er als schön groß; »wir von Wolkenstein« schon lange in dieser Region. Früher gab es dort die von Maulrapp und die von Hauenstein. Burg Hauenstein liege »mitten in einem großen Wald«, sei noch bewohnt, verschiedene Zinsgüter gehörten zum Besitz, eine »schöne große Waldung mit allerlei Holz, wie Lärchen, Fichten und Tannen«. Im Schloss gebe es auch eine Kapelle, für Sankt Martin und Sankt Sebastian.
Marx Sittich berichtet auch über die Trostburg, die sein Bruder Engelhard Dietrich schön ausgebaut habe, auch seien dort Gärten angelegt worden, die allerlei Früchte brächten. Und er weist hin auf die Seiser Alm: die schönste und größte Alm des Landes. Jährlich sind dort oben 1500 Kühe und 600 Ochsen, dennoch werden nicht weniger als 1800 Fuhren Heu herabgeschafft; vier bis fünf Wochen lang arbeiten etwa 4000 Menschen, um das beste und kräftigste Heu des Landes einzubringen. Und die allerköstlichsten Kräuter wachsen dort oben. Der Chronist weist auch hin auf »wilde Leute«: noch vor wenigen Jahren seien droben Waldmenschen bei Nacht gehört, bei Tag gesehen worden. Sogar bei Villanders habe man, nach einem glaubwürdigen Zeugen, einen wilden Mann gesehen, »ganz rauh, haarig und ungestalt«. Und bei Meran wurde ein »wildes Fräulein«, eine Waldnymphe gesichtet, und das am hellen Tag.
Das Gericht Wolkenstein schließe sich an das Gericht Kastelruth unmittelbar an. Der Chronist weist hin auf die Burg Wolkenstein: sie liege an einer jäh abfallenden Wand, sei nicht mehr bewohnt, »steht nur etliches Gemäuer«. Das Gericht Wolkenstein habe nur etwa 50 Feuerstätten, dafür aber gute und reiche Almgebiete, etwa die Stevia-Alm, die Puez-Alm, die Cawazes-Alm.
Wein und Weizen wüchsen nicht im Gericht Wolkenstein, wegen der Kälte, aber es gebe genügend Heu und Gerste, Mohn und Linsen, Rüben und Futter. Man lebe dort vom Vieh, das man aufziehe und verkaufe. An Wildbret gebe es Hirsche, Bären, Wölfe, Hasen, Füchse, Marder, Murmeltiere und an »Federwildbret«: Auerhähne, Haselhühner, Schneehühner, Steinhühner. Auch in diesem Gericht rede man eine »grobe und unverständliche Sprache«, weder italienisch noch deutsch: das Ladinische.
Wolkenstein gegenüber liege ein sehr hoher Kofel oder Berg, der Wolkenstein, mit vielen Zinnen und Spitzen; dieser Berg sei selten frei von Nebel oder Wolken; man höre vielfach Sausen und Rauschen, als würden sich Steine oder große Wände lösen. Dieser Berg sei sehr wild, hoch oben wachse weder Holz noch Heu, kein Mensch habe ihn bisher bestiegen, es gebe dort große Adler.
Dieser Wolkenstein ist der heutige Langkofel.
Angenommen, ich würde Oswald einen Brief schreiben, der ihn in einer phantastischen Raum-Zeit-Kurve erreicht, würde in diesem Brief ein Wort benutzen wie »Wald«, ein Wort, das damals in Gebrauch war, das heute weiter in Gebrauch ist, so gäbe es schon bei diesem scheinbar gemeinsamen, verbindenden Wort Schwierigkeiten. Denn was er sich beim Wort »Wald« dachte und was ich mir beim Wort »Wald« denke, es unterscheidet sich so sehr, dass wir eigentlich zwei verschiedene Wörter benutzen müssten.
Wald bedeckte zu seiner Zeit beinah ganz Europa, Wald war fast von jedem Weg, von jedem Feld, von jedem Dorf, von jeder Burg, auch von jeder Stadt aus zu sehen, fast immer bildete Wald den Horizont. Dieser Wald war etwas Weites, Dichtes, Dunkles, durch das nur einige Pisten, Wege, Pfade führten, und in diesem Weiten, Dichten, Dunklen gab es Tiere, vor denen man sich fürchtete, beispielsweise Wölfe, die hörte man vor den Burgen und vor den Städten heulen, nachts, vor allem im Winter, und wie oft geschah es und wie oft wurde davon berichtet, dass Menschen in diesem Weiten, Dichten, Dunklen von Wölfen angefallen wurden oder von Bären, die sehr behend waren? Und noch größer die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem Weiten, Dichten, Dunklen von Räuberbanden überfallen wurde: so was kennen wir nur noch in Kindergeschichten von Räubern im finsteren Tann, in dem Äste knacken und Käuzchen rufen, die nicht immer Käuzchen sind.
Aus dem Wald wollte man möglichst rasch wieder herauskommen, aber in welche Richtung man auch zog, es dauerte oft Tage, ehe man in gelichtetes Gebiet kam, mit einem Dorf, das stundenweit vom nächsten Dorf entfernt lag und vielleicht tageweit von der nächsten Stadt.
Was wir uns dagegen unter Wald vorstellen: forstwirtschaftliche Nutzflächen mit einem dichten Netz von Wirtschaftswegen, mit einer durch Zählungen und Abschussquoten ständig kontrollierten Zahl von Tieren. Was der gewohnten Waldordnung widerspricht, wird mit Polizei-Einsatz entfernt: »Waldmenschen« beispielsweise. Und als irgendwo in Bayern ein paar Wölfe aus einem Gehege ausbrachen, marschierten gegen die halb domestizierten Tiere Hundertschaften der Polizei auf, und bald schon wurde in der Bevölkerung der Einsatz gepanzerter Fahrzeuge gefordert.
Die Südtiroler Sage von Eisenhand beginnt mit einer Weissagung: Oswalds Mutter wird verkündet, ihr Sohn werde ein gefeierter Sänger, falls er das Harfenspiel erlerne, aber es werde dann kein Glück, keinen Frieden mehr für ihn geben. Davor möchte die Mutter den Sohn bewahren, wie die meisten Mütter ihre Söhne davor bewahren wollen, Sänger oder Dichter zu werden; sie trägt den noch kleinen Jungen hinauf ins Felsgebirge Kedùl, lässt dort von wilden Frauen seine Hände verzaubern: sie werden stark für Schwert und Lanze, zu grob für jedes Instrument.
Das zeigt sich, als Oswald, einige Jahre älter geworden, die Musik von Spielleuten hört: Begeisterung, er möchte ebenfalls musizieren; Spielleute versuchen, ihn zu unterrichten, aber den Fiedeln zerfetzt er, den Harfen zerreißt er die Saiten, Instrumente zerbrechen in seinen Händen. Man nennt ihn nun »Eisenhand«.
Und Eisenhand erlernt das Kriegshandwerk, wird Jäger. Meist pirscht er allein in Bergwäldern. Einmal steigt er hinauf in die Berge (südlich der Seiser Alm), wandert am Molignon-Massiv entlang, kommt zur Mittagsstunde an eine weite Bergwiese, hört Gesang und Saitenspiel. Seine Ohren sind nicht verzaubert, er schleicht sich näher heran: eine Elfe, in einem selbstverständlich silberglänzenden Gewand, spielt eine kleine Harfe, singt. Singt so betörend schön, dass Oswald atemlos lauscht. Stundenlang hört er ihr zu. Als Schatten in die Bergtäler wachsen, verschwindet die Sängerin, löst sich die Blumenwiese auf.
Am nächsten Tag ist Oswald wieder dort oben, und die Blumenwiese ist wieder da und die Elfensängerin auf der Blumenwiese, und sie spielt wieder Harfe, singt wieder, und Oswald ist wieder in Bann geschlagen, lauscht stundenlang, versteckt. Selbstverständlich hat ihn die Elfe längst bemerkt. An sechs Tagen singt sie, an sechs Tagen hört er ihr zu; am siebten Tag ruft sie zu ihm hinüber, sie habe ihn durchaus bemerkt. So kommt man ins Gespräch: Oswald gesteht ihr, wie gern er das Harfenspiel erlernen würde, aber seine Hände seien zu schwer, zu grob, zu hart. Die Elfe weiß, was Oswald noch nicht weiß, er hat es als kleiner Junge nicht bemerkt: dass seine Hände verzaubert wurden. Und die Elfe sagt ihm, dieser Zauber könne nur gebrochen werden durch großes Leid; sie wünscht ihm freilich, dass er dieses Leid niemals erfahre.
Als der junge Mann Oswald einige Zeit darauf seine Mutter besucht, erzählt er ihr vom sehr schönen Fräulein dort oben im Gebirge; er habe sich mit ihr verlobt. Natürlich möchte Mutter Wolkenstein wissen, wer dieses Fräulein ist, aber darüber kann Oswald nichts sagen, nicht einmal ihren Namen kann er nennen. Er steigt wieder in die Berge, wandert am Molignon entlang, trifft die Elfe, fragt sie nach dem Namen. Sie antwortet, er dürfe nie erfahren, wie sie heiße – sobald er ihren Namen besitze, müsse sie sich von ihm trennen.
Oswald berichtet dies bei nächster Gelegenheit seiner Mutter. Die weiß sofort, um welche Art Fräulein es sich handeln muss, und warnt den Sohn: es gebe keine wahre Gemeinschaft zwischen Menschen und Berggeistern.
Monate vergehen. Oswald streift allein durch die Wälder, durchs Gebirge. Einmal kehrt er spät zurück, es ist schon finster, er sieht Feuerschein in einer entlegenen Bergwaldregion, schleicht sich heran: Bergmenschen, wilde und weise Cristànes, sitzen am Feuer, sprechen aus, was Oswald nicht hören darf: Die alte Wolkenstein habe durchaus recht gehabt, als sie Sohn Oswald die Hände verzaubern ließ, aber nun, seit er Antermòya kennengelernt habe, bestehe Gefahr, dass der Zauber wieder gebrochen werde. Jetzt kennt, besitzt Oswald ihren Namen: Antermòya.
Und Oswald trifft Antermòya wieder, vergisst sich, spricht ihren Namen aus. Antermòya, auch sie verliebt, klagt und weint: Nun müsse sie sich von ihm trennen, müsse fort für immer. Sie sagt Lebewohl, schenkt ihm zum Abschied ihre Harfe, geht in die Mitte der Blumenwiese, singt das Lied, das Oswald als Erstes von ihr hörte, schon bricht der Boden auf, schon quillt Wasser hoch, schwarzes Wasser, in dem sie eintaucht, versinkt, und mit ihr die Blumenwiese: Ü te kash leek spari’l adüm la trónyora florida ü bèla tjantarina, heißt es in der Ladiner Mundart.
Was bleibt, ist ein Bergsee (Lago Antermoia). Drei Tage lang geht Oswald um den See herum, trauernd. Dann nimmt er die Harfe, beginnt wieder zu spielen, zu singen: ein Klagelied. Er spielt und singt vollendet: das Leid hat den Zauber gebrochen.
Aber damit erfüllt sich auch diese Weissagung: Dass er nun ruhelos in der Welt umherziehen muss, kein Glück, keinen Frieden findet.
Oswald mit etwa sieben: von nun an also zählte er! Denn nun war er nicht mehr, in Verständnis und Mentalität jener Zeit, so etwas wie ein Kind auf Probe, noch ohne Zukunft, nun konnte für ihn geplant werden. Und damit ein Stichwort, das uns Oswald nicht gibt, das sich aber wie von selbst einstellt im Kontext jener Zeit: Schule.
Kein Thema für Oswald, den Dichter, jedoch für uns. Die Eltern, standesbewusst und erfolgsorientiert, schauten nicht zu, wie Kind Oswald verwilderte, als Wolfsjunge in Waldungen oberhalb der Trostburg, auch er musste lernen.
In älteren Texten zum Wolkensteiner heißt es schon mal, auf der Trostburg hätte es einen Hausgeistlichen gegeben. Der wäre denn nicht nur zuständig gewesen für die Hauskapelle, sondern auch für das Unterrichten der Kinder, zumindest der Söhne. Nachweisen lässt sich ein Burgpädagoge allerdings nicht. Er ist offenbar interpoliert worden – während sich damals übliche Schulformen weithin dokumentieren lassen.
Es sah im Schulwesen nicht so finster aus, wie es für das Mittelalter oft postuliert wird. Seit Karl dem Großen gab es Schulen in Städten, sogar in Dörfern: Pfarrschulen, Küsterschulen.
In der (lateinischen) Vita des Paderborner Bischofs Meinwerk, (anonym) verfasst im 12. Jahrhundert, wird berichtet, dass bereits im Jahrhundert zuvor »an der Kirche in Paderborn die allgemein üblichen Studienfächer aufblühten, denn es gab dort Lehrer für Musik und Dialektik, derweil auch bedeutende Lehrer der Rhetorik und Grammatik; Magister der freien Künste übten dort das Trivium ein, während andere sich dem Quadrivium widmeten; dort glänzten Mathematiker und Astronomen, wurden Naturwissenschaftler und Geometrielehrer beschäftigt.« Höchstes Ansehen besaßen Horaz und Vergil. Und es galt für die Schüler als »Zeitvertreib [ludus], sich mit Versen, Spruchsammlungen und lustigen Liedern [iocundis cantibus] zu befassen.«
Bereits gegen Ende des zwölften Jahrhunderts wurde vom dritten Lateranischen Konzil dekretiert, dass auch Kinder armer Eltern in Schulen unterrichtet werden könnten, dürften, sollten; Mitte des dreizehnten Jahrhunderts wuchs die Zahl der Stadtschulen, in denen zumindest Elementarunterricht erfolgte.
Angebote gab es erst recht in Oswalds näherer Umgebung: die Domschule in Brixen, die Klosterschule Neustift etwas außerhalb der Stadt.
Martin Peintner, vormals Stiftskapellmeister, Bibliothekar, Archivar des Chorherrenstifts, hat einen Aufsatz über Schreibkunst, Studium und Musikleben im mittelalterlichen Kloster publiziert. Einleitend berichtet er hier, dass (bei allen lokalen Unterschieden) »die Ausbildung der Schüler in der Regel in drei Stufen verlief«.
Erste Stufe: Elementarunterricht (scientia primitiva) in Lesen und Schreiben. Benutzt wurden dazu handflächengroße Wachstafeln, in die Buchstaben mit Metallstiften eingeritzt wurden; die Schrift konnte mit einem »Streicher« wieder gelöscht werden. Als erste Lektüre: Psalter.
Zweite Stufe: das Trivium. Also Grammatik, Dialektik, Rhetorik. »Die Ausbildung in Musik und Gesang war von allem Anfang schon mit dabei.«
Für Grammatik wurde »der Donatus« herangezogen. Seine Ars minor musste sicherlich auch Oswald auswendig lernen. Ihr Umfang: etwa zehn Druckseiten.
Dritte Stufe: Ars maior, die Lehre für Fortgeschrittene. Fast ein halbes Jahrtausend blieb auch hier »der Donatus« Standardwerk des dominierenden Lateinunterrichts.
Normalerweise (aber noch nicht vorschriftsmäßig) ging ein Kind von sieben bis fünfzehn zur Schule. Bei Oswald war es anders – nach etwa drei Schuljahren ergab sich offenbar eine Zäsur.
Oswald berichtet in seinem berühmten Lebenslied (ich werde es bald vorstellen), er sei mit zehn Jahren aufgebrochen, um sich in der Welt umzuschauen. Die berühmte Intrada: »Es fügt sich, do ich was von zehen jaren alt, ich wolt besehen, wie die werlt wer gestalt.«
Die Welt an den Grenzen Europas, außerhalb Europas, sie war zu seiner Zeit weithin märchenhaft! Dies zeigt das Reisebuch des John Mandeville, im damaligen Europa überaus erfolgreich: zahlreiche Abschriften und Übersetzungen.
Eine der Übersetzungen stammte von Hans Vintler. Er dürfte in der Familie Wolkenstein bekannt gewesen sein. Vintler war ein angesehener Bürger der Stadt Bozen, war Zeitgenosse Oswalds. Weitere Angaben: Pfleger des Gerichtsbezirks Stein am Ritten; Amtmann des Herzogs Friedrich; Übersetzer weiterer Werke; 1413 verstorben. Oswald dürfte die neue Übersetzung des Reisebuchs früher oder später kennengelernt haben.
Wer Mandeville gewesen sein mochte (Jean de Bourgogne, Arzt in Lüttich?), wie weit er und ob er überhaupt die Welt erkundet hatte, diese Frage muss jetzt nicht erörtert werden. Wahrscheinlich war hier ein Kompendium diverser Reisebeschreibungen mit Geschick erstellt worden. Der Erfolg zeigt, welche Erwartungen in der Öffentlichkeit bestanden; die wurden nun bestätigt, bestärkt.